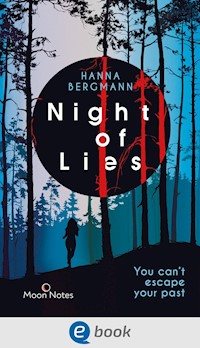
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als die 17-jährige Leah von ihrer Mutter auf das Eliteinternat Elm Castle in den Wäldern North Carolinas verbannt wird, merkt sie schnell, dass dort etwas nicht stimmt. Ihre Mitbewohnerin Carter bedroht sie, und im Wald stößt sie auf einen blutverschmierten und scheinbar verwirrten Jungen. Außer Reese, die sich ihrer annimmt, und dem charmanten Jasper scheinen auf Elm Castle alle ziemlich durcheinander zu sein, seit vor zwei Jahren ein Mädchen spurlos verschwand. Leah beginnt zu ermitteln und entdeckt ein Geheimnis nach dem anderen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
Als die Eskapaden der 17-jährigen Leah überhandnehmen, schickt ihre Mutter sie zur Strafe auf das Eliteinternat Elm Castle in den tiefen Wäldern North Carolinas. Doch Elm Castle ist alles andere als der perfekte Ort, um brav zu lernen und Reue zu üben. Denn Leah merkt schnell, dass hier etwas nicht stimmt: Ihre Mitbewohnerin Carter bedroht sie, und im Wald stößt sie auf einen blutverschmierten und verwirrten Jungen. Außer Reese, die sich ihrer annimmt, und dem charmanten Jasper scheinen alle ziemlich durcheinander zu sein, seit vor zwei Jahren ein Mädchen spurlos verschwand. Je mehr Zeit Leah mit der Schulclique verbringt, desto mehr Unheilvolles kommt ans Licht. Sie beginnt auf eigene Faust zu ermitteln – doch jedes Geheimnis, das sie aufdeckt, bringt sie in noch größere Gefahr.
Für mich
Playlist
Son Lux – Resurrection
Like Lovers – Fall
Dua Lipa – Don’t Start Now
Warren Zevon – My Shit’s Fucked Up
Cari Cari – Mazuka
Cari Cari – Anaana
Neil Young – Hey Hey, My My
Bell Witch – The Moment (Outro)
Oasis – Bag It Up
Cari Cari – Nothing’s Older Than Yesterday
Kasabian – British Legion
R.E.M. – Überlin
Ex:Re – Crushing
Oasis – She’s Electric
AnnenMayKantereit – Schon krass
Giant Rooks – Watershed
The Smiths – Bigmouth Strikes Again
Mark Ronson, Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart
Billie Eilish – Ocean Eyes
Anna F. – Friedberg
Cari Cari – Summer Sun
Zwischenzeit – Nichts zu sagen
alt-J, ADP, Hex, Paigey Cakey – Adeline
The Dandy Warhols – Not If You Were The Last Junkie On Earth
Prolog
Willkommen, du miese kleine Ratte.
Willkommen am einzigen Ort, den du dir lieber nicht ausgesucht hättest. Vielleicht gratulierst du dir noch, weil du zwischen all den Felsen und Wäldern endlich so etwas wie Zivilisation gefunden hast. Aber leider muss ich dich enttäuschen. Auch wenn alles danach aussieht mit seinen netten kleinen Zimmern, den majestätisch aufragenden Zinnen und dem glatt spiegelnden See, wirst du hier keine Erholung finden.
Dieser Ort ist wie eine fleischfressende Pflanze: verlockend schön und absolut tödlich. Wenn du dich hier erst einmal niedergelassen hast, ist es schon zu spät. Schnapp – und die Falle geht zu. Schnapp – und das Opfer stirbt einen langsamen, qualvollen Tod. Mach dir keine Illusionen: Die Falle wurde längst ausgelöst. Nur dass du es wahrscheinlich erst merkst, wenn es schon zu spät ist.
Vermutlich denkst du, du kannst dich hier nun in aller Ruhe einnisten, deine schmutzigen kleinen Nagerhände nach allem ausstrecken, was eigentlich uns gehört: unseren Freundschaften, unseren Ritualen, unseren Geheimnissen. Dabei weißt du noch gar nicht, was es heißt, eine von uns zu sein. Und wenn du es wüsstest, würdest du sofort deine Koffer packen und für immer verschwinden.
Aber das wird nicht passieren. Du wirst dich hier schnell einleben, das verspreche ich dir. Elm Castle findet immer einen Weg, seine Bewohner in den Abgrund zu ziehen.
Kapitel 1
Glaubte man der Broschüre, die mir Mom während der Autofahrt in die Hand gedrückt hatte, so war dieses Schloss der reinste Albtraum. Ein Steingebilde, so aufgebläht und gigantisch, wie es sich nur ein einsamer Milliardär ausdenken konnte. Und so unübersehbar, dass man bei seinem Anblick den Kopf in den Nacken legen musste und atemlos nach Luft rang. Besonders wenn man fortan in diesem Monstrum leben sollte. So wie ich.
Elm Castle wirkte auf den ersten Blick wie das Life Goal einer jeden Hobbyprinzessin: steile Zinnen, die in den Himmel ragten, niedliche Erker, aus denen man das bekrönte Köpfchen hinausstrecken konnte, und drum herum ein verwunschener Märchenwald. Die Wahrheit jedoch war, dass dieses nicht einmal hundert Jahre alte Schloss der Knechtung unerwünschter Jugendlicher diente. Vielleicht herrschte in seinem Inneren deswegen diese Friedhofsstimmung.
Das einzige Geräusch, das die Stille durchbrach, waren unsere Schritte. Drei Paar schlurfender Straßenschuhe und ein Paar messerscharfer High Heels auf kaltem Stein. Die Frau, die mit klackernden Absätzen vor Mom und mir herlief, hatte sich uns als Denise vorgestellt. Nun gab sie dem Schüler, dem sie mein Gepäck aufgedrängt hatte, mit einem Nicken zu verstehen, dass er es auf mein neues Zimmer bringen sollte, und er dampfte keuchend ab. Sie dagegen drosselte trotz des engen Rocks, der ihr die Gedärme abschnüren musste, nicht einmal das Tempo und textete uns, während wir uns durch die Gänge des Schlosses schoben, pausenlos mit irgendwelchen superwichtigen Informationen zu.
»Elm Castle ist natürlich kein richtiges Schloss«, sagte sie gerade. »Wie alle Schlösser in Nordamerika. Der Architekt hat sich zwar an einer mittelalterlichen Burg orientiert, aber das ist so, als würde man ein weißes Blatt ankokeln und als alte Schatzkarte verkaufen: Auf den ersten Blick fällt man darauf rein, aber beim zweiten erkennt man die billige Kopie.«
So einstudiert, wie das klang, musste es Denise schon einige Male zum Besten gegeben haben. Vermutlich, um den langen Weg zum Büro der Direktorin zu überbrücken.
»Ich mag’s trotzdem«, seufzte Denise und warf mir über die Schulter ein Zwinkern zu, ohne darauf zu achten, dass Mom und ich kaum hinter ihr herkamen. »Übrigens, Annabelle, am besten gleich vorweg: Die Schüler kommen normalerweise zu mir, wenn sie ein Problem haben oder jemanden zum Reden brauchen. Vielleicht weil ich dem Aussehen nach eine von euch sein könnte.« Sie lachte schrill auf. »Spaß beiseite. Das ist natürlich mein Job hier. Aufzupassen, dass es euch gut geht und ihr keine Dummheiten macht. Also, sollte dich mal der Schuh drücken, dann komm einfach vorbei. Ein bisschen reden kann oft Wunder wirken.«
Ich warf Mom einen wütenden Blick zu. Hatte sie den Internatfuzzis etwa erzählt, weshalb sie mich für den Rest des Schuljahres hierher verbannt hatte, oder war das nur eine hohle Phrase von Denise gewesen?
Mom wich meinem Blick aus, indem sie übermäßiges Interesse an Denise’ Ausführungen heuchelte.
»Die meisten Schüler kommen erst in den nächsten Tagen aus den Sommerferien zurück«, fuhr Denise mit einem Blick über ihre Schulter fort. »Ein paar wenige haben den Sommer zwar hier im Internat verbracht, aber die kommen kaum von ihren Spielekonsolen weg. Fürs Erste solltest du also deine Ruhe haben, Annabelle.«
Wenn sie meinen Namen noch ein einziges Mal wiederholte, würde ich ausrasten. »Was ist dein Job noch gleich?«, fragte ich mit zuckersüßer Stimme. »Nanny?«
Denise’ Schritte verlangsamten sich kaum merklich. »Ich bin Pädagogin«, sagte sie. Sie versuchte, freundlich zu klingen, aber ich hörte ihr genau an, dass ich sie in ihrer Ehre verletzt hatte.
»Wolltest du ursprünglich Lehrerin werden?«
Nun wurde Denise’ Nacken steif wie ein Brett. Ich hatte wohl einen wunden Punkt getroffen. Mom bemerkte es ebenfalls.
»Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr sich Annabelle gefreut hat hierherzukommen«, sagte sie und warf mir ein kleines, giftiges Lächeln zu. »Am liebsten wäre sie schon ein paar Tage früher angereist.«
»Jaaa«, erwiderte ich und lächelte nicht minder giftig zurück. »Mein Therapeut hat mir dringend geraten, meinem schlechten häuslichen Umfeld zu entfliehen.« Bevor Mom mich zerfleischen konnte, wechselte ich das Thema.
»Wo sind eigentlich die Ulmen? Man sollte meinen, hier müsste es davon nur so wimmeln, wenn das Schloss schon Elm Castle heißt. Wäre Pine Castle nicht deutlich passender gewesen?« Ich dachte an die endlosen Reihen aus Kiefern, die wir mit dem Auto durchquert hatten, ehe wir über den Wipfeln die ersten Zinnen hatten ausmachen können. Der Westen North Carolinas war nicht nur für die Blue Ridge Mountains bekannt, sondern auch für seine ausgedehnten grünen oder herbstlich orange-roten Wälder. Ulmen hatten hier sicher nichts zu suchen.
Denise machte ein Gesicht, als hätte ich sie persönlich angegriffen. Vermutlich hatte sie noch immer an der Pädagoginnensache zu knabbern. »Die Lieblingsbäume des Schloss-Erbauers waren Ulmen«, sagte sie und räusperte sich. »Besser gesagt: die seiner Mutter. Deswegen hat er einige um das Schloss herum anpflanzen lassen, aber alle außer einer sind eingegangen. Die letzte steht am See auf dem Schlossgelände. Wenn du mal daran vorbeikommst, wird sie dir sicher gleich auffallen.«
Ehe ich noch weitere Fragen stellen konnte, die Mom beschämten, kamen wir vor einer dicken Tür aus Eichenholz zum Stehen. Daneben prangte ein Namensschild mit geschwungenen Lettern: Dr. Phillis Bitterfield – Schuldirektorin. Denise klopfte gegen das dunkle Holz. Als nach ein paar Sekunden eine gedämpfte Antwort erklang, steckte Denise ihren Kopf durch die Tür.
»Direktorin Bitterfield, Annabelle Leanne Stirling und ihre Mutter sind eingetroffen.«
Ich verzog das Gesicht, eine unwillkürliche Reaktion auf meinen Namen. Annabelle Leanne Stirling. Darunter stellte man sich eine zarte Blondine mit Puppengesicht vor, die sich die Zehennägel rosa lackierte und den ganzen Tag mit ihren Freundinnen shoppen ging. Das Problem an der Sache war, dass ich die Hälfte dieses Klischees leider erfüllte, nämlich was das Äußere anging. Mit meiner zierlichen Figur, den blonden Löckchen und meinen veilchenblauen Augen hätte ich ohne Probleme den Rauschgoldengel beim Krippenspiel mimen können. Und ich hasste es. Doch so was wie Haarefärben und Piercings kam leider nicht infrage – Mom hatte mir schon früh angedroht, mich sonst zu meiner Tante auf ihre Farm in Colorado zu schicken. Um wenigstens über eine Sache Kontrolle ausüben zu können, hatte ich meinen Freunden eingeschärft, mich bei der Kurzform meines Zweitnamens zu nennen: Leah. Einfach nur Leah. Auf meinen Geburtsnamen reagierte ich nur bei offiziellen Angelegenheiten wie dieser hier.
»Treten Sie ein, Ms Stirling«, drang es nun hinter der Eichenholztür hervor.
Mom zupfte an meiner Bluse herum, als hätte sie Angst, ich könnte einen schlechten Eindruck hinterlassen. »Ich bleib besser draußen«, sagte sie. »Ab jetzt musst du deine Sachen allein regeln.«
Ich warf ihr nur einen bösen Blick zu, drehte mich auf dem Absatz um und folgte Denise in Ms Bitterfields Büro. Die Person, die hinter dem massiven Schreibtisch voller akkurat aufgestapelter Bücher und säuberlich zurechtgelegter Papiere auf mich wartete, sah mir mit starrem Blick entgegen. Sie hatte etwas von einer jahrtausendealten Reliquie, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Keuschheit Marias stand. Ms Bitterfield war … grau. Anders ließ sie sich nicht beschreiben. Ihre Haare waren grau, ihre Augen waren grau, ihr Jackett war grau, und bestimmt trug sie auch graue Unterwäsche. Alles an ihr wirkte spitz und kantig, ihre Nase, ihre Wangenknochen, der Dutt auf ihrem Kopf. Alles saß perfekt an seinem Platz.
Alles außer mir. Mir war nämlich gerade ein altes Hustenbonbon aus den übergroßen Taschen des Blazers gerutscht, den Mom mir aufgezwungen hatte. Ich kroch am Boden umher, um es wieder aufzusammeln.
»Annabelle«, murmelte Denise, die sich neben meinem Stuhl aufgestellt hatte, »setz dich hin.«
Trotz meiner Faszination für den makellos sauberen Holzboden kam ich ihrer Aufforderung nach. Als ich aufsah, hatte Ms Bitterfield ihre Lippen zu einem schmalen Lächeln zusammengepresst. Es sollte vermutlich herzlich aussehen, wirkte aber, als unterdrücke sie einen gewaltigen Furz. Ich nahm ihre ausgestreckte Hand, ihr Griff war überraschend stark.
»Guten Tag, Ms Stirling«, sagte sie und klang dabei wie die Nachrichtensprecherin von Fox News. »Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise.«
Unwillkürlich sackte meine Laune noch weiter in den Keller. Die ganze Fahrt über vom Osten in den Westen North Carolinas hatten Mom und ich uns gestritten. Mom hatte mich darauf hingewiesen, dass ich nach den letzten Wochen froh sein konnte, dass sie mich nicht in ein radikales Erziehungscamp schickte, und ich hatte erwidert, dass sie und ihr Internat mich am Arsch lecken konnten. Es war in Schreien und Heulen ausgeartet, aber Mom kannte keine Gnade und hatte kein einziges Mal an einer Raststätte gehalten, auch dann nicht, als ich damit drohte, ihr ins Auto zu pinkeln – vielleicht aus Angst, dass ich es irgendwie schaffte abzuhauen. Dabei gab es keinen Ort mehr, an den ich mich flüchten konnte. Nur wenn ich die Augen schloss und ein, zwei Sekunden herumspann, gab es einen Ausweg. Dann riss ich von zu Hause aus und begann ein neues Leben, zusammen mit meinem Vater. Vielleicht lebte er auf einer Ranch in Texas mit Pferden und einem Country Club. Vielleicht ging er auf Tour mit seiner Band, und ich könnte in einem Campingbus schlafen und die beste Zeit meines Lebens haben. Vielleicht hatte er eine neue Familie und ich eine kleine Schwester, die ich lieben und unter meine Fittiche nehmen würde. Doch dafür hätte ich erst einmal wissen müssen, wo er sich überhaupt aufhielt.
»Die Zeit verging wie im Flug«, sagte ich und lächelte schwach.
Diese Antwort schien Ms Bitterfield zufriedenzustellen. Als Denise sah, dass ich mich wenigstens in Anwesenheit der Chefin benehmen konnte, verabschiedete sie sich, um meiner Mom, die draußen wartete, einen Kaffee zu machen.
»Übernachtet Ihre Mutter in einem der Gästezimmer, oder macht sie sich gleich heute wieder auf den Weg?« Ms Bitterfield schien einem strengen Gesprächsprotokoll zu folgen.
Als ich leicht den Kopf schüttelte, zeigten ihre grauen Augen einen zufriedenen Ausdruck. »Sie meinte, sie wirft mich lieber direkt ins kalte Wasser«, sagte ich und konnte den bissigen Ton in meiner Stimme nicht verhindern. »Außerdem muss sie morgen wieder arbeiten.«
»Ich sehe schon, ihr Stundenplan ist relativ voll.« Die Bitterfield schnaubte über ihren eigenen schlechten Witz. »Ich möchte Sie und Ihre Mutter nicht länger als nötig aufhalten, beginnen wir also gleich mit dem Papierkram.«
Insgesamt sechs Mal setzte ich meine krakelige Unterschrift unter irgendeine Art von Vertrag. Eine Bestätigung, dass ich meinen Zimmerschlüssel erhalten hatte und mir im Klaren war, dass ich einen neuen bezahlen musste, sollte er mir abhandenkommen. Die Schulordnung, die sich in der jahrhundertealten Tradition der Schule sicherlich nicht ein einziger Schüler durchgelesen hatte. Dann irgendeine Datenschutzeinverständniserklärung. Und den Rest schaute ich schon gar nicht mehr genau an.
»Frühstück gibt es von sechs Uhr dreißig bis sieben Uhr fünfundvierzig«, sagte Ms Bitterfield. »Der Unterricht beginnt um Punkt acht Uhr. Sollten Sie eine Frühaufsteherin sein, können Sie schon vor dem Frühstück an einem unserer zahlreichen Sportkurse oder an einer Meditationsklasse teilnehmen.«
Meine Augenbrauen wanderten nach oben. Zahlreiche Sportkurse? Vor sechs Uhr dreißig?
Ms Bitterfield lächelte wissend, während sie mir eine Broschüre in die Hand drückte. »Für alle anderen gibt es natürlich ein erweitertes Angebot nach Schulschluss um sechzehn Uhr.«
Lustlos blätterte ich mich durch die Seiten. Qigong, Hatha Yoga, Gymnastik – bei der Laufklasse blieb ich hängen. »Muss man eine Prüfung bestehen, um bei denen teilzunehmen?«, fragte ich und schob der Bitterfield den aufgeschlagenen Prospekt über den Tisch zu. Sie runzelte die Stirn und rückte ihre Brille so weit vor, dass sie ihr fast von der Nase fiel. »Nicht dass ich wüsste. Laufen Sie etwa?«
Ich zuckte die Schultern. »Ein bisschen. Hin und wieder.«
Um meine Gedanken zu töten.
Die Bitterfield musterte mich eingehend, dann lächelte sie schmallippig. »Für die Spätaufsteher gibt es auch noch einen Lauftreff am frühen Abend. Den führt allerdings Lawrence McAllister an.«
Ich runzelte die Stirn. »Gibt es ein Problem mit ihm?«
Ihr grimmiges Lächeln vertiefte sich. »Ganz und gar nicht. Nur sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass diese Gruppe nichts für Hobbysprinter ist.«
Bevor ich nachhaken konnte, ratterte Ms Bitterfield weitere Fakten herunter. Die einstündige Mittagspause lag jahrgangsweise um ein paar Minuten versetzt. Am Wochenende konnte man einen Nachmittag in der nahe gelegenen Kleinstadt verbringen. Das Büro des Hausmeisters war zugleich eine Art Minikiosk, an dem man sich Kaffee und Süßigkeiten holen konnte. Bisher klang das gar nicht so schlecht. Bis zum nächsten Satz.
»Der Wald ist tabu«, sagte die Bitterfield. Mehr sagte sie nicht. Sie sah mich nur mahnend an.
Ich stieß einen halb entrüsteten, halb überraschten Laut aus. »Das gesamte Gelände um das Internat besteht aus Wald!« Als ob sie das nicht selbst wüsste.
Wie in Zeitlupe hob die Bitterfield eine Augenbraue. »Sollten Ihnen die Sportanlagen und das mehrere Hektar große Gelände rund um den See nicht reichen, kann ich Ihnen leider auch nicht helfen, Ms Stirling.«
Hatte ich mich zuvor gewundert, wie sehr sie sich um die Freizeit ihrer Schützlinge sorgte, wurde mir nun langsam klar, warum es so viele verschiedene Angebote gab – man konnte in dieser Pampa nichts anderes unternehmen, als irgendwelche Bastelworkshops zu besuchen oder sich die Seele aus dem Leib zu meditieren.
»Warum?«, fragte ich harsch. »Das muss doch einen Grund haben.«
»Den hat es.« Ms Bitterfields Stimme klang eisig. »Ihre Sicherheit, Ms Stirling. Als das Internat eröffnet wurde, gab es diese Regelung noch nicht. Aber aufgrund der Größe und Unüberschaubarkeit des Geländes verirrten sich immer wieder Schüler. Irgendwann wurde uns das Risiko zu groß, weil sich durch den Wald eine mehrere Meilen lange Schlucht schneidet, die man erst erkennt, wenn man direkt davorsteht. Außerdem halten sich in den Wäldern von North Carolina immer noch Schwarzbären auf.«
»Ähm …« Ich spürte, wie sich meine Stirn in skeptische Falten zog. »Ist es nicht ein wenig … seltsam, ein Internat inmitten eines Waldes zu gründen, der von keinem Schüler betreten werden darf?«
»Elm Castle steht nicht nur für hervorragende schulische Bildung, sondern auch für Diskretion und Privatsphäre. Und diese Privatsphäre erreichen wir nur durch Abschottung. Dementsprechend ist die Antwort: Nein. Ich finde das nicht seltsam.« Damit setzte die Bitterfield einen Schlussstrich unter die Unterhaltung. Ihre Stimme ließ keinerlei Gefühlsregung erkennen. Ganz anders als ihre langen, dünnen Finger, die sich um einen Briefbeschwerer krallten, als wolle sie mir damit gleich den Schädel einschlagen.
Ein lautes Klopfen an der Tür ließ mich zusammenzucken. Nur einen Atemzug später schwang die schwere Eichenholztür unheilvoll knarzend auf, und das puterrote Gesicht einer schnaufenden Schülerin tauchte dahinter auf. Ihre kinnlangen roten Haare standen in alle Richtungen ab.
»Guten Tag, Ms Griffith«, sagte die Bitterfield ungerührt.
»Entschuldigen … Sie … Ms … Bitterfield«, presste Ms Griffith hervor, die aussah, als wäre sie nicht einen Tag älter als ich. Und als leide sie unter akuter Atemnot. Für den Bruchteil einer Sekunde blitzten ihre Augen in meine Richtung, dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder der Direktorin zu. »Ma’am, er ist schon wieder … Ich dachte, er …«
Entweder keuchte sie dieses unverständliche Zeug, weil sie so schnell gerannt war, oder sie brachte vor Aufregung keinen geraden Satz mehr zustande. Vermutliches beides. Ich kapierte nichts von dem, was sie dort von sich gab. Die Bitterfield dagegen schien ganz genau zu verstehen. Sie erhob sich und drückte dem rothaarigen Mädchen meine Zimmerschlüssel in die Hand. »Sie begleiten Ms Stirling auf ihr Zimmer.«
»Aber … Ms … Bitterfield.« Das Mädchen strich sich die roten Haare aus der verschwitzten Stirn. »Das geht jetzt nicht. Ich muss mithelfen, ihn zu suchen.«
Die Bitterfield stand stocksteif hinter ihrem Ungetüm von Schreibtisch. »Ms Griffith, ich habe mich klar ausgedrückt. Ich kann Sie in diesem Zustand nicht gebrauchen. Beruhigen Sie sich und erklären Sie mir die Lage, dann begleiten Sie Ms Stirling und stellen sie ihrer Mitbewohnerin vor.«
Das Mädchen warf einen fassungslosen Blick auf die große goldene Zahl an dem braunen Schlüsselanhänger. »Ma’am, das ist Carter Bonhams Zimmer.«
Die Bitterfield bedachte sie mit einem eisigen Blick. »Ganz genau.«
Ohne Umschweife bedeutete sie mir aufzustehen. »Ms Stirling, wir haben einen kleinen Notfall. Warten Sie bitte einfach draußen vor der Tür auf Ms Griffith.«
Meine Neugier war geweckt. »Ist es etwas Schlimmes? Scheint ja nicht zum ersten Mal zu passieren.«
Sie schenkte mir ein freudloses Lächeln. »Nichts Schlimmes, aber in der Tat ein wiederholtes Vorkommnis.« Sie legte mir eine Hand auf den Rücken und schob mich mit resoluten Schritten aus der noch immer geöffneten Tür. Nur einen Atemzug später fiel diese mit einem endgültigen Klicken hinter mir ins Schloss.
Kapitel 2
Als ich meinen Blick von der Tür löste, sah mich Mom aus ihren Rehaugen so fragend an, dass ich ihr am liebsten ins Gesicht geschrien hätte. Immerhin war sie es, die mich dazu verdammt hatte, fortan hier vor mich hin zu rotten. Angeblich war es zu meinem Besten, sie wollte mir »den Abstand geben, den ich brauchte«. Dabei wussten wir beide, dass es bei dieser Verbannung nicht um mich ging. Es ging allein um sie. Schließlich hatte sie mich aufgegeben. Und sie hatte beschlossen, dass sie die Verantwortung für mich nicht länger tragen konnte und wollte. Dass ich mein Zuhause und meine Freunde vermissen würde, spielte dabei keine Rolle für sie.
»Na, so was.« Mom versuchte sich an einem schwachen Lächeln. »Sieht so aus, als wäre Ms Bitterfields Terminkalender eng getaktet. Das Mädchen, das eben hineingestürmt ist, konnte es ja kaum abwarten.«
Ich antwortete nicht, also versuchte sie es auf einem anderen Weg. »Hat dir Ms Bitterfield schon gesagt, wo dein Zimmer ist?«
Sie trat von einem Bein aufs andere und strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Entweder wollte sie diesen Ort so schnell wie möglich hinter sich lassen, oder sie wurde angesichts des nahenden Abschieds doch langsam nervös.
»Nein. Ich soll hier warten«, erklärte ich knapp. Ich verschränkte die Arme, um klarzumachen, dass das Gespräch hiermit beendet war, und lehnte mich gegen die Wand zu Ms Bitterfields Büro, aber natürlich hielt Mom es nicht aus, wenn nicht alles um sie herum vor Harmonie platzte.
»Leah …« Sie versuchte, mich in ihre Arme zu ziehen, doch ich machte mich los.
»Lass gut sein, Mom«, sagte ich kühl. »Keine dramatische Abschiedsszene. So sind wir nicht.«
Mom senkte den Blick, doch mir entging nicht, dass ihre Gesichtszüge in sich zusammenfielen wie ein kenterndes Papierschiffchen. Sie seufzte. »Wahrscheinlich wird es dauern, aber irgendwann wirst du begreifen, dass ich nur das Beste für dich wollte. Das Beste für dich will. Und das ist im Moment Elm Castle, Leah.«
»Das glaub ich nicht. Würdest du das Beste für mich wollen, hättest du mich nicht einfach ausrangiert wie einen alten Teppich.«
Moms Finger krampften sich zusammen. Vermutlich kämpfte sie gegen ihren inneren Yogi oder hörte die unangenehme Stimme ihrer besten Freundin Trudy, die ihr versicherte, dass sie alles richtig gemacht habe. »Du weißt ganz genau, dass du dir das selbst zuzuschreiben hast«, presste sie schließlich hervor. »Deine Uneinsichtigkeit zeigt, dass Dave und ich richtig entschieden haben.«
»Dave und du?« Fassungslos starrte ich sie an. »Du triffst diese Entscheidung mit deinem neuen Freund, anstatt einfach mal mit mir darüber zu sprechen? Du lässt diesen Kerl über mein Schicksal entscheiden?«
»Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber du bist minderjährig. Also bestimme immer noch ich, wo du dich aufhältst und unterrichtet wirst.«
Nun schrie ich beinahe. »Und natürlich entscheidest du dich für den hinterletzten Ort am Arsch der Welt, wo du das Problem, das du zur Welt gebracht hast, nicht ständig vor Augen haben musst!«
Bevor sie etwas erwidern konnte, erklang das aggressive Klackern von Denise’ Absätzen, und wir fuhren zusammen.
»Ach, wie schön.« Denise hielt uns ein Tablett mit zwei Cappuccini und einem kohlrabenschwarzen Kaffee entgegen. »Ich hatte schon Angst, ich erwische Sie nicht mehr. Die Kaffeemaschine hat sich heute mal wieder von ihrer grummeligen Seite gezeigt.« Sie lachte, als hätte sie den Witz des Jahrtausends gemacht, und glaubte anscheinend, ihre aufgesetzte Fröhlichkeit könne die giftige Stimmung übertünchen.
Mom und ich nahmen unsere Cappuccini entgegen. Ich leerte meinen in einem Zug, ohne Mom aus den Augen zu lassen, und stellte ihn kommentarlos wieder auf dem Tablett ab. Mom dagegen nippte mit einem dankbaren Lächeln an ihrer Tasse und versuchte Denise in Small Talk zu verwickeln.
Irgendwann hielt ich dieses gespielt fröhliche Theater nicht mehr aus. »Wir sollten uns jetzt verabschieden«, sagte ich. »Ich will es Mom nicht noch schwerer machen. Sie leidet jetzt schon fürchterlich unter der Trennung.«
Denise’ perfekt getuschte Augen wurden vor Mitleid ganz groß. »Das kann ich verstehen. Egal, wie alt sie ist, es muss schwer sein, die einzige Tochter loszulassen.«
Moms Gesicht nahm einen gequälten Ausdruck an. »Ja. In der Tat.« Sie seufzte, wandte sich mir zu und umklammerte ihre Handtasche so fest, als wolle sie an meiner Stelle lieber ihr die ausstehende Abschiedsumarmung geben. »Ich ruf dich morgen an, in Ordnung?«
In ihren Augen lag ein so flehender Ausdruck, dass ich es nicht übers Herz brachte, den Blick abzuwenden. Ich nickte knapp und rang mich zu einem halbherzigen Lächeln durch. Dann kam Mom auf mich zu, zog mich in ihre Arme, und ich ließ es stocksteif über mich ergehen.
»Bis bald, mein Mädchen«, flüsterte sie, und einen Moment lang war ich versucht, heulend in ihrer Umarmung zusammenzubrechen. Doch dann war dieser Moment auch schon wieder vorbei, und Mom winkte mir noch ein letztes Mal zu, bevor sie um die nächste Ecke verschwand.
Denise bedachte mich mit einem Lächeln, das wohl aufmunternd sein sollte, aber einfach nur künstlich wirkte. »Dann bringe ich dich zu deinem Zimmer«, flötete sie. »Du bist sicher schon wahnsinnig neugierig.«
Bevor ich ihr mitteilen konnte, dass alles, worauf ich hinfieberte, meine baldige Abreise war, ging die Tür zu Ms Bitterfields Büro auf.
»Das macht Ms Griffith schon«, sagte ich und deutete auf das rothaarige Mädchen, das mit einer Miene wie sieben Tage Regenwetter aus dem Büro hinausschlurfte.
War das Erleichterung auf Denise’ Gesicht?
»Großartig«, zwitscherte sie, während Ms Griffith aussah, als wolle sie mir vor lauter Freude gleich ins Gesicht kotzen. »Wie lieb von dir, Hartlyn. Siehst du, Annabelle, so schnell geht das hier auf Elm Castle. Kaum angekommen und schon den ersten Kontakt geknüpft. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch blendend verstehen.«
Das bezweifelte ich, wenn ich mir Hartlyn so ansah. Ihr Gesicht war merkwürdig verquollen, und auch ohne große empathische Fähigkeiten entging mir nicht, dass sie Besseres zu tun hatte, als mein Kindermädchen zu spielen. Als sie sich wortlos in Bewegung setzte, wirkte es eher, als ob sie vor mir weglief.
»Okay«, rief ich ihr hinterher. »Ich folge dir dann einfach mal.«
Hartlyn drehte sich noch nicht einmal um.
Eine Weile fragte ich mich, ob sie mich einfach abhängen wollte. Wir fegten durch die Gänge, als hätte sie Angst, von jemandem aufgehalten zu werden. Dabei war das ganze Schloss wie ausgestorben, die Einzige, die sie verfolgte, war ich. Und allmählich fragte ich mich, ob ich nicht einfach damit aufhören und mich auf irgendeinem Teppich zusammenrollen sollte.
Alles an dem rothaarigen Mädchen wirkte gehetzt, nervös. Als ob das Gespräch mit der Bitterfield sie noch einmal zusätzlich aufgewühlt hätte. Ich hätte sie ja gern darauf angesprochen, aber dafür fehlte mir trotz meiner neu ausgebildeten Läuferlunge der Atem. Erst viel zu spät begriff ich, dass das hier wohl eine Führung sein sollte, denn zwischendurch ließ Hartlyn vereinzelte Wörter fallen: »Aufenthaltsraum.« »Speisesaal.« »Bibliothek.« Doch es klang mehr wie: »Verpiss dich.« »Du nicht auch noch.« »Hau ab.« Vermutlich erwartete sie, dass ich mich nach diesen ausführlichen Erläuterungen einigermaßen orientieren konnte, doch vor meinen Augen verschwamm alles zu einem gewaltigen Brei aus Farben, Gerüchen und Verwirrtheit.
»Ich bin übrigens Leah«, brachte ich irgendwann hervor, als sich mein Sauerstoffvorrat langsam wieder auffüllte.
Zuerst glaubte ich, Hartlyn habe mich nicht gehört, doch dann warf sie mir einen knappen Blick zu und nickte. Nach diesem intensiven Moment ging es sofort weiter in ein Treppenhaus, das noch gewaltiger war als die anderen, die wir bisher durchquert hatten.
Zum ersten Mal ließ sich Hartlyn zu einem vollen Satz hinreißen. »Im ersten Stock wohnen die Fünftklässler, im zweiten die Sechstklässler und so weiter, die Zimmer der Elftklässler befinden sich also im siebten Stock.«
Entsetzt riss ich die Augen auf. Ich war schon jetzt vollkommen außer Atem, und nun sollte ich auch noch sieben ganze Stockwerke hinaufkraxeln?
»Auf der linken Gangseite wohnen immer die Jungs«, erklärte mir Hartlyn unbeeindruckt, während sie in zügigem Tempo die Treppen hinaufstieg, »auf der rechten die Mädchen. Selbstverständlich sind die beiden Trakte durch das Treppenhaus voneinander getrennt.«
Selbstverständlich.
Ab der vierten Etage konnte ich nicht mehr, meine Raucherlunge siegte über meine Läuferlunge. Ich blieb schnaufend an die Wand gelehnt stehen und wartete darauf, dass Hartlyn es bemerkte, doch sie lief unbeirrt weiter. Also beschloss ich, mir eine kleine Pause zu genehmigen. Ich blieb stehen und kramte in meiner Hosentasche, um mein Handy rauszuholen und Junis zu schreiben – aber da stand Hartlyn auch schon wieder vor mir.
»Hättest du nicht etwas sagen können?«
Ich warf ihr ein charmantes Lächeln zu. »Entschuldige, aber ich hatte einen Wadenkrampf. Musst du heute noch irgendwo hin, oder warum hetzen wir hier durch, als würde uns Ms Bitterfield höchstpersönlich verfolgen?«
Hartlyn verengte die Augen. »Ich habe darauf genauso wenig Lust wie du. Wieso kommst du nicht einfach mit, damit ich dir endlich dein Zimmer zeigen kann?«
Ich seufzte und schlug mir dramatisch den Handrücken gegen die Stirn. »Meine körperlichen Grenzen. Außerdem kann ich mich kaum konzentrieren bei der Frage, die mir die ganze Zeit durch den Kopf schwirrt.«
»Und die wäre?« Hartlyn stemmte entnervt die Hände in die Hüften.
Ich schenkte ihr ein schmales Lächeln. »Was macht eine Hartlyn Griffith an einem Ferientag vollkommen aufgelöst im Büro der Direktorin?«
»Geht dich nichts an.« Die Antwort kam schnell und hart.
»Ach ja? Ms Bitterfield hat von einem wiederholten Vorkommnis gesprochen. Sollte ich da nicht lieber aus Sicherheitsgründen wieder nach Hause geschickt werden? Auch wenn das natürlich unglaublich schade wäre.«
Hartlyn sah aus, als würde sie gleich an die Decke gehen. »Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du unglaublich anstrengend bist?« Sie wischte sich grob die Haare glatt, die wie Zitteraale von ihrem Kopf abstanden.
»Jeden Tag«, erwiderte ich. »Was glaubst du, warum mich meine Mutter wohl hierher verbannt hat, Ms Griffith?«
Hartlyns Gesicht wurde zornesrot. »Weiter«, befahl sie. »Sonst muss ich Ms Bitterfield berichten, wie unkooperativ du dich gezeigt hast.«
Ich seufzte und löste mich von der Wand. »Ich wäre dir sehr verbunden, wenn wir ein etwas mäßigeres Tempo anschlagen könnten. Dabei lässt es sich besser reden.«
»Dann musst du dich wohl mit dir selbst unterhalten«, sagte Hartlyn und drehte sich auf dem Absatz um.
Wow. Sie schien wirklich bei bester Laune zu sein. Wieder preschte sie voran, wieder verlor ich sie. Glücklicherweise sah ich ihren roten Schopf noch rechtzeitig in einem Korridor verschwinden, bevor ich eine Treppe zu viel nehmen konnte.
»Das ist der Flur für die Mädchen unseres Jahrgangs«, erklärte Hartlyn, als ich zu ihr aufgeschlossen hatte, und machte eine halbherzige Geste in den Flur hinein.
»Ich sehe schon, hier herrscht strikte Geschlechtertrennung«, sagte ich trocken. »Lass mich raten – Jungsbesuch ist strengstens untersagt?«
»Interessant, was dich am meisten beschäftigt«, fauchte Hartlyn. »Madame könnte ja nach dem Weg zu den Waschräumen fragen oder ob es eine Hausaufgabenbetreuung gibt, aber nein, das Einzige, was sie wissen will, ist, ob Jungs mit auf die Zimmer dürfen.«
Ich verkniff mir ein Augenrollen und streckte die Hand aus. »Na komm schon, gib mir den Schlüssel, und du bist entlassen. Dann kannst du weiter deinen geheimnisvollen Unternehmungen nachgehen.«
Hartlyn schüttelte den Kopf. »Ich bringe dich bis ins Zimmer.«
»Eeeins. Dreeei«, las ich übertrieben langsam vom Schlüsselbund ab und deutete auf eine Tür, die ebendiese Zahlen trug. »Ich glaube, den Weg finde ich.«
»Ich habe Ms Bitterfield versprochen, dich deiner Zimmernachbarin vorzustellen, also tue ich das auch.«
»Bezahlt sie dich für deine Loyalität, oder warum freust du dich nicht einfach, dass du mich jetzt los bist?«
Hartlyn schürzte die Lippen. »Glaub mir, du wirst mir noch dankbar sein, wenn deine erste Begegnung mit Carter Bonham nicht allein stattfindet.«
Sie blieb vor dem Zimmer mit der Nummer 13 stehen und klopfte, ohne zu zögern, gegen die Tür. Niemand öffnete.
»Sieht so aus, als wäre meine Mitbewohnerin nicht da«, wies ich sie auf das Offensichtliche hin.
Hartlyn schnaubte. »Glaub mir, sie ist da.«
Ich blinzelte zu ihr hinüber. Stocksteif und mit wütender Miene starrte sie auf die verschlossene Tür.
»Warum verwenden wir nicht einfach den schönen goldenen Schlüssel in deiner Hand?«, fragte ich.
»Weil.« Sie stieß bei jedem weiteren Wort mit der Faust gegen die Tür. »Sie. Lernen. Muss. Zu. Öffnen. Wenn. Jemand. Was. Von. Ihr. Will.«
Wow, da schien jemand einige Aggressionen angestaut zu haben. Sanft nahm ich ihr den Schlüssel aus der Hand. »Keine Sorge«, sagte ich. »Ich bin diejenige, die die Carter-Erziehungsregeln bricht, nicht du.«
Hartlyn sah mich nicht einmal an, als ich die Tür mit einem leisen Klicken aufschloss und ins Zimmer trat. Das Erste, was mir auffiel, war der Geruch. Er war viel zu steril für den Raum einer Teenagerin. Das Zweite war der Dschungel aus Pflanzen, der die ganze linke Zimmerseite bevölkerte. Es hätte mich nicht gewundert, wenn im nächsten Moment eine Vogelspinne daraus hervorgesprungen wäre, so tropisch war die Atmosphäre des kleinen Waldes.
Das Dritte, was mir ins Auge fiel, war eine lebensgroße Puppe auf dem Bett meiner Mitbewohnerin. Als sie kurz blinzelte, fuhr ich erschrocken zusammen.
Shit! Wie konnte ein Mensch nur so reglos dasitzen?
Mit klopfendem Herzen betrachtete ich das Mädchen, mit dem ich die nächsten Monate zusammenwohnen würde. Ihre dunklen Dreads hingen ihr wie zur Tarnung ins Gesicht, doch sie verbargen weder ihre intensiv funkelnden Augen noch die olivbraune Haut oder ihre geschwungenen Lippen. Letztere presste sie nun missmutig zusammen. Das war also Carter Bonham. Interessant.
»Hallo, Carter«, sagte Hartlyn sichtlich pikiert.
»Hi«, sagte ich und grinste grimmig.
Carter sagte nichts.
Ich warf einen Blick auf meine Seite des Zimmers. Ein schlichter Schreibtisch, leere Regale, ein Kleiderschrank und ein Bett warteten auf mich. Mein Gepäck, bestehend aus einer Reisetasche und meinem Ukulelekoffer, kauerte schüchtern neben dem Fußende. Wie nett von meinem Pagen, alles hier hoch in den tausendsten Stock zu bringen. Vermutlich hatte sein Besuch Carter erst vorgewarnt, dass sie eine neue Mitbewohnerin bekam.
»Carter«, zog Hartlyn ihre Mission bis zum Ende durch, »das ist deine neue Mitbewohnerin. Sie nennt sich Leah.«
»Sie nennt sich Leah.« Ich verdrehte die Augen und warf Carter einen Blick zu, der sagte: Hör nicht auf die Irre. »Das klingt ja, als wäre ich eine Dragqueen und hätte mir einen Künstlernamen verpasst.«
»Wir wissen ja wohl beide, dass du in Wirklichkeit nicht Leah heißt«, pampte Hartlyn zurück.
»Ach so?«, fragte ich. »Hast du das bei meiner Passkontrolle herausgefunden?«
Hartlyn schnappte nach Luft und schien an ihrer Wut beinahe zu ersticken.
»Okay. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Jetzt gehe ich.«
»Das war keine Beleidigung«, stellte ich richtig. »Man wird sich ja wohl noch wundern dürfen.«
Hartlyn winkte ab. »Ich wünsche euch viel Spaß zu zweit. Hoffentlich arrangiert ihr euch so weit miteinander, dass keine von euch stirbt.«
Ich lächelte in Carters Richtung. »Also, bisher verspüre ich große Sympathie.« Carter starrte ausdruckslos durch mich hindurch.
»Warum wundert mich das nicht?« Hartlyn wandte sich ab. »Wenn es Probleme gibt: Klopf einfach an der Nummer sechzehn. Die Schlange mit Menschen, die etwas von mir wollen, hält sich in Grenzen, alle sind noch bei ihren Familien.«
»Alle, abgesehen von uns«, erwiderte ich trocken und machte eine Bewegung, die Carter, Hartlyn und mich in einem Kreis aus Losern zusammenschloss.
»Gibt Schlimmeres.« Hartlyn griff nach der Klinke. »Das Wichtigste steht noch mal auf dem Zettel auf deinem Schreibtisch. Essenszeiten, Stundenplan und so weiter. Ich bin deine offizielle Ansprechpartnerin.«
»Bist du so was wie die Vertrauensschülerin aus Harry Potter?«
»Das nennt sich Jahrgangssprecherin.«
»Ah. Ein großes Amt. Daher kennst du also die Kopie meines Ausweises?«
»Mach dich nicht über mich lustig, Annabelle. Deine Unsicherheit kannst du damit nicht kompensieren.«
Ich grinste dreckig. »Wie recht du hast. Weil ja ganz offensichtlich nur ich etwas kompensiere. Ganz viel Spaß bei deinen ehrwürdigen Jahrgangssprecherinnenpflichten wünsche ich dir.«
»Danke.«
Die Tür schlug zu. Nun war ich mit Carter allein. Noch immer hatte sie keinen Ton gesagt und saß missmutig auf ihrem Bett, vor sich ein dickes Notizbuch. So schlimm war sie doch nicht. Hartlyn hatte wirklich übertrieben. Dieses Mädchen wollte einfach nur seine verdammte Ruhe, und die gönnte ich ihr. Zumindest vorerst.
Ich verschwand in die Waschräume und machte mich frisch. Als ich wiederkam, hatte sich Carter Bonham um keinen Millimeter bewegt. Nur ihr T-Shirt war leicht verrutscht und offenbarte ein helles Tattoo an der Taille. Es zeigte eine Spinne mit gekrümmten Beinen, die so lebendig aussah, als wollte sie ihr gleich die Rippen hinaufkrabbeln. Ich unterdrückte ein Schaudern und öffnete meine Reisetasche, um zumindest das Nötigste schon mal auszupacken. Mit jeder Faser meines Körpers spürte ich, wie mich Carters Blick verkohlte. Er brannte sich in meinen Nacken, als wolle sie mich in Flammen aufgehen lassen. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und wandte mich um, um die Situation zu entschärfen.
»Vergiss ihn am besten sofort wieder«, sagte ich und machte ein paar vorsichtige Schritte in Richtung ihres begrünten Betts. »Meinen Namen, meine ich. Sag einfach Leah zu mir.« Ich streckte ihr die Hand hin, doch Carter sah mich nicht einmal an. Ein paar dunkle Strähnen fielen ihr vor die Augen.
»Ich deute dein Schweigen so, dass du eine friedliche Koexistenz wünschst«, sagte ich und zuckte die Schultern. »Daran bin ich auch sehr interessiert. Allerdings wäre es mir lieb, wenn du mich noch über ein paar Sachverhalte in diesem Internat aufklären könntest.«
Das Mädchen auf dem Bett rührte sich nicht. Großer Gott, hatten denn hier alle einen an der Waffel?
»Wie läuft das hier ab?«, fragte ich. »Lassen sie einen in Ruhe, oder muss man einer der komischen AGs beitreten?«
Keine Antwort. Ich sah nur, wie sich ihre Finger um das Notizbuch vor ihr verkrampften. Mein Gott, sie hätte auch aus einem Exorzistenfilm stammen können.
»Ich erwarte nicht von dir, dass wir beste Freundinnen werden, aber ist es nicht ein bisschen creepy, wenn wir so gar nicht miteinander reden?«
Anscheinend fand sie das nicht. Sie schlug ihre Haare zur Seite, sodass ich nun volle Sicht auf ihre Augen hatte. Sie waren von einem durchdringenden, matschigen Grün. Ein dunkler Kreis zog sich um ihre Iris, der die Intensität ihres Blicks nur noch verstärkte. Sie sah aus wie eine Wildkatze. Eine Wildkatze, bereit zum Sprung.
Als sie ihren Rücken mit einer fließenden, Angst einflößenden Bewegung aus ihrer an die Wand gelehnten Position aufrichtete, musste ich den Impuls, zurückzuweichen, gewaltsam niederkämpfen. Mein Herz klopfte gegen jede Vernunft wie wild in meiner Brust.
»So«, schnurrte sie gefährlich leise. »Leah heißt du, ja?«
Ich antwortete nicht, zu hypnotisiert war ich von ihren grünen Augen.
»Dann hör mal schön zu, Leah«, fuhr sie fort, ohne den Blick von mir zu wenden. »Gleich morgen wirst du zu Denise gehen und ihr sagen, dass du umziehen willst. Sonst wird es unangenehm, das verspreche ich dir.«
»Kein Grund, aggressiv zu werden.« Scheiße, war das ein Zittern in meiner Stimme? Ich hob die Hände. »Das war lediglich ein Versuch, höfliche Konversation zu betreiben. Du weißt schon, das macht man normalerweise so, wenn man sich kennenlernt. Wie heißt du? Ach, Leah, was für ein schöner Name! Möchtest du mit mir zum Mittagessen gehen, damit ich dich meinen tausend Freunden vorstellen kann?«
Blitzschnell sprang Carter vom Bett auf, und ebenso schnell stolperte ich zurück. Sie baute sich vor mir auf, jede Pore ihres Körpers schien Ablehnung zu versprühen. »Siehst du das?«
Ihre Hand schoss vor. Reflexartig zuckte ich zusammen, erkannte jedoch bereits nach wenigen Atemzügen, dass sie mir nur ein Foto unter die Nase hielt, das sie wohl aus ihrem Notizbuch gezogen hatte. Darauf war ein Mädchen mit schwarzen Haaren und blasser Haut zu sehen, dessen dunkle Augen ein wenig traurig blickten, obwohl sie lächelte.
»Das ist meine ehemalige Mitbewohnerin. Skylar hieß sie. Weißt du, was mit ihr passiert ist?«
Carter kam immer näher, und ich wich zurück, bis ich die Wand in meinem Rücken spürte. Schließlich war sie mir so nah, dass ihre Lippen beinahe mein Ohr berührten.
»Sie ist gestorben«, flüsterte sie, und sämtliche Haare an meinem Körper stellten sich auf. »Eines Nachts ist sie verschwunden und nie wiedergekommen. Willst du, dass dir das Gleiche passiert?«
Da spürte ich etwas Kaltes an meinem Arm. Als ich hinabblickte, erkannte ich, dass es sich dabei um eine verrostete Messerklinge handelte, die meine Haut gestreift hatte. Ihre Spitze zeigte direkt auf meine Eingeweide.
Mein Herz schlug mir bis zum Hals, und ich spürte meine Schlagader pulsieren. »Hör auf damit«, brachte ich schließlich hervor. »Denkst du, ich will nach dieser Nummer auch nur eine Sekunde länger mit dir in diesem Zimmer verbringen?«
Ein bitteres Lächeln erschien auf Carters Gesicht. »Das musst du wohl oder übel. Alle anderen Zimmer sind belegt.«
»Entscheide dich mal«, fauchte ich sie an. »Soll ich nun ausziehen oder nicht?«
Das Messer kam meiner Bauchdecke immer näher. Es wirkte nicht besonders scharf, aber auch eine stumpfe Klinge war dazu in der Lage, großes Unheil anzurichten.
»Ich fürchte, so kurz vor Denise’ Dienstschluss können sie kein neues Zimmer organisieren«, gurrte Carter. »Und diese Nacht lasse ich dich in Ruhe. Aber für jede weitere wirst du bitter büßen.«
Sie stieß mich von sich, sodass ich mit dem Rücken hart gegen die Wand schlug, und huschte in der Zeit, in der ich zu begreifen versuchte, was passiert war, zur Tür. Sie drückte die Klinke hinunter und lächelte mich eiskalt an. »Bis später, Mitbewohnerin. Denk an meine Worte.«
Dann verschwand sie auf den Gang.
Kapitel 3
Meine erste Amtshandlung war es, Junis anzurufen. Junis, meinen besten Freund, der so viel ruhiger und besonnener war als ich und immer wusste, was zu tun war. Alles in mir drängte darauf, seine beruhigende Stimme zu hören, mir versichern zu lassen, dass es nicht so schlimm war, wie es schien. Schließlich reagierten die Menschen in meiner Gegenwart des Öfteren über, oder etwa nicht? Vielleicht hatte ich einfach nur mal wieder diese unsichtbare Linie überschritten, die ich aus irgendeinem Grund nie sah.
Ich wartete ungeduldig bis zum zehnten Tuten, dann legte ich auf und betätigte den Button für Sprachnachrichten.
»Junis«, sagte ich und versuchte das Zittern in meiner Stimme zu verbergen. »Hier sind alle vollkommen durchgeknallt.« Dann erzählte ich von der grauen Bitterfield, von Denise und ihrer falschen Freundlichkeit, von Hartlyn Griffith, mit der ich es mir schon am ersten Tag verscherzt hatte, und von Carter Bonham, die mich nicht einmal kennenlernen wollte, bevor sie mich mit einem Messer bedrohte.
Am Ende dauerte die Sprachnachricht fünfzehn Minuten, doch ich fühlte mich nicht so erleichtert, wie ich es mir gewünscht hätte. Es war, als hätte ich mit einer Wand geredet. Normalerweise trafen Junis und ich uns jeden Tag, und wenn ich ihn mit meinen Problemen vollheulte, konnte ich ihm seine Meinung direkt an den Augen ablesen. Heute aber fühlte es sich an, als hätte ich eine Brieftaube losgeschickt und müsste zwei Wochen auf Antwort warten. Und zu allem Überfluss begann auch noch mein Magen, mir mit wütendem Brummen mitzuteilen, dass er sich gleich selbst verdauen würde, wenn ich nicht bald etwas zu essen auftrieb.
Ich schleuderte den hässlichen Blazer aus Moms Kleiderschrank von mir, schlüpfte aus der unbequemen Bluse und der Jeans und sprang in eine Jogginghose und ein altes Band-T-Shirt von Sum 41. Das Adrenalin, das noch vor wenigen Momenten in kraftvollen Strömen durch meinen Körper gepumpt worden war, war mittlerweile verschwunden. Selbst die rasende Wut, die mich in Momenten der Hilflosigkeit befiel, war mittlerweile wie weggewischt. Ich war einfach nur noch müde. Und so stattete ich den Waschräumen einen kurzen Besuch ab und versackte dann mit einer Folge Sons of Anarchy in meinen Kissen. Carter hatte sich seit ihrem Abgang nicht mehr blicken lassen. Einerseits war ich grenzenlos erleichtert deswegen, andererseits wuchs meine Angst, dass sie wiederauftauchen konnte, mit jeder Minute.
Vermutlich wäre nun der richtige Zeitpunkt gewesen, um Denise suchen zu gehen. Oder im Speisesaal nach irgendwas Essbarem Ausschau zu halten. Ich hätte mir auch einfach meine Laufschuhe anziehen und mir diese beschissenen Gefühle aus dem Körper laufen können. Doch mir fehlte die Kraft dazu. Für heute hatte ich genug geleistet.
Ein paar Minuten später rief Junis zurück, und wir quatschten, während ich aus dem Fenster über meinem Bett der Sonne beim Untergehen zusah.
»Leg dich nicht mit dieser blöden Kuh an«, sagte er, »ich kenne Menschen wie sie. Die sind so durchgeknallt, dass sie vor nichts zurückschrecken.«
Ich wollte widersprechen, aber Junis unterbrach mich. »Tu mir den Gefallen und hör wenigstens dieses eine Mal auf mich. Schwärz sie bei der Direktorin an, sorg dafür, dass sie bestraft wird oder sogar fliegt, aber mach bloß nicht den Fehler, dich mit ihr auf einen Krieg einzulassen.«
Ich verdrehte die Augen, obwohl ich wusste, dass er recht hatte. Gleichzeitig überwältigte mich ein so starkes Gefühl von Heimweh, dass mir mit einem Mal ganz schwer ums Herz wurde. Ich war noch nie so weit von zu Hause weg gewesen. Schon gar nicht mit der Aussicht, so lange nicht mehr zurückzukommen. Und Junis, mein lieber Junis, war mit einem Mal ganz fern, obwohl ich seine Stimme an meinem Ohr hörte. Würde er ohne mich zurechtkommen? Würde ich ohne ihn zurechtkommen?
Junis schien die gleichen Sorgen zu haben. »Mach keinen Unsinn, Leah, okay? Lass einfach alles sein, was ich nicht auch tun würde.«
»Na toll«, knurrte ich. »Darf ich dann überhaupt noch irgendwas machen?«
Ich hörte ihn am anderen Ende der Leitung lachen. Irgendwann legten wir auf, und ich fühlte mich wieder ganz allein und müde. Carter war noch immer nicht zurückgekehrt, und ich beschloss, nicht einzuschlafen, bevor sie wiederauftauchte.
Diese eine Nacht würde ich noch durchhalten. Und dann würde ich Mom anrufen und erzählen, in was für eine kranke Anstalt sie mich da entsendet hatte. Mein Blick huschte vom Handybildschirm immer wieder zur Tür, aus Angst, Carter könnte jeden Augenblick durch sie hindurchbrechen, doch bald wurden mir die Lider schwer, und schließlich fielen mir die Augen zu.
Erst viele Stunden später riss ich sie wieder auf. Ich hatte geträumt – mal wieder. Seit es passiert war, verfolgten mich die Schatten bis in meinen Schlaf. In dieser Nacht jedoch hatte sich der Albtraum nicht in meinem Kopf eingenistet – er stand am Fußende meines Betts und starrte auf mich herab.
Einen Herzschlag lang glaubte ich, meine letzte Stunde hätte geschlagen, denn es fühlte sich an, als würde jemand eine eiskalte Klinge in meinen Bauch jagen. Dabei war es nur der Schreck. Und mein Herz, das so wild in meiner Brust rumpelte, dass ich fürchtete, der Schatten könnte es hören.
Der Schatten.
Er stand reglos vor meinem Bett. Ein dunkler Schemen, der ebenso gut das Abbild der Baumwipfel hätte sein können, das vom Mondlicht gegen die Wand gezeichnet wurde. Wäre da nicht das schwere Atmen gewesen, das von ihm ausging.
In meiner Kehle staute sich ein Schrei, doch er schaffte es nicht heraus. Atemlos starrte ich auf die Gestalt. Obwohl ihr Gesicht nicht mehr als ein schwarzes Loch war, wusste ich genau, wer sich dort über mich beugte. Wie lange hatte sie mich schon beim Schlafen beobachtet? Reichte ihr ihre Drohung nicht mehr aus? Wollte sie mir gleich die nächste Abreibung verpassen? Ich wagte nicht, mich zu bewegen, aus Angst davor, was sie tun würde, wenn sie bemerkte, dass ich wach war. Oder wusste sie es längst?
Es fühlte sich an, als verstriche ein ganzes Jahrzehnt, ehe Carter sich endlich regte. Vor Schreck hätte ich beinahe aufgeschrien, doch sie bewegte sich nicht auf mich zu, sondern von mir weg. Kurz darauf hörte ich ihr Bettzeug rascheln und nur wenige Minuten später grunzende Atemzüge: Sie war eingeschlafen.
Danach bekam ich kein Auge mehr zu. Ich wartete darauf, dass Carter erneut über mir auftauchen würde, doch alles blieb gespenstisch still. Als sich das Schwarz der Nacht etwas lichtete, fasste ich mir schließlich ein Herz und streckte meine Zehen zum Bettrand hinaus. Ich lauschte auf Carters Atemzüge, die weiterhin regelmäßig gingen. Das Aufsetzen meiner Fersen auf dem Boden kostete mich mehr Mut als der Sprung vom Fünfmeterbrett, damals in der vierten Klasse. Als es schließlich geschafft war, war der Rest nicht mehr so schwer. Ich richtete mich auf und huschte zu meiner Reisetasche. Nie war ich so glücklich gewesen, ihren Reißverschluss nicht wieder verschlossen zu haben. Das unangenehme Ratschen hätte mir in der nächtlichen Stille den Angstschweiß auf die Stirn getrieben.
So leise ich konnte, raffte ich ein paar Klamotten zusammen – inklusive meiner bequemsten Laufschuhe und meines ausgeleiertsten Sport-BHs, den ich ohnehin zu jedem Anlass trug –, ehe ich mich wieder aufrichtete, in Carters Richtung blinzelte und ein Geräusch auszumachen versuchte. Nichts. Kein Schnarchen. Kein Rascheln. Kein Atmen!
Wie von der Tarantel gestochen, flüchtete ich zur Tür und hastete auf den Gang. Als ich mich mit pochendem Herzen an die Wand lehnte, fragte ich mich, was falsch mit mir war. Das da drin war ein Mädchen, keine Serienkillerin. Und doch war ich vor ihr davongerannt wie ein ängstliches Mäuschen. Wenn das so weiterlief, konnte ich mich ganz schnell von der Vorstellung der ach so coolen Leah verabschieden.
Nachdem ich ein paarmal tief durchgeatmet hatte, nahm ich meine Umgebung zum ersten Mal richtig wahr. Ein schummriges Licht verlieh dem Gang Konturen und ließ ihn aussehen, als verlöre er sich in der Unendlichkeit. Ein Bewegungsmelder hatte das Licht ausgelöst, als ich aus der Tür herausgeplatzt war, und beleuchtete schwach den Weg zu den Waschräumen. Alles schlief noch. Es fühlte sich an, als sei ich der einzige Mensch auf der Welt.
Bedröppelt stand ich auf dem Gang und wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Duschen gehen und danach durchs Schloss streifen, bis es Zeit fürs Frühstück war? Schon jetzt bei meiner Mutter durchklingeln und ihr den unerfreulichsten Wecker ihres Lebens bescheren?
Seufzend starrte ich auf meine nackten Füße und meine Schienbeine, die von oben bis unten mit blauen Flecken übersät waren. Dann fiel mein Blick auf das Bündel, das an meinen Fingern baumelte, und ich fasste einen Entschluss: Ich würde laufen gehen. Meine Gedanken frei machen. So lange rennen, bis ich diesen Höllenschlund hinter mir gelassen hatte. Und danach würde ich meine Mutter anrufen und ihr klarmachen, dass sie mich wieder abholen musste, wenn ihr das Leben ihres einzigen Kindes lieb war.
Nach einem kurzen Besuch im Waschraum machte ich mich auf den Weg. Die Stofftasche mit den Klamotten und den Badutensilien ließ ich für später dort hängen.
Das Schloss wirkte seltsam verlassen, als ich meinen Weg durch das Treppenhaus begann. Von Anfang an war mir aufgefallen, wie leer es hier drin war. Nun jedoch kam es mir vor, als habe man dem Ort seine Seele geraubt.
Ich irrte umher, bis ich schließlich auf ein Gemälde traf, das ich bereits auf dem Hinweg gesehen hatte. Es zeigte einen großen, hässlichen Hund in Livree. Unmöglich, sich dieses Bild nicht zu merken. Ab da war es ein Kinderspiel, den Weg zum Ausgang zu finden. Ich folgte den schwach beleuchteten Gängen und gelangte schließlich ins Foyer, das still und dunkel dalag wie eine Katze auf der Lauer. Ich blickte auf die dicken Türflügel, die sich wie stumme Wächter vor mir erhoben, und fragte mich zum ersten Mal, was wohl dahinter auf mich warten würde. Noch war die Sonne nicht aufgegangen, und der gruselige Wald umrundete das Internat, als wolle er ihm die Luft abschnüren. Wollte ich wirklich dort raus? Nachdem ich einige Male unruhig auf der Stelle getreten war, beschloss ich, dass ich wollte.
Zu meiner Überraschung öffneten sich die Türen ohne den leisesten Widerstand – ich hatte befürchtet, dass sie über Nacht verschlossen blieben. Nun konnte ich nur hoffen, dass ich sie auch von außen wieder aufkriegte.
Einen Moment lang atmete ich die dunkelblaue Morgenluft ein, die mir kühl und frisch entgegenströmte, dann stieß ich sie wieder aus, versetzte mich in einen gemächlichen Trab und lief geradewegs in das Morgengrauen hinein.
Zuerst trafen meine Schuhe auf Kies, dann auf groben Stein, schließlich auf einen unebenen Weg aus Gras und Erde, der unter meinen Schritten federte. Vom Weg aus sah ich die silberne Fläche des Sees schimmern, über den sich der Schatten der Ulme beugte. Sie sah aus wie eine einsame Witwe im Schatten des Waldes, der sich erst in einigem Abstand zu ihr entfächerte.
Obwohl hinter den gigantischen Baumriesen kein Sonnenaufgang zu erkennen war, erwachte der Tag langsam zum Leben. Die Farbe kehrte in kühlen Tönen zurück, legte sich wie eine Decke über das Gras und gab mir das Gefühl, mich zu jagen. Ich wollte schneller sein als sie.
Meine Schritte beschleunigten sich, mein Atem wurde gleichmäßiger. Das hier war es, wofür ich mich selbst im Morgengrauen, ohne zu murren, aus dem Haus stahl. Dieses Gefühl von Freiheit, von ineinandergreifenden Gelenken und arbeitenden Muskeln. Es gab mir die Gewissheit, dass ich mein Leben im Griff hatte. Dass ich ausbrechen konnte, wann immer ich es wollte. Ohne zurückzublicken.
Der Pfad passte sich den Konturen des Waldrands an und schlängelte sich in sicherem Abstand an den Nadelbäumen vorbei, als fürchte auch er, von Ms Bitterfield bestraft zu werden, wenn er sich zu nah an den Wald heranwagte. Die Bäume wirkten in der Morgendämmerung so schwarz, als saugten sie die schwindende Dunkelheit in sich auf. Immer wieder warf ich einen Blick zu ihnen hinüber, doch ich war zu sehr darauf konzentriert, die Luft gleichmäßig in meine Lungenflügel ein- und aus ihnen ausströmen zu lassen, um mich durch ihre seltsame Erscheinung beunruhigen zu lassen. Alles, was zählte, war der nächste Schritt, der nächste Atemzug.
Der Wald verschwamm in meinen Augenwinkeln zu einem einzigen dunklen Klecks. Ich wischte an ihm vorbei, zwang meine Gedanken, bei mir zu bleiben und nicht wie rastlose Geister in die Finsternis zwischen den Bäumen zu schwirren.
Brave Leah, zischte eine gemeine kleine Stimme in meinem Kopf. Nur einen Tag im Internat, und schon hältst du dich an die Regeln. Hast du etwa Angst vor dem Wald, Kleines? Natürlich hatte ich die nicht, aber Lust, im Halbdunkel über Wurzeln und Äste zu stolpern, nur weil ich mir mal wieder etwas beweisen wollte, hatte ich ebenso wenig. Trotzdem konnte ich nicht verhindern, dass mein Blick immer wieder zu der dunklen Mauer zu meiner Linken zuckte.
Lass den Scheiß, ermahnte ich mich. Konzentrier dich auf deine Atmung. Die Sonne hing nun wie eine halb reife Orange am Himmel und tauchte die Umgebung in helles Licht. Lächerlich. Was sollte schon passieren, wenn ich ein kleines bisschen vom Weg abwich? Mich würde sicherlich kein räudiges Horrorfilmmonster aus dem Unterholz angreifen, nur weil ich ein bisschen Waldluft schnupperte.
Ich warf einen Blick nach rechts, dann einen nach links und verließ mit weiten Schritten den Weg, um auf den Wald zuzusteuern, der wie ein Ungetüm aus Nadeln und Ästen auf mich wartete. Hallo, Monster, dachte ich.
Dann verschluckte es mich, umschlang mich mit seinem Körper aus vielen Tausend Beinen und senkte seine grünen Zähne in mich. Es tat so gut, dass mir ein Jauchzen entwich und ich mein Tempo so stark beschleunigte, dass vom Waldrand schon nach wenigen Augenblicken nichts mehr zu sehen war. Fast wünschte ich mir, die Bitterfield könnte mich nun sehen, wie ich in ihrem gefährlichen Wald herumsprang.
Ich sprintete zwischen den Stämmen hindurch, als wäre der Teufel hinter mir her. Meine Lungen brannten, doch ich genoss es – es war, als pustete der Wind durch meinen ganzen Körper, fegte alle meine Sorgen aus mir heraus. Meine Schritte wurden immer länger, meine Atmung schneller, und ich riskierte einen kurzen Blick zur Seite, um die unzähligen Stämme an mir vorbeifliegen zu sehen – doch da war nichts als verwischtes Braun und Grün und aufblitzende Lichtreflexe. Als ich meinen Kopf wieder umwandte, wurde ich jäh von den Füßen gerissen. Erst im Fallen wurde mir klar, dass ich gegen irgendetwas gestoßen sein musste.
Bereits im nächsten Moment presste mir der Aufprall auf dem Boden die Luft aus den Lungen. Ächzend lag ich da und versuchte zu begreifen, wie ich von einem Moment auf den anderen niedergestreckt am Boden liegen konnte. Ich blinzelte nach oben, doch alles, was ich sah, waren die dunklen Wipfel der Bäume, die über mir schaukelten, als berieten sie, was sie mit mir tun sollten. Benommen stützte ich mich mit der Hand am Boden ab, um mich aufzurappeln, doch als ein Schatten auf mich fiel, froren meine Bewegungen ein.
Jemand beugte sich über mich. Ein rothaariger Junge. Er sah freundlich aus. Sein Gesicht hätte sogar ziemlich attraktiv sein können. Wäre da nicht seine blau-grün angelaufene Nase gewesen, die abgeknickt wie eine Fahne nach links abstand.
Etwas Nasses fiel auf mein Gesicht. Wie in Trance ließ ich meine Finger zu der Stelle gleiten, an der es aufgekommen war. Als ich sie mir vor die Augen hielt, sah ich, dass sie rot waren. Rot von dem Blut, das sein gesamtes Gesicht besudelte.
Ich schrie auf und sprang wie eine Katze auf die Beine. Am ganzen Körper zitternd, presste ich mich gegen den Stamm eines Baums. Mein Herz pumpte auf Hochtouren, und ich konnte meinen Blick nicht von dem Koloss wenden, der sich schwer schnaufend vor mir aufgebaut hatte. Er war riesig. Ich musste gegen seine gigantische Brust gelaufen sein.
»Tu mir nichts«, keuchte ich, doch er schien meine Worte nicht einmal zu hören. Stattdessen taumelte er wie ein Betrunkener auf mich zu.
»Verschwinde!« Seine tiefe Stimme war ganz schwer vor Schmerz. Er streckte die Arme nach mir aus, als wollte er mich fangen. Ich schrie und versuchte mich wegducken – doch er packte mich an den Schultern und schüttelte mich so heftig, dass mir die Zähne klapperten. »Verschwinde, bevor sie dich kriegen!« Seine Augen waren so weit aufgerissen, dass ich die geplatzten Adern in seinen Augäpfeln sehen konnte. Sie schienen mich verschlingen, schienen mich hypnotisieren zu wollen.
Ich wimmerte und griff nach seinen Händen, um die Erschütterungen abzumildern, um mich zu befreien – doch da stieß er mich mit aller Gewalt von sich. Ich prallte gegen den Baum, mein Nacken knackte, und alles in meinem Schädel drehte sich, dann hörte ich seine gewaltigen Schritte, die sich durch das Unterholz kämpften und es einfach platt walzten. Im nächsten Moment verschwand er auch schon zwischen den Bäumen und war weg. Als wäre er nie da gewesen. Als hätte ich ihn mir nur eingebildet. Doch sein Blut auf meiner Haut war noch immer da. Es lief mir quälend langsam die Schläfen hinab.
Kapitel 4
»Hallo, Heart.«
Mit einem unangenehmen Knall ließ ich mein Tablett auf den Platz ihr gegenüber fallen. Hartlyn Griffith blickte zuerst irritiert, dann voller Abscheu drein. Ihr rotes Haar lag heute adrett frisiert am Kopf, doch die dunklen Ringe unter ihren Augen zeigten, dass sie ebenso wie ich nicht viel geschlafen haben konnte.
»Wie siehst du denn aus?«, zischte sie und verzog ihren Mund zu einer abfälligen Grimasse. Ihre kringellockige Sitznachbarin tat es ihr gleich.
Nach dem Vorfall im Wald hatte ich mir nicht die Mühe gemacht zu duschen, geschweige denn vernünftige Klamotten anzuziehen. Mein T-Shirt hing ebenso verschwitzt an mir herab wie mein Haar, die Schuhe waren dreckverkrustet. Nur das Blut hatte ich mir vom Gesicht gewaschen, um nicht auszusehen wie die Hauptdarstellerin eines Horrorfilms. Doch letztendlich war ich nicht hier, um die Misswahlen zu gewinnen. Ich war hier, um mich abzureagieren – und Hartlyn Griffith war das perfekte Opfer dafür.
»Das geht dich einen feuchten Dreck an, Ms Weasley!«, polterte ich und schlug die Hände mit einem lauten Knall auf den Tisch. »Hölle, wie abgebrüht muss man sein, um mich ohne schlechtes Gewissen dieser Psychopathin Carter auszuliefern?!«
Die Tassen klapperten lautstark auf den Untertellern, doch Hartlyn saß blass und stocksteif an ihrem Platz. »Ich habe keine Ahnung, wovon du redest«, presste sie hervor.
»Ach ja?« Ich lachte freudlos auf. »Dann hast du mich also nur zum Spaß vor Carter gewarnt, bevor du mich mit ihr allein gelassen hast?«
Tief in meinem Inneren war mir klar, dass nicht Hartlyn die Schuld für meine Situation trug, schließlich war sie nur die Botin gewesen. Doch es tat so gut, dieser selbstgerechten Streberin mit dem Stock im Arsch gehörig die Meinung zu geigen, um meine Wut und Angst irgendwo loszuwerden. Das, was ich erlebt hatte, war so was von abgefreakt. Nicht nur die Sache mit Carter und ihrem Messer, sondern auch meine Horrorbegegnung mit diesem Jungen. Und allmählich kam mir der Verdacht, dass Hartlyn auch damit etwas zu tun hatte. Ich muss mithelfen, ihn zu suchen, hatte sie im Büro der Bitterfield gesagt.
»Carter ist ein schwieriger Mensch«, setzte Hartlyn an.
»Carter ist KRANK!« Meine Stimme hallte durch den Speisesaal, als hätte ich mir ein Megafon an die Lippen gehalten. Scheiße. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie die wenigen Schüler, die sich im Speisesaal aufhielten, ihre Nahrungsaufnahme unterbrachen, um in einer Mischung aus Neugierde und Abneigung zu uns herüberzublicken.
»Geht das auch ein bisschen leiser?«, zischte Hartlyn. Dann beugte sie sich näher zu mir herüber und schlug einen belehrenden Ton an. »Annabelle. Nur weil Carter seltsame Verhaltensweisen an den Tag legt, hat sie es noch lange nicht verdient, dass du so über sie redest.«
Der Zorn überkam mich wie eine Welle. »Dann quartier du dich doch bei ihr ein, wenn du so scharf darauf bist, in der Nacht abgestochen zu werden!«
Hartlyn blieb der Mund offen stehen. Erst nach einigen Sekunden besann sie sich und klappte Ober- und Unterkiefer wieder zusammen. »Mir war von Anfang an klar, dass das nicht gut gehen würde«, sagte sie und durchbohrte mich mit ihren blassblauen Augen. »Du bist nicht gerade eine … dezente Person, und dass es zwischen dir und Carter krachen würde, war offensichtlich. Trotzdem. Vielleicht hat man es dir an deiner Schule nicht beigebracht, aber Konflikte löst man nicht durch falsche Anschuldigungen.«
Fassungslos starrte ich sie an. Selbst das letzte Hintergrundgemurmel war nun verstummt. Sämtliche Schüler hatten ihre volle Aufmerksamkeit der Leah-Stirling-Show gewidmet. »Dass ich nicht zu eurer versnobten Internatselite auf Arsch-Zusammenkneif-Castle gehöre, will ich nicht bestreiten«, presste ich mit letzter Selbstbeherrschung hervor. »Aber dass du mir unterstellst, ich würde mir hier etwas ausdenken, während du mich wissentlich mit einer Irren allein gelassen hast, das geht zu weit!«





























