
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Nightmare
- Sprache: Deutsch
Ist Angst stärker als Liebe? Melrose ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, wenn man davon absieht, dass sie Menschen mit einer einzigen Berührung töten könnte. Sie lebt mit ihren Adoptiveltern nicht lange an einem Ort, da sich die Vorfälle immer wieder häufen. Nachdem sie ihre beste Freundin verlassen musste und wieder in eine neue Schule kommt, lernt sie Luke kennen. Er scheint sich wirklich für sie zu interessieren, doch wie soll sie mit jemandem zusammen sein, ohne ihn zu berühren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Familie, Freunde und Leser, die ebenfalls gerne der Realität entfliehen.
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 1
Zahlen fand ich noch nie interessant. Ich saß in der letzten Reihe, während unser Lehrer irgendetwas an die Tafel kritzelte. Mein Name ist Rose, zumindest würde ich so genannt werden, wenn ich Freunde hätte.
»Melrose, schreibst du mit?«, bei meinem ganzen Namen zuckte ich unwillkürlich zusammen. Auf die Frage meines Lehrers nickte ich nur. Es interessierte sich sowieso keiner für mich, ich war sozusagen ein Freak. Damit hatte ich aber recht wenig Probleme, da ich ja auch anders als meine Mitschüler war.
Es klingelte und ich war mal wieder die Erste, die den Raum verließ. Die meisten von hier dachten, ich hätte Berührungsängste oder so etwas Ähnliches. Ich gab zu, ich berührte andere ungern, aber nicht weil ich mich davor ekelte, sondern vielmehr um sie vor mir zu schützen.
Ich war ein Alptraum, aber unsere Spezies bevorzugte den englischen Begriff Nightmare. Warum wusste ich selbst nicht so genau, aber vielleicht lag der Ursprung unserer Spezies ja im englischsprachigen Raum. Einen Alptraum hatte bestimmt jeder schon einmal, keine schöne Sache. Weißt du, vor was du am meisten Angst hast?
Was auch immer es ist, stell dir vor, es gibt jemanden, der alle deine Ängste kennt.
Ich war genau so jemand, ich war ein Nightmare. Mit einer einzigen Berührung lernte ich alle Ängste eines Menschen kennen und nicht nur das, ich konnte mich in die Sache verwandeln, die der Person am meisten Angst machte. Manchmal änderte ich meine Gestalt einfach nur durch eine simple Berührung von Haut und Haut. Es zu kontrollieren war unfassbar schwer.
Ich war keinesfalls stolz darauf so zu sein, ehrlich gesagt hasste ich es. Schon seit ich denken konnte, mieden mich alle, die nicht so waren wie ich. Alle anderen Nightmares, die ich kannte, lebten zurückgezogen und hatten Spaß daran, den Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Sie konnten einen so weit bringen, dass man sich vor Angst umbrachte, psychisch krank wurde oder komplett den Verstand verlor. Ich wollte nicht so sein. Ich wollte kein Monster sein und dennoch war ich es. Eine grausame Bestie, gefährlicher als alles andere, das ich kannte.
Ich ging zur Mädchentoilette, wie jede Pause. Es gab definitiv schönere Orte, aber hier war ich wenigstens allein und musste mich nicht 15 Minuten lang mit irgendwelchen anderen Schülern abgeben. Es erwarteten mich sowieso nur noch zwei Stunden Kunst, dann war endlich Wochenende.
Ich betrachtete mich im Spiegel, schwarze Haare, eiskalte graue Augen, Augenringe und eine Haut, als hätte sie nie die Sonne gesehen. Ich gab mir keine Mühe mit meinem Aussehen, selbst für Schminke, die hier so gut wie jedes Mädchen trug, war ich zu faul.
Als ich hörte, dass die Tür geöffnet wurde, huschte ich schnell zu einer Toilettenkabine und schloss ab.
»Hast du das neuste Gerücht schon gehört?«, fragte eine etwas höhere Stimme. Ich hätte sie auch erkannt, wenn sie vor der Tür geflüstert hätte. Amanda Crog war ein verwöhntes Einzelkind, eine totale Tusse und noch dazu der arroganteste Mensch, den ich je kennengelernt hatte.
»Das von Jan?«, fragte ihre Freundin Jenny.
»Nein, das ist doch sowas von gestern«, sie holte tief Luft. »Ich meine das von unserem Schulfreak.«
Ich riss die Augen auf, sie redeten von mir, ohne Zweifel. Amanda fuhr fort: »Ich habe gehört, sie sei adoptiert.«
Die Stimme ihrer Freundin klang verwundert: »Woher weißt du das denn?«
»Du kennst doch das übliche Gerede. Wahrscheinlich wollten ihre Eltern sie nicht, so hässlich wie sie ist. Mal ehrlich, sie sieht doch wie ein Geist aus, mit ihrer fahlen Haut und ihren Augenringen!« Ihre Freundin begann zu lachen.
Hatte ich gerade richtig gehört? Woher wussten sie von meiner Adoption? Meine Eltern - bei dem Gedanken fing ich fast an zu weinen. Mir wurde als Kind gesagt, sie seien bei einem Unfall gestorben. Ich schluckte den Kloß herunter, der sich zu manifestieren drohte, denn ich hatte oft genug deswegen geweint. Außerdem hatte ich schon früh gelernt, dass man nicht alles glauben durfte, was einem erzählt wurde.
Ich versuchte ruhig zu atmen, aber anscheinend war ich trotzdem zu laut.
»Warte mal«, Amanda trat vor die verschlossene Toilettentür, »Melrose?« Ich schwieg. »Du bist es doch, nicht wahr? Willst du uns nicht ein wenig über deine Familie erzählen? Man sagt auch, du seist depressiv und krank im Kopf.«
Ich spürte, dass sich meine Hände zu Fäusten ballten. Wenn ich die Tür jetzt öffnete, würde es nicht gut für Amanda ausgehen. Doch eigentlich hatte sie es nicht anders verdient.
Ich schloss auf und trat hinter der Tür hervor. Sie grinste mich breit an und in diesem Moment ertönte die Schulklingel. Ich wollte sie ignorieren und an ihr vorbeigehen, doch sie versperrte mir den Weg und hielt mich am Arm fest. Ihre Finger berührten meine Haut und meine Augen weiteten sich sofort. Fremde Gefühle strömten auf mich ein. Ich versuchte mich loszureißen. Doch zu spät, ich hatte keine Kontrolle mehr über mich.
Ich hasste mich für alles, alles was ich tat, alles was ich tue und alles was ich noch tun würde. Doch wenn man einmal mit ihnen in Berührung gekommen war, verfiel man in eine Art Rausch. Diese Gabe machte ein Monster aus mir, oder war ich schon immer eines gewesen?
Ich zog Amanda in ihrem Kopf an einen düsteren Ort, menschenleer. Das Einzige, was ich hörte, waren Beschimpfungen und Gelächter. Sie saß mitten auf dem schwarzen Boden, hielt sich die Ohren zu und weinte. Irgendetwas Unverständliches wimmerte sie vor sich hin.
Ich ging auf sie zu, doch ich war nicht ich. Ich sah wie eine Figur aus einem Horrorfilm aus. Blut klebte an meinen Händen und mein Gesicht war seltsam entstellt. Ich durfte nicht zu ihr laufen, sonst würde ich alles nur noch schlimmer machen, aber meine Füße gehorchten mir einfach nicht. Als ich vor ihr stand, sah Amanda auf. Augenblicklich begann sie zu schreien und versuchte aufzustehen. Doch sie brach gleich wieder zusammen. Ich kniete mich zu ihr herunter, aber das war nicht wirklich ich, oder?
Ich musste das beenden, und zwar sofort. Während Amanda wie am Spieß schrie, rief ich meinem Kopf zu aufzuhören. Hör auf, schrie ich mir selbst immer wieder zu und auf einmal wurde alles hell und ich war zurück in der Schule, zurück in der Realität.
Amanda jedoch, lag zusammengerollt auf dem Boden, kreischte und war tränenüberströmt. Ich sah zu ihrer Freundin hinüber, die nur gesehen hatte, wie ich Amanda mit einer einzigen Berührung zum Weinen gebracht hatte. Sie starrte mich mit Angst erfüllten Augen an. Was hatte ich getan?
Ich hörte eine Stimme in meinem Kopf: Monster.
Dieses Wort wiederholte sich immer wieder in meinen Gedanken. Mein Blick ging zu Amanda, dann wieder zu ihrer Freundin. Verzweifelt suchte ich nach irgendwelchen entlastenden Worten, doch ich konnte das Geschehene nicht erklären. Also hob ich meine Tasche auf und verließ die Toilette.
Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, dass Lehrer in die Mädchentoilette rannten, aus der immer noch Amandas Geschrei kam. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, dort zu bleiben, aber was sollte ich sagen? Dass es ein Unfall war? So oft wie ich die Schule gewechselt hatte, würde mir das keiner glauben. Diese Vorfälle waren überall in den Akten vermerkt, also würden sie sowieso auf mich zurückkommen. Ich steuerte auf den Ausgang zu, woraufhin mich kühle Luft umgab und ich tief durchatmete. Monster.
Sie wird keinen Schaden davontragen, dachte ich. Amanda hatte ein starkes Selbstbewusstsein.
Ich steckte meine Hände in die Jackentasche und setzte meine Kapuze auf. Nachdem ich den Pausenhof verlassen hatte, lief ich die Straße hinab, aber nach Hause konnte ich nicht, der Unterricht war ja noch nicht offiziell zu Ende. Daheim wartete sowieso nur Ärger, deswegen bog ich in eine dunklere Gasse ab, die ich nur allzu gut kannte.
Für Außenstehende sah sie aus wie eine gewöhnliche Sackgasse, doch für Nightmares verbarg sich hinter den alten Mauern eine Art Wohngemeinschaft. Ich drückte meine Hand an die Wand. Einen Augenblick später verschoben sich die Backsteine und gaben eine Tür frei. Ich hörte einen Riegel, der sich verschob, und sie schlug auf.
»Melrose, was für eine Ehre«, Luna grinste falsch.
Ihren ironischen Unterton ignorierte ich und ging an ihr vorbei: »Ist Nelli da?« Sie nickte und ich lief durch das Gemeinschaftswohnzimmer und den schwarzen Gang, der zu den verschiedenen Zimmern führte. Viel unterschied sich nicht von einer normalen WG, abgesehen von den fehlenden Fenstern und der düsteren Farbwahl. Schwarz, grau und dunkelrot.
Noch bevor ich an der Tür klopfen konnte, wurde sie von der anderen Seite aufgerissen.
»Süße, du lebst ja auch noch!« Nellis Make-up saß wie immer perfekt und ihre blonden Haare fielen glatt über ihre Schultern. Im Gegensatz zu mir hatte meine beste Freundin genau diesen glamourösen Stil, der viele Jungs wie automatisch anzog.
»Ist der Kronleuchter neu?«, ich deutete auf einen riesigen rostigen Leuchter an der Decke.
»Ach der, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe«, Nelli setzte sich auf ihren Schreibtischstuhl und ich ließ mich auf ihr Bett plumpsen.
»Ich hab es schon wieder getan«, murmelte ich und starrte an die Decke.
»Das ist ja wundervoll, wer war es dieses Mal und was hast du gemacht?«
»Eine Oberzicke und sie lag nur schreiend auf dem Boden.«
»Kommst du jetzt endlich zu uns?«, Nelli betrachtete ihre Fingernägel.
»Wie oft denn noch, ich will nicht im Untergrund leben.«
»Wir gehen jede Nacht raus Süße, keine Sorge.«
Ich seufzte: »Ich mag solche Spielchen nicht und das weißt du genau.« Ich funkelte sie böse an, doch sie lachte nur. Mit rausgehen meinte sie Typen verführen und danach töten.
»Gib es doch zu Melrose, du hast tief in dir drinnen auch das Verlangen andere zu zerstören«, ihre Hand lag auf der Stelle, wo sich ihr Herz befand.
Sie hatte recht, der Druck jemanden zu töten war enorm.
»Du kennst meine Einstellung dazu«, ich wandte mich zum Gehen. So endete eigentlich jedes Gespräch zwischen uns.
»Du hast Talent Süße, bitte vergeude es nicht.«
Darauf erwiderte ich nichts mehr und winkte ihr zu, ohne sie anzusehen, bevor ich die Tür hinter mir schloss. Ich lief wieder durch das Gemeinschaftswohnzimmer in Richtung Ausgang. Luna saß auf der schwarzen Couch und schaute sich irgendeine Serie an. »War mir ein Vergnügen«, sie lächelte mich an.
»Wie jedes Mal«, damit zog ich die Tür hinter mir zu und stand wieder in der Sackgasse.
Ich hielt mir die Hände vor meine Augen, da mich die Sonne blendete. Als ich weiterlief, gewöhnte ich mich langsam wieder an das Licht. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Wenn ich einen Umweg nahm, konnte ich allmählich nach Hause gehen. Meine Füße trugen mich zurück zur Hauptstraße und nach ein paar Straßen bog ich links ab.
Wir wohnten in einem Reihenendhaus. Rasch klingelte ich, bevor ich es mir noch anders überlegen oder gar damit anfangen konnte, wegen des neuen Vorfalls und dessen Folgen Panik zu schieben. Doch niemand öffnete die Tür. In meiner Tasche kramte ich eine gefühlte Ewigkeit nach meinem Schlüssel und schloss dann auf.
»Hallo?«, rief ich. Keine Antwort. In der Küche hing ein Zettel: Bin einkaufen.
Ich nahm zwei Treppenstufen auf einmal, schmiss meine Tasche auf den Boden und ließ mich in meinem Zimmer auf das Bett fallen. Einmal tief durchatmen. Wie sollte das nur weitergehen?
Umziehen war keine Lösung.
Ich lag ungefähr zehn Minuten still da, bis ich die Schlüssel unten an der Haustür hörte. Meine Adoptivmutter war nicht die Netteste, aber sie hatte genug Probleme mit mir, daher sollte ich mich nicht beschweren.
»Melrose?«, schrie sie.
»Ja?«, antwortete ich.
»Wir müssen reden.« Ich schluckte, die Schule hatte angerufen. Die Küchentür wurde geöffnet und ich hörte, dass sie etwas zu trinken zurechtstellte.
Ich schloss die Augen und stand danach ruckartig auf: »Ich komme.«
Nachdem ich die Treppen wieder heruntergegangen war, nahm ich am Küchentisch Platz. Meine sogenannte Mutter sah mich eiskalt an. Sie war etwas kräftiger und hatte kurze braune Haare.
»Du hast es uns versprochen«, sagte sie und nippte an ihrem Wasser. Mit uns meinte sie sich und ihren Mann.
»Ich weiß«, war das Einzige, was ich hervorbrachte.
»Mehr hast du dazu nicht zu sagen?«, sie zog die Augenbrauen hoch.
»Ich wollte das nicht. Aber sie hat angefangen - sie hat mich berührt!«, ich hielt ihrem Blick stand.
Natürlich wusste sie nicht, dass ich ein Nightmare war. Menschen durften nichts von unserer Existenz wissen, sonst würden sie uns töten - oder wir sie. Auf jeden Fall würde es Chaos bedeuten.
»Denkst du eigentlich auch einmal an die Konsequenzen? Es ist jedes Mal dasselbe!« Ich nahm einen großen Schluck Wasser. Bei ihr musste ich keine Angst haben, sie hatte mich genau einmal angefasst, seitdem nie wieder. Sie hatte Angst davor, Angst vor mir.
Anstatt zu erklären, fragte ich: »Ziehen wir jetzt wieder um?«
Sie seufzte: »Uns bleibt nichts anderes übrig. Und wenn du es dort nicht schaffst, dich unter Kontrolle zu halten, kommst du in ein Heim. Ich kann das nicht mehr.« Damit stand sie auf. Ich starrte wie vor den Kopf gestoßen auf mein Glas. Sie würden mich weggeben.
Ich konnte das nicht unter Kontrolle bringen. Erneut griff ich nach dem Glas und meine Hand zitterte.
Im Heim würde niemand ein 16-jähriges Mädchen mit einer solchen Akte zu sich nehmen. Ich musste lernen es zu kontrollieren. Ich hatte keine andere Wahl.
Ich stellte das Wasser ab und stand auf. Wie gelähmt lief ich die Treppe hoch in mein Zimmer und schloss ab. Danach ließ ich den Rollladen herunterfahren. Somit saß ich im Dunkeln. Ich genoss den Moment der Stille, bis sich mein Laptop erhellte und ein Geräusch von sich gab. Viele Menschen hatten Angst vor der Dunkelheit, weil sie dachten, dort würden irgendwelche Monster lauern. Ich hingegen fühlte mich hier sicherer.
Monster, flüsterte mir die Stimme in meinem Kopf immer wieder zu. Ich schlug mit meiner Handfläche gegen meine Stirn. »Klappe jetzt!«, murmelte ich.
Ich gab mein Passwort in den Laptop ein, aber nicht irgendein beliebiges, sondern das, was mich in das Internet der Nightmares brachte. Eine neue Nachricht.
Ich klickte mit der Maus darauf und eine Begrüßung von Nelli öffnete sich: Na, Süße.
Ich schrieb zurück: Hey.
Nachdem ich das Fenster geschlossen hatte, gab ich in die Suchleiste ein: Kräfte kontrollieren.
Es kamen nicht viele Ergebnisse, aber ich war froh, dass überhaupt etwas kam. Das Erste war ein Bericht über einen Nightmare namens Steve Wilson. Angeblich konnte er die Menschen mit nur einem Blick kontrollieren und seine, wie hier so schön ausgedrückt, Gabe ausschalten. Aber nicht ein Wort darüber, wie das funktionieren sollte. Was für ein Schwachsinn. Ich scrollte weiter nach unten. Ein Artikel sprang mir sofort ins Auge: Mächtiger werden und Gabe gänzlich unterdrücken.
Es stand nur ein kurzer Text auf der Seite, sonst nichts. Doch als ich lesen wollte, kam eine neue Nachricht rein: Und was ist passiert?
Ich tippte schnell eine Antwort: Wir ziehen wieder um.
Jetzt las ich den Text.
Es gibt nur einen Weg seine Gabe zu unterdrücken, nämlich üben. Wie sagt man so schön? Übung macht den Meister. Nur dadurch kann man besser werden.
Ich runzelte die Stirn, an wem sollte ich denn üben? Andere Nightmares waren immun gegen ihre eigenen Fähigkeiten und einem Menschen würde ich so etwas nicht antun. Also suchte ich weiter, doch alle anderen Links führten zu nichts oder sagten genau dasselbe. Ich ließ mich auf dem Bett zurückfallen und starrte ins Schwarze. Es war hoffnungslos. Ich sah, dass Nelli nochmal geschrieben hatte: Scheiße! Bock heute Abend mit zu kommen?
Ich wollte schon nein schreiben, doch wenn ich so überlegte, was soll's? Bald war ich in einem Heim, dann konnte ich mich sowieso nicht mehr unbemerkt rausschleichen.
Wann soll ich kommen?
Es kam sofort eine Antwort: Yes Baby, bis sieben, bei uns.
Dann ging sie offline und ich auch. Es war mittlerweile halb fünf. Ich zog den Rollladen wieder hoch, nachdem ich den Laptop ausgemacht hatte. Aus meinem Zimmer lief ich ins Bad, wobei ich hörte, dass mein Vater nach Hause gekommen war und mal wieder mit meiner Mutter stritt. Sie so zu nennen fühlte sich falsch an, verdammt falsch.
»Nach einem Monat sollen wir schon wieder umziehen?«, mein Adoptivvater musste sich zusammenreißen, um nicht komplett los zu brüllen. Als er keine Antwort bekam, fuhr er fort: »Wir geben sie weg, am besten gleich morgen, und dann ziehen wir um und fangen ein ganz normales Leben an!«
»Wir geben ihr noch eine Chance!«
»Das bringt doch nichts! Sie ist nicht normal und das wird sich auch nicht über Nacht ändern!«
»Wir geben ihr noch eine Chance!«, wiederholte meine Adoptivmutter und damit war das Gespräch beendet. Ich huschte schnell ins Bad, schloss die Tür und schluckte den Kloß in meinem Hals herunter. Sie waren noch nie meine Familie gewesen, aber dennoch bedeuteten sie mir etwas. In einem Waisenheim wäre ich nur wieder der Freak, ich wäre diejenige, mit der sich keiner abgeben würde. Zitternd holte ich Luft. Monster.
Um auf andere Gedanken zu kommen, ging ich duschen und föhnte danach meine Haare. Ich überschminkte meine Augenringe und tuschte sogar meine Wimpern. Das sollte reichen.
Selbst mein Spiegelbild wirkte irgendwie traurig, meine Augen kalt und leer. Ich ging in mein Zimmer zurück und lauschte, aber unten war alles ruhig. In meinem Kleiderschrank ragten mir eine schwarze Jeans und ein graues Oberteil entgegen.
Die Uhr zeigte halb sechs an.
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und begann Hausaufgaben zu machen, obwohl ich keinen einzigen Tag mehr in dieser Schule verbringen würde.
KAPITEL 2
Ein wenig später klopfte es an der Tür.
»Ja?«
Meine Adotivmutter streckte den Kopf herein: »Willst du noch etwas essen?« Ich schüttelte den Kopf. Mit einem Stirnrunzeln betrachtete sie mein Aussehen: »Gehst du heute Abend noch weg?«
»Ja, aber nur zu einer Freundin, um mich zu verabschieden«, sagte ich, ohne sie anzusehen. Sie seufzte. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, sie wollte mich umarmen; mir sagen, dass alles gut werden würde und dass wir das zusammen in den Griff bekämen. Doch sie schloss nur die Tür, ohne ein weiteres Wort.
Ich schluckte und wieder einmal hasste ich mich für das, was ich war. Ein Monster. Mich überkam plötzlich das Gefühl zu ersticken und dass die Wände immer näher rückten. Es war, als würde mich irgendjemand in die Enge treiben und wahnsinnig machen wollen.
Ich stand ruckartig auf, nahm meine Jacke und ging die Treppe herunter. Doch an der letzten Stufe erwartete mich mein Adoptivvater. »Wo willst du hin?«, fragte er und stemmte die Hände in die Hüfte.
»Zu einer Freundin«, ich wollte an ihm vorbeigehen, doch er versperrte mir den Weg.
»Um noch mehr anzustellen? Du bleibst schön hier.« Ich zog die Augenbrauen hoch, ich würde sowieso rauskommen, ob auf die leichte oder harte Tour.
Er wurde lauter und trat näher zu mir, sodass ich sein billiges Aftershave riechen konnte: »Du! Wegen dir zerfällt meine ganze Ehe langsam! Ich streite mit meiner Frau, muss mir immer wieder neue Jobs suchen und warum? Wegen dir, alles nur wegen dir! Du wirst uns verlassen, dafür werde ich sorgen!« Wütend trampelte er an mir vorbei nach oben. Ich starrte auf den Boden, unschlüssig was ich jetzt tun sollte. Eine Mischung aus Schmerz, Trauer, Hass und Wut machte sich in mir breit. Doch am Ende siegte der Schmerz und ich stürmte aus dem Haus nach draußen, wo es allmählich schon dunkel wurde.
Ich begann zu rennen, damit keiner meine Tränen sah. Als könnte ich vor meinen Problemen weglaufen. Ich rannte und rannte und rannte, bis ich den Wald erreichte.
Als ich alleine zwischen den Bäumen war, ging ich wieder langsamer. Meine Brust hob und senkte sich unruhig, meine Lunge brannte und meine Augen suchten die Umgebung ab.
Es war hier ziemlich düster. Ich blickte in die hohen Baumkronen und beruhigte mich allmählich wieder. Vögel zwitscherten, aber sehen konnte ich keine. Ich achtete mehr auf den Boden, um nicht über Äste zu stolpern und nahm auf einem großen Stein Platz.
Eine ganze Weile schloss ich einfach nur die Augen und ließ die frische Luft mich beruhigen. Doch dann weckte ein leises Rascheln meine Aufmerksamkeit.
Ich wischte mir mit dem Handrücken über die Augen, um den Rest der Tränen zu entfernen. Als ich die Lider wieder öffnete, konnte ich ein kleines Rehkitz und seine Mutter beobachten.
Die beiden wirkten unglaublich glücklich zusammen.
Warum konnten Familien nicht alle so sein?
Ich wandte den Blick ab. Nach einigen Minuten erhob ich mich und lief den mit Laub bedeckten Waldweg zurück.
An der Hauptstraße angekommen, bog ich wieder in die Sackgasse ab, es war mittlerweile kurz vor sieben. Nachdem sich die Tür geöffnet hatte, sah ich in Nellis seltsam blickendes Gesicht, wahrscheinlich wegen meines Erscheinungsbildes.
»Was ist denn mit dir passiert, Süße?« Ich zuckte nur mit den Schultern und steuerte auf ihr Zimmer zu. Sie schloss hinter uns ab.
»Ich komme in ein Heim!«, platzte es aus mir heraus, bevor ich auch nur hätte nachdenken können.
Nelli schüttelte den Kopf: »Menschen! Wenn ihnen etwas nicht passt, wird es einfach beiseite geschoben!« Ich setzte mich an ihren Schminktisch. Meine Wimperntusche war verlaufen, ich sah wirklich schrecklich aus. »Links von dir sind Abschminktücher«, meinte sie und suchte selbst etwas in einer Schublade. Als ich eine Weile nicht sprach, weil ich mit Abschminken beschäftigt war, fragte Nelli zögerlich: »Kommst du jetzt zu uns?«
Ich drehte mich zu ihr um: »Würde ich nur zu gern, aber ich kann doch nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden.«
»Und mit 16 lassen sie dich sowieso noch nicht weg«, ergänzte meine beste Freundin.
»Ich müsste es also theoretisch noch zwei Jahre aushalten, bei meiner Familie zu leben, dann können sie mir nichts mehr vorschreiben«, stellte ich fest.
Die Abschminktücher von Nelli waren mittlerweile komplett schwarz verfärbt. Mein Spiegelbild sah wieder aus wie immer. Müde, kalt und leer, nur dass jetzt noch traurig dazugekommen war.
»Wie auch immer. Heute machen wir uns einen schönen Abend!«, sie kam auf mich zu und betrachtete ebenfalls mein Spiegelbild. Ihr Lächeln war freundlich: »Das bekommen wir hin.«
Sie begann mein Gesicht zu überschminken, was etwas dauerte, da ich so blass war. Dann fuhr sie meine Augenbrauen nach, tuschte meine Wimpern doppelt und betonte meine Lippen mit einem dunkelroten Lippenstift. Als sie fertig war, durfte ich mich ansehen.
Ein dunkler Lidstrich zog sich über meine Lider und betonte das Grau meiner Iris. Meine Brauen waren dunkler, mein Gesicht nicht mehr so blass und auch die Lippen passten perfekt zum Rest.
Ich selbst würde mich nie so schminken. Ich konnte es allerdings auch nicht: »Du bist echt nicht schlecht.«
»Du stehst vor einem Profi«, zwinkerte mir Nelli zu, »und jetzt kümmern wir uns noch um dein Outfit!«
Sie öffnete ihren riesigen Kleiderschrank und zog ein bauchfreies Oberteil heraus.
Ich schüttelte den Kopf: »Du weißt, das ist nicht mein Style.«
»Wenn wir feiern gehen - und die Betonung liegt auf wir - dann gehst du nicht so raus«, sie deutete auf mein zugegebenermaßen etwas spießiges T-Shirt.
Es ging noch eine Weile so hin und her, bis sie mir ein schulterfreies schwarzes Oberteil reichte. Dazu bekam ich noch eine dunkelgraue Lederhose, silberne Ohrringe und eine Kette. Ich sah umwerfend aus, wenn man auf so etwas stand. Und ich stand absolut nicht darauf.
Eine ganze Weile beobachtete ich meine beste Freundin und sah zu, wie sie sich selbst zurechtmachte, bis ich es nicht mehr aushielt.
»Nelli?«, ich war direkt hinter ihr.
»Ja?« Sie sah mich an und ich versuchte krampfhaft, nicht loszuweinen, weil ich wusste, dass ich sie in wenigen Stunden verlassen musste.
»Ich weiß, du magst es nicht, aber kann ich dich mal umarmen?«
Nelli legte den Pinsel beiseite, mit dem sie sich gerade noch geschminkt hatte, und stand auf. Seufzend stellte sie sich aufrecht hin und verzog das Gesicht: »Na los!« Ich lächelte. Es war ewig her, dass ich jemanden in die Arme geschlossen hatte. Und erst jetzt merkte ich, wie sehr ich es vermisst hatte.
Wahrscheinlich drückte ich sie für ihre Verhältnisse schon viel zu lange, deswegen ließ ich schnell wieder los: »Danke.«
»Solange es nicht zur Angewohnheit wird, gerne«, meinte Nelli und schminkte sich weiter.
Nach einer weiteren halben Stunde waren wir beide fertig und sahen aus als wären wir nur zum Flirten unterwegs, was ja auch irgendwie stimmte. Um halb neun verließen wir ihr Zimmer.
»Nadine! Luna!«, rief Nelli. Luna saß bereits im Gemeinschaftsraum und betrachtete mich, jedoch ohne eine Miene zu verziehen.
»Was für eine Überraschung!«, meinte sie sarkastisch lächelnd und es schien gerade so, als wäre ich das einzige lebendige Etwas, das man in diesem Raum ansehen konnte.
»Kommt Nadine noch?«, fragte Nelli, die die Launen ihrer Mitbewohnerin schon kannte und erst gar nicht auf deren Tonlage einging. Luna zuckte nur mit den Schultern.
»Ich gehe mal nach ihr schauen«, sagte sie.
»Nicht nötig!«, ein braunhaariges Mädchen mit Sommersprossen tauchte auf. »Melrose! Dich habe ich hier ja schon ewig nicht mehr gesehen!«, Nadine kam zu mir und streckte mir die Hand entgegen. Ich klatschte ein.
»Na dann sind wir für heute vollzählig. Der Rest will nicht mit«, erklärte Nelli.
»Ich fahre«, meinte Luna.
»Dann los!«, rief Nadine und drängte uns lachend vorwärts. Wir liefen durch den Flur, bis wir zu einer Treppe kamen, die nach unten in eine Tiefgarage führte. Die anderen steuerten direkt auf einen schwarzen matten Porsche zu. Ich war ein wenig beeindruckt, doch ließ mir nichts anmerken. Luna und Nelli stiegen vorne ein, ich und Nadine hinten.
»Wo fahren wir jetzt eigentlich genau hin?«, fragte ich und knetete unruhig meine Finger.
»Zu den angesagten Clubs natürlich«, jubelte Nelli und klatschte in die Hände.
Einer der angesagten Clubs war nur zehn Minuten entfernt und hieß Underground. Luna parkte den Porsche in einer Seitenstraße und schloss, nachdem wir alle ausgestiegen waren, ab. Ich kam mir total dämlich vor mit all der Schminke im Gesicht, den freizügigen Klamotten und den hochhackigen Schuhen. Aber wir sahen alle so aus, also sollte ich mich wahrscheinlich einfach daran gewöhnen.
Das Gebäude, auf das wir zusteuerten, kannte ich nicht, was aber auch kein Wunder war, da ich so gut wie nie feiern ging. Der Türsteher am Eingang grüßte Luna und nickte mit dem Kopf in meine Richtung, was so viel heißen sollte wie: Wer ist die Kleine?
»Melrose«, murmelte Nadine und dann waren wir auch schon drinnen. Er wollte lediglich meinen Namen wissen, seltsam. Als ich die Frauen auf der Tanzfläche erblickte, fühlte ich mich nicht mehr dämlich. Ich war Nelli eher dankbar, dass sie mich nicht in meinem langweiligen T-Shirt hatte gehen lassen.
Kurze Röcke, Ausschnitt bis zum Bauchnabel und alle sahen aus, als wären sie in einen Topf voller Schminke gefallen. Die Musik war dröhnend laut und die einzigen Lichter waren die Reflektionen der Discokugel. Ein DJ spielte Technomusik und die Tanzfläche war gut gefüllt.
Nadine und Luna redeten gerade mit einer Absperrfrau, zumindest erinnerte mich ihr gelb schwarzes Kleid an ein solches Absperrband.
»Komm wir holen uns etwas zu trinken!«, brüllte Nelli mir zu.
Während wir zur Mitte an die Bar liefen, achtete ich darauf, niemanden zu berühren. Nelli tat das nicht. Sie streifte einen Mann, der sofort aufschrie, aber keiner hörte oder beachtete ihn. Sie bestellte zwei Cocktails, was mir nicht gefiel. Ich und Alkohol, das war so eine Sache. Eigentlich vertrug ich rein gar nichts.
Nachdem ich die Brühe gereicht bekommen hatte, nahm ich einen kleinen Schluck. Es schmeckte sogar ganz okay. Nelli leerte ihr Glas auf ex. »Ich gehe tanzen«, schrie sie lachend, und als ich keine Anstalten machte mitzukommen, ging sie alleine.
Ich setzte mich an die Theke und umklammerte mein Glas. Nelli wurde durch Alkohol immer lustig. Ich dagegen nicht. Im betrunkenen Zustand konnte man praktisch alles mit mir machen. Aber ich brauchte mich da sowieso nicht zu sorgen, mich berührte keiner länger als nötig.
Ich nahm einen großen Schluck und beobachtete die Leute. Typen, die Mädchen in knapper Kleidung anmachten, Mädchen, die an andere herantanzten und in einer Ecke kotzte jemand. Ich wandte den Blick schnell wieder ab.
»Ist der gut?«, ein Junge, vielleicht zwei Jahre älter als ich, setzte sich neben mich.
»Was?«, ich war überrumpelt.
»Der Cocktail. Welcher ist das? Caipirinha?«
Ich nickte: »Ist gut.« Und wie um es zu bestätigen, leerte ich mein Glas und schon einen Augenblick später stand ein neues, volles Glas vor mir. »Danke«, brachte ich hervor und sah ihn absichtlich nicht an. Ich hatte keine Lust zu sprechen.
»Du bist wohl nicht oft hier«, meinte er lachend.
»Du etwa?«
»Ich bin Luke«, er reichte mir die Hand und ich nahm sofort meinen Cocktail. Ich trank und tat so, als hätte ich es nicht bemerkt. Er nahm sie zum Glück wieder herunter. Das Zeug schmeckte eigentlich gar nicht so schlecht. »Und du?«, er sah mich an.
Der Alkohol begann zu wirken oder lag es an mir: »Was ich?«
»Dein Name.«
»Ach so, Rose, Melrose«, ich spürte, dass sich meine Wangen röteten.
»Schöner Name«, er nippte an seinem eigenen Cocktail.
»Danke«, peinlich berührt rührte ich mit meinem Strohhalm in dem Getränk herum.
»Mag deine Mutter Rosen?«, er lachte und trank noch einen Schluck.
»Keine Ahnung«, ich zwang mich dazu, ruhig zu atmen.
»Bist du alleine hier?« Warum löcherte er mich so?
»Nein.«
»Mit deinem Freund?«
»Freundinnen«, gab ich zurück.
»Wo sind die?«
»Tanzen.« Ich trank das Glas leer. Es schmeckte immer besser. Also bestellte ich gleich noch eins.
»Willst du nicht tanzen?«, er fuhr sich durch die Haare, das konnte ich aus dem Augenwinkel erkennen.
Ich schüttelte den Kopf: »Nein.«
»Bist du hergekommen, um zu trinken?«, sein Finger deutete auf meinen dritten Caipirinha.
Gute Frage, war ich das? In einem Heim konnte man sicherlich nichts trinken, und wenn man dort bald für immer festsitzen würde, so wie ich, konnte man sich sicher mal die Kante geben.
»Kann sein«, ich exte das dritte Glas.
»Komm, das hast du gar nicht nötig«, er streckte die Hand nach mir aus und ich sprang auf, wobei ich mit einem anderen Mädchen zusammenstieß. Es fühlte sich gut an, ich spürte ihre Ängste. Alles, was sie zu verbergen versuchte, strömte auf mich ein. Jede Person, jeder Gegenstand, vor dem sie sich fürchtete.
Ich wollte loslassen, doch der Nebel in meinem Kopf wurde dichter. Meine Finger umgriffen ihr Handgelenk.
Ich sah sie. Sie rannte in einer ausgestorbenen Stadt durch eine verlassene Straße und drehte sich alle paar Sekunden um. Von irgendwoher drangen Schreie an mein Ohr, doch ich konzentrierte mich auf die rennende Person. Ich konnte mein Lächeln nicht unterdrücken, es fühlte sich einfach so unglaublich richtig an und trotzdem war es so verdammt falsch.
Mit schnellen gleichmäßigen Schritten verfolgte ich das Mädchen. Ich war schnell, schneller als sie. Also schloss ich zu ihr auf. Meine Gestalt hatte die eines Killers angenommen, denn ich rannte mit einem Messer neben ihr her. Ich genoss die Panik, die Angst, die Schreie.
Von weit her drang eine Stimme an mein Ohr: »Melrose! Was tust du da? Lass sie los!« Ich spürte Schläge an meinem Arm, heftige Schläge.
In einem Moment hob ich noch das Messer, im nächsten war nur meine Faust in der Höhe.
Ein Junge kniete über dem toten - nein - bewusstlosen Mädchen. Luke sah mich entsetzt an. Die Musik war ausgeschaltet worden und alle Blicke waren auf mich gerichtet.
Der Junge, der anscheinend der Freund des Mädchens war, schlug mir mitten in den Bauch. Ich riss die Augen auf und krümmte mich. Er holte erneut aus, doch Luke fing die Faust ab.
Nelli stürmte zu mir herüber und zog mich weg. Die Leute wichen mit großen Augen vor uns zurück und machten Platz. Ich sah mich panisch um, was war gerade nur passiert? Alles ging viel zu schnell.
Ein dumpfes Pochen machte sich in meinem Arm breit.
Kurz vor dem Eingang fand ich meine Stimme wieder: »Sie leidet unter Schizophrenie!«
Wir traten in die Nacht hinaus und die Kälte schlug mir entgegen, sodass mir schwindelig wurde. Luna hatte das Auto schon vorgefahren und Nelli half mir einzusteigen. Auch Nadine saß bereits im Porsche.
»Ich fasse es nicht!«, Luna funkelte mich während der Fahrt böse an, aber das war mir egal. Der Nebel zog sich dichter zusammen und ich ließ es zu.
»Aua!«, meine Stimme klang heiser.
»Bleib ruhig liegen, sonst wird es noch schlimmer«, Nelli holte eine Salbe und trug sie auf meinem Arm auf. Ich biss die Zähne zusammen. Mein Blick ging in Richtung meines Arms. Blaue Flecken und riesige Blutergüsse waren dort zu sehen. Mir wurde schlecht. »Ich verbinde deinen Arm«, sie kramte in ihrer Schublade.
»Nein!«, ich richtete mich auf und erst jetzt stellte ich fest, dass ich in ihrem Zimmer lag.
»Warum nicht?«
»Es soll keiner mitbekommen und das wäre viel zu auffällig.«
»Zieh eine Jacke darüber. Außerdem werde ich mir jetzt noch deinen Bauch ansehen.« Nelli verband meinen Arm und zog mein Oberteil ein wenig hoch: »Tut das weh?«
Und wie! »Geht.«
»Also ja«, sie holte wieder eine Salbe und einen Verband. Ich seufzte und ließ mich nochmal verarzten.
»Ich muss nach Hause«, ich wollte aufstehen, doch Nelli drückte mich wieder runter.
»Morgen früh, jetzt schläfst du«, sie stand auf und verließ das Zimmer. Immer noch leicht benebelt sah ich ihr nach, auch als sie schon längst verschwunden war.
Ich ballte die Hände zu Fäusten. Ohne den Alkohol wäre das niemals passiert. Oder eher ohne Luke. Was war das überhaupt für ein Typ? Für wen hielt er sich?
Aber eigentlich lag die Schuld einzig und allein bei mir, denn ich war diejenige, die mit zu diesem dämlichen Club wollte. Das war mir alles zu viel. Monster.
Ich kniff die Augen zusammen und versuchte einzuschlafen, was mir dann auch nach einer gefühlten Ewigkeit gelang.
Es klopfte an der Tür und ich brauchte einen Moment, um mir sicher zu sein, dass ich das Geräusch nicht nur geträumt hatte: »Ja?«
»Willst du etwas frühstücken?«, Nadine stand im Türrahmen.
»Ja.« Sie kam mit einem Teller herein und ich setzte mich auf. Ein stechender Schmerz fuhr in meinen Kopf, sodass ich mich gleich wieder nach hinten lehnte.
»Kopfschmerzen?«, Nadine reichte mir die Toasts.
»Sieht so aus«, ich stöhnte. Warum musste ich auch trinken, obwohl ich wusste, dass ich rein gar nichts vertrug?
»Ich hole dir etwas zu trinken«, sie stand auf und kam ein wenig später mit Wasser und einer Kopfschmerztablette zurück.
»Danke.« Als ich fertig war, gab ich ihr das Geschirr wieder. Allerdings ging Nadine noch nicht gleich.
»Brauchst du sonst noch etwas?« Ich schüttelte den Kopf. »Wie war er?«
»Wie war wer?«, wiederholte ich.
»Na der Typ, der sich gestern für dich geprügelt hat.«
»Wie bitte?«, ich runzelte die Stirn.
»Sag nicht, du hast nicht mitbekommen, dass die Leute danach noch geschrien haben«, sie zog die Augenbrauen hoch.
»Scheiße, ist ihm was passiert?«, in mir läuteten alle Alarmglocken.
Sie zuckte beiläufig mit den Schultern: »Ich war doch nicht mehr dabei, keine Ahnung.« Ich starrte auf die Bettkante. Wenn ihm etwas passiert sein sollte, war das alles meine Schuld. Nadine begann zu grinsen: »Machst du dir etwa Sorgen um ihn?«
»Was? Nein, natürlich nicht.«
»Süß, die kleine Melrose hat sich verliebt. Ich muss zugeben, er sieht echt nicht schlecht aus. Braune Haare waren schon immer mein Typ und sein Körperbau ist auch nicht von schlechten Eltern.«
»Du spinnst doch! Ich war betrunken und er ist total-«, mir fiel nichts ein.
»Total was? Heiß?«
»Seltsam.«
Nadine brüllte los: »Das war der schlechteste Versuch, sich aus so einer Situation herauszureden, den ich je gehört habe.«
Ich sah sie fassungslos an, schlug dann aber die Bettdecke zurück und ging gar nicht weiter auf dieses Thema ein: »Ich muss nach Hause, wir ziehen heute um.«
»Na dann«, Nadine machte eine Handbewegung zur Tür.
»Kannst du Nelli holen?«
»Sicher? Nicht lieber den Retter?«, sie wackelte vielversprechend mit den Augenbrauen. Könnten Blicke töten, dann läge sie längst unter der Erde.
Er war weder mein Retter, noch mein Geliebter. Er war rein gar nichts.
»Ist ja schon gut«, sie begab sich zur Tür und einen Augenblick später setzte sich Nelli neben mich.
»Das war es dann wohl«, sie gab mir schlichte Klamotten zum Anziehen, natürlich langärmelig.
»Wir bleiben in Kontakt?«, ich schluckte.
»So wie immer«, meinte sie mit einem Lächeln.
Ich zog mich um: »Ich werde dich vermissen.«
»Jetzt werd mal nicht sentimental, Süße. Wir sehen uns doch wieder.«
Ich fiel ihr ohne Nachzudenken um den Hals. Wahrscheinlich hätte ich ewig nicht losgelassen, doch irgendwann reichte es Nelli: »Du schaffst das.« Mit beiden Armen drückte sie mich sachte von sich.
Vielleicht hätte ich gekränkt sein sollen, doch das war ich nicht, stattdessen konzentrierte ich mich auf das Wesentliche: »Kann ich den Verband dann abmachen?«
»Ich gebe dir die Salbe mit und dann machst du einen frischen Verband darum«, sie lief zu einem kleinen Schrank und fing an darin herum zu suchen.
»Wenn es sein muss«, ich konnte meinen genervten Ton nicht unterdrücken.
Nadine stand an der Tür. Luna nicht, was mich aber herzlich wenig wunderte. »Ich glaube an dich, Rose, und wenn ich deinen Typen wiedersehe, gebe ich ihm deine Nummer«, meinte Nadine und ich boxte sie leicht.
»Wir sehen uns wieder«, sagte ich mit fester Stimme; mehr für mich selbst, um mich daran zu erinnern, dass das hier nicht das letzte Mal war, wo ich die beiden besuchen konnte.
»Bis bald«, flüsterte Nelli halbherzig grinsend und ich griff nach der Türklinke.
Ein paar Sekunden später stand ich wieder hinter der Backsteinmauer und atmete tief durch.
Du schaffst das Melrose, kein Grund zur Sorge.
Ich lief nach Hause, wenn man das so nennen konnte. Am liebsten wäre ich Kilometer weit gerannt, nur um dort nicht auftauchen zu müssen. Kurz erwog ich sogar, wieder umzukehren und einfach von der Bildfläche zu verschwinden. Würde das einen Unterschied machen? Würde mich überhaupt jemand vermissen?
Meine Eltern waren gerade dabei unsere Sachen ins Auto zu packen. Darin waren sie geübt, dank mir.
»Dass du auch noch erscheinst gleicht einem Wunder«, mein Adoptivvater sah mich eiskalt an. Ich zuckte nur mit den Schultern und ging in die Richtung meines Zimmers.
»Du hast noch eine halbe Stunde«, kam von unten.
Mein Zeug zu packen dauerte ungefähr 20 Minuten. Dann schleppte ich meine Koffer runter, packte sie auf den Rücksitz und nahm daneben Platz.
Meine Adoptivmutter gab eine Route ins Navi ein und mein Adoptivvater schloss das Haus ab. Als wir losfuhren, herrschte Totenstille. Also holte ich mein Handy heraus und steckte Kopfhörer rein.
Ich blendete einfach alles um mich herum aus, konzentrierte mich schlichtweg nicht auf die Tatsache, dass ich bald ein richtiges Waisenkind sein würde und ließ mich stattdessen von der Musik mitziehen.
Keine Ahnung, wie lange wir gefahren waren, aber es konnten nicht mehr als ein, zwei Stunden gewesen sein. Wir bogen in eine kleine Einfahrt ein. Das Haus stand ziemlich alleine und dahinter begann ein Wald, so wie ich das aus dem Auto heraus sehen konnte.
Ich half beim Koffertragen. Durch eine weiße Haustür ging es in einen großzügigen Eingangsbereich. Innen war alles sehr modern eingerichtet. Eine Glastür führte zum Garten, der an dem Wald grenzte. Ein nicht zu kleiner Pool war in der Mitte eingelassen und die Küche war offen. Kurzgesagt, es war atemberaubend.
»Komm kurz mit hoch!«, meine Mutter führte mich eine Wendeltreppe hinauf. »Du kannst entweder dieses Zimmer oder das auf der anderen Seite haben.«
Der Raum war doppelt so groß wie mein vorheriges Zimmer und ich sah mich neugierig um. Durch das Fenster hatte man Blick auf die Straße und die Wände waren in einem hellen Gelb gestrichen. Danach führte sie mich weiter und da wusste ich, dass ich meine Entscheidung getroffen hatte.
Das Zimmer war zwar nicht so groß wie das andere, aber es hatte eine Wand voller Fenster und man blickte genau auf den Wald. »Ich würde das hier nehmen«, ich sah nach draußen, unter mir der Pool.
Sie lächelte leicht: »Habe ich mir schon gedacht.«
Ich holte meine Koffer von unten und meine Adoptivmutter stand immer noch an derselben Stelle.
Ich ließ mir meine Verwunderung nicht anmerken: »Ist etwas?«
Sie öffnete den Mund, schüttelte jedoch dann den Kopf: »Soll ich dir die Heizung anmachen, dann kannst du die Jacke ausziehen.«
»Das mache ich schon, danke«, ich versuchte, sie nicht förmlich anzustarren. Wir hatten schon lange nicht mehr geredet, ohne dass es um meine sogenannten Berührungsängste ging.
»Gut, dann komm einfach runter, wenn du fertig bist.« Ich nickte und die weiße Holztür schloss sich hinter mir. Mein Blick wanderte durch mein neues Zimmer. Laminatboden, ein grau-schwarzer Kleiderschrank links, ein Glasschreibtisch mit Blick nach draußen, ein graues Bett rechts und ein schwarzer Teppich davor. Mir gefiel dieser schlichte Stil.
Ich räumte meine Klamotten in den Schrank. Meinen Laptop stellte ich auf den Schreibtisch. Dann holte ich unten noch meine Schulsachen und Schuhe. Ich besaß nicht gerade viel, aber das war mir relativ egal. Nachdem ich noch ein paar Bücher auf das Regalbrett, das über dem Bett hing, gestellt hatte, sah ich mich zufrieden um. Das Zimmer war wie für mich gemacht. Bei dem Gedanken, dass ich hier vielleicht bald wieder wegmusste, wurde mir mulmig zumute.
Als ich auf der Wendeltreppe zurück in die Küche ging, hörte ich meine Adoptiveltern schon wieder streiten.
»Dann geh doch!«, schrie mein Adoptivvater und meine Mutter eilte weinend an mir vorbei die Treppe hoch. »Du!«, er kam auf mich zu und ich erkannte an seinem Atem, dass er getrunken hatte.
Er packte meinen Arm mit dem Verband und ich schrie kurz auf, was ihn zum Lachen brachte. Wieder brüllte er los und sein widerlicher Geruch schlug mir entgegen: »Geh mir aus den Augen und komm am besten nie wieder!«
Ich sah ihn hasserfüllt an und drehte mich in Richtung Garten. Konnte er so haben. An dem Pool vorbei lief ich direkt auf den Wald zu. Am Ende des Gartens stand ein kleiner Zaun, über den ich mit Leichtigkeit klettern konnte. Nach ein paar weiteren Schritten wurde ich von riesigen Tannen umgeben, Äste krachten unter meinen Füßen und Tiergeräusche drangen an mein Ohr.
Ich achtete erst jetzt wieder auf meinen Arm und der pochte wie verrückt.
Zähne zusammenbeißen, Rose, du schaffst das.
Der Waldboden knirschte unter meinen Füßen und meine Schmerzen wurden immer heftiger. Doch ich ignorierte sie, denn sonst wäre ich vermutlich umgekehrt und das wollte ich auf keinen Fall.
Ich lief noch ein Stück weiter und setzte mich dann auf einen umgefallenen Baumstamm, etwas abseits hinter ein paar Bäumen versteckt. Nellis Jacke zog ich aus und krempelte den Ärmel hoch, den Verband löste ich vorsichtig. Einer meiner Blutergüsse hatte sich extrem vergrößert.
Ich ballte meine Hände zu Fäusten. Erst brachte er seine Frau zum Weinen und dann wurde er auch noch gewalttätig. Ich hasste ihn. Konnte man seinen Vater hassen? Strenggenommen war er es ja gar nicht.
Ich rollte den Ärmel wieder runter und zog die Jacke darüber. Er würde uns nicht nochmal so behandeln, dafür würde ich sorgen.
Ich stand auf und lief zurück zu unserem neuen Haus. Zum Glück war ich nur geradeaus gelaufen, sodass ich den Weg nach ein paar Minuten wieder sicher bestimmen konnte.
Er hatte die Terrassentür geschlossen, während ich weggewesen war. Anscheinend meinte er es ernst. Ich ging um das Haus herum und klingelte, erst einmal, dann zweimal, dreimal. Langsame zögerliche Schritte schlichen die Treppe herunter, es war meine Mutter.
Ihr Gesicht war gerötet und verweint, als sie die Tür öffnete: »Er ist gegangen, ich-, ich weiß nicht wohin.«
Ich nickte und schloss die Tür hinter mir. Am liebsten hätte ich sie in den Arm genommen, so allein und verletzt wie sie da vor mir stand, aber das ging ja nicht. Es tat verdammt weh, sie so leiden zu sehen und ihr nicht helfen zu können.
»Das wird wieder«, flüsterte ich und rang mir ein Lächeln ab. Sie versuchte zu lachen, doch es gelang ihr nicht. Unbeholfen sah ich mich um und erblickte die Kartons in der Küche: »Soll ich die für dich einräumen, dann kannst du dich in Ruhe hinlegen.«
»Das wäre lieb«, sie stieg langsam die Wendeltreppe wieder hoch und ich begann das Besteck einzuräumen. Danach folgten noch Teller, Töpfe, Gläser, Schüsseln, Pfannen und etliche Küchengeräte. Außerdem packte ich noch Gewürze, Tee und ein bisschen zu essen aus. Ich beschloss, mir eine Aufbackpizza zu machen und schob sie in den Backofen. Nach circa 15 Minuten Fernsehen stand ich von der Couch auf, holte die Pizza aus dem Backofen und halbierte sie.
Als ich die Schlüsselgeräusche an der Haustür hörte, beeilte ich mich und huschte gerade noch rechtzeitig mit den Tellern die Treppe hoch. Leise klopfte ich an die Tür des Schlafzimmers und meine Mutter öffnete zögernd.
»Willst du etwas essen?«, flüsterte ich.
Schon seltsam, sonst war sie immer diejenige, die mir diese Frage stellte. Sie nickte und als sie hörte, dass ihr Mann zurück war, schloss sie sofort die Tür. Ich ging in mein Zimmer und schloss ebenfalls ab.
Es war seltsam sich in seinen eigenen vier Wänden fehl am Platz zu fühlen. Die Stimmung hatte schon Ähnlichkeit mit der Ruhe vor einem Sturm, doch alles blieb ruhig und ich begann meine halbe Pizza zu essen.
Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, hörte ich schwere Schritte nach oben kommen. Ich spannte mich automatisch an, zog die Jacke aus, schmiss sie von mir und krempelte auf der gesunden Seite den Ärmel hoch. Ich wollte sichergehen, dass er den Kontakt auch genoss.
Es war wieder still. Anscheinend war er stehen geblieben.
Plötzlich begann er an die Tür meiner Mutter zu hämmern. Der hatte sie doch nicht mehr alle! Allerdings hörte er gleich wieder auf. Ich dachte, er hätte aufgegeben, doch jetzt begann er bei mir an die Tür zu klopfen.
Du schaffst das, Melrose. Monster.
Ich schlug mir gegen den Kopf. Ja, ich war ein Monster. Doch Leute hatten Angst vor Monstern, also würde ich ihm beibringen, mich zu fürchten.
Mittlerweile hatte er damit angefangen zu treten. Mir platzte der Kragen. Ich schloss die Augen und riss dann die verdammte Tür auf. Mir stockte der Atem.
Er hatte sich einen schwarzen Schutzanzug besorgt, der seine komplette Haut bedeckte, die Augen und Atemwege ausgenommen. Noch bevor ich auch nur die Chance hatte, reagieren zu können, packte er mit aller Gewalt meinen kaputten Arm. Es knackte.
Ich schrie, ich hatte das Gefühl, mein Arm würde jeden Moment explodieren. Es pochte heftig und einer meiner Blutergüsse hatte irgendwie begonnen zu bluten.
Sein Griff umschloss meinen anderen Arm durch das Oberteil und ich konnte mich nicht wehren. Der Schock saß zu tief. Doch kurz bevor er meinen zweiten Arm brechen konnte, fiel er mit einem lauten Schlag um.
Ich sah erschrocken hoch. Meine Adoptivmutter stand mit einer Pfanne hinter ihm. »Oh mein Gott, Melrose!«, sie zog mich am Ärmel nach unten und verständigte einen Notarzt.
Ich sei in einen Dornenbusch gefallen, wo eine alte Säge gelegen hatte. Hätte ich nicht so höllische Schmerzen gehabt, hätte ich darüber bitter gelacht.
Ich hörte die Sirenen und Männer mit roter Kleidung stürmten auf mich zu. Es war wie einem Film. Irgendwie war alles so verdammt unrealistisch.
Das Letzte, was mir auffiel, war, dass alle die gleichen weißen Handschuhe trugen, danach wurde alles schwarz.
KAPITEL 3
Ich öffnete die Augen, sah aber nur verschwommen.
Mit mir im Raum saß eine Person, deren Umrisse ich nicht richtig ausmachen konnte. Nach ein paar Mal Blinzeln wurde meine Sicht allmählich besser und der helle Raum entpuppte sich als Krankenhauszimmer. Doch die unbekannte Person blieb weiterhin unbekannt.
Mein Blick glitt an meinem Körper hinab, mein linker Arm war vergipst und mein Rechter verbunden. Ich spürte glücklicherweise keinen Schmerz, was mir ein wenig seltsam vorkam.
»Dein linker Arm ist gebrochen und dein Rechter hat ein paar Macken abbekommen, deswegen der Gips und der Verband. Außerdem haben wir dir Schmerzmittel verabreicht, damit du ruhig aufwachen kannst. Pass beim nächsten Mal besser auf, wenn du im Wald spielst«, der Arzt stand auf und wandte sich zum Gehen.
Hatte ich das gerade richtig verstanden? Dieser Mann glaubte also die peinliche Geschichte, die meine Adoptivmutter sich zurechtgelegt hatte? So würde ich sicherlich nicht mit mir reden lassen.
Ich lächelte: »Natürlich mache ich das, aber können Sie kurz nach dem Verband schauen? Irgendwie brennt da etwas.« Er sah mich erschrocken an. Er hatte also auch die Anweisung mich nicht zu berühren.
»Eigentlich solltest du gar nichts spüren«, seine Stimme wurde gegen Ende des Satzes immer leiser.
»Tue ich aber. Sie sind doch der zuständige Arzt, oder täusche ich mich da etwa?«, fragte ich mit meiner Unschuldsstimme.
»Ja, natürlich«, er kam unsicher an mein Bett. Zögerlich streckte er die Hand nach mir aus und ich ergriff sie, noch bevor er die Gelegenheit hatte, sie zurückzuziehen. Ich wusste nicht, was in mich gefahren war, aber ich hatte immer noch so unglaublich viel Wut in mir und die musste ich irgendwie herauslassen. Für mich hätte keine bessere Gelegenheit kommen können.
In der Vision war ich auf einem OP-Tisch und lag gerade im Sterben, als er schrie: »Nein, nein, rettet sie!« Der Monitor des Messgerätes für die Herzfrequenz zeigte nur noch eine gerade Linie an und ein unfassbar lautes Piepsen schmerzte mir in den Ohren.
Das sollte schon reichen, auch wenn es nur kurze Zeit gedauert hatte. Obwohl es mich unheimliche Überwindung kostete, ihn loszulassen, zwang ich mich dazu.
Schweißperlen hatten sich auf seiner Stirn gebildet, seine Haut war jetzt so weiß wie die Wand und sein Atem ging unregelmäßig. Er starrte mich panisch an, wie um sich zu vergewissern, dass ich nicht gestorben war.
»Wir werden uns noch öfter sehen. Keine Sorge. Und passen Sie doch nächstes Mal besser auf, mit wem Sie spielen«, ich grinste ihn breit an und er stürmte aus dem Zimmer. Ich lehnte mich zurück und sah an die Decke. Manchmal war es vielleicht doch recht hilfreich, ein Monster zu sein.
Ich fragte mich, wie das weitergehen sollte. Lügen über Lügen, Eltern die mich gar nicht wirklich wollten und mit Fähigkeiten für ein ganzes Leben gestraft.
Ein leichtes Stechen machte sich in meinem Arm breit, anscheinend verloren die Schmerzmittel ihre Wirkung. Ich schaute zu meinem Verband und dann zu meiner Hand, mit der ich dem Arzt gerade gelehrt hatte, dass man nicht so mit mir umgehen konnte. Wie hatte ich überhaupt so schnell aufhören können? Wie hatte ich die Vision so schnell abbrechen können? Sonst war es ziemlich unmöglich, sich diesem Rausch zu entziehen. Vielleicht war ich ja wirklich besser geworden, nur wodurch mochte das ausgelöst worden sein?
Um realistisch zu bleiben: Ich war noch weit davon entfernt, meine Fähigkeiten unter Kontrolle zu haben. Aber immerhin war es ein Anfang.
Ich beobachtete die Uhr und ihre viel zu langsamen Zeiger. Die Zeit wollte einfach nicht vergehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit, was in Wirklichkeit nur eine halbe Stunde war, wurde die Tür geöffnet.
Meine Mutter kam zögerlich herein: »Wie fühlst du dich?«
»Die Schmerzen kommen langsam, aber es ist erträglich«, erwiderte ich und starrte weiterhin die Uhr an.
Sie stand unschlüssig am Ende des Bettes: »Es tut mir so leid.«
Nun sah ich sie an: »Das ist nicht deine Schuld, du hast mir ja geholfen.« Ich atmete tief durch: »Wo ist er jetzt?«
»Er schläft seinen Rausch aus«, sie blickte gen Boden.
Ich zog die Augenbrauen hoch: »Ist das dein Ernst?« Sie zuckte mit den Schultern und widmete immer noch dem Boden ihre volle Aufmerksamkeit. »Und, was jetzt? Willst du einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert?«, ich war fassungslos.
»Das wird nicht nochmal passieren, versprochen.«
Ich lachte und in dem Moment kam eine Krankenschwester herein: »Ich werde deiner Mutter alles bezüglich der Medikamente erklären.« Meine Adoptivmutter sah aus als wäre sie erleichtert, endlich von mir wegzukommen. Sie gingen auf die Tür zu.
»Warum macht das nicht der Arzt?«, fragte ich.
Die Krankenschwester sah mich ernst an: »Doktor Klag hat vorhin ohne ein Wort gekündigt.«
Die Tür wurde geschlossen und ich dachte an die Vision, die ich ihm vorhin beschert hatte. Seltsamer Zufall.
Ich stand kurze Zeit später auf und verließ das Zimmer, weil es mir zu langweilig wurde. Typischer Krankenhausgeruch stieg mir in die Nase - widerlich.
»Was machst du denn hier?«, meine Adoptivmutter kam mir entgegen.
»Ich werde behandelt wie eine Fünfjährige, ich bekomme nicht einmal gesagt, wann ich nach Hause kann.«
»Jetzt.«
»Na dann, gut. Gehen wir?«
»Willst du dich nicht noch umziehen?«
Ich blickte an mir herab: »Ich finde Krankenhauskleider stylisch.« Ich hätte alles gegeben, um so schnell wie möglich von hier wegzukommen.
Sie schüttelte den Kopf, drehte sich um und ging in Richtung Ausgang, woraufhin ich ihr folgte. Sie reichte mir meine Turnschuhe, in die ich dann schnell hineinschlüpfte. »Du gehst am Mittwoch das erste Mal in deine neue Schule«, meinte sie beiläufig, als wir am Auto waren und das Ganze klang eher wie ein viel zu langes und viel zu grässliches Machtwort.
Juhu: »Okay.«
Die Fahrt war ziemlich ruhig, im Radio lief nur eines dieser uralten Lieder, die ich hasste. Nach einer viertel Stunde bogen wir in unsere Einfahrt ein. Ich mochte das Haus, jedoch fühlte es sich nicht nach einem Zuhause an.
»Du hast bestimmt Hunger«, meine Mutter schloss die Tür auf.
»Es geht«, log ich.
»Ich kann dir nicht viel anbieten, ich war noch nicht richtig einkaufen.«
»Eine Tiefkühlpizza reicht völlig aus«, von denen hatten wir eigentlich immer reichlich.
»Gut, ich bringe sie dir dann hoch, und wenn du bei irgendetwas Hilfe brauchst, sag mir einfach Bescheid.«
Ich nickte und ging nach oben. Doch bevor ich die Schwelle zu meinem Zimmer auch nur betreten konnte, wurde die Schlafzimmertür aufgerissen und mein Adoptivvater stand mir gegenüber. Er betrachtete meinen Arm, dann fing er an zu lachen. Ich hätte ihm am liebsten das dumme Grinsen aus dem Gesicht geschlagen, doch ich tat es nicht.
Auf der einen Seite wegen meiner Verletzungen und auf der anderen wegen meiner Mutter; sie gab sich wirklich Mühe und das wusste ich zu schätzen.
Mit einem Grummeln ging er an mir vorbei nach unten und dabei sah ich seine riesige Beule am Hinterkopf. Ich lächelte zufrieden. Geschah ihm recht.
Ganze zehn Minuten war ich damit beschäftigt, aus dem Krankenhaushemd herauszukommen und noch länger dauerte es, mir wieder etwas anzuziehen.
Ich unterdrückte ein Stöhnen, als es an der Tür klopfte: »Ja?«
Meine Adoptivmutter stellte mir den Teller auf den Schreibtisch: »Umziehen klappt also.«
»Dauert nur länger«, ergänzte ich. Aber sie hörte es entweder nicht, oder tat so, als ob ich nichts gesagt hätte.
»Wenn du noch etwas brauchst, ruf einfach. Ich bin im Wohnzimmer.« Danach schloss sie die Tür wieder und ich begann zu essen.
Am Mittwoch sollte ich also schon wieder in die neue Schule. Wie ich das hasste. Ich würde sowieso wie immer der Außenseiter sein. Aber das war ich ja schon gewohnt.
Während dem Kauen fuhr ich meinen Laptop hoch: Samstag 19:04 Sie haben neue Nachrichten. Das war gestern.
Nelli hatte geschrieben: Und wie ist es, Süße? Warum meldest du dich nicht?
Ich tippte eine Nachricht ein: War im Krankenhaus, mein sogenannter Vater hat mir den Arm gebrochen, aber das erzähle ich dir wann anders.
Es kam sofort eine Antwort zurück: Hast du es ihm heimgezahlt?
Nein.
Sollen wir dich holen?
Nein. Damit ging ich offline.
Ich rief die Seiten von neulich über den Nightmare, der seine Kräfte kontrollieren konnte, auf. Wenn es ihn wirklich gab und ich zu ihm Kontakt aufnehmen könnte, wäre das vielleicht die Lösung all meiner Probleme.
Ich suchte alle möglichen Webseiten nach ihm ab, aber auf keiner wurde genauer auf Steve Wilson eingegangen. Mit einem Seufzer schaltete ich den Laptop aus. Ich öffnete meine Zimmertür. Fernsehgeräusche drangen an mein Ohr und ich entschied mich gegen den Plan, mir etwas zum Trinken zu holen. Ich wollte jetzt niemanden stören.
Deswegen öffnete ich eine Tür, in der Hoffnung, es wäre das Bad, doch es war nur irgendeine alte Treppe, die, so wie es aussah, zum Dachboden führte. Mit der nächsten hatte ich dann wieder mehr Glück. Ein riesiges Bad mit grauen Fliesen erstreckte sich vor mir. Die Badewanne, Dusche und die Toilette waren weiß. Das Waschbecken ebenfalls, der Wasserhahn allerdings wieder grau. Ich sah mich im silbernen Spiegel an. Meine helle Haut sah blasser aus als sonst, meine Augenringe tiefer als normal und meine schwarzen Haare waren ein einziges Chaos.
Ich löste vorsichtig den Verband, mein Arm war komplett blau. Vorsichtig tippte ich ihn an und biss gleichzeitig die Zähne zusammen. Das würde ich noch lange spüren.
Ich kämmte meine Haare und putzte meine Zähne. Den Rest ließ ich gerade so wie er war. Als ich in mein Zimmer zurückging, brannte das Licht, jedoch hatte ich es nicht angelassen. Ich lugte vorsichtig in den Raum, aber er war leer. Alles war an seinem Platz, merkwürdig.
»Suchst du etwas?«, mein Adoptivvater stand direkt hinter mir.
»Was willst du?«
Er ging in mein Zimmer: »Dich auf jeden Fall nicht unter meinem Dach.« Ich schnaubte und verfolgte jede einzelne seiner Bewegungen mit eisigem Blick. Er sprach weiter: »Du wirst gleich am Mittwoch in der Schule das tun, was du immer machst. Mach es, oder ich werde dafür sorgen, dass du uns verlässt.«
»Und was, wenn nicht? Was willst du machen, mich umbringen?«
»Guter Vorschlag, aber nein. Ich werde dafür sorgen, dass du uns freiwillig verlässt.« Ich starrte ihn an, ich hatte noch nie so einen Hass auf eine Person empfunden.
»Du weißt schon, dass ich dir genauso drohen kann, oder?«
Er lachte auf: »Du bist ein Kind, außerdem habe ich einen Schutz vor dir.«
»Ich rede auch nicht von dir.«
Er runzelte die Stirn und fing dann an den Kopf zu schütteln: »Das würdest du niemals machen, du liebst sie doch wie deine eigene Mutter!«
»Ich mache es nicht freiwillig, aber wenn du mich dazu zwingst, dann schon. Dann muss ich sie verletzen.« Er kam einen Schritt auf mich zu und ich lächelte: »Du hast im Moment keinen Schutzanzug an, Dad.« Er stürmte aus dem Zimmer und schmiss die Tür hinter sich mit voller Wucht zu.
Ich nahm auf meinem Schreibtischstuhl Platz und stützte meinen Kopf mit der nicht eingegipsten Hand ab. Wie sollte ich ihr wehtun? Sie war der einzige Mensch, der mich liebte. Der Einzige, der mich zu schätzen wusste. Eine einzelne Träne lief über meine Wange und ich atmete tief durch. Es wird alles gut; vielleicht wurde dieser Satz ja wahr, wenn man ihn nur oft genug sagte.
Du schaffst das. Monster. Ich schüttelte den Kopf.
Ein stechender Schmerz erfüllte meinen rechten Arm und ich rannte ins Bad. Dort ließ ich eiskaltes Wasser darüber laufen, was gut tat. Ich sah erneut in den Spiegel, so würde ich auf keinen Fall in die Schule gehen.
Ich entschloss mich dazu, früh schlafen zu gehen, aber es war eine unruhige Nacht, denn meine Arme schmerzten und ich wachte deshalb andauernd auf. Es war sieben Uhr, als ich das Herumwälzen endlich aufgab.
Ich griff sofort nach meinen Tabletten und versuchte sie ohne Wasser zu schlucken, was aber nicht gut klappte. Also ging ich in die Küche und versuchte dabei niemanden aufzuwecken. Danach setzte ich mich an meinen Schreibtisch und schrieb eine Liste: Schminke.
Ich musste über mich selbst lachen, weil ich mich nicht auskannte. Shampoo, Deo, Blöcke und Kaugummis. Ich hatte sowieso die Hälfte vergessen. Im Schneckentempo zog ich mich um und spielte dann eine App auf meinem Handy bei der man Auto fahren musste. Ich war so in das Spiel vertieft, dass ich gar nicht bemerkte, wie die Zeit verging. Es klopfte an der Tür und ich blickte zur Uhr, es war neun.
»Ja?«
»Guten Morgen, willst du frühstücken?«, meine Mutter streckte den Kopf ins Zimmer herein.
»Ja, und können wir danach in einen Drogeriemarkt?«
Sie zog die Augenbrauen hoch: »Du willst in einen Drogeriemarkt?«
Ich zuckte mit den Schultern: »Ist das etwas Schlimmes?«
Sie lachte: »Nein, natürlich nicht. Ich rufe dich, wenn das Frühstück fertig ist.«
Kurze Zeit später saß ich dann auch schon am Esstisch, mein Vater allerdings auch.


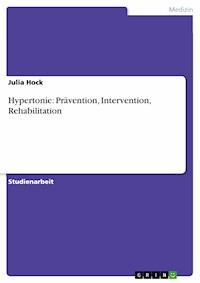















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










