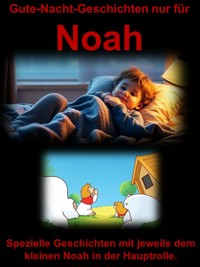9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der Friedhofsgärtner
- Sprache: Deutsch
Auf Friedhofsgärtner Konrad Leisegang wartet wieder eine Leiche – eine, die nicht auf seinen Friedhof gehört: Zu Füßen einer imposanten Bronzeskulptur liegt der Tote, der einem Stromschlag zum Opfer fiel. Er war ehemals Besitzer eines bekannten Kölner Bordells. Leisegang, seinem Assistenten Martin und dem befreundeten Kommissar Heribert Rehbein bleibt kaum Zeit, die Spuren zu sichern, da gibt es bereits die nächste Leiche, erneut ein Mann, erdrosselt und in ein steinernes Tor hineingezwängt. Während Martin schon einen Serientäter wittert, tappt die Polizei erst einmal im Dunkeln. Schließlich stellt sich heraus, dass der zweite Tote ebenfalls Kompagnon im Bordell war. Es wird klar: Die Spuren reichen in die Vergangenheit zurück, zu einem spektakulären Kunstraub in den 90er-Jahren. Und der Mörder könnte erneut zuschlagen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Das Buch
Als ihn die Sterne, die er gesehen hatte, nicht mehr blendeten, bemerkte auch Konrad den Schatten jenseits des Rondells. Der war so wuchtig wie Böcklers Grabstein. Martin stach der Hafer. Er duckte sich und schlich auf das Steintor-Denkmal in der Mitte des Rondells zu. Er war sich vollkommen sicher, den Mörder gesehen zu haben und ihn nun überführen und an weiteren Morden hindern zu müssen. Wie er das mit elf Jahren und kaum vierzig Kilogramm Kampfgewicht anstellen sollte, fragte er sich nicht. Als Hochbegabter verließ er sich darauf, dass ihm Problemlösungen schneller zur Verfügung standen als die mit den Lösungen verbundenen Probleme. Konrad, der Überrumpelte, zögerte. Er befürchtete, Martin in Gefahr zu bringen, wenn er ihm folgte. Und dann … Was war das? Ein weiterer Schatten, klein und schnell. Im Hintergrund, jenseits des Rondells.
Martin verharrte. Direkt neben dem Denkmalsblock, in dessen Öffnung die zweite Leiche gesteckt hatte. Der kleinere Schatten wieselte dort im Zickzack, streifte das Rondell, wich zurück. Konrad hörte in der Echokammer seiner Visionen zwei Schüsse, sah zwei Tote: Martin und sich. Verschwindet, verschwindet, verschwindet, dachte er. Ein Stoßgebet auf geweihtem Boden.
Der Autor
Thomas Krüger, geboren 1962 in Ostwestfalen, arbeitete zunächst als Journalist für Tageszeitungen und Magazine. Heute ist er Hörbuch- und Kinderbuchverleger, Autor von Kriminalromanen, Kinderbüchern (Jo Raketen-Po) und zahllosen Sonetten – u. a. an Donald Duck. Thomas Krüger lebt mit seiner Familie in Bergisch Gladbach bei Köln.
Lieferbare Titel
978-3-453-44198-9 – Es rappelt in der Kiste
THOMAS KRÜGER
NIRGENDS STIRBT ES SICH SCHÖNER
Der Friedhofsgärtner ermittelt
KRIMINALROMAN
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 01/2026
Copyright © by Thomas Krüger
Copyright © 2026 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Michelle Stöger
Umschlaggestaltung: © zero-media.net, unter Verwendung
von FinePic®, München
Karte: © Verena Krüger
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30675-5V001
www.heyne.de
für Simone, Niklas und Verena Die geschäftigeHektik des Eichhörnchens zwischen letztem Laub weiß um die drohende Verknappung der Lebensenergie.P.C.
BLUT, SCHWEISS & RUBINE
Zwei Uhr morgens. Er warf immer wieder einen Blick auf die Uhr. Die Nervosität ließ sich nicht abschütteln. Wo blieben sie nur? Laut ihrem Plan hätten sie schon vor einer Stunde beginnen sollen. Die Alarmsysteme waren deaktiviert, ebenso die Laser-Lichtschranken. Dafür hatte er gesorgt, denn ihnen war ein Fehler unterlaufen, den er zum Glück hatte ausbügeln können. Nun ja: Er war ein Trickser, wie er im Buche stand, und jetzt lächelte er in der Dunkelheit, die ihn umgab.
Es war der 5. Februar 1995. Ein Sonntag. Von draußen drang nur schwaches, fahles Licht durch das Panzerglas der Fenster. Es umhüllte, was man hier in den Räumen allenfalls erahnen konnte. Ein bleicher Schimmer lag über allem. Vielleicht wegen des Schnees, der die Straßenbeleuchtung vor dem Gebäude reflektierte.
Anfang Februar herrschte in Köln üblicherweise Matschwetter. In dieser Nacht allerdings zog ein gewaltiger Schneesturm über die Stadt hinweg. Und der Rhein hatte gerade den Zenit eines Jahrhunderthochwassers überschritten. Das Wasser endete nur wenige Meter vor dem Museum.
Hier drinnen war es warm. Die Räume waren riesig, wie mächtige Schatzkammern, quadratisch und passend zu diesem wuchtigen Gebäude neben dem Dom. Zwischen den Ausstellungen, die hier alle paar Monate stattfanden, wirkten die Räume nüchtern mit ihren schlichten weißen Wänden. Mächtige Stützpfeiler gaben den Decken Halt. Ein rechtwinkliger Grundriss, passend zur Sterilität moderner Kunst. Dann und wann allerdings – es kam auf die Ausstellung an –, trat das Schlichte zurück hinter den opulenten Inhalt. Dann leuchteten die Glasvitrinen, die Auslagen mit kostbaren Ausstellungsgegenständen aus goldenen Zeitaltern.
Gegenstände war ein viel zu tristes Wort für die Schätze, die ihn umgaben.
Seit dem Umbau vor drei Jahren wirkte in den Räumen hier alles etwas unheilig. Und um diese Stunde herum auch unheimlich. Ja, das fahle Licht, das durch die Fenster fiel und sich hier drinnen nicht gänzlich verlor. Es schimmerte nach. Aber ganz und gar nicht bleich, da hatte er sich geirrt. Er musste seinen ersten Eindruck korrigieren. Das Licht vom Roncalliplatz, von den Laternen an der Straße vor dem Gebäude, schien sich hier drinnen aufzuwärmen. Es verwandelte, entzündete sich. Es war nur eine Andeutung, die vielleicht nur er wahrnahm und vielleicht nur, weil er jetzt darüber nachdachte. In den Räumen hier, das wusste er, gab es Dinge, die geradezu süchtig nach Licht waren. Und das, was sie mit dem Licht anstellten, wirkte in diesem Moment … einladend?
Wieder lächelte er.
Die Dunkelheit lächelte zurück.
Brillanten, Rubine, Smaragde, Saphire. Die Siegelringe. Einige Bischofs- und Kardinalsringe. Breite Amtsketten, viele Gemmen, Kelche, kostbare Vortragekreuze. Monstranzen, mit Juwelen besetzt, eingefügt in filigran gearbeitete, Sonnenstrahlen nachbildende Gefüge aus Gold. Zahllose Goldschmiedearbeiten, Silberaltärchen, Reliquiare, Schmuckkästen, Votivgaben, liturgische Lanzen aus dem Ritus der orthodoxen Ostkirche: Kirchenschätze aus aller Welt, sehr viele davon auch aus der Kölner Domschatzkammer. Die Ausstellung war seit Wochen ein Publikumsmagnet. Der Schmuck in diesen Räumen war sicher mehrere Hundert Millionen D-Mark wert.
Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles, dachte er.
Es war jetzt zehn Minuten nach zwei, und plötzlich war da im Dunkel so etwas wie eine Schwingung? Dann zuckte ein Blitz durch den Raum. Ein Licht, das nur einmal kurz aufblinkte.
Das Signal.
Jetzt, dachte er. Es begann. Sie machten sich ans Werk, ganz in Schwarz. Ohne Taschenlampen, Stablampen oder Ähnliches. Sie benutzten Nachtsichtgeräte. Es war faszinierend, mit welcher Präzision und Geschwindigkeit sie vorgingen: Schemen, die mit eingeübten Bewegungen, genau nach Plan, die Glasvitrinen öffneten. Kein Splittern, kein Krachen. Sie waren Profis. Für das, was sie in diesen Minuten zeigten, war die Beschreibung nach den Plänen des Tricksers sicher nicht ausreichend. Aber dann …
Er erschrak:
Ein Aufblitzen, ein Keuchen, ein zusammenbrechender Körper.
Plötzlich lief alles aus dem Ruder. Das hatte er nicht erwartet. Schüsse fielen. Glas splitterte. Taschenlampen leuchteten. Weitere Körper kollabierten. Innerhalb von zehn Minuten entwickelte sich etwas, das noch lange nachwirken sollte.
Er geriet mitten hinein in den Sog des Geschehens …
RUHE IN FRIEDEN
Dreißig Jahre später
Der Mai war längst gekommen – nun endlich auch mit dem passenden Wetter. Am 11., einem Montag, hatte Konrad das schöne Gefühl von Frieden und glühender Emsigkeit, das sich hier, auf dem Melatenfriedhof, immer irgendwann im Frühling einstellte. In diesem Jahr hatte es lange gedauert. März und April hatten zwar sonnige Abschnitte gehabt, aber alles in allem war das Frühjahr verregnet gewesen. Der Boden war noch immer vermatscht, und die Dürregebiete der Welt blickten voller Neid auf Köln. Doch ab jetzt würde auch am Rhein dauerhaft die Sonne scheinen. Kaum jemand hatte ein besseres Gespür für die Entwicklungen des Wetters als der Friedhofsgärtner Konrad Leisegang.
Er befand sich am Rand einer Wiese im westlichen Teil Melatens. Die Sense, mit der er Gras schneiden wollte, hielt er geschultert. Konrad liebte dieses alte Ding, auch wenn seine Kollegen mit modernen Geräten wie Motorsensen und Aufsitzmähern arbeiteten. Bei seinem Chef, Arno Schorn, dem obersten Gartenmeister von Melaten, hatte Konrad einen Stein im Brett. Bei einigen anderen der auf Melaten arbeitenden Gärtner eher nicht.
»In welchem Jahrhundert lebst du eigentlich, Leisegang?«, hatte sein Kollege Gandulf Kantmann gespottet, als Konrad mit der Sense vom Betriebshof loszog.
»Immer in einem anderen als du«, hatte Konrad geantwortet.
Solche Geplänkel nährten den Konflikt zwischen den beiden.
Jetzt stand Konrad da und blickte sich um. Das scharfe Sensenblatt wies mit der Spitze zu Boden, und Konrad sah ein bisschen aus wie der Schnitter, der ja irgendwie zu einem Friedhof passte. Zu Melaten ganz besonders, denn das Wahrzeichen Melatens war das verwitternde Denkmal des Sensenmanns: die lebensgroße Figur eines aufrecht stehenden Gerippes, in ein Leichentuch gewickelt, das die Knochen umhüllte und den grinsenden Totenschädel in der Art eines Kopftuchs bedeckte – alles aus Sandstein natürlich. Das linke Knochenbein hatte der makabre Geselle vorgestellt, als handelte es sich bei ihm um eine schöne Dame, die ihr geschlitztes Kleid für eine kokette Geste nutzte.
Konrads rechte Hand ruhte in der Hosentasche. Er hatte am Morgen überlegt, ob er kurze oder lange Hosen wählen sollte. Seine grüne Arbeitsmontur ließ beides zu. Aber im Alter von fast 39 Jahren fühlte er sich in kurzen Hosen dann doch manchmal seltsam. Mit seinem schlaksigen Körper, dem schwarzen Wuschelkopf und den neugierigen Eichhörnchenaugen waren kurze Hosen womöglich das entscheidende Zuviel an Jugendlichkeit. Außerdem trug ja schon Martin kurze Hosen – an allen Tagen zumindest, an denen die Temperatur oberhalb des Gefrierpunktes lag.
Martin, 11 Jahre alt, hatte mal scherzhaft gemeint, dass Konrad in einem früheren Leben vielleicht ein Frosch gewesen war. Damit hatte er sich ebenso auf das Grün von Konrads Montur wie auf Konrads Fähigkeiten zur Wettervorhersage bezogen.
Martin verbrachte die Nachmittage oft bei Konrad auf dem Friedhof. Er war der Sohn von Amalia Schmitz, 36, Violinvirtuosin und Erste Geige des WDR-Sinfonieorchesters. Konrad hatte sie vor einem halben Jahr kennen und seitdem so sehr lieben gelernt, dass ihn auch Martins bisweilen nervige und altkluge Art nicht abschreckte.
Martin und er teilten immerhin eine gemeinsame Vorliebe: Sie ermittelten in kniffligen Kriminalfällen. Manchmal fanden sich Knochen bei Grabauflassungen, die von rätselhaften Todesumständen zeugten. Dann versuchten sie, diese Umstände zu klären.
Martin wünschte sich nichts sehnlicher, als später zusammen mit Konrad ein Detektivbüro zu gründen:
Leise & Verschmitzt – die Detektei für knifflige Fälle.
Als 11-jähriger Höchstbegabter, Schüler des nahen Apostel-Gymnasiums, zweifacher Klassen-Überspringer und sehr naturwissenschaftlicher Mensch fühlte sich Martin berufen für ein Leben als Sherlock Holmes. Konrad billigte er die Rolle des Dr. Watson zu.
Als Konrad so ins Rund blickte, musste er an Martin denken, an den Spruch mit dem Frosch und des Frosches wegen an Pläne, die er sich immer wieder zur Verschönerung des Friedhofs machte.
Eigentlich, dachte er, wäre es doch ganz reizend, wenn man auf Melaten einen Teich mit Fröschen, Kaulquappen, Schilf und so weiter anlegte. Um die Biodiversität des Grüns zu stärken. In den vergangenen Jahren hatte sich der Friedhof mehr und mehr in ein Biotop verwandelt. Hier und dort waren mit den Ruhegärten Wildblüten- und Kräuterzonen angelegt worden.
Einen Teich aber, nicht bloß eine winzige Wasserstelle, gab es noch nicht.
Ob er mal mit Schorn darüber sprechen sollte? Wenn der Frühling durchstartete, an Tagen wie diesen, dann war auch Schorn für Neues empfänglich. So ein Teich musste gar nicht besonders groß sein: ein Weiher mit Schilf am Rand, flach, umstanden von Kalmus, Berle, Pampagras und Mädchenauge vielleicht. Und dann der Frühlingssonnenschein …
Ach, was würde es dort summen. Platz für ein kleines Wasserparadies wäre zum Beispiel im nordwestlichen Teil Melatens, wo es Rasenflächen mit nur wenigen Grabfluren gab.
Konrad hatte den Kopf voller Libellen, die in schönstem Röhricht herumsausten, als er am Montagmorgen mit der Arbeit begann. Zunächst Gras mähen, gegen Mittag dann eine neue, gestiftete Bank aufstellen. Und nach dem Bankaufstellen stand am Nachmittag auch noch die Einweihung des neuen Kolumbariums an. Schorn hatte Konrad zur Teilnahme verdonnert. Wahrscheinlich gab es Alkohol, und Gandulf Kantmann würde sich während der Feier maximal viele Kölsch reinkippen und auffällig werden.
Schlechte Aussichten.
Apropos Alkohol: Gegen acht Uhr morgens, Konrad mähte seit einer Stunde, trabten Marlies von Törne, Gisbert Schwaderlapp und weitere Mitglieder eines Trupps Ü80-Senioren aus dem nahe gelegenen Wohnstift Sankt Ursula herbei. Sie erschienen täglich unter Marlies’ Führung hier auf Melaten, Nordic-walkend oder um ihren Qigong-Übungen auf einer ruhigen Wiese des Friedhofs nachzugehen. Heute bewegten sie sich mit solchem Elan, dass Konrad sich fragte, ob da Alkohol im Spiel war. Gisbert, Norbert Podolski und Gerd von Hoppenstedt waren für gewisse Tropfen durchaus anfällig. Gisbert guckte vor allem dann zu tief ins Glas, wenn er bei seiner Angebeteten Marlies mal wieder abgeblitzt war.
Überhaupt war Gisberts Interesse für Qigong nur die Tarnung für sein Interesse an Marlies. Und weil er bei Marlies im vergangenen Jahr nicht weitergekommen war, hatte er nun, im Aufblühen des Frühlings, die Idee gehabt, es mal mit Eurythmie zu versuchen.
Er hatte auch die Gruppe dafür interessieren können. Es machte ja Spaß, Worte zu tanzen. Im eurythmischen System entsprach jedem Laut, jedem Buchstaben eine Bewegungsfolge. »Ist ganz nah dran am Leben«, hatte Gisbert gesagt. Und nun begann er auf jenem Teil der Wiese, den Konrad bereits gemäht hatte, den Namen MARLIES zu tanzen.
Heidewitzka: Gisbert ging diese Buchstabenfiguren sehr schwungvoll an. Das M wurde eine knackig-rock’n’rollige Annäherung an eine Festung, die sich beim A womöglich wunderte, ob sie gestürmt oder umzingelt werden sollte. Beim R inszenierte Gisbert eine Art Rollbewegung, die den A-Eindruck unbestimmt verwischte. Dies setzte sich im L fort, wo aus der Rollbewegung die einer Dampflok wurde, aus deren Schornstein – den Gisbert nicht besaß, aber er schnaufte zum Gotterbarmen – Wolken quollen. Ab dem I dann war Marlies raus, weil Gisbert leider zu doof war für die Figur oder vielleicht auch zu arthritisch, denn das Heben des rechten Arms, der wie eine Rakete hätte in die Höhe gehen sollen, blieb in einem verunglückten Hitlergruß stecken.
Da machte Marlies nicht mit. Gisbert verfärbte sich bis weit über die Ermüdungsröte hinaus. Sie brachen ab und trabten davon.
Minuten später erblickte Konrad Paul und Bernadette. Die beiden Obdachlosen lebten zusammen mit der etwas wunderlichen Oma Gitti auf Melaten, unweit der Fröbelinger Straße, in einem Mauerwinkel neben dem Rechtsmedizinischen Institut und dem alten Jüdischen Friedhof von Ehrenfeld, der direkt an Melaten und das Institut grenzte. Die Fröbelinger, wie Konrad sie gern nannte, durften auch nachts auf dem Friedhof bleiben. Sie wurden geduldet und auch beschützt von Konrads Chef Arno Schorn.
Paul und Bernadette schlenderten wie frisch Verliebte über eine nahe Allee aus Bergahorn, Rosskastanien, Blutbuchen und alten Platanen. Paul, etwas kurz geraten, leichter Bierbauch, graublondes Strubbelhaar, trug als alter Punker einen Ohrring. Bernadette war stämmig, rothaarig und von brünhildener Wucht – aber seit mindestens 40 Jahren waren die beiden unzertrennlich, und Gezänk war die Grundsubstanz ihrer Zärtlichkeiten.
»Holla!«, rief Konrad, das Sensen unterbrechend, als die beiden in Hörweite waren: »Gibt’s was zu feiern? Wo ist Oma?«
Paul und Bernadette guckten sich an. Dann lachten sie.
»Verliebt!«, rief Bernadette. Paul grinste, wurde rot. Bernadettes Gesicht glich ohnehin einem Apfel.
Konrad runzelte die Stirn.
»Verliebt? Oma Gitti? In wen?«
»Wissen wir nicht. Aber wir haben ’ne Vermutung«, sagte Paul mit rasselnder Stimme. »Wir machen uns aber auch ’n bisschen Sorgen.«
»Erzählt mal.« Konrad war neugierig, stützte sich auf die Sense: »Verliebt in jemanden, der jetzt mit euch in Fröbelingen lebt?«
»Neee!«, rief Bernadette. »So leicht lassen wir keinen bei uns rein. Aber Oma singt jetzt dauernd …«
Paul verdrehte die Augen.
»Vom Fliegen, von Engeln, von bunten Farben. Kennst ja Oma.«
Ja, so kannte Konrad Oma Gitti. Bernadette wurde nun etwas ernster:
»Wir glauben, Oma singt für einen von den schweren Jungs vom neuen Pfarrer.«
»Und da singt sie vom Fliegen? Versteh ich nicht.«
»Wir auch nich«, sagte Paul.
»Und was genau meint ihr mit schwere Jungs?«
»Na ja …«, begann Paul. Und Bernadette fuhr fort:
»Die Verbrecher, die der neue Pfarrer da immer bei sich hat. Mörder und Kehlenaufschlitzer sind das.«
»Hey, Moment mal«, sagte Konrad. »Das wisst ihr doch gar nicht. Der neue Pfarrer, also Pfarrer Braun, der ist so ein Typ wie Pfarrer Uermer. Der versucht, Gestrauchelten zu helfen. Ich habe gehört, der Braun führt da ganz ordnungsgemäß eine Resozialisierungsmaßnahme durch.«
»Ja, gut«, sagte Paul. »Aber wir haben eben auch gehört, dass einer von denen ’ne Ordensschwester abgemurkst hat. Kann ja sein, dass die schweren Jungs hier aufm Friedhof jetz lernen solln, dass man eben keinen aufn Friedhof bringt …«
»Aber wenn der ’ne Ordensschwester umgebracht hat«, sagte Bernadette, »dann is Oma, die ja ’n Engel is und mehr als ’ne Ordensschwester, vielleicht in Gefahr.«
Konrad war verwirrt. Pfarrer Uermer kannte er gut. Uermer hatte viel auf Melaten zu tun gehabt, war aber für ein Jahr in ein Kloster gegangen. In seiner Abwesenheit war Pfarrer Braun gekommen, auf Uermers Wunsch. Braun hatte den sozialen Ansatz der Arbeiten Uermers übernommen. Er hatte seit vielen Jahren Resozialisierungsmaßnahmen im Gefängnis von Ossendorf begleitet. Einige davon führte er hier nun weiter.
Mörder also …
Konrad seufzte.
»Na ja«, sagte er, »aber Oma Gitti würde sich doch niemals jemandem zuwenden, dessen Herz nicht vollkommen rein ist?«
Zögern.
»Oder?«
Paul brummelte was Unverständliches. Bernadette meinte: »Reines Herz, ich weiß nich. Vielleicht kann man jemanden auch mit ’nem reinen Herzen abmurksen? Passiert schon viel Komisches inner Welt.«
»Ja, aber kommt«, sagte Konrad. »Oma ist verliebt. In wen, das wissen wir nicht, weil Oma voller Geheimnisse ist. Möglicherweise ist es jemand, der an diesem Resozialisierungsprojekt teilnimmt. Ich finde ja, diese Leute verdienen Unterstützung. Wer in solch ein Programm aufgenommen wird, der hat die ersten Hürden zum Wiedereintritt in die Gesellschaft schon genommen. Gebt den schweren Jungs also eine Chance.«
Schweigen.
»Was ist?«, sagte Konrad nach einer Weile.
»Die hätten auch dich nehmen können«, sagte Bernadette.
»Wofür?«
»Für dieses … Resaziolidingsbums. Du bist auch so ’n Pfarrer.«
Das kam von Paul, der Bernadettes Gedanken gelesen hatte.
Sie lachten, flachsten noch ein bisschen über Oma Gitti, dann zogen die Fröbelinger weiter. Konrad widmete sich nun der Bank, die vom Förderverein des Friedhofs gestiftet worden war und nah der Gedenkstelle für die Aidshilfe Köln aufgestellt werden sollte. Anschließend streifte er durchs Grün, führte Kartierungsarbeiten durch und suchte nach Nestern brütender Singvögel, damit man dort in den kommenden Wochen auf Schnittarbeiten verzichtete.
Am Nachmittag kam Martin aus der Schule, in grünen kurzen Hosen und grünem T-Shirt, als hätte er sich für einen Praktikumstag beim Grünflächenamt eingekleidet. Er warf seinen Rucksack mit den Schulsachen hinter einen Grabstein und hielt als professioneller Neunmalkluger gleich einen Vortrag zum Brutverhalten der Passeri auf Melaten.
»Der was?«
»Passeri. Singvögel. Ist Lateinisch.«
»Ach was. Gib nicht so an, Martin.«
Martin grinste. Da er während des Dozierens gleich auch Feldforschung betrieb, warnte er Konrad davor, einem Wintergoldhähnchen-Gelege zu nahe zu kommen, das sich direkt neben Konrad in einer Gruppe naher Fichten befand.
»Der kleinste Vogel Europas. Regulus regulus. Wiegt kaum 6 Gramm und legt manchmal mehr als 10 Eier. Da sollte man glauben, der Winzling verbraucht sich körperlich komplett für seine Eier. Hey, das wär mal witzig. Der Vogel legt Eier, bis er verschwunden ist. Und dann … 10 neue Vögel. Wahnsinn.«
»Ja, Wahnsinn«, sagte Konrad. »Wie hast du mich eigentlich gefunden?«
»Och«, sagte Martin, »ich kann dich … piepsen hören.«
»Martin?«
»Du hast mir neulich mal deinen Standort gegeben. Also …«
»Auf dem Smartphone? Du trackst mich?«
Martin nickte. Grinste.
»Du kommst in die Hölle.«
»Das will ich verhindern, indem ich mich brav dem Naturschutz widme.« Martin hob die Schwurhand. »Ich behandle deinen Standort vertraulich. Aber wenn ich dich tracken kann, spar ich Zeit, dich zu finden. Ist praktisch.«
Konrad schüttelte den Kopf. Und dann tauchte Arno Schorn auf. Er näherte sich in weißem Kugelbauch-Hemd und schwarzen Hosen und wies auf seine Armbanduhr.
»14 Uhr 30. Konrad, es ist Zeit.«
Konrad erinnerte sich. In einer halben Stunde würde die Oberbürgermeisterin das neue Kolumbarium im kernsanierten Gebäude der alten Trauerhalle eröffnen. Die lag auf der Mittelachse des Friedhofs, der sogenannten Millionenallee, mit den größten und prächtigsten Gräbern Melatens.
Die Gäste waren handverlesen. Eine Abordnung von Leuten im Dienst des Grünflächenamts – die auf Melaten werktätige Bevölkerung also – sollte ebenfalls dabei sein. In Arbeitskleidung. Das war eine Idee der OB gewesen, und weil Schorn in trotzigen Momenten der Meinung war, dass man manche der Ideen von oben besser auf Distanz hielt, trug er Anzughose und Hemd und wirkte recht feierlich. Konrad aber war ganz froh, sich nicht noch umziehen zu müssen.
Schorn beäugte Martin.
»Kannst mitkommen«, sagte er, bevor er weitereilte, die anderen der zur Feierstunde verdonnerten Gärtner an ihren Termin zu erinnern. »Wenn die das Kolumbarium nur mit alten Geldsäcken einweihen, sieht’s da so verwelkt aus.«
»Verstehe«, sagte Martin. »Ich bin der frische Grabschmuck. Wie gut, dass ich ganz in Grün bin.«
Schorn zog lachend davon.
Das Kolumbarium war die jüngste Zierde des Friedhofs. Die ehemalige Trauerhalle, nicht sehr groß und im neoromanischen Stil Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, hatte Jahrzehnte des Verfalls hinter sich. Fast wäre sie dem Abriss zum Opfer gefallen. Doch die Stadt hatte sich aufgerafft, und nun erstrahlte das Gebäude in neuem Glanz. Das Cremeweiß der Fassade, das Braun des Sockels und der Ockerton der ornamentierten Säulen an der Vorderseite harmonierten ganz prächtig miteinander. Diese Säulen gehörten zu einem von Rundbögen getragenen, schmalen Portikus, der dem Eingang so etwas wie einen Regenschutz gab. Hinter der Eichenholztür des Eingangs lag ein langgestreckter Raum, einem kleinen Kirchenraum nachempfunden, in dem über die kommenden Jahre 1000 Urnen in 500 Urnenfächern Platz haben würden – untergebracht in wuchtigen, mit Bronzeplatten verkleideten Blöcken hoher Urnenschränke.
Farben und Licht im Kolumbarium erinnerten an ein honigfarben ausgeleuchtetes Juweliergeschäft. Denn die Urnen, die dort einmal ruhen sollten, wären ja auch, auf gewisse Weise, Juwelen: Kostbarkeiten für diejenigen, die um ihre Toten trauerten.
Als Konrad und Martin erschienen, stand die Oberbürgermeisterin vor den Säulen des Portikus an einem Pult mit Mikrofon. Hinter ihr, noch mit Absperrband versehen wie ein Tatort, das zu eröffnende Gebäude. Auf der Millionenallee davor hatten sich Politik und Lokalprominenz versammelt. Dazu der Stadtdechant Wilhelm Hennes, Repräsentant des katholischen Kölns, neben seiner evangelischen Kollegin, der Superintendentin Miriam Thies-Müsli. Von der örtlichen Geschäftswelt, die mit zahlreichen Spenden zur Finanzierung der Sanierung beigetragen hatte, waren anwesend: Annie Stüssges vom nahe gelegenen Supermarkt, Kurt Dröger von der Drogerie Die Drögerie, der Buchhändler Lothar Herzog, Florian Cremers aus dem Blumen-Paradies und Roswitha Mehring vom Café Ruhepol – allesamt Dürener Straße. Es hatte schon ein bisschen Sekt und Kölsch gegeben. Für Martin gab es ein improvisiertes Glas Orangensaft.
Mit einigen Minuten Verspätung klopfte die Oberbürgermeisterin an ihr Mikrofon, und die Menge verstummte. Die Oberbürgermeisterin hielt eine aus Floskeln bestehende Rede, und Konrad und Martin entflohen in eigene geistige Welten, betrachteten die im Licht taumelnden Insekten und die in leichten Sektwolken schwebenden Gäste. Martin betrachtete insbesondere die dicke Taube, die sich auf die Regenrinne am Rand des auch den Portikus überdeckenden Walmdachs gesetzt hatte und sich dort mit ihrem dicken Hintern hin und her drehte. Direkt oberhalb der Oberbürgermeisterin.
Es wurde dann doch noch lustig.
Während all dies geschah, wurde auf Melaten jemand unter die Erde gebracht. Die Bestattung fand im unscheinbaren nordöstlichen Teil des Friedhofs statt, auf der Ehrenfelder Seite. In jenem Abschnitt, der bei einer Erweiterung unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg angelegt worden war. Die Kriegstoten hatten Platz gefordert. Und nun kam eine weitere Leiche hinzu.
Im Schatten der vielen hier fast waldartig wuchernden Ahorn-Bäume, Hainbuchen und Kiefern lag es sich düsterer als anderswo auf Melaten. Um die schmalen Rechtecke der Gräber herum blieb das Herbstlaub oft das ganze Jahr über liegen, hatte eine dunkle, erdige Zone mit viel Schatten auch an sonnigen Tagen geschaffen. Der Charakter dieses Abschnitts war ein ganz anderer als der in der hoffnungsvoll grünen, lichten Mitte Melatens oder auf der prunkvollen Millionenallee.
Hier, im Nordosten, war der Tod deutlich Herr im Haus.
Die Bestattung verlief so zügig wie unscheinbar. In der Nähe des Geschehens gab es zwei größere Grasflächen. Sie waren vorzügliches Qigong- und nun auch Eurythmie-Gelände. Seit ein paar Wochen kamen Marlies von Törne und ihr Trupp häufiger hierher. Hier fühlten sie sich bei ihren Turnübungen relativ unbeobachtet.
Aber die Qigongs hatten den Friedhof ja schon verlassen.
Es waren nicht viele Trauergäste gekommen. Der Sarg der Toten war ein stattlicher weißer: viel zu groß für einen sparsamen Abschied. Fast noch bemerkenswerter als Sargfarbe und -größe waren die Begleiter des Sargs. Meist traf man auf klassischen Beisetzungen ältere Herren in schwarzen Anzügen, schwarze Zylinder oder Schirmmützen tragend, die einen Katafalkwagen aus der Trauerhalle bis zur Grabstelle zogen. Und dieselben Herren senkten den Sarg dann ins Grab.
Von Erde sind wir genommen, zur Erde müssen wir werden.
Hier und heute waren die Sargträger recht jung: vier Männer und zwei Frauen von höchstens vierzig Jahren. Schweigend taten sie ihre Arbeit, hoben den wuchtigen Sarg vom Wagen, schulterten ihn, stellten ihn auf die Bretter, die quer über die Ausschachtung gelegt worden waren. Dann senkten sie den Sarg ab, traten zur Seite, murmelten ein Gebet. Sie trauerten. Tränen flossen, miteinander gesprochen wurde kaum. Sechs Blumen fielen ins Grab, fünf weiße Rosen und eine tiefrote. Dann Händeschütteln. Stumme Blicke. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Der Pfarrer war die einzige Person, die häufiger sprach: zunächst am Grab, anschließend einzeln mit den wenigen Trauergästen und den Sargträgern. Mit einem der Sargträger, einem kräftigen Mann mit blassem Gesicht und dunklem Haar, unterhielt er sich länger. Der Pfarrer blickte freundlich, der Mann eher düster.
Einige Dutzend Meter entfernt, halb verborgen hinter einer breiten, teils verwitterten, teils bemoosten Sandsteinplatte verharrte ein dunkel gekleideter älterer Herr. Die Bäume und Sträucher um ihn herum gaben ihm zusätzlich Schutz, und da sich die Trauergäste ganz auf die Zeremonie konzentrierten, fiel sein Beobachten nicht auf.
Aber weshalb auch? Der große weiße Sarg war ungewöhnlich genug. Bei so etwas blieben Leute stehen und warfen neugierige Blicke darauf.
Die dunkle Kleidung des heimlichen Beobachters, sein feiner Traueranzug, ließ indessen den Gedanken aufkommen, dass er nicht nur zuschaute, sondern aus gewisser Distanz an der Zeremonie teilnahm.
Die Trauergemeinde löste sich auf, und der Mann, der alles aus der Entfernung beobachtet hatte, ging als Letzter.
Sekt wie bei der Eröffnung des Kolumbariums gab es auf dieser tristen Feier im Nordosten Melatens natürlich nicht. Nachdem die Oberbürgermeisterin aufgebrochen war und die Beschwipsten sich verstreut hatten, ging für Konrad und Martin die Arbeit weiter. Nah eines emsig umsummten Bestattungsgartens in der Friedhofsmitte war ein Insektenhotel zerstört worden. Vandalismus. Konrad hatte für so etwas kein Verständnis, und anders als die Stadt Köln begann er möglichst schnell mit der Restaurierung wichtiger Gebäude. Bei diesen Arbeiten half Martin gern. Am Ende des Arbeitstages überraschte er Konrad dann mit der Aufforderung, zum Abendessen zu kommen. Seine Mutter Amalia hatte die Einladung ausgesprochen.
»Damit rückst du erst jetzt raus?«
»Ja, Mama hat gesagt, du sollst dir keine Umstände machen.«
»Na ja, aber ich hätte den Arbeitstag bei frühzeitiger Benachrichtigung in viel größerer Freude erlebt.«
Martin stöhnte auf.
»O Gott. Das muss schlimm sein. Du bist jetzt schon wie lange verknallt? Ist das nicht heilbar?«
»Davon verstehst du nichts, Martin.«
»Zum Glück.«
Er lachte und rannte los. Konrad folgte im Erwachsenentempo.
Und weil er nicht verschwitzt und mit schmutzigen Fingernägeln bei Amalia erscheinen wollte, verpasste er sein sonst übliches Abendgespräch mit Kommissar Rehbein. Heribert Rehbein, wie immer in Mantel und Hut, goss seit 18 Uhr am Grab seiner Mutter Blumen, ordnete Beete, zupfte Abfall aus den Katzenpfötchen, den Berberitzen und Elfenblumen und hielt Zwiesprache mit der ehemaligen Chefsekretärin diverser Kölner Polizeipräsidenten. Käthe Rehbein, geboren 1913, gestorben 1995, ruhte in einem modernen Bestattungsgarten mit Wildkräutern und eleganten Grableuchten: ein Garten der Lichter. Als Kommissar mit bestem Ruf und langer Berufszeit – Rehbein war vierundsechzig und stand kurz vor der Pensionierung – war es ihm gelungen, die Umbettung aus dem alten Grab nach fünfundzwanzig Liegejahren genehmigt zu bekommen. Nun ruhte Käthe in einem Beet, dessen Blumenschmuck auf subtile Weise an ihren Schreibtisch im Polizeipräsidium erinnerte. Wenn Konrad das in einer schlanken Stele angebrachte Grablicht sah, musste er an eine Schreibtischlampe denken. Leuchtete sie – und sie leuchtete immer –, war Käthe Rehbein im Dienst.
Während der Kommissar auf Konrad wartete, telefonierte er mit seinem Kollegen Jan-Philipp Freese. Kommissar Freese würde in knapp einem Jahr Rehbeins Position übernehmen und war schon jetzt für die meisten ihrer gemeinsamen Fälle zuständig. Sie mochten sich nicht, aber sie hatten sich arrangiert. Rehbein trat seit einiger Zeit kürzer. Das gab Freese die Hoffnung, dass ihm »der Alte« nun weniger in die Quere kam.
Heute hatte Rehbein einen freien Tag gehabt. Jetzt, am Abend, holte er sich bei Freese Informationen zu den Vorkommnissen des Tages. Freese erwähnte unter anderem, dass man überlege, einen nach über 30 Jahren Sicherheitsverwahrung aus Ossendorf entlassenen Einbrecher und Mörder heimlich zu überwachen. Man befürchtete, der Mann könnte wieder aktiv werden.
Rehbein winkte ab: »Ach, die alte Schmickler-Geschichte«, sagte er. »Da kommt nichts mehr, wenn du mich fragst. Der Polizeipräsident hat sich da in was verrannt. Schmickler wird sich bestimmt nicht noch ein zweites Lebenslänglich einfangen wollen. Der Mann ist so alt wie ich.«
»Ja«, sagte Freese und grinste, »seh ich auch so. Da kommt nix mehr. Wenn der so alt is wie du.«
Rehbein ließ den Witz abprallen. Als das Telefonat beendet war, sah er sich um und brummelte: »Hier kommt wohl auch nix mehr«, womit er Konrad meinte. Er ging heim, wo es ein belegtes Brot und eine Tasse Tee gab. Mit Abendessen hatte er es nicht so.
Bei Amalia war das anders. Konrad und Martin speisten königlich – Martin korrigierte den Eindruck zu königinnenlich. Er und Konrad genossen einen wunderbaren Abend, denn Amalia war trotz Probenstress bester Laune. Das WDR-Sinfonieorchester plante ein Doppelkonzert mit Werken von Niccolò Paganini. Amalia war nicht nur zur ersten Violinistin dieses Projekts ernannt worden. Die Stadt Genua, aus der Paganini stammte, stellte ihr für die Konzerte die berühmte Geige Il Cannone – Paganinis Lieblingsvioline – zur Verfügung. Damit verbunden war ein Auftritt des Kölner Orchesters im Opernhaus von Genua. Am 21. Mai würde Amalia mit ihren Kollegen dorthin reisen. Das Konzert fand am Freitag, dem 22. Mai, statt. Am Sonntag würde es zurückgehen – für das zweite Konzert in Köln in der Woche darauf.
Amalia platzte vor Stolz und Glück und verbrachte nicht nur das Abendessen, sondern anschließend die ganze Nacht mit Konrad. Konrad hätte Paganini küssen mögen, hätte er noch Zeit gehabt, jemand anderen als Amalia zu küssen …
So verging der Abend in wunderbarer Harmonie.
Zumindest in der Piusstraße, wo Amalia lebte und Martin sich dezent in sein Zimmer zurückgezogen hatte. Auf dem Friedhof hingegen ereignete sich in diesen Stunden ein brutaler Mord.
JULIUS KNACKT EINE NUSS
Julius hatte von Mord keine Ahnung. Aber von Nüssen verstand er viel. Julius war ein Eichhörnchen. Am Dienstagmorgen, dem 12. Mai, hatte er in aller Frühe eine wirklich harte Nuss zu knacken. Die Nacht war kühl gewesen, und es hatte mal wieder geregnet. Aber die Tage vertrieben Kälte und Nässe schnell und ließen Duft und Frische zurück.
Die Sonne war kaum aufgegangen, da flitzte Julius schon los. Er umsauste den Bronze-Engel und die zu dem Engel aufblickende Bronze-Frau auf dem Grabmal, das sich direkt unter Julius’ Schlafbaum befand: eine sterbende Kiefer mit dichtem Efeubewuchs. Das Grab mit den zwei Figuren auf einem breiten, gerahmten Steinsockel gehörte zu den schönsten auf Melaten. Aber Julius hatte für Engel keinen Blick und für Frauen nur dann, wenn sie mit Nüssen lockten. Er wollte eine Sache vom Vortag zu Ende bringen. Er hatte da was in der Nase.
Es war der Duft von Hasel- und Walnüssen, der mit steigender Sonne deutlicher wurde und Julius an seinen Hunger erinnerte. Julius’ Gedächtnis war nicht das beste, sonst hätte er sich dem Problem gleich nach der gestrigen Störung gewidmet, nachdem er verscheucht worden war.
Am Vortag, gestern also, hatte Gandulf Kantmann, die größte Arschkrampe unter den Gärtnern auf Melaten, eine Schaufel nach Julius geworfen. Gandulf war noch weitaus hinterhältiger als die überfütterten Katzen, mit denen es Julius manchmal zu tun bekam. Normalerweise benahm sich Gandulf allzu tollpatschig für jemanden wie Julius, dessen Ohren noch das Knurpseln der Borkenkäfer unter der Rinde der kränkelnden Kiefern nebenan vernahmen. Gestern aber hatte die Vielzahl von Nüssen auf dem Schotterweg das kaum nussgroße Eichhörnchengehirn überfordert. Und wegen dieser Überforderung hatte Julius Gandulf Kantmann mit Konrad verwechselt.
Das war dumm gewesen.
Konrad Leisegang war, im Gegensatz zu Kantmann, der netteste Friedhofsgärtner, den sich ein Eichhörnchen wünschen konnte. Konrad war ein edler Nussspender und ein Mensch von beruhigender Ausstrahlung. Den Namen Julius hatte Julius übrigens von Konrad erhalten. Der hatte Amalia mal ein Eichhörnchen aus Glas geschenkt. Amalia hatte es Julius getauft. Seitdem nannte Konrad jedes Eichhörnchen, das ihm auf dem Friedhof begegnete, Julius.
Julius hielt sich gern in Konrads Nähe auf, was dann die fast tödliche Verwechslung mit Kantmann zur Folge hatte.
Julius war aus einem Hasel- und Walnuss-Tagtraum erwacht, als die Schaufel aus der Hand Kantmanns unmittelbar vor der Eichhörnchen-Nase landete und dann über den Wegschotter bis gegen den Steinrahmen des großen Grabes schlitterte. Mitten durch die Nüsse hindurch, die dort teils mit, teils ohne Schale lagen, einem Nussbesitzer vermutlich aus der Tüte gefallen. Wie nach einem Billardstoß und von Gandulfs hämischem Lachen begleitet, sprangen Nüsse in alle Richtungen davon.
Julius sprang fast ebenso schnell. Er flitzte erschrocken seinen Baum hoch und verkroch sich in jener Astgabel, wo er sich einen hübschen Kobel eingerichtet hatte.
In dem es allerdings nichts zu essen gab.
Der Schreck hielt Julius für den Rest des Tages von aller Neugier fern. Als er sich wieder nach unten wagte, hatte er die Nüsse vergessen. Viele waren auch schon von anderen Eichhörnchen geklaut worden. Julius witterte nun überall Gefahr und mied all jene Wesen, die er sonst mit Bettelpose nach Lust und Laune manipulierte. Er stillte seinen Hunger mit jungen Fichtentrieben und saftigen Knospen. Er nippte Wasser aus einer Vogeltränke, flüchtete vor einer streitlustigen Elster, sauste einer hübschen Eichhörnchen-Dame nach, auf die er schon länger ein Auge geworfen hatte und mit der er sich gern intensiver … balgen würde. Und weil das Damen-Nachjagen Kraft kostete, naschte er anschließend wieder an jungem Grün und fand auch einen frischen Regenwurm. Erst am Abend stieß er auf jemanden, der ihm Knabberzeug anbot und dem er vertraute: eine Oma mit Rollator.
Die warfen niemals mit Schaufeln.
Jetzt, zwölf Stunden später, am frühen Morgen des 12. Mai, erinnerte sich Julius wieder an die Nüsse. Nicht, weil sein Gedächtnis über Nacht besser geworden war, sondern weil es hier so gut roch. Ein rätselhafter, würziger Duft stieg zu ihm auf. Nuss-würzig, mit einer Röstnote als Beimischung. Der Duft kam von unter dem sterbenden Baum. Mit frischer Neugier sauste der kleine Eichkater den Baum hinab, vorbei an Bronze-Engel und Bronze-Frau – und bremste.
Was war denn das?
Ärger stieg in Julius auf. Wäre sein Fell nicht ohnehin rot gewesen, dann wäre es jetzt wutrot. Julius zitterte. Die Nüsse, die er deutlich witterte, lagen dort auf dem Weg, bedeckt von etwas, das noch friedlicher war als eine Rollator-Oma, aber ganz und gar nicht spendabel. Ein Mensch? Julius hatte klare Vorstellungen von Menschen – Zweibeinern also. Er sah sie ja täglich. Er wusste mit ihnen umzugehen. Manche allerdings waren ihm ein Rätsel. Der Mensch aus Luft zum Beispiel, der hier ganz in der Nähe, Tag und Nacht auf dem Paarungsrasen stand. Er bewegte sich nie. Julius konnte sogar durch ihn hindurchschlüpfen. Der Mensch aus Luft schien das gar nicht wahrzunehmen. Julius kannte die Menschen nicht gut genug, um zu wissen, dass viele von ihnen nichts wahrnahmen.
Dieser Mensch hier rührte sich ebenfalls nicht. Aber er bestand nicht aus Luft. Dieser Mensch verhielt sich eher wie der Mensch, der direkt vor dem Menschen aus Luft lag. Der war aus Stein. Durch den konnte Julius auch nicht hindurchschlüpfen, doch das war ihm egal, denn unter dem Steinblockmenschen lagen keine Nüsse.
Julius hopste aufgeregt um den reglosen Körper herum. Dieser Duft von Geröstetem. Julius war erbost. Er versuchte, an der Seite des Menschen an eine halb hervorlugende, unter platt gedrücktes Fettgewebe gepresste Nuss zu gelangen. Julius schob das Schnäuzchen vor, mühte sich, das auf die Nuss gepresste Fett beiseitezuschieben, doch es gelang nicht. Und dann …
»Das gibt’s doch nicht!«
Julius hörte die aufgeregte Stimme und ergriff die Flucht.
Die Nüsse konnte er vergessen.
Konrad war schon um sechs Uhr früh voller Elan, mit Paganini im Ohr und Wärme im Herzen, auf dem Friedhof erschienen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Arno Schorn, der fast jeden Morgen um diese Zeit im Betriebshof hinter seinem Schreibtisch saß und die Arbeitspläne des Tages durchging, wunderte sich kaum. Konrads privates Glück war ihm kein Geheimnis.
»Kannst gleich oben am Birkenrondell weitermachen«, sagte er. »Wo du gestern gemäht hast. Guck da auch mal nach dem Steintor-Denkmal. Kösters meint, da würden nachts Partys gefeiert.«
»Bei den Steinblöcken?«
Konrad blickte seinen Chef ungläubig an.
»Kösters sagt, da sind letztens sogar Videos aufgetaucht, wo junge Paare nacheinander nackich durch den Block mit dem Loch drin hüpfen.«
»Nackt? Durch den Marmorblock?«
»So isses. Is aber kein Marmor, sondern Vulkangestein. Impala. Die Steinmetze haben mir das mal erklärt. Durch den Menschenumriss, den sie aus dem stehenden Block rausgeschnitten und dann vor das Loch, also direkt vor den Block, gelegt haben, da passt man durch.« Er lachte. »Also, wenn man nich grad ’ne Kugel is wie ich. Junge Leute kommen da bestimmt durch. Aber wenn da nachts Pärchen bekifft und womöglich nackich …«
Er winkte angewidert ab.
Konrad grinste.
»Also, die einzigen Pärchen, die ich da am Denkmal schon mal hab rumhüpfen sehn, waren Eichhörnchen.«
»Ja, tagsüber sind das Eichhörnchen«, brummte Schorn. »Geh mal kucken, ob da Spurn sind. Bist doch Detektiv, du und dein Knirps-Kumpel.«
»Geht klar, Chef«, sagte Konrad, schulterte die Sense und zog los.
»Ach ja«, Schorn hatte noch was vergessen. »Kannst dich auch mal umkucken, ob da oben irgendwo Baggerschlüssel liegen. Kantmann hat die verlorn. Sind ihm aus der Tasche gefalln, behauptet er. Kurz vor Feierabend passieren dem dauernd so Sachen.«
»Wird gemacht«, rief Konrad – und weg war er.
Und als er fast am Birkenrondell mit dem Steintor-Denkmal 200 Jahre Melaten angekommen war, entfuhr ihm jener verwunderte Ausruf, mit dem Julius nicht gerechnet hatte.
Eine halbe Stunde später wimmelte es am Rondell von Polizei, einem Notarztteam und Leuten von der Kölner Rechtsmedizin. Heribert Rehbein war gekommen, auch sein Kollege Jan-Philipp Freese, plus fünf weitere Beamte von der Spurensicherung. In einigem Abstand hatten sich Schaulustige versammelt. Darunter fast sämtliche Friedhofsgärtner, die an diesem Morgen Dienst hatten. Arno Schorn und Konrad standen den Beamten Rede und Antwort.
Das Notarztteam hatte nichts zu tun. Der Mann war mausetot. Das Areal um das Grab mit den zwei Bronzefiguren war weiträumig abgesperrt worden. Die Spurensicherung suchte nach Hinweisen für ein Verbrechen. Benedikt Weiss und seine Kollegin Josepha Roth waren aus der Rechtsmedizin herübergekommen und nahmen eine erste Leichenschau vor.
Der Tote lag da wie angeliefert: ein Mann, zwischen 60 und 70, leicht korpulent, Bierbäuchlein, dürre Beine, dünnes Haar, ungepflegter Bart oder seit Tagen unrasiert. Der Mann trug dunkle Sachen, allerdings nichts, was man auf einer Beerdigung getragen hätte: schwarze Skimütze, schwarze, teils ausgewaschene Jeans und einen schwarzen Rollkragenpullover.
»Der ist hier nachts rumgeschlichen«, mutmaßte Freese. Rehbein nickte.
»Dazu passt die schwarze Mütze. Die festen Schuhe. Handschuhe. Drüben im Gras lag eine Stablampe.«
»War der auf Schatzsuche oder was?«
Freese wies auf die Schuhe des Toten, an denen Lehm- und Erdreste trockneten. »Der ist hier rumgestreift, ohne auf die Wege zu achten. Der ist auch zwischen Bäumen und Sträuchern durch.«
»Ja«, sagte Heribert Rehbein. »Irgendwelche Papiere?«
»Fehlanzeige«, sagte Freese. »Weder Papiere noch Smartphone oder was der Mann von heute so dabeihat, wenn er nach Mitternacht den Friedhof besucht.«
Konrad hielt sich im Hintergrund. Er hatte mit Rehbein gesprochen, die Umstände des Fundes geschildert, hatte alles zu Protokoll gegeben. Ihm und Kommissar Rehbein war aufgefallen, dass der Tote zumindest ein paar Meter bewegt worden sein musste. Da waren Schleifspuren, die an den Schuhen endeten. Und der linke Arm wies ausgestreckt nach vorn.
Hatte jemand an der Hand des Toten gezogen?
Als weitere Beamte eintrafen, hatte Konrad sich zurückgezogen und das Geschehen um das Grabmal aus der Distanz verfolgt. Mit Freese konnte er nicht gut. Wenn er sich jetzt einmischte, gab das nur dumme Kommentare. Nach einigen Minuten aber – Rehbein und Freese diskutierten miteinander – näherte sich Konrad dem Toten wieder. Konrad war interessiert an dem, was die Forensiker herausfanden. Und da er Benedikt Weiss und Josepha Roth gut kannte und sie beide wussten, dass er die Leiche gefunden hatte, empfanden sie seine Gegenwart nicht als aufdringlich.
Sie grüßten und fuhren mit der Arbeit fort.
Als Konrad den Mann gefunden hatte, hatte der bäuchlings auf der Erde gelegen, halb auf dem Weg, halb auf den Pflanzungen um das Grab, die linke Hand nach vorn gestreckt, als hätte er fallend noch den Rand oder die Kante von etwas ergreifen wollen, was Leben hieß. Dann war er aber doch in diese Schlucht gestürzt, in die jeder früher oder später hinabmusste.
»Durchtrainiert ist der nicht grad. Eher Couch mit Kartoffel. War vielleicht bloß ein Infarkt«, sagte Benedikt Weiss mit forensischem Feingefühl. Er steckte, wie seine Kollegin, in einem schneeweißen Overall, hockte neben dem Toten, begutachtete ihn. Ein Leichensack lag bereit. Für das genaue Obduktionsergebnis würden sie den Mann später noch auf den Sektionstisch hieven. Aber sie kamen schon hier gut voran. Der Todeszeitpunkt lag vermutlich innerhalb der ersten Stunden nach Mitternacht.
»Im weiteren Sinne ist ein Infarkt nicht auszuschließen«, sagte Josepha Roth, »hast du dir die Augen angesehen?«
»Trüb, wie seine Aussichten auf zukünftige Lottogewinne«, sagte Weiss.
Josepha Roth seufzte.
»Genau. Die Eintrübungen.«
»Sind registriert«, antwortete Weiss.
»Sternförmig«, sagte Roth. »Hab ich selten so ausgeprägt gesehen.«
»Vielleicht sah Ikarus Sterne, bevor er stürzte.«
»Herr Weiss. Ihre Witze waren schon bedeutend besser.«
»Werden sie auch wieder, wenn ich im Institut bin und Ihren wunderbaren koffeinstarken Kaffee genossen habe, Frau Roth.«
»Ich werde eine besonders robuste Bohne wählen«, sagte Josepha Roth.
»Das wäre ganz wunderbar«, antwortete Benedikt Weiss.
Wie auf ein Zeichen hin erhoben sie sich. Josepha Roth blickte Benedikt Weiss an.
»Nun ernsthaft, Herr Kollege: Ihre Meinung?«
»Stromschlag«, sagte Benedikt Weiss. »Die Pupillen. Spuren von Muskelkontraktionen. Die Haut. Zu viele Ampere.«
Josepha Roth nickte.
»Würde mich sehr wundern, wenn die Sektion etwas anderes ergibt.«
Das Wort »Stromschlag« löste in Konrads Kopf eine Kette von Assoziationen aus. Als er gegen halb sieben auf die Leiche gestoßen war, war ihm der Schreck gleich mit 300 Volt in die Glieder gefahren. Und dann dieses Eichhörnchen, das wie ein Blitz unter dem Mann hervorflitzte.
Konrad hatte natürlich gehofft, dass der Mann lebte, bewusstlos geworden war und Hilfe brauchte. Also war er auf ihn zugeeilt, hatte ihn halb auf die Seite gedreht. Der Körper hatte auf ziemlich vielen Nüssen gelegen.
Vielleicht war er über die Dinger gestolpert, hingefallen, war bewusstlos geworden?
Das war natürlich Quatsch. Das Gesicht des Mannes hatte ganz und gar nicht nach dem Gesicht eines Mannes nach einem Nuss-Unfall ausgesehen: Bleich war es gewesen. Die Augen milchig, mit großen, toten, seltsam gezeichneten Pupillen. Es war das Gesicht eines Menschen, der vielleicht deshalb tot war, weil er nie besonders gesund gelebt hatte.
Vor allem aber war es ein Gesicht, das Konrad kannte.
Wo hatte er den Mann schon mal gesehen?
Konrad hatte die Leiche wieder in jene Position zurücksinken lassen, in der er sie vorgefunden hatte. Dann hatte er Polizei, Schorn und auch Amalia informiert. Sie hatte sich besorgt gezeigt, weil sie davon ausging, dass ein Leichenfund am frühen Morgen auch für einen Friedhofsgärtner kein guter Start in den Tag war. So hatte sie, als Martin aus dem Haus war und unterwegs zur Schule, den Entschluss gefasst, Konrad zu überraschen.
Die Polizei blieb mehrere Stunden. Zu den Friedhofsgärtnern gesellten sich bald weitere Schaulustige, die man mit Absperrband auf Distanz hielt. Innerhalb des Gärtnertrupps spielte sich Gandulf Kantmann auf. Weil er am Vortag ganz in der Nähe im Einsatz gewesen war, konnte er sozusagen von der Front berichten. Er verwies auf den Bagger, mit dem er, kaum 50 Meter vom Tatort entfernt, Gräber ausgehoben hatte.
»Da sind mir von der Kabine aus schon ’n paar schräge Typen aufgefallen«, behauptete er.
»Haste in ’nen Spiegel gekuckt oder was?«
Harry Mützenich. Der ließ Kantmann gern auflaufen. Die Kollegen achteten ihn und lachten. Kantmann lachte notgedrungen mit.
»Dein Bagger steht da ja immer noch«, bemerkte Mützenich und wies zu einer Gruppe von Kiefern, die den Metallsaurier einrahmten. »Hat dich gestern der Feierabend überrascht? Der Bagger gehört abends in den Betriebshof.«
»Ja, ich weiß, das … irgendwie …«, stammelte Kantmann. »Irgendeiner hat mir die Schlüssel geklaut. Hab Schorn schon Bescheid gesagt.«
Harry Mützenich nickte nur und ließ es gut sein. Er genoss die Achtung seiner Kollegen auch deshalb, weil er nicht nachtrat.
Zu den Schaulustigen gehörten mittlerweile auch Paul, Bernadette und Oma Gitti. Sie blieben auf Distanz, unweit des Gehölzes, hinter dem der Bagger stand. Oma Gitti mochte die Polizei nicht. Das bezog sich vor allem auf Jan-Philipp Freese.
»Na, wen haben wir denn da?«, rief der plötzlich. Heribert Rehbein blickte auf. Er hatte mit seinem Smartphone weitere Fotos von Leiche und Tatort gemacht. Jetzt sah er zum Hauptweg. Vom Betriebshof her näherte sich eine Gruppe von fünf Männern: vier davon muskulös, tätowierte Arme, stiernackige Gestalten in Arbeitsoveralls. Die vier wurden dreimal die Woche von der JVA Ossendorf hergebracht und von jenem wesentlich schmächtigeren Mann in Empfang genommen, der sie anführte. Ein Pfarrer: fröhliches Gesicht, dunkel gekleidet, auf Hüfthöhe eine Umhängetasche, eine Art Kuriertasche aus abgewetztem Leder. Der Mann war sicher schon 60 Jahre alt, und Rehbein erkannte ihn.
»Das gibt’s doch nicht!«, rief er. »Das ist doch …«, der Kommissar blickte in Richtung der Männer, und Konrad horchte auf.
»Sag ich doch.« Freese interpretierte Rehbeins Worte als Zustimmung zu seinen eigenen Ansichten: »Mörder sind das. Und hier liegt ein Toter. Wusstest du, Heribert, dass die hier so’n Resozialisierungsding laufen haben? Ausgerechnet Schwerstkriminelle. Vier Mörder. Und jetzt …«
»Peter! Peter Braun?!«, rief Rehbein.
»Du kennst einen von denen? Hast du den verknackt?«
»Pater Braun. Ich werde verrückt!«
Heribert Rehbeins Ruf war so laut, dass die Forensiker und die Leute von der Spurensicherung aufblickten. Rehbein eilte auf den Pfarrer zu, der ihn ebenfalls überrascht ansah.
»Heribert! Mich laust der Affe.«
»Peter? Mensch, wie lange ist das her?«
Die beiden umarmten sich. Die Schwerstkriminellen guckten verunsichert, was gar nicht zu ihrem stiernackigen Aussehen passte. Der Pfarrer oder, wie er von Heribert Rehbein scherzhaft genannt wurde, Pater Braun, erklärte seinen Schützlingen, wen er da zufällig getroffen hatte.
»Vielleicht hat der eine oder andere von euch ihn ja schon kennengelernt«, witzelte er. »Ich jedenfalls kenne Kommissar Rehbein seit … Wie lange, Heribert?«
»Fast fünfzig Jahre sind das, würde ich sagen.«
»Genau. Die Schule. Doktor Bremser. Weißt du noch? Die Folterwerkzeuge der Mathematik? Du wolltest die Welt besser machen. Ich wollte uns den Himmel bringen.«
»Und Doktor Bremser wollte uns aufhalten.«
Sie lachten – wie Schuljungen. Die schweren Jungs wechselten mitleidige Blicke. Das heißt: drei von ihnen. Der vierte, ein besonders kräftiger, älterer Mann, bullig, mit kugeligem Glatzkopf, guckte verträumt zum Rand des Grabes, auf dem diese bronzene Engelsfigur mit großen Schwingen einer am Boden sitzenden bronzenen, verunsicherten Frau Trost spendete. Hinter dem Grab, halb im Schutz der Bäume und Sträucher, stand Oma Gitti.
Als sie den Blick des Mannes wahrnahm, winkte sie. Der Mann – Otto Fröbe, ein Mörder, mental eingeschränkt− winkte zurück.
Das sahen weder Konrad noch Heribert Rehbein. Der Tote wurde für den Transport in die Rechtsmedizin vorbereitet, ein Leichensack lag bereit. Die Forensiker waren fertig mit der Arbeit vor Ort und zogen ab. Mit ihnen einige der Polizeibeamten. Schorn scheuchte seine Gärtner zurück an die Arbeit.
Kommissar Rehbein rief Konrad zu sich.
»Konrad«, sagte er. »Kennst du Pater Braun?«
»Pfarrer«, korrigierte Peter Braun mit einem Grinsen. Zwischen den beiden bestand eine gewisse Ähnlichkeit. Das silbergraue, seitlich gescheitelte Haar des Pfarrers war fülliger als das des Kommissars, und der Pfarrer war etwas größer als Rehbein, aber die beiden hätten Brüder sein können. Brüder desselben Jahrgangs.
Konrad hatte den Pfarrer, der erst vor wenigen Wochen die Vertretung Uermers übernommen hatte, ein paarmal auf dem Friedhof gesehen, doch sie hatten noch nicht miteinander gesprochen. Der Kommissar moderierte das Kennenlernen, und innerhalb weniger Minuten erfuhr Konrad, dass Kommissar Rehbein und Peter Braun gemeinsam zur höheren Schule gegangen waren. Von der 5. bis zur 13. Klasse. Peter Braun war in der Oberstufe von Heribert Rehbein bekniet worden, ebenfalls zur Polizei zu gehen. Seit den frühen Schultagen bewunderte Rehbein Brauns Kombinationsgabe, mit der er im Lateinunterricht als größter Faulpelz der Jahrgangsstufe die bestmöglichen Ergebnisse erzielte. Eine Polizeikarriere wäre bei Braun steil nach oben verlaufen. Der liebe Gott aber intervenierte. Braun verschrieb sich der Theologie. Rehbein ging auf die Polizeihochschule.
Vor etwa zehn Jahren waren sie sich einmal kurz begegnet. Da hatten sie sich schon lange aus den Augen verloren. Damals ging es um einen Kriminalfall im Umfeld des Kölner Kardinals. Einer der Weihbischöfe des Erzbistums war in arge Schwierigkeiten geraten, und es war Pfarrer Braun gewesen, der entscheidende Hinweise zur Lösung des Falls beisteuerte. Heribert Rehbein hatte sehr davon profitiert.
Da war der Name Pater Braun entstanden.
Und nun trafen er und Kommissar Rehbein sich erneut.
Rehbeins Aufgabe, herauszufinden, ob es sich bei dem Leichenfund um einen Mord handelte, kam in der folgenden Stunde nicht recht voran, denn Braun und Rehbein zelebrierten ihr Zusammentreffen wie Schulkinder. Und Konrad geriet ebenfalls in die Fallstricke der Gefühle: Amalia erreichte den Tatort. Konrad bemerkte sie erst, als sie ihn von hinten umarmte und sanft an sich drückte.
»Wie geht es dir? Gott, das sieht ja schlimm aus.«
Sie sah den gefüllten Leichensack, der dort noch immer unverschlossen lag.
Konrad drehte sich um, küsste Amalia.
»Alles gut?«, fragte sie.
Er nickte, wies auf den Toten: »Ich kenne den Mann. Ich habe das Gesicht schon mal gesehen.«
Mit einem Ratschen des Reißverschlusses verschwand der Anblick.
»Wenn ich nur wüsste, wo …?«
»Heribert!«, rief Jan-Philipp Freese. »Die Intelligenz hat zugeschlagen.«
»Du meinst jetzt aber nicht dich?«
»Guter Versuch, Heribert«, rief Freese. »Im Gegensatz zu dir hab ich mich dem Fall gewidmet. Wir haben den Mann. Er heißt Karlo Möllekens.«
»Der Tote?«
Freese reichte sein Smartphone an Rehbein weiter. Der und Pfarrer Braun betrachteten die Mail interessiert. Ebenso Konrad und Amalia. Ein Foto mit einem Namen darunter.
»Karlo Möllekens?«
Konrad zuckte mit den Schultern. »Nie gehört. Aber gesehen hab ich den schon. Ganz sicher.«
»So so«, sagte Freese. »Das lässt tief blicken.«
Er nahm sein Smartphone zurück.
»Möllekens war der Besitzer des Chez Sasha.«
»Chez Sasha?«
Konrad blickte von Rehbein zu Freese und zurück. Heribert Rehbein räusperte sich.
»Nun ja«, sagte er. »Das Chez Sasha. Ein großes Bordell, wahrscheinlich das größte in NRW. Wurde 1995 eröffnet. Ist Anfang des Jahres pleitegegangen.«
»Und du kanntest den Mann, Konrad?«
Amalias Stimme klang plötzlich angespannt.
Wie eine Violinseite bei Paganini.
EMPOWERMENT
»Nicht alt genug? Ich bin elf!«
»Eben. Keine weiteren Diskussionen.«
»Ich will doch nur wissen, warum Mama sauer ist.«
»Ein Missverständnis.«
»Wie, Missverständnis? Sag schon.«
»Sie hat nur was falsch verstanden.«
»Und was?«
»Jetzt hör auf. Wie war die Schule?«
»Doof. Wie immer.«
Martin war gekommen. Über seiner Schulter hing die Botanisiertrommel, die er mal auf eBay ersteigert hatte und die er für Feldforschungen und naturwissenschaftliche Recherchen benutzte. Die Gründe für die Beziehungskrisen Erwachsener waren zu einhundert Prozent unwissenschaftlicher Natur. Und Unwissenschaftliches interessierte Martin eigentlich nicht. Aber er war neugierig. Und da er seine und Konrads Zukunft in einem gemeinsamen Detektivbüro sah, ließ er Konrad beim Thema Beziehungskrise nun in Ruhe und nervte mit Fragen zum neuen Kriminalfall. Heute, so viel wusste Martin schon, war es also kein Knochenfund gewesen, sondern ein fast noch warmer Toter nach einem Stromschlag.
»Erzähl mal«, drängelte er. Konrad runzelte die Stirn.
»Darf ich vorher erfahren, ob deine Schule regulär so früh aus war?«
In Martins Gesicht zuckte es kurz.
»Der Tillmanns ist krank. Da ist ’ne Doppelstunde Mathe ausgefallen.«
»Wenn ich Zeit hätte, würde ich dich einem Verhör unterziehen.«
»Wieso das denn? Jede bei Tillmanns ausgefallene Mathestunde ist ein Anschlag weniger auf die geistigen Fähigkeiten in unserer Klasse. Nun erzähl schon.«
Konrad erfuhr, dass der Buschfunk in der Schule bereits morgens vor Unterrichtsbeginn Gerüchte über einen Mord auf Melaten in Umlauf gebracht hatte. Das hatte in Martins Kopf sehr lebendige Bilder erzeugt, wie Konrad nun bemerkte. Seufzend entschloss er sich, Martin mit möglichst sachlichen Erläuterungen wieder zu erden. Konrad berichtete also vom Leichenfund. Martin fragte viel, und Konrad antwortete nach bestem Wissen und Gewissen. Martin freute sich, dass er Konrad ausgetrickst hatte, und speicherte alles in seinem ausgezeichneten Gedächtnis ab.
»So«, sagte Konrad, »jetzt muss ich aber ans Werk. Die Wiese neben dem neuen Ruhegarten fertig mähen. Und beim Ruhegarten muss ich die Steinumfassungen der Langbeete abnehmen und gucken, ob da Bäume oder Sträucher rausmüssen für den Zugang. Viel zu tun.«
»Wenn du für mich nichts hast, widme ich mich schon mal der Spurensicherung.«
Konrad hustete.
»Da hab ich mich wohl sehr undeutlich ausgedrückt. Und ganz davon abgesehen: Die Polizei war mindestens drei Stunden vor Ort, Martin.«
»Genau, Watson. Und bestimmt haben die was übersehen.«
Martin wies mit der großen Geste kurzer Arme ins Rund.
»Was hat der hier gewollt, der Tote? Der war schließlich illegal auf dem Friedhof.«
»Der Tote?«
»Bevor er tot war.«
»Und illegal heißt?«
»Nachts. Ist doch nachts geschlossen, dein Friedhof. Also illegal.«
»Ja, aber über die Mauer zu klettern ist an der Piusstraße wirklich nicht schwer.«
»Aber illegal. Und wenn die Spuren, die hier übersehen wurden, erst mal eine Nacht hinter sich haben, sind sie vielleicht futsch.«
Konrad schüttelte den Kopf, schulterte die Sense und zog los.
»Mach keinen Unsinn. Sonst entzieht Schorn dir die Ermittlungserlaubnis.«
»Laut § 34a der Gewerbeordnung brauche ich für reine Detektivarbeit, also für Beobachtung, Ermittlung und Materialbeschaffung, keine Lizenz«, rief Martin.
»Schorn erteilt dir Friedhofsverbot«, antwortete Konrad.
»Ich werde ihn nicht enttäuschen. Und wenn’s bei mir schnell geht, komm ich dir noch helfen.«
»Lügen haben so kurze Beine wie du.«
Das verschlug Martin für einige Sekunden die Sprache. Als er sie wiederfand, war Konrad verschwunden. Nun denn. Martin atmete tief ein und aus und konzentrierte sich auf die Stille unter den Bäumen. Jetzt galt es erst einmal, den Geist dieses geweihten Ortes zu erfassen. Wenn der Mann an einem Stromschlag gestorben war, wie die Forensiker vermuteten, dann war dieser Platz mit seinen efeubewachsenen Kiefern und Lärchen, der einzelnen Rosskastanie, dem breiten Grab mit reichlich Grünbelag auf der Steineinfassung, den Begonien- und Bodendeckerbeeten und all dem Unterholz, dem Kirschlorbeer und sonstigem wildem Heckengrün ein äußerst unwahrscheinlicher Tatort. Konrad hatte ihm gesagt, dass er vermute, der Tote sei ein Stück weit fortgeschleift worden. Von diesen Schleifspuren auf dem Gras aber war schon nichts mehr zu sehen. Alles war zertrampelt worden, das Gras hatte sich inzwischen wieder aufgerichtet. Und die Tatsache, dass die Beamten den Tatort schon nach wenigen Stunden freigegeben hatten, deutete Martin so, dass sie nichts Weiteres zu finden meinten.
Doch hier, wo die Eichhörnchen flitzten, die Meisen wie Flummibälle in den Zweigen landeten und gleich wieder davonsausten, verbarg sich etwas. Die Ruhe des Ortes war das eine. Die flirrende Energie das andere. Man musste nur warten, dann zeigte sie sich. Es gab keinen Fundort ohne zweite Ebene; keinen Fundort, der nicht auf den Tatort verwies. Das gehörte zu den Glaubenssätzen des jungen Detektivs.
Sherlock Schmitz machte sich auf die Suche. Er sah zwei Möglichkeiten: Wenn der Mann hier umgebracht worden war, dann musste es eine Stromquelle geben oder gegeben haben. Nichts aber lag diesem Grün ferner als eine Steckdose. Und eine Steckdose, eine normale, hätte für einen solchen Mord kaum ausgereicht.
Und wenn der Mann woanders ermordet worden war?