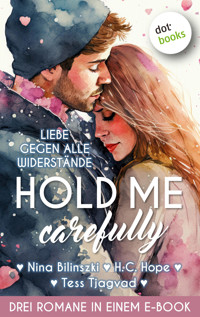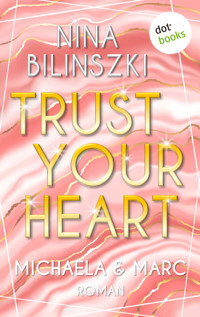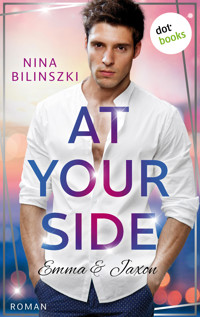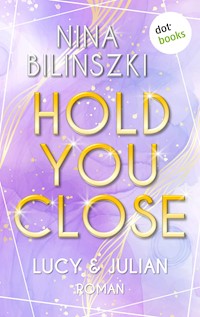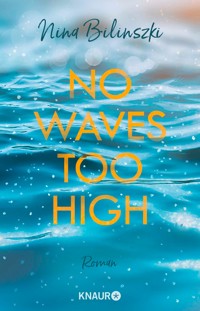9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Love Down Under
- Sprache: Deutsch
Die atemberaubende Natur Australiens und eine zarte Liebe, die alte Wunden heilt: Auch der zweite Liebesroman der New-Adult-Reihe »Love Down Under« von Nina Bilinszki erzählt eine hochromantische Liebesgeschichte zum Mitfiebern und In-die-Ferne-Träumen. Der Naturfotograf Cooper Lee liebt sein Leben in der Wildnis Australiens und hält sich von Menschen fern. Nie mehr möchte er jemanden so nah an sich heranlassen, dass er verletzt werden kann. Doch dann ist er gezwungen, in die kleine Küstenstadt Eden zurückzukehren, wo die deutsche Studentin Sophie Naumann wie eine Naturgewalt über ihn hinwegfegt. Nicht nur schmeißt sie den Pub seines Großvaters fast im Alleingang, sie teilt auch seine Leidenschaft für die Natur und geht ihm mit ihrer Neugier und ihrem Optimismus gleich unter die Haut. Als Cooper erfährt, dass Sophies Work-&-Travel-Aufenthalt sich bereits dem Ende zuneigt, will er sie umso mehr auf Abstand halten. Doch auf einem gemeinsamen Roadtrip durch Australiens Outback ist das definitiv leichter gesagt als getan ... »No Stars too bright« erzählt herzergreifend davon, dass es sich immer lohnt, der Liebe eine Chance zu geben – und nimmt uns mit auf einen romantischen Roadtrip durch Australiens Outback. Wie Sophies Freundin Isabel in einem Koala-Reservat den Australier Liam kennenlernt, der von einer alten Schuld verfolgt wird, erfährst du in Nina Bilinszkis New-Adult-Roman »No Flames too wild«, dem 1. Teil der »Love Down Under«-Reihe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Nina Bilinszki
No Stars too bright
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Epilog
Nachwort
Danksagung
Playlist
Für alle Abenteurer*innen
Sophies Geschichte ist für euch
Kapitel 1
Cooper
Jetzt bin ich völlig allein.
Ich schluckte gegen die Beklemmung an, die meine Kehle emporkroch. Mit kleinen Widerhaken hatte sie sich in meiner Brust festgesetzt, und ich rieb über die Stelle, als könnte ich die Empfindung damit vertreiben. Doch natürlich funktionierte das nicht. Im Gegenteil. Mit jedem Schritt, den ich machte, wurde die Enge schlimmer. Schließlich blieb ich stehen.
Mr Daniel Collard
Rechtsanwalt und Notar
Mein Blick blieb einen Moment an dem kleinen Messingschild hängen, das sich mittig an der dunklen Holztür befand. Ich wollte nicht hier sein, wäre gerade an jedem anderen Ort lieber gewesen, doch das war eins der Dinge, vor denen ich nicht die Augen verschließen konnte. Vor denen ich nicht wegrennen und mich im Outback verstecken konnte.
Ich nahm einen tiefen Atemzug, versuchte die unerklärliche Angst in mir zu zügeln, dann klopfte ich an die Tür. Fast umgehend erklang ein gedämpftes »Herein«, und ich trat ein.
Das Büro war spärlich eingerichtet. Ein großer Schreibtisch, ein Computer mit zwei Bildschirmen und eine Sitzecke befanden sich darin. Rechts von mir eine Regalwand voller Bücher, die nach Gesetzestexten aussahen. Davon abgesehen war das Büro leer. Keine Bilder an den Wänden, keine persönlichen Gegenstände auf dem Schreibtisch, der für meinen Geschmack viel zu aufgeräumt aussah. Ich würde mich hier nicht wohlfühlen und wusste nicht, wie jemand jeden Tag bis zu zehn Stunden in dieser sterilen Umgebung verbringen konnte.
»Mr Lee, wie schön, dass Sie es einrichten konnten.« Mr Collard erhob sich von seinem Platz und reichte mir die Hand. Alles an ihm war gestriegelt. Er steckte in einem maßgeschneiderten dunkelblauen Anzug, von seinen dunkelblonden Haaren lag jedes einzelne perfekt an seinem Platz, und auf seiner Nase saß eine rahmenlose Brille, von der ich wetten würde, dass sie nie versehentlich verrutschte. Zudem konnte ich sein Alter überhaupt nicht einschätzen. Sein Gesicht war überwiegend faltenfrei, gleichzeitig haftete ihm etwas an, das mein Grandpa als alte Seele bezeichnet hätte.
Ich schluckte gegen die aufkommende Bitterkeit in meiner Kehle an. Grandpa. Der Grund, warum ich hier war.
»Freut mich«, sagte ich zu Mr Collard, obwohl nichts ferner von der Wahrheit lag, und nahm in dem Ledersessel Platz, bevor dieser mir angeboten werden konnte.
Auf Mr Collards Gesicht war keine Gefühlsregung zu erkennen, als er sich ebenfalls wieder setzte. »Wollen Sie etwas trinken? Wasser? Kaffee? Etwas Stärkeres?«
Meine Augenbrauen hoben sich. Hatte er mir gerade Alkohol angeboten? Gut, bei dem, weswegen wir hier waren, wäre es vielleicht nicht ungewöhnlich, trotzdem wollte ich einen klaren Kopf bewahren. »Kaffee, bitte.«
Er nahm den weißen Telefonhörer zur Hand und drückte eine Taste. »Leslie, bring uns bitte zwei Kaffee.« Dann legte er auf und wandte seine volle Aufmerksamkeit mir zu. »Mein Beileid zu Ihrem Verlust.« Es kam so ausdruckslos herüber, dass ich beinahe gelacht hätte. Für ihn war Grandpa bloß ein Auftrag. Ein Punkt auf seinem Tagesplan, den es abzuarbeiten galt. Er hatte keine Ahnung, was für ein Mensch er gewesen war, und ich bezweifelte, dass es ihn groß interessierte.
»Was haben Sie für mich?« Als der Anruf der Kanzlei gekommen war, hatte ich mich gerade beruflich im abgeschiedenen Norden Australiens befunden. Weil ich keinen Empfang gehabt hatte, hatten sie mir auf die Mailbox gesprochen, und so erfuhr ich, dass mein Großvater gestorben und ich zur Verlesung seines letzten Willens geladen war. Ich war nicht hier, damit wir um den heißen Brei herumreden konnten. Ich wollte wissen, was Grandpa mir hinterlassen hatte, und dann schnellstmöglich zurück in die Wildnis. Zu den Tieren, der endlosen Weite und Ruhe, die ich jetzt schon vermisste, dabei war ich seit kaum zwei Stunden in der Stadt.
Ehe Mr Collard etwas erwidern konnte, wurde die Tür geöffnet, und eine Frau mittleren Alters trat ein, bei der es sich nur um Leslie handeln konnte. Ihre hellbraunen Haare waren zu einem akkuraten Dutt frisiert, und sie hielt ein Kaffeetablett in den Händen, das sie zwischen uns auf dem Tisch abstellte. Ich dankte ihr mit einem Nicken und nahm eine der zwei Tassen, froh, dass ich nun etwas hatte, an dem ich mich festhalten konnte.
Nachdem Leslie wieder gegangen war, zog Mr Collard einen Umschlag aus einer Schublade hervor und legte ihn vor sich auf den Tisch. »All sein Privatvermögen hat Ihr Großvater gemeinnützigen Organisationen gespendet, überwiegend an die Charleston Foundation, die sich um vernachlässigte Kinder und Jugendliche kümmert, und das Sapphire Coast Koala Sanctuary.«
Ich musste schmunzeln, denn mein Großvater hatte kein Vermögen besessen. Was er gehabt hatte, hatte er meistens in Ausbesserungen seines Lebenstraums, des Moonlight, gesteckt. Es würde mich wundern, wenn er mehr als fünftausend australische Dollar auf irgendeinem Sparbuch liegen gehabt hatte. Doch an Geld war ich nie interessiert gewesen, was er gewusst hatte, daher begrüßte ich diese Entscheidung.
»Klingt gut, aber warum bin ich dann hier?«
Mr Collard räusperte sich und rückte seine Krawatte zurecht. »Weil Ihr Großvater Ihnen ebenfalls etwas hinterlassen hat, und zwar das Moonlight inklusive der Wohnung, die darüberliegt.«
»Das kann nicht sein«, rutschte es mir heraus. »Was soll ich mit der Bar?« Grandpa wusste, dass ich seine Bar auf keinen Fall weiterführen wollte. Das war sein Lebenstraum gewesen, nicht meiner. Ich war auch nicht der Typ, der sesshaft wurde. Der einzige Grund, warum ich überhaupt noch nach Eden zurückgekehrt war, war Grandpa gewesen. Der Letzte aus meiner Familie, der mir noch geblieben war. Nachdem er nun auch nicht mehr da war …
»Es gibt einen Zusatz.« Mr Collard zog einen Zettel aus dem Umschlag heraus und begann davon abzulesen.
»›Ich übermache meinem Enkel Cooper Lee die Moonlight Bar unter der Bedingung, dass er sich regelmäßig dort aufhält und sich mit allen Vorgängen vertraut macht. Nur er weiß, wie ich sie weitergeführt haben möchte, und er darf sie frühestens nach einem halben Jahr verkaufen. Auch das nur unter der Bedingung, dass er den Käufer darüber unterrichtet, wie mein Lebenswerk geführt werden soll. Stimmt Cooper Lee dem nicht zu, soll die Bar dem Erdboden gleichgemacht und das Grundstück an eine Familie vergeben werden, die dort ein Haus bauen möchte.‹«
Widerstand regte sich in mir, und ich schüttelte den Kopf. Mit Mühe unterdrückte ich einen Fluch, den Mr Collard sicher nicht begrüßt hätte. Ich konnte nicht fassen, dass Grandpa mich aus dem Grab heraus noch um den Finger gewickelt hatte. Er legte die Entscheidung, was mit dem Moonlight passieren sollte, in meine Hände, und ließ mir gleichzeitig keine Wahl. Denn er wusste genau, dass ich es nicht über mich bringen würde, seinen Lebenstraum dem Erdboden gleichzumachen. Niemals würde ich die Entscheidung fällen, die Bar abreißen zu lassen, die Grandpa sich aufgebaut und die ihm nach Grandmas Tod eine Zuflucht geboten hatte. Nicht, nachdem die beiden mich damals aufgenommen hatten, als ich selbst kein Zuhause mehr gehabt hatte.
»Ich mache es. Das Moonlight übernehmen.« Meine Stimme klang kratzig dank all der Empfindungen, die mich mit einem Mal überkamen. Erst jetzt wurde mir so richtig bewusst, dass auch mein Großvater fort war. Dass mir von den einzigen Menschen, die mir jemals etwas bedeutet hatten, nur Erinnerungen blieben.
Und das Moonlight.
Der Anflug einer Gefühlsregung zuckte in Mr Collards Mundwinkeln. Kein richtiges Lächeln, eher etwas wie Zufriedenheit. »Ihr Großvater sagte, Sie würden sich dafür entscheiden.«
Weil er mir keine wirkliche Wahl gelassen hat. Anstatt meine Gedanken auszusprechen, nickte ich bloß, denn das Letzte, was ich wollte, war, mit einem wildfremden Notar meine Familiengeschichte zu erörtern.
Ein weiteres Mal schob Mr Collard seine Hand in den Umschlag und holte einen zweiten, viel kleineren hervor. »Den Brief sollen Sie bekommen, wenn Sie zustimmen, das Moonlight zu übernehmen.« Er schob ihn mir zu, und ich hatte fast Angst, ihn an mich zu nehmen. »Dann müssten Sie nur noch diese Erklärung unterzeichnen, bekommen die Schlüssel ausgehändigt, und wir wären hier bereits fertig.«
Das Herz schlug mir bis zum Hals, und meine Finger zitterten, während ich den Kugelschreiber entgegennahm. Was für Mr Collard nur seine tägliche Arbeit war, fühlte sich für mich lebensverändernd an. War es auch, um genau zu sein, und ich hatte keine Ahnung, was das für meine Zukunft bedeuten würde. Trotzdem unterschrieb ich die Vereinbarung, nahm einen Durchschlag für meine Unterlagen mit und bekam den Generalschlüssel für das Moonlight sowie für die darüberliegende Wohnung ausgehändigt.
Nachdem ich mich von Mr Collard verabschiedet hatte, verließ ich das Gebäude so schnell wie möglich. Draußen atmete ich zuallererst tief ein. Obwohl sich das Gebäude recht zentral in Eden befand, konnte ich das Meer riechen. Diese unvergleichliche Mischung aus Salz, Wasser und unendlicher Weite, die mich normalerweise sofort beruhigte, heute aber nicht gegen das beklemmende Gefühl in meiner Brust ankam. Der Brief meines Großvaters lag wie ein schweres Gewicht in meiner Hosentasche, brannte sich durch den Stoff in meine Haut und erinnerte mich erneut mit der Kraft einer Abrissbirne daran, dass Grandpa nicht mehr da war. Erst jetzt schien sich der Schockzustand zu lösen, der mich nach dem Anruf vor wenigen Tagen befallen hatte.
Ich war im Northern Territory unterwegs gewesen, als Mr Collards Büro mich kontaktierte. Dort sollte ich für ein Magazin die Leistenkrokodile fotografieren, die in Australien auch Salties genannt wurden, weil sie in Salzwasserregionen lebten. Eine mir unbekannte Stimme auf meiner Mailbox teilte mir mit, dass Grandpa einen zweiten Herzinfarkt gehabt hatte, an dem er leider verstorben war. Seitdem hatte ich mich in einer seltsamen Schockstarre befunden. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich nach Eden gekommen war, dabei hatte ich mich, direkt nachdem ich den Anrufbeantworter abgehört hatte, in meinen VW-Bus gesetzt und war losgefahren. Doch die Fahrt hierher verschwamm in einem Strudel aus Sorgen und schlechtem Gewissen. Hätte ich öfter bei ihm vorbeischauen sollen? Zwar hatte ich ihn nach dem ersten Herzinfarkt besucht, um ihm unter die Arme zu greifen, aber nach kaum einer Woche hatte er mich wieder rausgeschmissen. Es ginge ihm gut und er käme allein klar, waren seine Worte gewesen. Zwar hatten wir danach alle paar Tage telefoniert, wenn ich ausreichend Empfang gehabt hatte, aber mittlerweile fragte ich mich, warum ich seiner Aufforderung, mich wieder meinem eigenen Leben zuzuwenden, so bereitwillig Folge geleistet hatte. Ich hätte misstrauisch werden sollen – denn eigentlich war Grandpa nicht müde geworden zu betonen, dass er mich für seinen Geschmack zu wenig zu Gesicht bekam. Wahrscheinlich hatte er vor mir bloß keine Schwäche zeigen wollen.
Auf dem Weg zum Auto fischte ich ein Butterbrotpapier, das irgendwer achtlos zu Boden geschmissen hatte, auf und warf es in den nächstbesten Mülleimer. Warum die Menschen mit ihrem Dreck immer die Umwelt verschmutzen mussten, würde ich nie verstehen.
Erst als ich hinter dem Steuer saß, zog ich den Brief hervor. Er steckte in einem schlichten weißen Umschlag und sah so unschuldig aus, doch darin steckten die letzten Worte, die mein Großvater je an mich richten würde. Unweigerlich fragte ich mich, wann er diesen Brief verfasst hatte. Vor vielen Jahren, weil er gewusst hatte, dass dieser Tag irgendwann kommen würde und er vorbereitet sein wollte? Oder nach dem ersten Herzinfarkt, weil dieser ihm bewusst gemacht hatte, wie schnell es vorbei sein konnte?
Ohne weitere Umschweife riss ich den Umschlag auf und zog den gefalteten Zettel heraus. Nur eine halbe Seite war vollgeschrieben, und mit wild klopfendem Herzen begann ich zu lesen.
Mein lieber Cooper,
Es tut mir leid, dass ich dir das Moonlight mehr oder weniger aufgedrängt habe. Ich weiß, dass du es nie wolltest, mir war aber auch klar, dass du den Deal nicht ablehnen kannst. Mir geht es auch nicht um die Bar – auch wenn sie mein Lebenstraum war, kann ich damit nach meinem Tod nichts mehr anfangen –, mir geht es um dich. Du hast jetzt niemanden mehr. Ich weiß, du willst das nicht hören, weil du denkst, niemanden zu brauchen, aber das stimmt nicht. Jeder braucht Freunde, zumindest einen davon. Daher möchte ich, dass du dieses halbe Jahr in Eden bleibst, die Menschen hier kennenlernst und verstehst, dass nicht jeder gegen dich ist oder deinen Lebensstil nicht versteht. Ich will dich nicht davon abhalten, deinen Traum zu leben, ich weiß, wie viel dir das Fotografieren bedeutet. Aber du brauchst auch Menschen, zu denen du ab und zu zurückkommen kannst, die du um Hilfe bitten kannst, wenn es nötig ist. Und glaube mir, ich habe gelernt, dass für jeden irgendwann der Tag kommt, an dem es nötig ist.
Es war mir eine Ehre, dein Großvater zu sein!
In Liebe
Grandpa
Ich schnaubte, während gleichzeitig Tränen in meinen Augen brannten. Jeder Satz in diesem Brief war typisch mein Grandpa. Natürlich war es ihm nicht um das Moonlight gegangen, ich hätte von selbst draufkommen können. Jedes Mal, wenn ich in Eden war, hatte er versucht, mich dazu zu überreden, länger zu bleiben, öfter zu kommen und mir vor Ort Freunde zu suchen. Daher passte es zu ihm, dass er nun mithilfe dieses Deals das erreichen wollte, was er zu Lebzeiten nicht geschafft hatte.
Aber so gern ich meinen Großvater hatte … gehabt hatte, diesen Gefallen würde ich ihm nicht tun. Das Leben in einer Stadt – unter Menschen – war nichts für mich. Jedes Mal, wenn ich in Eden oder einer anderen Stadt war, durch die ich aufgrund meiner Arbeit reiste, war ich am nächsten Tag froh, wenn ich weiterziehen konnte. Menschen waren laut, unverschämt, teilweise gewalttätig und vor allem hinterhältig. Ganz im Gegensatz zu Tieren. Da wusste man immer, was einen erwartete, es gab keine bösen Überraschungen.
Daher würde mein Grandpa in diesem einen Fall leider nicht bekommen, was er sich wünschte. Ich war den Deal eingegangen und würde mich auch an die Abmachung halten. Regelmäßig würde ich in Eden sein, mich mit dem Moonlight vertraut machen und in der Zeit hoffentlich einen würdigen neuen Eigentümer dafür finden. Denn im Gegensatz zu meinem Großvater war mir daran gelegen, dass seine Bar in seinem Sinne weitergeführt wurde. Die restliche Zeit würde ich meiner eigenen Arbeit nachgehen und als freiberuflicher Fotograf Landschafts- und Tieraufnahmen für Magazine und Zeitschriften schießen. Und sobald die vereinbarten sechs Monate um waren, würde ich das Moonlight verkaufen, meine Sachen packen und Eden für immer den Rücken kehren.
Kapitel 2
Sophie
Ich betrachtete den kleinen Vogel in seinem Käfig und fühlte mich genauso eingesperrt wie er. Dabei hielt mich niemand gefangen. Es waren imaginäre Ketten, die mich an Eden banden.
Ich stellte das Glas, das ich gerade poliert hatte, in den Schrank und sah über die Theke hinweg zu meinen Freunden, die am selben Platz wie immer saßen. Liam hatte den Arm um meine beste Freundin Isabel gelegt, die ihren Kopf an seine Schulter lehnte. Sie waren der Grund, warum ich mich eingesperrt fühlte, dabei trugen sie überhaupt keine Schuld daran. Seit neun Monaten waren die beiden bereits ein Paar und seit zehneinhalb waren wir in Eden. Eigentlich hatte Eden nur eine Station von vielen auf unserer Reise durch Australien sein sollen, doch nachdem Isabel und Liam sich ineinander verliebt hatten, waren wir hiergeblieben. Und obwohl es nicht das gewesen war, was ich mir von dieser Reise erhofft hatte, hatten wir eine gute Zeit gehabt. Wir hatten großartige Freunde gefunden, die welche bleiben würden, auch wenn wir nach Deutschland zurückkehrten. Ich hatte in Australien viel über mich gelernt und war zu der Erkenntnis gekommen, dass ich unbedingt näher am Meer leben wollte. Trotzdem konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, etwas verpasst zu haben. Dass ich noch so viel mehr aus dieser Zeit hätte herausholen können, wenn ich nur mehr von diesem wunderschönen Land gesehen hätte. Zwar hatten wir einige Ausflüge gemacht – wir waren in Canberra gewesen, hatten einen Wochenendtrip nach Sydney unternommen und waren zum Pebbly Beach gefahren, wo wir Kängurus begegnet waren –, aber damit hatte ich in all den Monaten nur einen Bruchteil dieses riesigen Landes gesehen.
Mit einem Seufzen legte ich den Lappen zurück auf den Tresen und machte meine Runde durch das Moonlight, um zu sehen, ob einer der Gäste einen Wunsch hatte. Viel war heute nicht los, was auch der Grund war, warum ich allein war. Normalerweise waren wir immer mindestens zu zweit hier, aber ich hatte Grayson vor einer Stunde nach Hause geschickt, weil wir uns nur gegenseitig im Weg gestanden hatten. Außer der Ecke, in der meine Freunde saßen, waren nur zwei Tische besetzt, und die Stimmung im Raum war deutlich gedrückter als gewöhnlich. Was sicher damit zu tun hatte, dass Bobbys Beerdigung erst zwei Tage zurücklag. Noch immer sammelten sich Tränen in meinen Augen, wenn ich daran dachte. Ganz Eden war erschienen, um dem Besitzer des Moonlight die letzte Ehre zu erweisen. Es war eine ergreifende, schöne und zugleich unfassbar traurige Veranstaltung gewesen. Jeder in Eden hatte Bobby gekannt und wusste Anekdoten über ihn zu erzählen. Obwohl er mein Chef gewesen war, würde ich ihn auch als meinen Freund bezeichnen, und zu wissen, dass ich sein lautes Lachen nie wieder hören würde, machte mich trauriger, als ich mit Worten ausdrücken konnte.
Ich klapperte die besetzten Tische ab und landete schließlich bei meinen Freunden. Weil niemand einen Getränkewunsch geäußert hatte, setzte ich mich kurz zu ihnen. Auch ihre Stimmung war alles andere als ausgelassen. »Alles okay?«, fragte ich in die Runde.
Kilian drehte die Bierflasche in seinen Händen, das Etikett war bereits an mehreren Stellen abgeknibbelt. »Was passiert jetzt mit dem Moonlight?«
Das war die Frage, die seit Tagen wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen schwebte. »Keine Ahnung.« Wir wussten ja nicht einmal, ob wir das Moonlight weiterhin jeden Tag öffnen durften. Grayson, Hayden und ich hatten darüber diskutiert und schließlich beschlossen, dass wir so lange weitermachen würden, bis uns jemand etwas Gegenteiliges sagte.
»Was auch immer Bobby angeleiert hat, er wird nicht zulassen, dass die Bar geschlossen wird«, sagte Fotini mit Nachdruck. Ihre Haare waren vor Kurzem noch in einem knalligen Pink gefärbt, das mittlerweile zu einem zarten Rosa herausgewaschen war.
Liam drehte den Kopf zu Isabel, drückte ihr einen Kuss auf den Kopf, dann sah er mich an. »Ich meine mich zu erinnern, dass Bobby einen Enkel hatte, der auch eine Zeit lang bei ihm gewohnt hat. Vielleicht bekommt er die Bar übertragen.«
»Stimmt, da war jemand.« Alicia beugte sich auf den Ellbogen gestützt nach vorn und blickte skeptisch in die Runde. »Aber wie viel kann ihm an Bobby oder der Bar liegen, wenn er es nicht mal zu seiner Beerdigung geschafft hat?«
Stille senkte sich über unseren Tisch, und ich musste ihr insgeheim recht geben. Wer kam denn nicht zur Beerdigung seines Großvaters? Wenn meine Eltern mich jetzt anrufen und mir mitteilen würden, dass einer meiner Großeltern gestorben war, würde ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um rechtzeitig zurück in Deutschland zu sein.
»Vielleicht sollten wir nicht vorschnell urteilen«, sagte Kilian. »Wir kennen ihn nicht und wissen nicht, was ihn aufgehalten haben könnte.«
»Hmm«, machte Alicia, wirkte aber nicht überzeugt.
»Wir können das Rätsel eh nicht lösen, bevor er nicht hier ist … oder irgendwer anders, dem Bobby die Leitung des Moonlight übertragen hat.« Kate trank ihr Glas in einem Zug leer und schob es zu mir. »Bekomme ich noch eins?«
Ich nahm es entgegen und griff nach drei weiteren leeren Gläsern, die auf dem Tisch verteilt standen. »Will sonst noch jemand was?« Isabel bestellte ein Root Bier, der Rest verneinte, und so ging ich zur Theke zurück.
Während ich die Biere für Isabel und Kate zapfte, wurde mir bewusst, wie viel seit unserer Ankunft in Eden passiert war. Dem Koalareservat, das Liam und seine Eltern führten, ging es damals sehr schlecht. Liam hatte kaum genug Spenden reinbekommen, um die kommende Woche zu überstehen. Erst Isabel hatte es mit ihrem Marketingplan geschafft, für neue Einnahmen zu sorgen, von denen erst vor Kurzem das dritte Koalagehege fertiggestellt werden konnte. Generell war Liam viel lockerer geworden. Er verbrachte nicht mehr den Großteil des Tages eingesperrt in seinem Büro. Er machte früher Feierabend, lachte viel mehr als anfangs und hatte sich sogar mit Social Media angefreundet. Zwar reichte er immer noch Isabel das Handy, wenn es um das Löschen unliebsamer Kommentare ging, doch das regelmäßige Posten beherrschte er mittlerweile wie ein Profi. Auch Fotini hatte durch Isabels Hilfe Aufmerksamkeit für ihre erste Kollektion bekommen. Ihre Stunden in der Boutique hatte sie reduziert, um mehr Zeit für ihre eigenen Designs zu haben. Zwar machte sie noch immer alles von zu Hause aus, aber wenn es weiterhin so gut lief, könnte sie bald eine kleine Wohnung anmieten, die sie als Atelier benutzen wollte.
Erneut fühlte ich mich irgendwie überflüssig, denn während Isabel das Leben unserer Freunde nachhaltig verändert hatte, hatte ich bloß als Kellnerin gejobbt und davon abgesehen nichts erreicht. Dabei war es gar nicht meine Absicht gewesen, in meiner Zeit in Australien etwas zu erreichen. Ich hatte das Land sehen, jeden versteckten Winkel erkunden wollen, aber dazu war es nicht gekommen. Ich nahm es Isabel nicht übel, dass sie bei Liam hatte bleiben wollen, an ihrer Stelle wäre es mir vermutlich genauso gegangen. Ich gönnte den beiden das Glück von ganzem Herzen, weil sie wirklich wundervoll zusammenpassten.
Ohne Isabel hatte ich nicht weiterziehen wollen, keine Sekunde hatte ich gezögert und mich ebenfalls zum Bleiben entschieden. Doch nun verspürte ich zunehmend diesen inneren Drang, noch irgendeinen meiner ursprünglichen Pläne durchzuziehen, und sei es nur eine einzige Sache.
Ich brachte die Biere zu Isabel und Kate und nahm weitere Bestellungen von Liam und Kilian auf, die jetzt doch Nachschub wollten. Auf dem Weg zurück zur Theke klapperte ich erneut die besetzten Tische ab. Nummer sieben wollte zahlen, die anderen waren noch wunschlos glücklich. Ich kassierte ab, bedankte mich für das Trinkgeld, dann deckte ich den frei gewordenen Tisch ab und ging zurück hinter die Theke.
Ich spülte gerade die benutzten Gläser ab, als die Tür zum Moonlight aufgestoßen wurde und ein Typ hereinkam, der mir auf den ersten Blick den Atem raubte. Er hatte dunkelbraune Haare, die am Hinterkopf zu einem Man-Bun gebunden waren, und einen ebenso dunklen Fünftagebart. Seine braunen Augen waren aufmerksam und scannten den ganzen Raum. Er schien viel Zeit draußen zu verbringen, so gebräunt wie seine Haut selbst jetzt im Frühling war, wo sich die Temperaturen nur um die Zwanziggradmarke bewegten. Eine ausgeblichene Jeans hing tief auf seinen Hüften, und sein enges T-Shirt betonte ausgeprägte Muskeln. Um sein rechtes Handgelenk hingen einige Armbänder mit Holzperlen, und beide Arme waren von oben bis unten tätowiert.
Während er sich wachsam im Moonlight umsah, konnte ich meinen Blick nicht von ihm lösen. Ich hatte ihn nie zuvor hier gesehen – und jemand wie er wäre mir definitiv aufgefallen. Vermutlich war er ein Tourist auf der Durchreise.
Dann ging ein Ruck durch ihn, und er kam auf mich zu. Mein Herz begann wie wild zu klopfen, als er mich mit seinen stechend braunen Augen fixierte. Ich umklammerte das Glas, das ich längst nicht mehr spülte, und schluckte, als Mr Hottie auf der gegenüberliegenden Seite der Theke stehen blieb.
»Wer hat denn hier das Sagen?«, fragte er ohne jegliche Begrüßung. Seine Stimme war genauso anziehend wie der Rest von ihm, tief und leicht kratzig, aber irgendwas an der Art und Weise, wie er durch mich hindurchzusehen schien, irritierte mich.
Automatisch drückte ich den Rücken durch. »Aktuell ich.« Genau genommen hatte hier momentan niemand wirklich das Sagen, weil Bobby sich immer um alles gekümmert hatte, aber das würde ich diesem Typen sicher nicht auf die Nase binden. Vielleicht war er vom Ordnungsamt und würde den Laden jetzt endgültig schließen, wie wir es bereits befürchtet hatten, aber bis dahin wollte ich mir vor ihm keine Blöße geben.
Er betrachtete mich mit verengten Augen und versuchte, einen Blick hinter mich in den Durchgang zu Bobbys Büro zu werfen. »Außer dir ist niemand hier?«
Ich schluckte und schüttelte den Kopf. »Wie du siehst, ist kaum etwas los, das schaffe ich auch allein.« Ob er mich wohl für unfähig hielt, die paar Gäste ohne Hilfe zu bedienen? Oder gab es irgendeine Verordnung, von der ich nichts wusste, die besagte, dass in einer Bar mindestens zwei Mitarbeitende anwesend sein mussten? Mein Vater arbeitete auf dem Bau, und dort war es ähnlich. Niemand durfte allein auf der Baustelle arbeiten, damit immer jemand da war, der Hilfe holen konnte, falls es zu einem Unfall kam.
»Aber du kennst dich hier aus und könntest mir alles zeigen?«
Ich blinzelte und fragte mich im ersten Moment, ob ich mich verhört hatte, weil ich so ziemlich mit allem gerechnet hatte, nur nicht damit.
Er musste mir meine Verwirrung angesehen haben, denn er seufzte und rieb sich über die Augen. »Sorry, langer Tag, fangen wir noch mal von vorne an?«
»Klar.«
Über den Tresen hinweg reichte er mir die Hand. »Hey, ich bin Cooper, Bobbys Enkel. Er hat mir diese verdammte Bar vererbt, und ich hab keinen blassen Schimmer, was ich damit anfangen soll.«
Mir klappte die Kinnlade herunter. Das war Bobbys Enkel, von dem die anderen zuvor schon überlegt hatten, ob er das Moonlight übernehmen würde. Für einen Moment konnte ich ihn nur anstarren. Ich wusste nicht, warum, aber irgendwie hatte ich ihn mir anders vorgestellt. Weniger heiß und mehr wie ein Arschloch. Welcher Enkel ließ sich denn nie bei einem Großvater wie Bobby blicken und schaffte es nicht einmal zu seiner Beerdigung?
Cooper räusperte sich, und erst da fiel mir auf, dass ich ihn schon viel zu lange sprachlos anstarrte. Er stand immer noch vor mir und hielt mir die Hand hin, und ich beeilte mich, danach zu greifen. »Sophie«, stellte ich mich vor. Seine Haut war unfassbar weich, an den Fingerkuppen konnte ich leichte Verhärtungen spüren, als würde er Gitarre spielen – oder als hätte er es zumindest einmal getan.
»Was hast du denn jetzt mit dem Moonlight vor?«, fragte ich geradeheraus. Wenn er nur hier war, um die Bar schnellstmöglich an den Meistbietenden zu verkaufen, wollte ich das lieber sofort wissen.
Er seufzte schwer, als würde ihm die Antwort alles abverlangen, und setzte sich auf einen der Barhocker. »Erst mal hierbleiben und lernen, was alles zu machen ist. Dann einen Nachbesitzer finden, der das Moonlight im Sinne meines Grandpas weiterführen würde.« Mit einem Mal sackten seine Schultern herab, und eine große Traurigkeit legte sich auf seine Züge. Es war, als hätte er eine Maske abgenommen. Eine, die zu tragen sehr anstrengend gewesen war.
Nachdenklich zog ich meine Unterlippe zwischen die Zähne und entschloss mich, mit der Wahrheit weiterzumachen. »Deshalb haben wir das Moonlight weiter geöffnet, obwohl wir nicht sicher waren, ob wir es rechtlich dürfen. Aber Bobby hätte es so gewollt.«
Cooper hob den Kopf, und sein Blick traf mich wie eine Wucht. Hatte ich zuvor noch gedacht, er würde nicht um seinen Großvater trauern, weil er nicht zur Beerdigung erschienen war, zeigte sich mir nun ein anderes Bild. Da waren so viel Schmerz und Schuld in seinen Augen, dass ich ihm mitfühlend die Hand auf den Arm legen wollte, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten.
»Hätte er auch. Aber nicht wegen sich oder der Bar, sondern wegen euch. Grandpa hat das Moonlight geliebt, weil er damit den Leuten in Eden einen Platz gegeben hat, zu dem sie immer kommen konnten. Wo jeder willkommen war, ohne verurteilt zu werden. Er hat nie gewollt, dass die Bar nur für einen Tag schließt. Er würde nicht mal wollen, dass wir um ihn trauern, aber darauf hat er natürlich keinen Einfluss.«
»Natürlich«, murmelte ich zu mir selbst. Alles, was Cooper über Bobby sagte, passte zu hundert Prozent zu dem Mann, den ich als meinen Chef kennengelernt hatte. Er hatte sich immer mehr um andere als um sich selbst gesorgt, und hatte das Moonlight als sicheren Hafen für jeden angesehen, der Zuflucht suchte.
»Und genau deswegen muss sehr genau überlegt werden, wer das Moonlight übernehmen soll.«
Warum machst du es nicht selbst?, rutschte es mir fast heraus. Wie gut, dass ich mich gerade noch zurückhalten konnte, denn das wäre anmaßend gewesen. Ich kannte Cooper nicht, wusste nicht, welches Leben er führte und was er vielleicht eh schon aufgab, um jetzt hier zu sein. Und egal, wie sehr er seinen Opa geliebt hatte, niemand konnte von ihm verlangen, diesen Lebenstraum weiterzuführen, der nicht sein eigener war.
»Wir kriegen das schon hin«, sagte ich mit mehr Zuversicht, als ich empfand.
Er stützte sich mit den Ellbogen auf der Theke ab und lehnte sich ein Stück näher zu mir. »Bevor wir damit anfangen, machst du mir ein Bier?«
»Klar.« Das erinnerte mich daran, dass auch die Getränke für meine Freunde noch nicht fertig waren und ich generell einen Job in dieser Bar zu erledigen hatte.
Schnell zapfte ich ein Bier für Cooper und stellte es vor ihm auf den Tresen, dann kümmerte ich mich um die Bestellungen meiner Freunde. Überdeutlich spürte ich dabei Coopers Blicke auf mir, die jeden meiner Handgriffe verfolgten. Ich versuchte, ihn bestmöglich auszublenden, weil er mich nervös machte. Sah er mich einfach nur an, weil ich direkt vor ihm stand? Interessierte ihn, wie die Arbeit erledigt wurde, weil er das ab jetzt mit übernehmen musste? Oder wollte er insgeheim prüfen, ob ich sie überhaupt korrekt erledigte? Ich wusste es nicht, konnte die Antwort auch nicht in seiner Miene lesen, und das trieb mich in den Wahnsinn.
Als ich endlich die Getränke von Liam und Kilian zubereitet hatte und mit ihnen zum Tisch von Isabel und den anderen ging, atmete ich erleichtert durch. »Sorry, ich wurde aufgehalten«, sagte ich zu meinen Freunden und stellte die Getränke vor ihnen ab.
Isabel sah an mir vorbei in Richtung Tresen. »Kein Problem. Was ist das für ein Typ? Ihr scheint ein intensives Gespräch geführt zu haben.«
Mit der Hüfte lehnte ich mich gegen die Tischkante. »Das ist Cooper, Bobbys Enkel. Ihr hattet recht, er wird das Moonlight vorerst übernehmen.«
Ruckartig sahen alle in seine Richtung und begannen gleichzeitig zu reden. Ich wartete, bis ihre Überraschung abgeebbt war, dann erzählte ich ihnen, worüber ich mit Cooper gesprochen hatte.
»Wenigstens will er den Laden nicht an irgendwen verkaufen, um möglichst viel Kohle zu scheffeln.« Liam sah noch immer skeptisch aus.
Kilian schlug ihm gegen den Oberarm. »Wir sollten ihm eine Chance geben.«
»Die muss er sich erst mal verdienen.«
»Genau«, stimmte Fotini zu. »Wie wichtig kann ihm Bobby schon gewesen sein, wenn er sich hier nie hat blicken lassen?«
Das bestätigte meine Vermutung. »Ihr habt ihn also noch nie gesehen?«
Einstimmiges Kopfschütteln am Tisch.
»Das muss nix heißen«, entgegnete Kate. »Nur weil er nie im Moonlight war, muss das ja nicht bedeuten, dass er Bobby nie besucht hat. Außerdem wird Bobby sich schon was dabei gedacht haben, ihm die Bar zu vermachen. Ich bin bei Kilian, wir sollten ihm eine Chance geben.«
»Uns bleibt ja nichts anderes übrig.« Liam verschränkte die Arme vor der Brust und sah aus, als würde ihm das nicht gefallen.
Ich stand auf und nahm das Tablett vom Tisch. »Ich geh mal zurück und schau, ob ich etwas mehr aus ihm herausbekommen kann.«
Kapitel 3
Cooper
Ich betrachtete Sophie, die an dem einzigen vollbesetzten Tisch lehnte. Immer wieder sahen ihre Freunde zu mir rüber, was wohl belegte, dass sie über mich redeten. Nicht, dass das irgendwie verwunderlich war. In Eden galt ich als der verlorene Enkel, und nur die wenigsten wussten, dass ich überhaupt regelmäßigen Kontakt zu meinem Großvater gehalten hatte. Dass ich sogar mal eine Zeit lang bei ihm gewohnt hatte, war den meisten gar nicht klar – oder sie hatten es verdrängt. Dazu musste ich gestehen, dass ich es ihnen leicht gemacht hatte. Ich hatte mich aktiv aus den Angelegenheiten von Eden rausgehalten, war nie runter in die Bar gekommen, wenn ich meinen Grandpa besucht hatte, und hatte sonst mit niemandem gesprochen. Andere Menschen und ich … das war eine schwierige Sache, weshalb ich mich möglichst von ihnen fernhielt. Da durfte ich mich nicht beschweren, wenn die Leute aus Eden mir nun mit Skepsis begegneten. Die ja sogar berechtigt war. Auch wenn ich das Moonlight in guten Händen wissen wollte, war es nicht mein Plan zu bleiben. Sechs Monate, so stand es in dem Vertrag, dann wäre ich sofort wieder weg.
»Sorry, dass es so lange gedauert hat.« Sophie erschien in meinem Blickfeld, klemmte sich eine rotblonde Haarsträhne hinter das Ohr und stellte das Tablett vor sich ab. Ihre warmen braunen Augen musterten mich über die Theke hinweg. Ich versuchte, den Argwohn darin zu entdecken, mit dem mir so viele andere begegneten, konnte aber nichts als ehrliche Neugier finden.
Meine Mundwinkel hoben sich, aber das Lächeln fühlte sich bitter an. »Ich kann schon verstehen, dass es viel über mich zu reden gibt.«
Sie hob die Schultern. »Bis gerade hatten wir Angst, dass das Moonlight in absehbarer Zeit schließen müsste. Dass es verkauft wird und hier ein Wohnkomplex, eine Mall oder was auch immer entsteht. Es ist wirklich eine gute Sache, dass du da bist und einen würdigen Nachfolger für Bobby finden willst.« Sie legte die Stirn in Falten und schüttelte den Kopf. »Wobei niemand Bobby ersetzen kann.«
Es war nett, dass sie das sagte, aber ich war trotzdem nicht davon überzeugt, dass alle in Eden mich mit offenen Armen empfangen würden. Allerdings wollte ich das vor Sophie nicht zu genau erläutern. Sie schien bisher keine Vorbehalte mir gegenüber zu haben, und dabei wollte ich es belassen. Also ging ich auf ihren Akzent ein, der mir schon von Anfang an aufgefallen war. »Du bist nicht von hier, oder?«
Leichte Röte kroch ihren Hals empor. »Nein, ich bin aus Deutschland und mache gerade ein Work-and-Travel-Jahr in Australien.«
»Nicht schlecht. Was hast du schon alles gesehen?«
Jetzt färbten sich auch ihre Wangen dunkel. »Na ja, die meiste Zeit habe ich ehrlich gesagt in Eden verbracht. Und bald reisen wir schon wieder ab. Also, zurück nach Hause.« Ihr Blick richtete sich auf etwas hinter meiner Schulter, vermutlich den Tisch mit ihren Freunden. »Ich bin mit meiner besten Freundin Isabel hier, die sich in diesen Koalaretter verliebt hat, auf dessen Reservat wir gearbeitet haben. Da ist die Entscheidung, hierzubleiben anstatt weiterzuziehen, leichtgefallen.«
Es kam mir vor, als wäre es nur die halbe Wahrheit. Da war ein Unterton in ihrer Stimme, der ihre Worte Lügen strafte. »Bereust du es?«
»Nein«, sagte sie sofort. Ein bisschen zu schnell und zu vehement, was ihr selbst aufzufallen schien. Mit einem Seufzen zog sie den Hocker zu sich und setzte sich mir gegenüber hin. »Doch, schon«, gestand sie. »Zumindest ein bisschen. Dieses Jahr sollte ein großes Abenteuer für mich werden, bevor ich meinen Master mache und dann anfange zu arbeiten. Ich hatte eine ellenlange Liste, was ich alles von Australien sehen will, doch die ist jetzt leider für die Tonne.«
»Wie lange bleibt ihr noch?«
»Sechs Wochen etwa.«
»Dann hättest du noch genug Zeit.« Klar würde sie nicht mehr alles sehen können, was sie sich vorgenommen hatte, aber das würde mich an ihrer Stelle nicht davon abhalten, es zumindest zu versuchen.
Sophies Stimme klang melancholisch. »Ich habe drüber nachgedacht, allein aufzubrechen, aber ehrlich gesagt ist das nichts für mich.« Ihre Miene machte deutlich, dass sie nicht weiter darüber reden wollte, dabei hätte es vieles gegeben, das ich dazu gern losgeworden wäre. Wenn man allein unterwegs war, eröffneten sich einem viel mehr Möglichkeiten. Man war ungebunden, musste sich nicht anderen unterordnen und konnte seine volle Aufmerksamkeit auf das richten, weswegen man aufgebrochen war. Niemand konnte einen davon abhalten, irgendwo länger zu bleiben als geplant oder frühzeitig weiterzuziehen, wenn es einem nicht gefiel. Die Möglichkeiten waren unendlich, und ich war immer dafür, es zumindest auszuprobieren, trotzdem sagte ich nichts davon. Denn das war eins der Dinge, die mich seltsam machten. Zumindest gaben mir andere immer das Gefühl, seltsam oder zumindest anders zu sein, wenn ich ihnen erzählte, dass allein reisen etwas Gutes war, etwas, das sie unbedingt ausprobieren sollten. Außerdem ging es mich nun wirklich nichts an, warum Sophie das nicht getan hatte.
Ich sah zu dem Vogel, der in einem Käfig hinter Sophie auf dem Tresen stand, und wechselte das Thema. »Ist das nicht Bobbys Vogel?«
»Ja. Grayson hat ihn runtergeholt, weil …« Sie verstummte und senkte den Blick auf ihre Hände, die sie im Schoß wrang. »Wir wollten ihn oben nicht allein lassen, aber auch nicht jeden Tag hochgehen, um ihn zu füttern. Wir wussten ja überhaupt nicht, was mit dem Moonlight und Bobbys Wohnung geschieht. Deshalb haben wir beschlossen, erst mal business as usual zu machen, bis uns jemand was anderes sagt.«
»Hattet ihr denn niemanden, der euch hilft?« Mit zusammengekniffenen Augen taxierte ich Sophie. Ich schätzte sie auf Anfang zwanzig, und als Work-and-Travellerin konnte sie maximal als Aushilfe eingestellt sein. Aber Grandpa musste doch auch eine Vertretung gehabt haben. Jemanden, der sich um alles gekümmert hatte, wenn er mal krank wurde. Er war über sechzig gewesen, da konnte er den Laden doch nicht mehr allein geschmissen haben.
Mit einem Mal straffte sie die Schultern. »Wir kennen uns hier gut aus, das kriegen wir auch allein hin. Klar war Bobbys bester Kumpel Jenkins hier, um uns zu unterstützen. Von ihm haben wir auch den Generalschlüssel für die Wohnung und das Lager bekommen, wir hatten nur den für die Bar. Ansonsten hat Bobby sich schwer damit getan, die Kontrolle abzugeben. Er hat immer aus dem Hintergrund die Fäden gezogen und musste jeden Abend in der Bar sein, um zu kontrollieren, ob alles seine Richtigkeit hat.«
Ich unterdrückte einen Fluch. Das war typisch mein Grandpa. Vor einigen Jahren hatten wir mal eine Diskussion geführt, weil ich der Meinung gewesen war, dass er langsam etwas kürzertreten sollte. Seit dem Tod meiner Grandma hatte ich das Gefühl gehabt, dass er sich viel mehr in die Arbeit stürzte, als gut für ihn war. Ich hatte gehofft, er hätte sich meine Argumente zu Herzen genommen, aber das war wohl nicht der Fall gewesen.
Sophie redete weiter und bestätigte meinen Verdacht. »Nach seinem ersten Herzinfarkt im letzten Jahr haben wir ihm geraten, es ruhiger angehen zu lassen. Grayson hatte sogar einen Plan erstellt, wie wir den Laden am Laufen halten, ohne dass Bobby jeden Abend runterkommen muss. Dreimal die Woche, war unser Vorschlag. Wir dachten, es würde ihm guttun und dass er etwas abschalten könnte, wenn er sieht, dass der Laden auch ohne ihn läuft, aber … na ja …« Etwas hilflos zuckte sie mit den Schultern.
»Lass mich raten, er hat keine Woche durchgehalten?«
»Drei Tage.« Ein wehmütiges Lächeln umspielte ihre Lippen. »Er hat es drei Tage ausgehalten, dann war er wieder jeden Tag unten, als wäre nichts geschehen.«
Ich seufzte. Wann immer ich mit Grandpa gesprochen hatte, hatte es anders geklungen. Jedes Mal hatte ich ihn gefragt, ob er sich auch genug schonte, und er hatte behauptet, weniger Stunden in der Bar zu verbringen. Offensichtlich hatte er mich damit nur beruhigen wollen, wenn ich Sophies Bericht Glauben schenkte. Und das tat ich.
»Ich frage mich, ob wir nicht vehementer hätten sein sollen«, sagte sie jetzt. »Vielleicht hätten wir …«
»Tu das nicht«, unterbrach ich sie. »Bobby war ein erwachsener Mann, der es gewohnt war, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ihr hättet nicht verhindern können, was geschehen ist, und das war auch nicht eure Aufgabe.« Wenn überhaupt, wäre es meine gewesen, aber ich war viel zu selten hier gewesen, um die Anzeichen zu erkennen. Und um ehrlich zu sein, hätte ich sie vermutlich auch gar nicht sehen wollen. Grandpa war mir immer unverwüstlich erschienen. Wie ein Fels in der Brandung war er damals eingesprungen und hatte mich zu sich geholt, als ich sonst niemanden mehr gehabt hatte. Doch das war mittlerweile sieben Jahre her. Ich hatte einfach nicht sehen wollen, dass er Hilfe benötigte. Ich atmete gegen die plötzlich wiederkehrende Enge in meiner Brust an. Eine Mischung aus Trauer und Schuldgefühlen lastete auf mir, und ich machte mir selbst bittere Vorwürfe, dass ich nicht regelmäßiger bei Grandpa vorbeigekommen war. Natürlich war es müßig, im Nachhinein darüber nachzudenken – was mein Gehirn aber nicht davon abhielt, genau das zu tun.
»Das weiß ich«, riss Sophies Stimme mich aus meinen Gedanken. »Ich gebe mir auch nicht die Schuld an dem, was passiert ist. Aber ist es nicht normal, dass man sich fragt, ob man etwas hätte tun können, das einen Unterschied gemacht hätte?« Sie sah mich direkt an. Ihre hellbraunen Augen waren wachsam und schienen viel mehr mitzubekommen, als mir lieb war. Mir wurde heiß, gleichzeitig raste ein kalter Schauder über meinen Rücken, und ich stand abrupt auf.
»Komm, wir bringen den Vogel raus.«
Sie blinzelte verständnislos. »Was?«
»Der Vogel.« Ich deutete auf den Käfig hinter ihr. »Er sollte nicht eingesperrt sein. Wir lassen ihn draußen frei.«
Eine steile Falte bildete sich auf ihrer Stirn. »Kann er denn überleben, nachdem er jahrelang bei Bobby versorgt wurde?«
Ihre Besorgnis brachte mich zum Lächeln. Gefühlt das erste Mal, seit ich von Grandpas Tod erfahren hatte. »Kann er. Es gibt natürlich keine Gewissheit, dass er nicht von einem anderen Greifvogel gefressen wird, aber das ist der Lauf der Dinge. Auf jeden Fall sollte er nicht in einem Käfig in dieser Bar leben, das ist nicht die richtige Umgebung für ihn.«
Sie seufzte. »Du hast ja recht. Bei Bobby durfte er frei in der Wohnung fliegen, aber wir wollten ihn dort einfach nicht komplett allein lassen.« Beherzt griff sie nach dem Käfig und hob ihn vom Tresen. »Bringen wir ihn raus.«
Ich rutschte vom Stuhl und folgte Sophie auf den Parkplatz. Der Himmel war heute bewölkt, trotzdem war ersichtlich, dass die Dämmerung bereits eingesetzt hatte. Langsam wurde es dunkel, und in einer Stunde wäre die Sonne komplett untergegangen. Ein frischer Wind wehte vom Meer aufs Land und ließ mich in meinem T-Shirt frösteln, das tagsüber noch ausreichend für die Temperaturen gewesen war.
Sophie ging zielstrebig zu der Mauer, die den Parkplatz eingrenzte. Heute standen nur wenige Autos hier, die meisten davon Kleinwagen, was meinen Bus besonders auffällig herausstechen ließ. Doch Sophie beachtete ihn gar nicht. All ihre Aufmerksamkeit lag auf dem kleinen grünen Vogel im Käfig, den sie gerade auf der Mauer absetzte. Sie sagte etwas zu ihm, das ich nicht verstehen konnte, dann öffnete sie die Käfigtür und trat einen Schritt zurück.
Zuerst passierte nichts. Der Vogel blieb auf seiner Stange sitzen und betrachtete das offene Türchen skeptisch, als wüsste er nicht, was er damit anfangen sollte. Vielleicht fragte er sich, wo der Haken an der Sache war, dass ihn plötzlich jemand in die Freiheit entlassen wollte. Vielleicht war er aber auch einfach von der aktuellen Perspektive verwirrt, kannte er den Parkplatz doch nur vom Fenster aus.
Unwillkürlich zuckte mein Blick nach oben zu der Wohnung, die über dem Moonlight lag. Fast erwartete ich, eine Bewegung hinter einem der Fenster zu erkennen, so wie es früher oft der Fall gewesen war, wenn ich zu Besuch gekommen war. Doch natürlich war da nichts. Es brannte nicht einmal irgendwo Licht, die ganze Wohnung lag im Dunkeln.
Wieder dieses Ziehen in meiner Brust, und die Erkenntnis, dass Grandpa nie wieder irgendwo Licht entzünden würde, traf mich wie eine Wucht. Er würde nie wieder hier stehen und zu seiner Wohnung hochschauen, wie ich es gerade tat. Nie wieder das Moonlight betreten, das er über alles geliebt hatte, und mich nie wieder in seine Arme ziehen, wenn wir uns nach längerer Zeit wiedersahen.
»Da, er kommt raus.«
Erneut war es Sophies Stimme, die mich in die Realität zurückholte. Ich sah zu ihr, betrachtete sie in ihrer engen schwarzen Jeans und dem fliederfarbenen T-Shirt. Auf ihren Armen hatte sich eine Gänsehaut gebildet, doch das schien sie gar nicht zu stören. Entzückt betrachtete sie den kleinen Vogel, der soeben auf das Dach seines Käfigs gekrabbelt war und seine Federn aufplusterte. Keine Sekunde später setzte er zum Sprung an, breitete die Flügel aus und erhob sich in die Luft. Ich sah ihm nach, wie er zuerst zu einem Eukalyptusbaum flog, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand, und kurz darauf über die angrenzenden Häuser hinweg in Richtung Wald verschwand.
»Mach’s gut, kleiner Freund«, murmelte Sophie, dann griff sie nach dem Käfig und wandte sich mir zu. »Komm, wir bringen den weg, dann kann ich dir schon mal das Lager und den Abstellraum zeigen.«
Ich nickte und folgte ihr. Das war tatsächlich ein Bereich, den ich noch nicht kannte. Früher hatte Grandpa nicht zugelassen, dass ich im Moonlight aushalf, weil er nicht nur der Meinung gewesen war, dass ich mich auf die Schule konzentrieren sollte, sondern zudem nicht wollte, dass ich als Minderjähriger mit Alkohol hantierte. Stattdessen hatte er mir meine erste Kamera geschenkt, und ich hatte die Nationalparks in der Umgebung unsicher gemacht. Nach meinem Abschluss hatte es mich dann in die Weiten Australiens gezogen, und wenn ich zu Besuch hier gewesen war, hatte ich kein Interesse daran gehabt, das Moonlight zu betreten. Ich hatte Grandma und Grandpa besucht, war aber oben in ihrer Wohnung geblieben.
Sophie führte mich zu dem Durchgang hinter der Theke, der mir zuvor schon aufgefallen war. Ein schmaler Flur, von dem etliche Türen abgingen, empfing uns.
»Hier sind die Umkleiden des Personals.« Sie deutete auf die erste Tür zu unserer Linken. »Hier rechts ist die Küche, die heute nicht besetzt ist, weil so wenig los ist. Wir haben eine recht klassische Speisekarte mit überwiegend Burgern und Fingerfood. Einmal im Monat veranstalten wir ein Barbie, das wird dann draußen auf der Terrasse aufgebaut.«
Neugierig öffnete ich die Tür und warf einen Blick in die Küche. Alles war unheimlich sauber und aus Stahl. Lange glänzende Tische, die zur Zubereitung dienten, und vier Kochinseln auf der gegenüberliegenden Seite. »Sieht ziemlich verlassen aus«, kommentierte ich trocken, was Sophie zum Lachen brachte.
»Wenn hier Hochbetrieb herrscht – vor allem am Wochenende, wenn Rugbyspiele sind, oder im Sommer, wenn es vor Touristen in Eden wimmelt –, sieht es völlig anders aus. Die Lautstärke treibt dich in den Wahnsinn.«
Fragend zog ich die Augenbrauen hoch, und sie hob die Schultern. »In der Küche wird nicht zimperlich miteinander umgegangen, dafür muss man gemacht sein.«
Mehr erklärte sie nicht, aber ich vermutete, dass ich es bald ohnehin selbst erleben würde.
Wir schlossen die Tür und gingen weiter den Flur entlang. »Hier ist ein kleiner Fundraum.« Sophie deutete nach links. »Alles, was Gäste liegen gelassen haben und wir nach der Schließung finden, kommt hier rein. Oftmals wird es nach wenigen Tagen abgeholt, aber manchmal, besonders wenn Touristen es vergessen haben, bleibt etwas liegen. Was nach zwei Wochen nicht abgeholt wurde und noch in einem guten Zustand ist, wird wohltätigen Organisationen gespendet.«
Hinter der nächsten Tür befand sich Grandpas Büro. Wir traten ein. Es war ein schmaler Raum, die Wände waren in einem hellen Beige gestrichen. Links stand ein Bücherregal, das auf den ersten Blick mit allerlei Sachbüchern vollgestellt war. Ein großes Fenster ging zum Meer hinaus, und davor befand sich ein großer Schreibtisch mit Computer und allerlei Akten.
»Sorry für das Chaos«, sagte Sophie. »Wir haben die letzten Tage damit verbracht, die wichtigsten Papiere zusammenzusuchen, damit alle Rechnungen pünktlich bezahlt werden. Wir wussten nicht genau, wo Bobby alles abgelegt hat.«
»Er hat immer noch alles allein gemacht? Selbst nach dem ersten Herzinfarkt?«
Sie stieß die angehaltene Luft aus. »Er meinte, das würde nicht wieder passieren, und wenn doch, dass er das rechtzeitig merkt und uns dann alles übergeben könne.«
»Natürlich dachte er das.« Ich kniff in meine Nasenwurzel und schloss für einen Moment die Augen. Diese Sturheit war etwas, das in meiner Familie angeboren war, aber es kam mir zusätzlich so vor, als wäre sie bei Grandpa in den letzten Jahren ausgeprägter geworden. Es passte auch einfach perfekt zu ihm, dass er niemanden in das Heiligtum seiner Arbeit einweihte.
»Ich habe mittlerweile einen ziemlich guten Überblick. Wir können uns die Tage gern zusammensetzen, dann zeige ich dir alles.« Sophie, die noch immer den Käfig in der Hand hielt, wandte sich zum Gehen, und ich folgte ihr aus dem Raum.
Jetzt lag nur noch eine Tür am Ende des Flurs vor uns, hinter der sich das Lager befinden musste. Zielstrebig ging Sophie darauf zu und zog die Tür auf. Der Raum, der sich dahinter erstreckte, war deutlich größer, als ich zuvor vermutet hatte. Auf der linken Seite stapelten sich Getränkekisten bis fast unter die Decke. Daneben gab es Regale, in denen aller möglicher Kram gelagert war. Servietten, Strohhütchen und Schirmchen für Getränke, Strohhalme aus Glas und diverse Dekomaterialien für die verschiedensten Themenabende. Boxen mit Gläsern, Tellern und Besteck, wenn mal was kaputtging, drei große Grills und zusammenfaltbare Tische, die vermutlich für das Barbie genutzt wurden.
Sophie stellte den Käfig in einer Ecke ab, wo niemand darüberfallen konnte, dann steuerte sie eine Tür an, die mir erst auffiel, als sie direkt davorstand.
»Hier geht es ins Kühllager.« Sie trat ein, und ich beeilte mich, ihr zu folgen. »Das ist die kritische Zone. Hier muss jeden Abend Bestandsaufnahme gemacht werden. Was muss nachbestellt werden, was ist nicht mehr frisch genug, um am nächsten Tag verwendet werden zu können. Bobby war fast jeden Tag am Hafen und auf dem Markt, um Nachschub zu holen. Fleisch wird von einer nahe gelegenen Ranch einmal die Woche geliefert.«
Ich ließ meinen Blick durch den großen Kühlraum wandern. In Stahlregalen wurden Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch gelagert, dazu diverse Teige und Soßen, Butter, Milch und was man sonst noch für die Zubereitung der Speisen im Moonlight brauchte. Allein dieses Lager überforderte mich komplett. Das einzige »Kochen«, mit dem ich mich auskannte, war das Aufwärmen von Dosenmahlzeiten auf meinem Campingkocher oder die Zubereitung einfacher Suppen. Bei den meisten Gerichten wusste ich nicht mal, welche Zutaten dafür verwendet wurden – oder wie viel gebraucht wurde.
»Ich werde mir das niemals alles merken können«, rutschte es mir heraus.
Sophie drehte sich zu mir um und schenkte mir ein Lächeln, bei dem mir merkwürdigerweise gleich etwas zuversichtlicher zumute wurde. »Ich werde dir eine Liste erstellen, auf der alles Wichtige draufsteht. Du wirst keine Probleme haben, wenn du sie befolgst.«
Kapitel 4
Sophie
Ich habe hinten alles abgeschlossen«, sagte ich und setzte mich Cooper gegenüber an den Tisch. Es war spät geworden, das Moonlight hatte längst geschlossen, aber er starrte noch immer mit leerem Blick auf die Theke. Aus irgendeinem Grund wollte ich ihn nicht allein lassen. Zum Teil lag es daran, weil er komplett überfordert gewirkt hatte, sobald er die Lagerräume gesehen hatte, aber da war noch etwas anderes. Etwas, das dafür sorgte, dass ich mich wohl in seiner Gegenwart fühlte, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten. Unerklärlicherweise fühlte ich mich zu ihm hingezogen, dabei war ich sonst niemand, der an Liebe oder Anziehung auf den ersten Blick glaubte. Das tat ich auch jetzt noch nicht, trotzdem hatte Cooper etwas an sich, bei dem ich mir wünschte, mich noch nicht von ihm verabschieden zu müssen.
»Wie hat Grandpa das alles allein geschafft?«, fragte Cooper und hob den Blick von der Liste.
»Hat er nicht«, entgegnete ich. »Wir arbeiten als Team hier. Der Koch hat ihm jeden Abend mitgeteilt, was nachbestellt werden muss. Grayson, Hayden und ich haben regelmäßig überprüft, welche Vorräte zur Neige gehen. Bobby musste sich dann nur um die eigentlichen Bestellungen kümmern und zusehen, dass wir rechtzeitig bezahlt wurden.«
»Was ist mit Trinkgeld?«
»Wird unter allen aufgeteilt. Wir sammeln es in der Maus«, ich deutete auf ein dickbauchiges Sparschwein hinter der Theke, das wie eine Maus aussah, »und teilen es unter allen auf, die an dem Abend gearbeitet haben. So haben auch die Leute in der Küche etwas davon.«
»Find ich gut.« Cooper lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Mit den Händen rieb er über sein Gesicht, dann über seine Haare den Kopf hinab, bis er sie in seinem Nacken verschränken konnte. »Ich glaub, ich hab genug für heute. Mein Kopf platzt gleich.«
»Oh, okay.« Enttäuschung überfiel mich, ich hätte noch ewig mit Cooper hier sitzen bleiben können. Aber ich verstand auch, dass er genug für heute hatte. Es war ein langer Abend gewesen, und man wurde schließlich nicht jeden Tag plötzlich Besitzer einer Bar.
Mit einem Ächzen drückte Cooper sich aus dem Stuhl hoch. »Magst du noch was mit mir trinken? Habe keine Lust, schon hochzugehen, aber du musst mir versprechen, dass wir nicht mehr über diese Arbeit reden.« Mit den Fingern machte er eine Drehbewegung durch die Bar.
Mein Herz machte einen Satz, und ich nickte bereits, bevor er zu Ende gesprochen hatte. »Ich nehme ein Bier.«
»Alles klar, kommt sofort.«
Ich betrachtete Cooper dabei, wie er hinter der Theke verschwand und kurz in den Regalen herumsuchte, bis er passende Gläser gefunden hatte. Dann trat er an den Zapfhahn, um diese zu füllen. Er wirkte konzentriert bei der Arbeit, aber schon etwas gelöster als am späten Nachmittag, als er die Bar betreten hatte. Seine Schultern waren weniger angespannt, und auch die steile Falte auf seiner Stirn hatte sich etwas geglättet. Auf den ersten Blick wirkte er in sich ruhend, gleichzeitig spürte ich eine nervöse Energie von ihm ausgehen, wie von einem wilden Tier, das in einen Käfig gesperrt war und versuchte auszubrechen. Mein Blick glitt zu seinen tätowierten Armen. Sie bestanden aus überwiegend schwarzen Bildern, nur ab und zu konnte ich auch etwas Blau oder Rot dazwischen entdecken. Sie waren aus mehreren kleinen Tattoos zusammengesetzt, und ich meinte, auch einige Tiere darunter erkennen zu können.
»Hier.« Cooper stellte mein Bier vor mir ab und setzte sich mit seinem Glas mir gegenüber hin. Dann hielt er es mir entgegen. »Cheers.«
»Prost.« Ich stieß mit ihm an und trank einen kräftigen Schluck. Der herbe Geschmack traf auf meine Zunge, und die Schaumkrone berührte meine Nase. Verdammt. Schnell setzte ich das Glas ab, griff nach einer Serviette und putzte den Schaumbart weg.
»Was machst du eigentlich so, wenn du nicht plötzlich der neue Besitzer einer Bar wirst?«, fragte ich, um das Schweigen zwischen uns nicht zu lang werden zu lassen.
»Ich bin Fotograf.«
»Von … Models?«, hakte ich skeptisch nach. Irgendwie konnte ich mir Cooper nicht in einem Studio vorstellen, wo er aufgehübschte Menschen fotografierte, die eine neue Kollektion präsentierten.
Als fände er die Idee genauso absurd, lachte er laut. »Bloß nicht. Ich bin Naturfotograf und arbeite mit unterschiedlichen Magazinen und Zeitschriften zusammen. Wenn ihre Redakteure einen Artikel über eine Tier- oder Pflanzenart schreiben, dann beauftragen sie mich, die entsprechenden Bilder dafür zu machen. Inklusive Vorgaben, was sie sich vorstellen.«
»Wow.« Sofort war mein Interesse geweckt. Cooper musste all das in- und auswendig kennen, was ich von Australien gern gesehen hätte. Ob er mir einige Fotos aus seinem Fundus zeigen konnte? Klar wäre es nicht dasselbe, wie es live zu erleben, aber allemal besser als gar nichts. »Und wie läuft das dann ab? Du fährst da hin, wo die Tiere leben, machst ein paar Bilder und kommst zurück?«
Er lachte erneut, und mir fiel auf, wie viel gelöster er dann wirkte. »Sehr vereinfacht ausgedrückt kann man das schon so sagen. In der Realität ist es aber so, dass es oftmals Tage dauert, bis die Tiere sich blicken lassen, und dann muss man das perfekte Foto erst mal schießen.« Cooper lehnte sich in seinem Stuhl zurück, ein Bein locker über das andere geschlagen.
»Also besteht dein Job hauptsächlich aus Warten?«
»Genau. Man muss viel Geduld mitbringen, sonst wird das mit dem richtigen Bild nichts.«
»Ich würde es hassen«, gestand ich lachend. »Ich bin der ungeduldigste Mensch auf der Welt.«
Er zuckte bloß mit den Schultern. »Die Tiere sind halt keine Models, denen man sagen kann, wo sie zu stehen und was sie zu tun haben. Es gehört auch immer etwas Glück dazu, das Foto zu schießen, das die Auftraggeber haben wollen.«
Interessiert lehnte ich mich näher zu Cooper. Wenn er über seine Arbeit sprach, verwandelte sich seine komplette Mimik und Körperhaltung. Es war offensichtlich, dass er liebte, was er tat, und völlig darin aufging. »Was machst du mit den Bildern, die sie nicht wollen?«
»Erst mal schicke ich alles Verwertbare in die Redaktion, daraus suchen sie sich aus, was sie wollen, und bezahlen mich dafür. Die übrigen Bilder gehen an mich zurück. Manchmal kann ich sie für andere Aufträge verwenden, und zur Not eignen sie sich zumindest für mein Instagram.«
»Oh, du hast eine Seite für deine Fotografien?« Ich musste später mal danach suchen und mir ansehen, was er dort postete.
»Dort versuche ich auch darauf aufmerksam zu machen, wie wir den Planeten und damit auch den Lebensraum der Tiere zerstören. Und was getan werden kann, um das rückgängig zu machen.«
Natürlich war er auch noch ein Weltretter. Gefühlt setzte jeder, den ich in Eden kennengelernt hatte, sich auf die eine oder andere Weise für Tier- oder Umweltschutz ein. Und ich hätte früher nicht gedacht, wie verflucht sexy ich das fand.
»Also kann ich noch was lernen, wenn ich dir folge?«, fragte ich ihn mit hochgezogenen Augenbrauen.
Cooper lachte erneut, und diesmal schien der Ton in all meinen Zellen zu vibrieren. »Lernen kann man jeden Tag und überall was. Die Frage ist immer, ob man das will.«
»Wir haben nur diese eine Erde«, entgegnete ich. »Es ist mehr als überfällig, dass wir anfangen, sie zu schützen.«
»Das ist wahr.« Cooper griff nach seinem Glas und trank einen großen Schluck. »Aber genug von mir, was treibst du so, wenn du nicht gerade Work and Travel in Australien machst?«
»Ich hab meinen Bachelor in Journalismus gemacht und plane, nach meiner Rückkehr in Deutschland meinen Master zu starten.«
Cooper stützte sich mit den Ellbogen auf der Tischplatte auf und lehnte sich näher zu mir. Sein Blick lag interessiert auf mir und setzte ein Prickeln tief in meiner Magengrube frei. »Also willst du danach bei einer Tageszeitung arbeiten?«
»Könnte ich, aber eigentlich weiß ich noch nicht genau, in welche Richtung es für mich geht.« Die Möglichkeiten bei Journalismus waren nahezu unendlich, und auch wenn ich das vorher in Ansätzen schon gewusst hatte, war mir das wahre Ausmaß erst während des Studiums klar geworden.
Die Andeutung eines Lächelns zupfte an Coopers Mundwinkeln. »Du willst dich noch nicht festlegen?«
»Das ist es nicht.« Ich suchte nach den richtigen Worten. »Vor dem Studium dachte ich, dass ich unbedingt bei einer regionalen Zeitung arbeiten will, die vor allem über Wichtiges aus der Umgebung berichtet. Dazu müsste ich nicht weit reisen und wäre jeden Abend zu Hause. Während des Studiums ist mir dann bewusst geworden, wie viel mehr Möglichkeiten mir offenstehen. Ich habe einen Kurs über Reportagen aus Krisengebieten belegt, was super spannend war. Da weiß man nie, wohin es einen die nächste Woche verschlägt. Aber genauso gut könnte ich auch für wissenschaftliche Zeitschriften arbeiten, oder das, was du erzählt hast, die Artikel für Fotoreportagen schreiben. Es gibt so viele Optionen, und ich werde im Masterstudium überlegen, welche davon ich mir näher ansehen möchte.«
Cooper nickte anerkennend. »Du scheinst dich mit deinem Feld jedenfalls genau auszukennen.«
Ich lachte leise. »Ich habe das zwei Jahre studiert, es wäre traurig, wenn es anders wäre.«
Etwas Düsteres legte sich auf seine Miene. »Du hast keine Ahnung, wie viele Leute ich in meinem Leben getroffen hab, die auf der Uni waren, aber eigentlich kein Interesse an dem hatten, was sie dort machen.«
Okay, von der Seite betrachtet musste ich ihm recht geben, die hatte es an der Uni Frankfurt ebenfalls gegeben. »Hast du denn selbst studiert?«, legte ich die Aufmerksamkeit wieder auf ihn.
Sofort schüttelte er den Kopf. »Ich hab in meinem Leben nicht einen Fuß auf ein Unigelände gesetzt. Aber ich komme viel rum, übernachte oft auf Campingplätzen oder sitze abends allein in Pubs, da kommt man schnell mit anderen ins Gespräch. Und du glaubst gar nicht, was die Leute alles bereit sind, dir zu erzählen, wenn sie genau wissen, dass sie dich nie wiedersehen.«