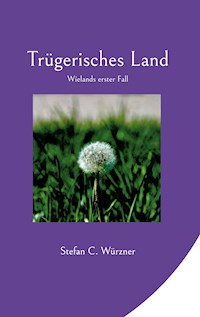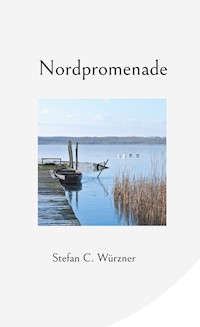
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Not zwingt Anna und ihre Familie Anfang der dreißiger Jahre aus den Wäldern am Fuße des Riesengebirges in die große Stadt. Persönliche Hoffnungen und Enttäuschungen bestimmen ihren Werdegang und den Blickwinkel ihrer Erzählungen. Sie durchziehen den Alltag wie klebrige Spuren. In geschwungenem Bogen begleiten die persönlichen Geschichten Aufstieg und Niederlage des dritten Reiches ebenso wie das Leben in den Jahrzehnten danach, mit Eltern, Ehemännern, einem Sohn und dem Enkel zu ihrer Seite. Es ist ebenso Wolfgangs Geschichte, der früh von seiner Großmutter geprägt worden ist. Sein Weg ist der Versuch, sich zu lösen und einen vermeintlich eigenen Weg zu finden, jenseits der verborgenen Aufträge, die in Familien generationsübergreifend weitergegeben werden. Mit tiefem Witz seziert der Autor die Abgründe seiner Protagonisten, ohne je den Respekt vor ihnen zu verlieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heimat ist das Gewehr, dass man sich Tag und
Nacht an die Stirn hält, ohne je abzudrücken.
Heinrich Steinfest
Heimat ist kein Ort, es ist unsere Erinnerung.
Ferdinand von Schirach
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Der Krieg ist vorbei
Auf der Veranda
Anna
Am Maschsee I
Anna tanzt
Schutt und Asche
Trümmer
Schwarzer Markt
Wolfgang
Ficus Elastica
Am Maschsee II
Das zuckende Ding
Trügerisches Afrika
Cowboys
Frauenabend
Eilenriede
Herrenabend
Pavlovsche Hunde
Julia
Feierabendbier
Die Hütte am See
Semesterausklang
Vor dem Sturm
Wer ist Julia?
Epilog
Novemberfrühe
Prolog
Der Krieg ist vorbei
Auf den Straßen Hannovers jubeln die, die einen Grund dafür haben. Die anderen verharren in den Resten ihrer zerbrochenen Welt. Verstohlen werfen sie Blicke auf den Feind, der zwischen den Trümmern marschiert. Der kleine Werner steht in kurzen Hosen am Rand und winkt den Soldaten zu. Die Worte, die sie ihm lachend zurufen, versteht er nicht.
Die Briten überführen ihre Gefangenen aus Italien in die Nordwestzone des besiegten Reiches. Auch die deutschen Landser aus der Schlacht um den Monte Cassino werden in die Internierungslager gebracht. Wilhelm Passmann, Hauptfeldwebel der 1. Fallschirmjäger-Divison der Luftwaffe kann seinen Wohnsitz in Hannover nachweisen und kommt schließlich aus der Gefangenschaft frei. Noch vor der Fahrt hat er Anna, seiner Frau, eine Nachricht übermitteln können.
Die Welt hält inne, während sie mit flatterndem Herzen den Brief zwischen ihren Fingern bewegt. Vor Werners Augen verwandelt sich die Mutter in den nächsten Tagen in ein verliebtes Mädchen, das zugleich lachend und weinend durch die kleine Ordnung stolpert, die sie dem Chaos des Krieges abgetrotzt hat. Diese seltsame Hoffnung in ihrem Gesicht. Sein junges Leben verformt sich in etwas Fremdes. Die Furcht vor einer Veränderung kriecht in ihm herauf. Was will der Mann hier? Er kennt den Vater nicht. Held der Wehrmacht, Fallschirmspringer! Seine Taten, mit denen er gegenüber den anderen auf der Straße geprahlt hat, sind so fern und groß. Zu groß für seine kleine Welt.
Am Morgen der Ankunft hüllt der glühende Badeofen das Zimmer in eine seltene Wärme. Anna putzt ihren Sohn heraus, wie er es bislang nicht hat erdulden müssen. Seine Haut brennt unter dem rauen Waschlappen. Alles wird vom Schmutz befreit. Die Jacke gebürstet, Hosen gebügelt und die Schuhe blank geputzt. Sein Hemdkragen kratzt und ist ihm viel zu eng.
Auf dem Weg zum Bahnhof füllen sich die Straßen mit Menschen, alle mit dem gleichen Ziel. Kinder zerren an den Händen ihrer Mütter, suchen sich vergeblich dem drohenden Wandel ihres kleinen Lebens zu entwinden, als beginne für sie damit ein anderer Krieg, den sie nicht gewinnen können.
Das Pfeifen der nahenden Dampfloks ist aus der Ferne zu hören. Von den Wänden der Häuser zurückgeworfen, hallt der Chor der Züge vielstimmig durch die Stadt. Die Menge strömt zum Eingang des zerbombten Hauptgebäudes.
Ein Kreischen von Stahl auf Stahl erfüllt die Weite unter dem Skelett aus Eisen, das sich über die Bahnsteige wölbt. Werner legt seinen Kopf in den Nacken. Das Glas der Halle ist bereits vor Jahren in den Luftangriffen geborsten. Von Dampf umhüllt stehen die Lokomotiven auf den Gleisen, schwarzglänzend und majestätisch, ein tiefes Ächzen des Metalls. Öl tropft von den Triebstangen der großen Räder. An der Hand der Mutter führt der Junge ehrfürchtig seine Schritte durch diesen riesigen Pferch wild schnaubender Schlachtrösser.
Um sie herum zwängt und wimmelt es auf dem Bahnsteig. Hälse werden gereckt, Hände winken aus der Menge heraus. Überall ein Schieben, Drücken und ein Lärmen. Werner ist umringt von scharrenden Füßen. Der grobe Stoff von Mänteln kratzt ihm durch Wangen und Stirn. Namen werden durch das Gedränge gerufen. Fotografien in Erwartung über die wogenden Köpfe gehalten. Junge Uniform-gesichter mit einer längst verblassten Zuversicht, wie zu einem traurigen Hohn.
Anna sieht ihren Wilhelm am Ende des Bahnsteigs stehen, Ausschau haltend, einen verschlissenen Koffer in der Hand. Sein Blick kreuzt sich mit ihrem. In schmerzhaften Sekunden zeichnet sich die Freude des Erkennens auf sein Gesicht. Anna entwindet sich dem Jungen und fliegt Wilhelm entgegen.
Werner bleibt voller Misstrauen stehen.
Er schaut auf zu der Gestalt, die seine Mutter umarmt und seinen geschorenen Kopf in ihrer Schulter verbirgt. Er hört das Schluchzen, dem der Mann keinen Widerstand entgegensetzt. Das soll sein Held der Wehrmacht sein? Dieses abgemagerte Häuflein Mensch in den zu großen Hosen, nur mit einem groben Strick um die Hüften gebunden? Dieser Kerl, der seine Arme um die Mutter schlingt, sein Gesicht an ihre Wange schmiegt und sie an sich drückt?
Mit Erstaunen wird ihm gewahr, dass sie die Berührungen von diesem Wilhelm zu genießen scheint. Und sich seinem Kuss ergibt. Er schaut zu, wie sie den dünnen Körper des anderen sanft umarmt. Sie weint haltlos. Endlich lässt der Mann von ihr ab. Er kommt näher, hockt sich vor ihn hin, legt die Hände auf seine Schultern und blickt ihn lange an. Offen erwidert Werner dessen Blick.
Das ist also mein Vater. Die Mutter schaut prüfend auf ihn herab. Ihre Erwartung lastet schwer auf ihm. Er wagt einen Schritt auf ihn zu und umarmt vorsichtig den stache-ligen Hals. Er riecht Kernseife und hört ein pochendes Herz. Er schaut zu seiner Mutter, die ihn aufmunternd anlächelt.
Er hat es richtig gemacht.
Auf der Veranda
Wolfgang lehnt sich in seinem Korbsessel zurück und verschränkt die Hände hinter dem Kopf. Träge schwappen unter ihm die Wellen an die Holzpfähle. Die Veranda ist an den Seiten von wuchernden Schilfbündeln eingefasst, die das Geländer umspielen und weit darüber hinausragen. Die Holzplanken thronen über dem Wasser des kleinen Sees. Paul Steinhoff, der zweite Ehemann seiner Großmutter, hatte sie ihm samt dazugehöriger Jagdhütte und der unbefristeten Nutzung des fischreichen Gewässers vermacht. Ein altes Erbe von dessen Familie, dem er viele Jahre keinerlei Beachtung geschenkt hatte. Schließlich hat er sich ein Herz gefasst, um Hütte und Veranda an arbeitsreichen Wochenenden vor dem Verfall zu retten und für sich herzurichten. Er lässt seinen Blick die Uferlinie entlang wandern. Regungslos steht ein Graureiher am Ufer im flachen Wasser, den langgezo-genen Schnabel starr auf die Oberfläche gerichtet. Eine tief stehende Sonne bekränzt die kräuselnden Wellen mit silb-rigem Glanz und wirft die Schatten der Weiden weit auf den See hinaus.
So mag es sich ereignet haben, vor fünfundsiebzig Jahren. Vielleicht war es auch anders. Als Kind hat ihm seine Großmutter die Geschichte von der Ankunft seines Großvaters in vielen Variationen erzählt. Welche davon entspricht der Wirklichkeit? Und woher hätte er wissen können, was sein Vater als kleiner Junge in jenem Augenblick gefühlt hat? Wahrscheinlich weiß es nicht einmal der. Selbst wenn Wolfgang ihn noch fragen könnte.
Hat an jenem Tag auf dem Bahnhof alles seinen Anfang genommen? Die eigene Geschichte, lange vor seiner Geburt? Er schürzt nachdenklich die Lippen, die Augen unbewegt in eine Ferne gerichtet. Vom Ufer aus scheint der Reiher zu beobachten, wie sich Wolfgangs Oberlippe bei dem Gedanken kaum merklich nach oben zieht. In einem plötzlichen Schwall rollt sein bitteres Auflachen weit über den See. Der Graureiher stiebt mit ausgebreiteten Schwingen davon.
Was für ein Unsinn!
Die Vergangenheit ist keine Operette, keine Ouvertüre mit Vorhang und gespanntem Raunen im Saal, keine augenfällige Vorahnung des finalen Akkords. Nichts ist verlässlich, bevor es tatsächlich geschehen ist. Das Leben, es geschieht einfach. Fortwährend verstrickt es sich neu, schlendert dahin ohne eine Absicht. Das Schicksal ist bloß ein launiger Gefährte, und der Tod hält es nicht anders. Nur ein armseliger Hochmut erwartet dahinter eine Bedeutung, einen Sinn.
Seine Hand ertastet die Flasche neben sich, und er gießt sich ein weiteres Glas Rotwein ein. Er zieht die Decke enger um die Schultern, ihn fröstelt. Im Herbst wird es nach Sonnenuntergang schnell kühl. Die Dämmerung taucht die Veranda vor der Hütte in ein sanftes Rot. Die einsamen Abende am See, Gedanken, die ohne eine Richtung dahintreiben. An manchen Tagen genießt er das.
In der Erinnerung an seine Eltern finden sich nur einzelne Ausschnitte, wenige davon sind scharf gezeichnet, die meisten verbergen sich hinter einem Schleier aus grauem Nebel. Insgesamt bleibt aus der frühen Kindheit nur ein blasser Eindruck. Als er heranwuchs, zog seine Großmutter ihn groß und hat die alten Bilder in ihm wachgehalten, miteinander verbunden wie einen ersten kleinen Lebenslauf. Das Ganze würzte sie mit Anekdoten wie der Behauptung, die Mutter hätte ihn als Baby jedes Mal verlässlich zum Lachen gebracht, indem sie ihn mit der Nase an Wange und Hals kitzelte. Dies sei so weit gegangen, dass er ohne diese Berührung von ihr nicht hatte einschlafen wollen. Kann er sich sicher sein, dass es tatsächlich so gewesen ist?
Oma Anna und ihre traurige Sehnsucht, die alles durchdrang, was sie ihm von früher erzählte. Ihre Hoffnungen, die der Krieg zunichte gemacht hatte, stießen wie ein wucherndes Kraut durch die Deckschicht des Bildes, das er sich von seiner Großmutter gemalt hatte. Es waren ihre Träume, mit der sie sein Sehnen auf ihr eigenes ungelebtes Leben gelenkt hat. All die Jahre führte sie seine Schritte und konnte doch ihrem Enkel seinen Atem nicht lassen.
Als er alt genug war, wählte er den Weg, der ihm zwischen ihren Träumen übrig zu bleiben schien und verließ die Stadt, den Ort, den er nie als sein zu Hause, als Heimat empfunden hatte. Er erinnert sich an die von ihm als Schmach bewertete Rückkehr nach Hannover vor gut zwanzig Jahren. Zu Beginn fiel es ihm schwer, hier Fuß zu fassen. Die Stadt war ihm durch die Zeit in der Ferne fremd geworden und er empfand jeden Tag als Niederlage.
Annas Schlaganfall, als ihr einziger lebender Verwandter hatte er keine Wahl. Kaum, dass sie wieder gehen konnte, folgten erste vorsichtige Spaziergänge in den Auen mit ihm. Kaum dass sie wieder sprechen konnte, griff Anna sich erneut den alten Platz in seinem Leben, bis zu ihrem Tod vor fast fünfzehn Jahren. In gewisser Weise besetzte sie ihn noch eine lange Zeit darüber hinaus.
Anna
Am Maschsee I
Von der Nordpromenade aus gen Süden trennt eine schmale Landzunge den Lauf der Leine vom Maschsee. Zuerst am Ufer entlang und dann weiter in Richtung Westen führt dort der Weg nach Ricklingen.
An warmen Tagen fährt Wolfgang regelmäßig mit dem Fahrrad zu seiner Großmutter. Vorbei an Skatern und Spaziergängern, zweigt der Deichweg durch die Wiesen ab. Vorbei an den Fischteichen, die wie Perlen einer Kette glänzend in der tiefen Marsch liegen. Von weitem schimmern die roten Dächer des Pflegeheims durch die Baumgruppen am Wege.
Das Zimmer im zweiten Stock hat Wolfgang mit Möbeln und dem Wichtigsten aus ihrer Wohnung eingerichtet. In dem neuen Zuhause soll ihr nicht alles fremd sein. Die lange Zeit im Krankenhaus und in der Reha-Klinik, bis ihre Furcht, nicht mehr zurückkehren zu können, auf dem zähen Weg der Genesung zur endgültigen Gewissheit wurde. Das allein war schon schwer genug für sie.
Zwischen ihnen thront das Kaffeegedeck auf dem Tisch, die Porzellankanne mit dem Tropfenfänger an der Tülle, der Kaffeewärmer, dessen geblümter Stoff längst verblichen ist. Er schmunzelt über die alten Gefährten seiner Kindheit. Oma Anna beugt sich vor und nimmt ein Plätzchen aus der Schale, tunkt es ein, streicht die Tropfen am Rand der Tasse aus und beißt vorsichtig ein Stückchen ab.
Jenseits des Fensters weitet sich der Blick in die Wiesen-landschaft, in der Ferne das Ufer des Sees. Mit einer unbeholfenen Geste umschließt sie die gesamte Niederung.
»Bevor wir damals den See in die Marsch gebaut haben, standen hier Bäume. Weiden, Eschen, ein schöner und lichter Auwald. Doch unten wucherte undurchdringliches Buschwerk, brakige Tümpel versperrten den Weg und Mücken schwebten in Schwärmen in der Luft. Hindurch führten nur Trampelpfade, die oft genug im Morast endeten. Es roch nach Verwesung. Wir haben all dem ein Ende gemacht und den ganzen Sumpf ausgetrocknet. Der Boden wurde fest und sicher und darauf haben wir den See gebaut. Die Wiesen im Süden sind erst Jahre später angelegt worden. Habe ich Dir erzählt, wie wir damals nach Hannover umgezogen sind?«
Ja, Oma, nur allzu oft. Er spricht es nicht aus, eine Bitterkeit liegt auf seiner Zunge. Er weiß, dass die Variationen der Geschichten ihre Art sind, mit dem eigenen Leben, das nur eine Hand breit in die Gegenwart ragt, in Kontakt zu bleiben und sich ihrer Herkunft zu vergewissern. Er ist nur die Leinwand, auf der sie ohne Rücksicht ihre Bilder gegen das Vergessen malt. Die Abbildung selbst ist kaum von Belang, ihre Erinnerung daran zählt. Er fragt sich, ob seine Großmutter um den Unterschied weiß. Damals, als er Hannover den Rücken gekehrt hat, war ihm zumindest dies nicht bewusst.
Anna kam mit ihren Eltern und den beiden Brüdern aus einem Weiler oberhalb von Spindlersmühle im Riesengebirge. Die mit Holzschindeln gedeckten Katen duckten sich schon zu aller Zeit unter den Fuß des Waldes an der großen Sturmhaube, die nun Velký Šišák heißt. Es wirkte, als stünden die Häuser zufällig beisammen, nur für den Moment. Wanderer, auf der Suche nach Schutz vor einem Gewitter. Niemand, der hier vorbei kam, blieb lange. Im Osten und Süden hielten die Wipfel der Bäume die wärmenden Strahlen der Sonne ab, im Norden der Berg. Durch das Trogtal des Flusses strich von Westen her ein scharfer Wind. Die Herbst-stürme drückten sich in die alten Wände aus Holz und Lehm und bliesen die Kerzen aus. Mitten durchs Dorf führte ein Bach seinen Weg. Im Winter, wenn die Welt unter Schnee und Eis erstarrte, gab nur ein leises Gluckern in seinem schmalen Bett darunter die Zuversicht, das nicht alles still stand. Im Frühjahr schmolz der Schnee und der Regen kam. Wochenlang regnete es. Die Wolken hingen an den Bergen und das Wasser floss mit Macht hinab ins Tal. Es trieb den Bach vor sich her, der sich weit über seine Ufer dehnen musste und die Wege zwischen den Katen in einen schlammigen Matsch verwandelte.
Anfang der dreißiger Jahre zog es viele Menschen in die Städte im Norden des Reiches. Dort gab es Arbeit und Brot, in Hannover die Hanomag. Lastwagen, Zugmaschinen und Traktoren. Das Land blühte nach der Wirtschaftskrise wieder auf und für die Fabriken brauchte es kräftige Hände.
Zudem rief der Führer die Menschen in die Stadt. Tausende gruben sich in das Marschland der Leine. Südlich des neuen Rathauses sollte ein Sumpf voller Leben für das Heil des Volkes in einen flachen See verwandelt werden. Eine lange Mauer an einer Allee entstand im Osten, eine breite Promenade mit Granitplatten am Ufer im Norden. Am südlichen Ende wuchs ein Strandbad in den See hinein.
»Es war eine schöne Zeit, Wolfgang. Wir hatten genug zu essen und die Familie war zusammen. Früher im Weiler gab es nur harte Arbeit und zum Leben von allem zu wenig.«
In der Kate gab es unten eine bescheidene Stube, abgetrennt davon der Stall für die Hühner und die beiden Ziegen. Durch die Ritzen pfiff der Wind sein klirrendes Lied. Der Kachelofen konnte die Kälte aus den schmalen Schlafkammern unterm Dach nicht vertreiben. An so vielen Tagen waren der Vater und ihre Brüder, Johann und Karl, abends und in der Nacht nicht daheim. Anna musste mit der Mutter oft lange auf deren Rückkehr warten. Als Kind hatte sie Angst gehabt, sie würden nicht mehr heimkommen. Die Mutter hatte sie mit ihrem Gesang zu beruhigen versucht. Mit den Jahren lernte sie die Reime und Melodien der Lieder. Die Arbeit in Haus, Stall und auf dem Feld, das hinter der Kate von den Wiesen begrenzt wurde, war angefüllt mit Musik, die die Zeit des Wartens durch die Stimmen der Frauen vertrieb.
Wenn der Weg zur Arbeit weit war, blieben die Väter und ihre Burschen abends im Wald, um früh wieder ins Holz gehen zu können. Es gab eine grob gezimmerte Behelfsunterkunft mit Pritschen und Decken, einen Ofen und Vorräte für ein paar Tage. Sie arbeiteten mit zehn, fünfzehn Mann aus dem Weiler dort, der ganze Trupp mit Sägen, Äxten, Ketten und dem Pferdegespann des Dorfes.
Es war spät im Herbst, Wiesen und Bäume bereits von weißem Flaum bedeckt, und es sollte ihre letzte Pflicht vor dem Winter sein. Bei Schnee und Eis war die Arbeit zu gefährlich. Nach vier Nächten erst kamen sie zurück. Keuchend schleppten Johann und der Vater den stöhnenden Karl in die Stube, der Arzt kam gleich hintendrein. Es sah schlimm aus. Unter dem gerissenen Stoff lugte blosses Fleisch hervor. Das Bein war gebrochen, es musste gerichtet werden. Karl schrie, der Vater fluchte. Anna barg ihr Gesicht in den Händen.
Doch der Bruch heilte schnell, Karl war jung und kräftig. Es war ein Glück, dass der Baum nicht mehr getroffen hatte. Viel hatte nicht gefehlt. Draußen stemmte sich der Schnee gegen den nahenden Frühling, wirbelte in einem scharfen Wind, der die Flocken mit stürmischer Wucht an die Scheiben drückte. Schweigend saßen sie am Tisch. Schatten tanzten in flackerndem Licht. Der Vater brach das Brot und mit gesenkten Köpfen löffelten sie ihre dünne Suppe.
Seine Tochter erfüllte ihn mit Freude, er nickte zufrieden. Sie achtet ihn und ist gutwillig. Nun, das sollte ihr nicht schwerfallen, denn anders als ihre Brüder hat sie nie seine Hand gespürt, musste sich nie mit ihm messen oder an seinen Worten reiben. Es ist Aufgabe der Mutter, das Mädchen anständig zu erziehen, seine Frau, die das Haus mit Umsicht führt. Und so ist es gekommen, erneut nickte der Vater. Ihm wiederum sind die Söhne gut gelungen. Kaum mehr bleibt an diesem Leben zu hoffen übrig.
Traurig blickte er in die Runde am Tisch. Der Unfall im Herbst hat ihm die Augen geöffnet. Hier an der großen Sturmhaube gibt es keine sonnige Zukunft. Früher einmal schien eine solche auf die Häuser und Menschen hier, ja, aber jetzt nicht mehr. Es ist eine schwere Entscheidung, doch er sieht keinen anderen Weg. Wie sonst kann er seiner Familie mehr bieten als dieses armselige Leben?
Er hatte in langem Abwägen einem Verwandten geschrieben, der nach dem großen Krieg in die Nähe von Hannover übergesiedelt war und um dessen Unterstützung ersucht. Der Vater war ein wortkarger Mann und bedachte stets gut, was zu sagen geboten war. Um so schwerer wogen seine Worte an jenem Abend, durch die sich das Leben seiner Familie zum Besseren wenden sollte.
»Hier in Hannover hatten wir eine Wohnung im dritten Stock und jeder in der Nacht sein eigenes Bett. Erst die Arbeit am Maschsee, dann auf der Hanomag. Wolfgang, das war ein Glück für uns.«
Ihre Ankunft in der großen Stadt, Anna fühlte sich bereits auf dem Bahnhof verloren. Ein ihr unbekannter Lärm und fremde Gerüche wanden sich zwischen den hoch aufragenden Häuserwänden durch die Straßen, trieben sie vor sich her. Um sie herum strömten die Menschen, zu Fuß, auf Fahrrädern, in stinkenden Kraftwagen, ab und zu ein in dem Treiben verloren wirkendes Pferdefuhrwerk oder eine Kutsche. So viele Menschen, noch nie hat Anna so viele Menschen gesehen. Überall eine Eile, Hupen und ein Geschrei. Die Straßenbahn brachte die Familie rumpelnd durch diese in ein stumpfes Grau gehüllte Stadt und über den Fluss bis nach Linden. Dicht gedrängt standen sie hinten im Anhänger, ein Ballett der Leiber. Die Menge wankte mit dem Verlauf der Schienen hin und her, der Stahl der Räder quietschte in den Kurven. Anna hielt sich die Ohren zu.
Ihre ersten, tastenden Schritte auf den knarrenden Dielen des neuen Zuhauses. Die hellen Zimmer und wie sie alle staunend vor den hohen Fenstern standen. Ihre Finger zitterten, als sie über die glatt verputzten Wände strich. Sie sorgte sich vor der Aufgabe, gemeinsam mit der Mutter die Wohnung mit einem Leben auszufüllen, das ihr fremd war.
Sie schluckt mit Mühe und blickt, eine Stütze suchend, zu ihrem Enkel auf, als könne der die Vergangenheit heilen.
»Ich habe unsere beiden Ziegen vermisst.«
Ganz leise spricht sie es aus. Gedrückt von der Bürde alter Gedanken neigt sich ihr Kopf. Unter der luftigen Strickjacke zeichnet sich ein schmal gewordener Leib ab und ein leichtes Zittern dringt durch die Falten ihrer hellen Bluse. Mit einem verhaltenen Seufzer senkt sich ihr Brustkorb. Sie gewinnt ihre Fassung zurück und schüttelt die Last von ihren Schultern.
»Für meine Brüder und den Vater war es zu Anfang in den Maschwiesen hart. Es waren kräftige Männer. Das breite Bett für den See haben sie ausgegraben. So viele haben mit den Spaten die Masch gestochen. Kolonnen von Lastwagen brachten Steine für die Befestigung der Ufer und luden das Moor auf ihre Pritschen. Das war ein Treiben.«
Sie unterschlägt dabei, dass es auch für sie anfangs kaum ohne Mühen gewesen ist. Im besten Fall ist es ein absichtsvolles Vergessen, ein tief gewachsener Schmerz, trotz aller Anstrengung in der neuen Heimat immer eine Fremde geblieben zu sein. Selbst in dem Sammelbecken dieser täglich wachsenden Stadt war es nicht zu verbergen. Die aus der Zeit gefallene Kleidung und die Melodie ihrer holprigen Sprache wiesen sie als eine Zugewanderte aus. Aus dem Osten, eine von diesen Pollacken! Misstrauische Gesichter beim Krämer, Rempler in der Schlange. Abschätzige Blicke und Spottgedichte von den Kindern, die auf der Straße hinter ihr her liefen. Zuerst wollte sie aufbegehren, stammte sie doch ebenso aus dem Deutschen Reich wie die Menschen hier, besann sich aber eines Besseren. Sie legte die Haube ab und nähte ihre Kleider um. Anna lernte und verbarg erfolgreich ihren Dialekt. Mit der Zeit war sie kaum mehr von den Anderen zu unterscheiden. Doch es wiegt immer noch schwer genug, selbst darum zu wissen.
»An Himmelfahrt 1936 wurde der See eröffnet. Die Nordpromenade war schwarz von Menschen. In feschen Uniformen und blank geputzten Stiefeln sind sie aufmarschiert. Fahnen knatterten im Wind, Reden schallten über den See. Wir standen erhobenen Hauptes in der Menge. Mir war feierlich zumute. Der Führer hatte uns Arbeit und Brot versprochen. Das hat er gehalten. Auch wenn wir alle bald nur noch für den Krieg arbeiten mussten. Ach, der Krieg!«
Anna zittert erneut und wendet ihr Gesicht ab.
»Erst war das alles weit weg. Meine Brüder und die vielen anderen Soldaten sind im Gleichschritt an uns vorbei zum Bahnhof marschiert. Wir standen am Rand, haben gewunken und Hurra geschrien. Hüte flogen in die Luft und Fahnen wurden geschwenkt. Mutter musste sich vor Rührung die Augen wischen.«
Sie unterbricht sich, streicht sich eine unsichtbare Strähne aus der Stirn und fährt tonlos fort.
»Zur Marine kamen sie, nach Norderney, weil sie so stattliche Burschen waren. Meine Brüder und das Meer, was hatten sie denn auf dieser Insel und diesen Schiffen verloren? Später rief niemand mehr ›Hurra‹. Die Nachricht kam, dass Johann und Karl gefallen sind. Sie wurden mit ihrem sinkenden Schlachtkreuzer in die Tiefe gezogen.
Ertrunken sind sie, Wolfgang. Vor Norwegen, im eiskalten Meer. So weit weg von zu Hause! Ihre Leichen irgendwo in einem nassen Grab, niemand weiß es.«
Still sitzt Anna ihm gegenüber. Die Wand hinter ihr mit gerahmten Fotos der Familie, die allesamt Zuversicht ausstrahlten. Ihr Hochzeitsbild mit Wilhelm, eines der Eltern in steifer Pose, Porträts der Brüder in Uniform. Eine vergilbte Postkarte von der Nordpromenade, die sie Wilhelm als Andenken an ihre erste Begegnung an die Front geschickt hatte.
Die Karte, eingerissen an der Faltung und die Tinte der Nachricht kaum mehr lesbar, hatte ihren Weg zurück gefunden.
Aus Gewohnheit rinnt ihr eine Träne die Wange herunter.
Anna tanzt
Aufatmend wird Wolfgang nach dem Besuch im Altenheim sein Fahrrad durch die Wiesen schieben, zurück zum Masch-see. Der Rest des Tages wird ihm gehören. Noch sitzen sie in der kurzen Weile von Annas Trauer stumm beisammen. Der restliche Kaffee ist in der Kanne kalt geworden und das Gebäck längst verzehrt. Wolfgang deutet ihr Schweigen als Vorbote des Endes dieses Nachmittags mit seiner Großmutter. Ungeduldig rutscht er leicht gebeugt auf der Vorderkante des Stuhls hin und her wie ein kleiner Junge, der dringend auf die Toilette muss, sich jedoch nicht traut, es auszusprechen. Ihm fehlt die Kraft, sich der Situation angemessen zu entwinden, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Er hofft auf die Entlassung aus der Pflicht seines sonntäglichen Besuchs, der ihm nach den zähen Stunden ihrer Erzählung einer Nötigung gleichkommt.
Als ihm dies gewahr wird, blickt er verschämt zu Boden. Er setzt sich wieder gerade auf seinen Stuhl und strafft die Schultern. Schließlich ist sie seine einzig verbliebene Verwandte, seine einzige Bindung an die Vergangenheit. Das klingt zu wichtig, als dass er es ignorieren könnte. Außerdem scheint Anna nicht zu wollen, dass er schon geht. Nur eine Geschichte noch. Sie unterbricht die Stille.
»Du willst doch bestimmt wissen, wie ich meinen Wilhelm kennengelernt habe, Wolfgang.«
Natürlich hat sie ihm das bereits in so vielen Versionen ausgemalt, dass er sie nicht mehr zu zählen vermag. Er schweigt, nickt und ergibt sich einer weiteren Lesart der Geschehnisse ihres Lebens.
»Lange blonde Haare hatte ich mit neunzehn, nicht grau und dünn, so wie jetzt. Die Männer haben sich nach mir umgedreht. Der Vater meinte, dass ich ein fesches Mädel und deshalb eine gute Partie sei. Dann musste es ja wahr sein.«
Sie lacht, doch es klingt nur im ersten Moment fröhlich. Eine Wolke der Verbitterung schiebt sich vor das Licht ihres hell tönenden Lachens, das einen beinahe jugendlichen Enthusiasmus erahnen lässt, der ihrem Wesen früher einmal innegewohnt haben mag.
Während Anna spricht, wächst ein Bild in Wolfgangs Vorstellung heran. Sie steht ihm gegenüber auf dem Trottoir. Es ist Markttag am alten Rathaus in der Stadt. Auf dem Platz hinter ihr sind Stände aufgebaut, es wird gefeilscht. Frauen mit Körben am Arm schlendern vorbei. In einem weißen Kleid steht sie da, die Schultern in ein leicht gewebtes Tuch gehüllt. Sie dreht den Kopf in seine Richtung und schaut ihn an. Die langen Haare ein Kranz aus Licht und auf ihren Lippen ein Lächeln.
»Am Maschsee, 1937 im Juli habe ich ihn kennengelernt. Ein so schöner Sommerabend ist das gewesen! Ich war fast erwachsen damals und brachte erstes Geld mit nach Hause. Ich konnte endlich meinen Beitrag für unsere Familie leisten. Es war eine gute Arbeit in der Kantine auf der Hanomag.«
Die Mutter, die halbtags in der Werksküche arbeitete, hatte ihr die Stelle vermittelt. Die Brüder und der Vater verdienten ihren Lohn im Schichtbetrieb der Eisengießerei.
Als sie das erste Mal den riesigen Speisesaal mit seinen hohen Fenstern betrat, herrschte dort die sonderbare Stille eines verlassenen Kirchenschiffs. Die Mittagspause war vorbei und niemand außer ihr im Raum. Vereinzelt standen noch Tabletts und Reste auf den Tischen. Der Herzschlag der Werkshallen ließ den Saal in rhythmischem Vibrieren erzittern. Anna spürte es eher, als dass es zu hören war. Sie legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und breitete ihre Arme aus. Der kraftvolle Puls der Maschinen durchdrang sie in wundersamer Erhabenheit. Tausende Menschen aus allen Teilen des Reiches, die um sie herum und Tag für Tag ihre Kraft in den Dienst eines großen Ganzen stellten, waren nun eins. Größer als jeder allein, und auch sie war nun ein Teil davon. Sie fühlte sich getragen, geborgen wie zuletzt als Kind in der Gemeinschaft des Weilers. Sie begann, sich um die eigene Achse zu drehen, schwang schneller und schneller herum und die Ahnung einer wunderbaren Zukunft verschmolz in jenem Augenblick mit ihrer Vergangenheit, nahm ihr den Schmerz über die verlorengegangene Heimat und der täglichen Ausgrenzung in dieser Stadt.
Die Granitplatten der Nordpromenade glänzen in der Dämmerung. Die Sonne ist bereits untergegangen und sendet über den Horizont ein letztes Licht. Alles ist in den Schimmer der blauen Stunde getaucht. Eine seltene Ausgelassenheit liegt in der Luft. Auf den weißen Holzbänken erkennt man Schemen von Liebenden. Die Pflanzkübel dazwischen stehen mit ihren weit ausladenden Palmwedeln in Reih und Glied. Hinten die große Gastwirtschaft mit dem Biergarten zur Landseite hin. Mit jedem Schritt näher dringen Fetzen von Gesprächen herüber, ab und zu ein Lachen, klirrende Gläser. Eine Kapelle spielt auf. Farbige Lampions hängen in den Bäumen und beleuchten die Tanzenden auf den Dielen. Über das Wasser weht ein verhaltener Wind. Die bunt flackernden Baumkronen begleiten das Bild in verträumtem Takt.
Das Leben gönnt sich in jenem Sommer eine Verschnaufpause. Es ist die Zeit der frühen Tonfilme, Lilian Harvey und Willi Fritsch tanzen in den Himmel hinein und erschaffen glanzvolle Gefühle nach den Jahren der Entbehrung. Der knarzige Klang von Schellackplatten mit Stars wie Peter Igel-hoff oder dem Telefunken-Swing-Orchester erfüllt den Äther mit einer langersehnten Leichtigkeit.
Anna sitzt inmitten ihrer Familie. Neben ihr eine Kollegin aus der Kantine, die ihr eine gute Freundin geworden ist. Nach einer Pause laden die Musiker mit einem leichten Walzer zum Tanz. Johann, Karl und einige andere Männer erheben sich, so auch ihr Vater. Er verbeugt sich vor der Mutter. Sie legt ihre Hand auf den angebotenen Arm und lässt sich führen. Die Paare streben gemessenen Schrittes zu der Tanzfläche. In diesem Ritual liegt eine heimliche Ernsthaftigkeit, beinahe eine erotische Intimität. Anna und ihre Freundin beobachten die Eltern kichernd.
Ein stattlicher Mann in Uniform nähert sich den beiden jungen Frauen auf der Bank. Die polierten Knöpfe und Abzeichen glänzen im Licht. Er bleibt vor Anna stehen, deutet knapp eine Verbeugung an. Den linken Arm auf den Rücken gewinkelt, hält er ihr den anderen auffordernd entgegen.
»Verehrtes Fräulein, darf ich um diesen Tanz bitten?«
Er umfängt sie mit einem fesselnden Blick, seine blauen Augen klar wie ein Gebirgsbach. Von seinem Lächeln geht ein samtener Zauber aus, der bei ihr eine tiefe Vertrautheit auslöst, als wäre es ein bekannter Ort, an dem sie Schutz findet. Eine ungestalte Vernarbung der Haut, die sich über seine rechte Wange zieht, hätte jeden anderen entstellt, bei ihm jedoch verstärkt dieser Makel nur Annas Neugier. Sie senkt den Kopf, nestelt an ihrer Bluse und errötet. Da fängt sie ihr Vater von der Tanzfläche aus mit seinem Blick ein und die Mutter lächelt sie an. Beide nicken ihr bestärkend zu.