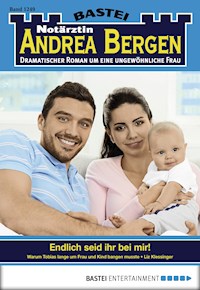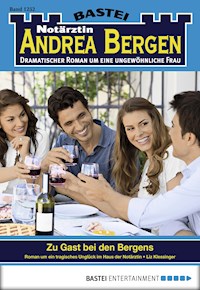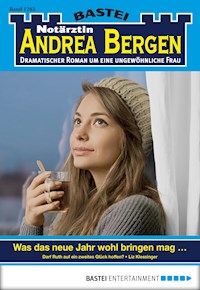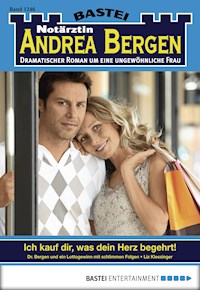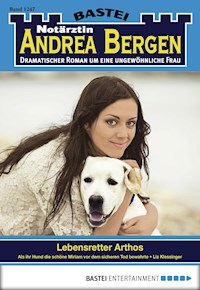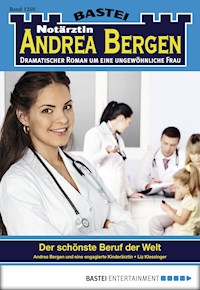
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Notärztin Andrea Bergen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der jungen Kinderärztin Daniela Kessing zieht sich vor Mitgefühl das Herz zusammen, als sie die kleine Maria ein letztes Mal an sich drückt. Auch für das zehnjährige Waisenmädchen ist der Abschied mehr, als es ertragen kann, denn Dr. Kessing ist Marias letzte Hoffnung.
Bei einem Erdbeben in Haiti ist die Kleine schwer verletzt worden! Nach mehreren offenen Brüchen der Beine ist es nun zu einer Entzündung des Knochenmarks gekommen, der unter den herrschenden katastrophalen hygienischen Bedingungen einfach nicht beizukommen ist! Wenn nicht ein Wunder geschieht, müssen die Kollegen im Ärztecamp amputieren...
Als sich Daniela nun sanft aus Marias Umklammerung löst, ist ihr T-Shirt nass von Kindertränen. Dies ist der Moment, der für die Ärztin alles verändern und der sie auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland nicht mehr loslassen wird. "Vertrau mir, Maria, ich werde zu dir zurückkommen und dich retten!", verspricht sie - und an dieses Versprechen wird sie sich halten...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 126
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Der schönste Beruf der Welt
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: shutterstock / Poznyakov
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-0331-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Kleine Maria, unser Sonnenschein! Niemanden am Elisabeth-Krankenhaus lässt das Schicksal der zehnjährigen Maria los, die bei einem schweren Erdbeben in ihrer Heimat Haiti lebensgefährlich verletzt wurde. Ihrem »Schutzengel«, der jungen Kinderärztin Dr. Daniela Kessing, ist es endlich gelungen, genügend Spendengelder aufzutreiben, um Maria zu uns nach Deutschland auszufliegen und hier behandeln zu lassen – doch es scheint bereits zu spät zu sein: Die lebensbedrohliche Entzündung des Knochenmarks lässt sich einfach nicht eindämmen! Aber am meisten bereitet mir Sorge, dass Maria sich aufgegeben und ihre verstorbenen Eltern nun gebeten hat, sie zu sich in den Himmel zu holen. Doch noch ist Hoffnung, noch kann Maria es schaffen! Deshalb flehe ich stumm die mir unbekannten Toten an: Wo immer ihr seid, helft eurem Kind, gesund zu werden! Lasst Maria hier bei uns! Sie soll doch leben …
Daniela Kessing bahnte sich einen Weg durch die unzähligen Verletzten, die dicht gedrängt am Boden lagen. Unsicher folgte ihr eine junge holländische Ärztin, die gerade im Feldhospital angekommen war. Swantje de Kerk machte einen Bogen um eine Frau, die mit ausgebreiteten Armen dalag. Tapfer lächelte sie der Verletzten zu.
Ein Meer von Menschen breitete sich vor dem Sanitätszelt aus. Sie lagen auf dem lehmigen Erdboden und warteten auf ärztliche Hilfe. Viele hatten Knochenbrüche, Quetschungen, tiefe Schnittwunden. Die meisten der Erdbebenopfer waren mit Staub und Schmutz überzogen.
»Der Dreck ist das Schlimmste«, rief Daniela über das Stimmengewirr der Menschen hinweg. »Dadurch entzünden sich die Wunden, das ist für den Heilungsprozess katastrophal.«
Von allen Seiten riefen die Menschen nach ihnen. Daniela und Swantje trugen das weiße T-Shirt mit dem breiten roten Kreuz und dem Äskulapstab darin, die Kleidung der Hilfsorganisation, die das mobile Krankenhaus betrieb. So waren sie schon von Weitem als Ärzte zu erkennen. Zwischen den dunkelhäutigen Menschen fielen sie ohnehin auf: Daniela war trotz der intensiven Sonne blass geblieben, sie war sehr schlank, ihr langes brünettes Haar hatte sie zu einem Zopf gebunden. Swantje dagegen hatte eine kräftige Statur, ihre rotblonden Locken quollen unter einem breiten Stirnband hervor.
»Wir gehen zum Aufnahmezelt, dort wird Doktor Marché dir dein Team vorstellen«, sagte Daniela zu Swantje.
Wie die anderen Sanitätszelte bestand es aus weißem Plastik, das über ein Gestänge gezogen war. Im offenen Eingang stand ein breitschultriger Mitarbeiter der Organisation, er sorgte dafür, dass immer nur ein paar Verletzte hereingebracht wurden. Daniela und Swantje gingen hinein.
In dem geräumigen Zelt drängten sich Verletzte und Angehörige, dazwischen liefen Schwestern und Ärzte umher, die einen ersten Blick auf die Verletzungen warfen und entschieden, wie weiterbehandelt werden sollte.
»Was ist mit den anderen Krankenhäusern?«, wollte Swantje wissen.
»Die sind alle zerstört worden, auch viele Schwestern und Ärzte sind bei dem Erdbeben umgekommen«, sagte Daniela mit ruhiger Stimme. »Es war eins der schwersten Beben hier in Haiti. Ich glaube, nicht ein Gebäude ist heil geblieben.«
»Ich hätte nie geglaubt, dass es aufblasbare Krankenhäuser gibt«, meinte Swantje, die sich im Zelt umsah.
»Diese Krankenzelte sind schnell zu transportieren und aufzubauen. In die Verstrebungen wird Luft geblasen, und dann steht es. Das Wichtigste aber ist, dass die Menschen sich hier sicher fühlen. Die meisten haben Angst, sich in festen Gebäuden aufzuhalten. Deshalb kommen sie auch alle zu uns.«
»Wie groß ist die Krankenstation?«
Daniela lächelte. »Es ist mehr als eine Station. Wir haben mehrere Krankenzelte mit hundert Betten, zwei OP-Zelte, ein Mutter-Kind-Zelt, eine Apotheke, dann noch einen technischen Bereich mit Wassertanks, Stormgeneratoren und ein eigenes Küchenzelt, in dem die Mitarbeiter essen können.«
»Wahnsinn!«, entfuhr es der jungen Ärztin. »Wie viele Leute seid ihr?«
»Ungefähr fünfzig Mitarbeiter, die Hälfte davon kommt aus Deutschland, der Rest aus allen Ländern der Welt. Allerdings bin ich die einzige Kinderärztin hier, die anderen sind alle in Port au Prince eingesetzt, wo es noch schlimmer aussieht.«
»Mich wundert es, dass hier so viele Ärzte und Schwestern arbeiten«, sagte Swantje. »Ich musste meinen Jahresurlaub nehmen, um hier helfen zu können.«
»Da bist du nicht die Einzige«, meinte Daniela. »Viele kündigen auch ihren Job und legen eine Zwischenstation hier ein. Du kennst das sicher: In einem normalen Krankenhaus läuft alles wie von selbst, hier ist man noch einmal ganz anders gefordert.« Plötzlich winkte sie. »Ah, da kommt ja mein Lieblingskollege!«
Sie winkte einem hochgewachsenen, dunkelhäutigen Arzt zu. »Das ist Vincent Marché, ein begnadeter Chirurg und einer der wenigen überlebenden Ärzte hier in Carrefour. Vincent ist der Einsatzleiter und wird dich einweisen.«
»Hallo, Daniela, bringst du uns endlich Verstärkung?«, begrüßte der Arzt sie auf Deutsch. Sein französischer Akzent war allerdings unüberhörbar. Er lächelte sie an, doch in seinen dunklen Augen lag eine tiefe Trauer.
»Das ist Swantje de Kerk, sie ist Internistin«, stellte Daniela die holländische Kollegin vor. »Wir sprechen hier normalerweise Englisch«, wandte sie sich an Swantje, »aber Vincent hat in Freiburg studiert, und es ist einfacher für uns, wenn er Deutsch spricht.«
»Wir können gern dabei bleiben«, versicherte Swantje.
»Dann mache ich mich mal auf ins Mutter-Kind-Zelt«, verabschiedete sich Daniela. »Ich will meine Patienten dort nicht so lange allein lassen.«
Sie ging wieder nach draußen und nickte den Verletzten aufmunternd zu. Auf Französisch sagte sie ihnen, dass sie Geduld haben müssten, niemand würde weggeschickt, jeder würde behandelt werden.
Die meisten sahen apathisch vor sich hin, der Schock über das apokalyptische Beben stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Andere lächelten erschöpft zurück, und Daniela bewunderte wie so oft in den letzten Wochen die Geduld und Herzlichkeit der Haitianer.
Sie wollte über ein Stoffbündel steigen, als sie sah, dass es sich bewegte. Es war eine winzige Bewegung, doch die ließ sie innehalten. Sie kniete sich nieder und schlug den schmutzigen Stofffetzen auseinander. Ein Neugeborenes bewegte schwach sein Händchen. Das Baby lag dicht neben einer jungen Frau, die vor sich hin stierte.
»Ist das Ihr Baby?«, fragte Daniela die Frau auf Französisch.
»Ich habe es auf der Straße gefunden«, sagte sie kaum hörbar.
Vorsichtig hob Daniela das Neugeborene auf und nahm es mit zum Mutter-Kind-Zelt. Unzählige Kinder waren durch das Beben zu Waisen geworden, sie irrten durch die Stadt, hungrig, durstig, verletzt an Körper und Seele. Sie schliefen auf der Straße, manchmal sogar neben den Leichen ihrer Familienangehörigen.
Es gab nicht genug Wasser, kaum etwas zu essen. Die Angst vor Cholera und Seuchen, vor weiteren Beben machte die Überlebenden panisch. So hilfsbereit und selbstlos die Haitianer waren, verschreckte Kinder oder ein hungriges Neugeborenes waren nur eine weitere, manchmal untragbare Last.
***
Daniela betrat das luftige Mutter-Kind-Zelt. Von der Decke baumelten bunte Luftballons, eine belgische Krankenschwester hatte sie von zu Hause mitgebracht. Daniela warf einen kurzen Blick in das Zelt, es schien alles in Ordnung zu sein.
Alle Krankenliegen waren belegt, einige der Kinder saßen im Bett und spielten mit Plüschtieren, die eine Spielwarenfirma gespendet hatte, die meisten kleinen Patienten aber lagen wie apathisch da.
Sie hatten starke Medikamente bekommen, damit ihre Schmerzen erträglicher wurden. Oder sie waren reglos vor Trauer, weil sie ihre Eltern, ihre Brüder und Schwestern, ihre Freunde und Schulkameraden verloren hatten. Sie hatten Verbände um oder geschiente Gliedmaßen, viele hatten blutunterlaufene Hämatome oder geschwollene Gesichter.
Daniela legte das Neugeborene auf den Untersuchungstisch und tastete es vorsichtig ab. Alle Knochen waren intakt, ebenso die inneren Organe, stellte sie erleichtert fest. Der aufgetriebene Bauch zeigte ihr, dass der kleine Junge unterernährt war, vermutlich hatte er seit Tagen keine Nahrung bekommen.
»Bringst du uns wieder Nachschub?«
Freundlich betrachtete Schwester Rose das Baby, sie kam aus Irland, hatte feuerrotes Haar und steckte mit ihrer Fröhlichkeit alle an.
»Warum?«, fragte Daniela erstaunt. »Habt ihr ein Kind entlassen?«
»Celestine wurde von ihren Eltern abgeholt«, antwortete Rose bedrückt. »Sie wohnen auf dem Land, und die Fahrt hierhin ist sehr mühsam.«
»Aber sie hätten doch hier im Zelt übernachten können«, wandte Daniela ein, während sie dem Neugeborenen eine Windel anlegte. »Das machen die anderen doch auch.«
Sie deutete mit dem Kopf ins Zelt. Neben den Betten saßen die Mütter, Großmütter oder auch großen Schwestern der kranken Kinder, je nachdem, wer überlebt hatte. In den Krankenhäusern des Landes war es üblich, dass die Angehörigen die Patienten wuschen und fütterten. Obwohl im Zelthospital für Essen gesorgt war, übernahmen sie auch hier die Aufgaben.
Am Anfang hatte es Daniela irritiert; ständig gab es Lärm und Lachen, ein Gehen und Kommen im Zelt, doch dann hatte sie schnell bemerkt, dass es den kleinen Patienten besser ging, wenn jemand aus der Familie bei ihnen wachte. Hier war niemand allein, viele helfende Hände boten sich an, wenn die Krankenschwestern überlastet waren.
Eine der Mütter kam auf Daniela zu und streckte ihre Arme aus. Lächelnd legte die Kinderärztin ihr das Kleine in die Arme, sie wusste, es war bei der warmherzigen Frau gut aufgehoben.
»Danke, Justine«, sagte sie zu der Frau.
»Habt ihr Celestine noch Medikamente mitgegeben?«, wollte Daniela von der Schwester wissen, und die nickte.
»Antibiotikum, Schmerzmittel und Elektrolyte«, antwortete Schwester Rose. »Ich hoffe nur, dass es ausreicht.«
»Hoffen wir das Beste!«, antwortete Daniela und lächelte, als sie sah, dass Schwester Rose sich mit einem Klemmbrett bewaffnete. Darauf waren Aufzeichnungen mit den wichtigsten Daten der Patienten. »Bereit für die Visite?« Munter sah sie ihre Kollegin an.
»Aye, aye, Sir«, rief Schwester Rose, und alle mussten lachen. Die Visite war jeden Morgen eine Herausforderung. Noch nie hatten sie es geschafft, alle Patienten zu untersuchen, jedes Mal war ein Notfall dazwischen gekommen.
Trotzdem nahmen sich Daniela und Rose viel Zeit für die Kinder und ihre Angehörigen. Sie begutachteten die Verletzungen, wechselten Verbände, erneuerten Infusionen, streichelten, lobten, lächelten und hörten zu. Die Verletzungen der kleinen Patienten waren versorgt worden. Was sie und ihre Angehörigen jetzt brauchten, war Zuwendung.
Gerade als sich Rose und Daniela dem nächsten Kind zuwenden wollten, brachten Sanitäter einen Neuzugang herein.
Daniela nahm seine Krankenunterlagen und überflog sie. Der Junge war zehn Jahre alt und hatte schwere Verbrennungen erlitten. Nach dem Erdbeben sei in seinem Dorf ein Feuer ausgebrochen, erzählte einer der Sanitäter. Seine Mutter und sein Bruder seien verschüttet worden, sein Vater vor weiteren Beben geflohen. Das hätten Verwandte erzählt. Ein Krankenwagen der Hilfsorganisation, der die Dörfer abfuhr, hatte den verwaisten Jungen mitgenommen.
Die Sanitäter betteten ihn behutsam auf die freie Liege von Celestine. Der schmale Junge steckte in dicken Verbänden und war sediert. Joëlle, die Mutter seines Bettnachbarn, deckte ihn fürsorglich mit dem dünnen Laken zu.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Doktor Dani«, sagte Joëlle, die Danielas besorgten Blick aufgefangen hatte. »Bald geht es ihm besser.«
Daniela musste lächeln. Die Patienten nannten sie Doktor Dani, und sie sagten es mit Ehrfurcht. Ihre Zuversicht gab ihr immer wieder Kraft. Auch wenn ihre Situation aussichtslos war, sie trösteten sich damit, dass alles gut werden würde.
Rose nahm wieder ihr Klemmbrett, und sie setzten die Visite fort. Dieses Mal schafften sie es ohne Unterbrechung bis zur letzten Patientin.
Erwartungsvoll sah Maria ihnen entgegen. Sie lag auf der letzten Krankenliege, hinten an der Zeltwand.
»Na, wie geht es meiner Lieblingspatientin heute?«, fragte Daniela auf Deutsch. Sie sprach langsam und deutlich, damit Maria alles verstehen konnte. Das zehnjährige Mädchen hatte bis zu dem Katastrophentag in einem Waisenhaus in der Hauptstadt Port au Prince gelebt, und die deutschen Ordensschwestern hatten ihr die Sprache beigebracht.
»Mir geht es gut«, antwortete Maria mit französischem Akzent und lächelte Daniela an. Sie freute sich immer, wenn sie auf Deutsch antworten konnte.
»Dann wollen wir uns mal deine Beine ansehen«, sagte Daniela betont munter und schlug das dünne Laken zurück. Sie zog sich sterile Handschuhe an und deckte vorsichtig den Verband ab.
Alle Schülerinnen und Lehrerinnen waren bei dem Beben verschüttet worden, hatte Maria der Kinderärztin erzählt. Die Erde hatte mehrmals gewackelt, plötzlich waren große Risse in den Wänden, sie waren umgefallen wie Karten.
Maria hatte großes Glück gehabt. Nach der Pause hatte sie getrödelt und war als Letzte ins Schulgebäude gegangen. In dem Moment bebte die Erde, die schwere Eingangstür riss aus den Angeln und stürzte auf Maria. Wieder hatte sie großes Glück gehabt. Die Tür fiel auf eine herabgestürzte Mauer, sodass nur Marias Beine begraben wurden. Sie war an den Schenkeln schwer verletzt worden, doch sie dankte jeden Tag dem Schöpfer im Himmel, dass sie noch lebte, hatte sie Doktor Dani anvertraut.
In Port au Prince hatte man sie in der eilig eingerichteten Krankenstation notdürftig versorgt und dann hierher nach Carrefour gebracht, weil auf der Kinderstation noch ein Platz frei gewesen war.
Als Vincent und Daniela sich die Röntgenbilder angesehen hatten, waren sie entsetzt gewesen: Maria hatte mehrere Trümmerbrüche in den Beinen, ihr linker Fuß war gebrochen, und im linken Bein breitete sich eine Knochenmarkentzündung aus. Wie hatte das Mädchen nur die starken Schmerzen ausgehalten? Das einfache Schmerzmittel, das man ihr in Port au Prince gegeben hatte, konnte nie und nimmer ausgereicht haben.
Seit ihrer Ankunft hatten Daniela und Vincent das Mädchen schon mehrfach operiert und beide Beine mit Schrauben und Platten fixiert. Die Knochenmarkentzündung behandelten sie mit Antibiotika und hofften inständig, dass sie die Entzündung in den Griff bekamen.
»Exogene Osteomyelitis, posttraumatisch«, diktierte Daniela auf Englisch, und Schwester Rose schrieb mit. »Behandlung mit Antibiotika, dazu noch Elektrolyte gegen den Flüssigkeitsverlust.« Daniela begutachtete das geschwollene Bein des Mädchens. »Bei der exogenen Osteomyelitis dringen die Bakterien von außen in den Knochen«, erklärte sie Schwester Rose, die sie fragend angesehen hatte. »Vermutlich wurden die offenen Brüche durch den Staub infiziert.« Danach maß sie Fieber, es war hoch, aber noch nicht besorgniserregend.
Die Kinderärztin setzte sich zu Maria ans Bett. »Hast du Schmerzen?«, fragte sie.
Maria biss sich auf die Lippen.
»Du musst uns sagen, wenn du Schmerzen hast«, sagte Daniela eindringlich. »Wir können dir helfen, du bekommst dann Medikamente.« Sie nahm die Hand des Mädchens und blickte ihm in die Augen. »Ich weiß, dass du große Schmerzen hast, und ich weiß auch, dass du sehr tapfer bist. Aber du musst nicht leiden, Maria. Wir haben gute Medikamente.«
Das Mädchen nickte nur und lächelte Daniela an. Liebevoll fuhr die Kinderärztin ihr über die Wange. Maria war der Liebling der Ärzte und Schwestern, noch nie hatte sie sich beklagt, äußerte selten Wünsche und lächelte meistens.
Daniela und Rose versuchten, sie zum Widerspruch zu bewegen.
»Du musst dich nicht für alles bedanken«, sagte Rose in ihrem schlechten Französisch, und Daniela und Maria mussten lachen. »Du darfst ruhig jammern, wir kommen dann und helfen dir.«
»Danke, Schwester Rose, das weiß ich«, antwortete Maria mit ihrer hellen Stimme. »Aber hier sind so viele, alle haben Schmerzen. Mir geht es gut, warum soll ich jammern?« Lächelnd sah sie die beiden Frauen an.
Daniela schüttelte den Kopf und schmunzelte. Sie zupfte an einem geflochtenen Zöpfchen, das Maria in der Stirn hing.
»Solange du dir noch Zöpfe flechten kannst, ist alles in Ordnung«, beruhigte sie das Mädchen und verabschiedete sich.
»Hoffentlich wirkt das Antibiotikum bald«, sagte Daniela leise, als sie mit Rose vor dem Zelt stand. »Wenn die Entzündung nicht abheilt, müssen wir ihr Bein amputieren.«
Rose verzog gequält das Gesicht. »Wir müssen es verhindern, egal, wie.«
***