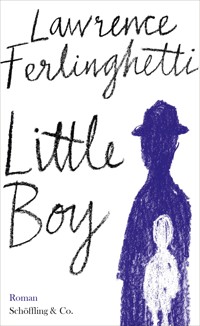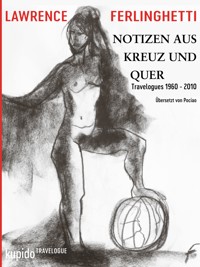
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kupido Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Travelogue
- Sprache: Deutsch
Lawrence Ferlinghetti, Jahrgang 1919, Kind einer sephardischen Mutter, am D-Day Skipper des U-Boot-Jägers USS SC-1308, 1945 am Seekrieg gegen Japan beteiligt, um die Welt vom Faschismus zu befreien, kannte als Seemann alle Meere der Welt und machte sich, Beatnik der ersten Stunde, zwischen 1960 und 2010 auf, auch die Kontinente zu bereisen. Er starb 2021 im Alter von (fast) 102 Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Notizen aus Kreuz und Quer
Travelogues
KUpido Literarturverlag
Travelogues 1960–2010
Aus dem amerikanischen Englisch von Pociao
Notizenaus
KreuzundQuer
Für meine Mutter, Clemence Albertine Monsanto,
und meine Brüder, alle nun in irgendwelchen Himmeln
Jedes Tagebuch ist ein Bekenntnis. Wenn es in der ersten Person geschrieben ist, kann es gar nicht anders sein. Es sei denn, der Autor belügt sich selbst – und das macht es noch mehr zu einem Bekenntnis. Ich versuche, die Harke meines Journals über die Landschaft zu ziehen. Vielleicht lege ich etwas frei.
Inhalt
Anmerkung des Autors15
Vorwort der Herausgeber17
Das erste Mal im Ausland25
Invasion der Normandie (6. Juni 1944)26
I. DIE SECHZIGER
Lateinamerika (Januar–Februar 1960)31
Amerika! Amerika! (März–November 1960)41
St. Thomas – Puerto Rico (November 1960)49
Malerisches Haiti (November–Dezember 1960)55
Notizen des Dichters zu Kuba (Dezember 1960)65
New Orleans (8. Dezember 1960)79
Big-Sur-Journal (September 1961)81
Saltonsee-Notizen (Oktober 1961)85
Seattle – British Columbia (Februar 1962)95
Frankreich – Nordafrika (Mai–Juli 1963)99
London (1963)119
Tijuana – La Paz (4.–7. Januar 1964)121
Los Angeles – Fresno (Januar 1964)123
Nerja-Journale (Februar–Mai 1965)127
Italienisches Journal (Juni 1965)159
Andrei Wosnessenski / Jewgeni Jewtuschenko (1966)163
Berlin Blauer Reiter (Februar 1967)173
Russisches Winter-Journal (Februar–März 1967)181
High Noon, High Night, Salome, Arizona (9. Oktober 1967)211
New Mexico (Oktober 1967)215
Santa-Rita-Journal (Januar 1968)219
Paris: Mai 1968225
Der ehrenamtliche Sheriff von Keystone Heights, Florida (August 1968)229
Massachusetts – Big Sur (August–Oktober 1968)231
Paris und Rom (Dezember 1968)235
II. MEXIKANISCHE NACHT245
III. DIE SIEBZIGER
Florida (Juli 1970)287
Spanien, Erinnerungen aus der Ferne (1971)290
Ferlinghetti – Ginsberg / Australische Reise (März 1972)291
Mexiko, schon wieder (Mai 1972)309
Hawaii (März 1974)313
Beatitudes Visuales Mexicanas (Oktober – November 1975)317
Pacific Northwest (Juli 1976)323
Manina (August 1978)325
Bisbee Poetry Festival (August 1979)327
IV. DIE ACHTZIGER
Amsterdam und der Rhein (September–Oktober 1981)331
Notizen aus Boulder (Juli 1982)343
Durchs Labyrinth in die Sonne (August 1982)347
Mailand (Dezember 1982)361
Ein Spaziergang durch mein altes Viertel (21. Dezember 1982)365
Marrakesch-Journal (Juli 1983)367
Der Mund der Wahrheit (August–September 1983)371
Sieben Tage in Nicaragua Libre (Januar 1984)379
Harbin Hot Springs, Kalifornien (August 1984)411
Rom – Neapel – Sizilien (September 1984)413
Tennessee (April 1986)425
Frankreich – Portugal (Juli 1986)427
Österreich (September 1986)431
Chicago (Juni 1988)435
Mexiko – Nicaragua (Juli 1989)437
Italia (Oktober 1989)449
V. DIE NEUNZIGER
Pompeji (September 1990)453
Baja Beatitudes (März 1991)455
Britannien – Spanien – Frankreich (Mai 1991)459
Italia (Mai 1995)467
Tagebuchnotizen, New York (2. März 1997)471
Italia Ancora (April–Mai 1997)473
Voyages (April – Mai 1998)477
Voyage au But (Juli 1999)487
VI. 2000– 2010
Griechenland – Italien (März 2001)499
Oaxaca (Februar 2004)505
Berlin-Journal (Juni 2004)515
Gedankenstrom / Dadapolis (Oktober 2005)517
Mexiko – Der Stierkampf (Februar 2006)531
Italien – Frankreich (2006–2007)533
Yelapa, Mexiko (Januar 2008)543
Belize (Februar 2010)547
Anmerkungen557
Index562
Glossar 570
Inhalt
Inhalt
Anmerkung des Autors
Ich sehe dieses Buch in der Tradition von D. H. Lawrences Reisen durch Italien oder Goethes Italienische Reise … Es ist, als sei vieles in meinem Leben die Fortsetzung meiner jugendlichen Wanderjahre, meines Umherstreifens in der Welt gewesen.
Ich schrieb diese Reiseberichte für mich und dachte nie daran, sie zu veröffentlichen. Ich las sie auch nicht wieder, bis Giada Diano und Matt Gleeson mir Fotokopien der Originale und Notizhefte brachten, die in der Bancroft Library, U.C. Berkely vor sich hingedöst hatten.
Wenn ich mich Jahre später durch das falsche Ende des Teleskops betrachte, komme ich mir vor wie ein Wanderer in bedeutsamen Zeiten … Ich gehörte dieser „Greatest Generation“ an (so die Bezeichnung eines Journalisten), die zu Anfang des Zweiten Weltkriegs volljährig wurde … Während ich in San Francisco arbeitete oder durch die Welt reiste, verschwanden die Tage und Jahre im großen Schlund der Zeit … Der Krieg ist zu Ende, Jahrzehnte schwirren vorbei, in den Kulissen rumpelt es, die Bühne wird dunkel, und Camelot ist verloren!
Danach machte Amerika gewaltige Veränderungen durch. San Francisco, die kleine provinzielle Hauptstadt, wurde erwachsen, so wie ich auch. Ich begann zu reisen. Meistens besuchte ich irgendwelche literarischen oder politischen Events oder suchte nach unentdeckten Meisterwerken von Autoren, die ich bei City Lights veröffentlichen konnte.
Europa war eine Art „Rückkehr“, auf der Suche nach meinen Wurzeln. Seit der frühesten Kindheit, die ich bei meiner französischen Tante Emilie in Frankreich verbrachte, hatte ich das Land als zweite Heimat betrachtet. Als mein Schiff nach der Invasion der Normandie in Cherbourg anlegen konnte, hätte ich am liebsten den Boden geküsst. Drei Jahre später als Student an der Sorbonne in Paris ging es mir noch genauso.
Spät erst verschlug es mich in das Italien meines Vaters, zunächst als Student der italienischen Sprache, la bella lingua, und dann auf der Suche nach seinem Geburtsort. Doch wie viel ergab sich daraus!
Ich führte kein durchgehendes Tagebuch, daher blieben einige literarische Kapriolen undokumentiert, etwa als ich nach Tanger fuhr, um Paul Bowles aufzusuchen; ich wollte ihm seine marokkanischen Geschichten A Hundred Camels in the Courtyard abluchsen. Nachdem wir uns einig geworden waren, saßen wir noch eine Weile lustlos in seiner Hochhauswohnung in der Nähe der amerikanischen Botschaft. Als Jane vorschlug, wir sollten uns antörnen, behauptete Paul, er habe kein Haschisch. Ich war glattrasiert und trug einen weißen Anzug; ich glaube, er hielt mich für einen Drogenfahnder. Paranoia – die ständige Begleiterin eines Kiffers!
Was sonst kann ich über diese inneren Monologe sagen, von denen einige als Nachrichten eines Reporters aus dem All durchgehen könnten, der über das seltsame Verhalten der „Menschen“ hier unten berichtet, im Auftrag eines Chefredakteurs, der für Schwachsinn nichts übrighat?
Lawrence Ferlinghetti23.10.2014S.F.
Vorwort der Herausgeber der Amerikanischen Ausgabe von 2014
Giada Diano und Matthew Gleeson
Die Journale des vorliegenden Buchs sind das Ergebnis von mehr als fünf Jahrzehnten kontinuierlichen Reisens. Einige sind bereits abgedruckt, doch bei den meisten handelt es sich um Transkripte von handschriftlichen Aufzeichnungen, die sich in der Bancroft Library der University of California, Berkeley, oder im Besitz des Autors befanden. Sie wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Autor ausgewählt und herausgegeben. Auch eine großzügige Sammlung an Zeichnungen aus Ferlinghettis reichem Fundus wurde zusammengestellt. Zusammengenommen zeigen diese Aufzeichnungen von Beobachtungen und Erfahrungen, dass die Reisen des Dichters um die Welt eine der wichtigsten und reichsten Quellen seiner Kreativität bildeten. Zwar wird Ferlinghetti meistens mit San Francisco in Verbindung gebracht, in Wirklichkeit aber wurde er von den vielen Jahren im Ausland geprägt. Und auch wenn man ihn oft mit den Schriftstellern der Beat Generation identifizierte, weil er sie bei City Lights verlegte, hielt Lawrence sich selbst nie für einen Beat-Autor. Die vorliegenden Journale bezeugen seine Verbindung mit einem weiten internationalen Feld rebellischer, avantgardistischer Literatur und einer Poesie des Widerstands. Darüber hinaus enthalten sie einige seiner hervorragendsten Prosastücke, Gedichte und Zeichnungen.
Ferlinghettis Leben war vom ersten Augenblick an kein allein amerikanisches; als kleiner Junge hielt er sich sogar für einen Franzosen. Er kam als fünftes Kind von Carlo Ferlinghetti und Clemence Mendes-Monsanto in New York zur Welt und wuchs als Lawrence Ferling auf, nachdem der Familienname anglisiert worden war. Da der Vater schon vor seiner Geburt gestorben war, gab man Lawrence in die Obhut seiner Tante Emilie, die ihn im Alter von zwei Jahren mit nach Frankreich nahm. Sie kehrten bald nach New York zurück, als seine Tante eine Stelle als Gouvernante der Tochter von Presley und Ana Bisland in Plashbourne annahm, einem Anwesen in Bronxville, wenige Kilometer nördlich von Manhattan. Als Emilie eines Tages unter mysteriösen Umständen verschwand, blieb Lawrence bei den Bislands. Erst im Laufe seines Lebens sollte er nach und nach herausfinden, dass sein Vater um 1900 von der Lombardei nach Amerika ausgewandert war und er mütterlicherseits sephardische Vorfahren hatte.
Die Journale beginnen 1960, doch bis dahin hatte Ferlinghetti schon viel Zeit im Ausland verbracht. Als Captain eines U-Bootjägers der US-Marine während des Zweiten Weltkriegs erlebte er die Invasion der Normandie, er sah die kurz zuvor durch eine Atombombe ausgelöschte Stadt Nagasaki. Nach dem Krieg verbrachte er vier Jahre in Paris und machte per G. I. Bill seinen Doktor in Literatur an der Universität Sorbonne. Bei der Ankunft in Paris lernte er seinen lebenslangen Freund George Whitman kennen, den zukünftigen Besitzer der Buchhandlung Shakespeare & Company am linken Seineufer, die mit Ferlinghettis späterer Buchhandlung City Lights „verschwistert“ war. Diese frühen Jahre wurden nicht direkt aufgezeichnet, tauchen aber in den hier vorliegenden Notizen immer wieder auf.
Zu Beginn der Journale hatte sich Ferlinghetti bereits einen Namen als Dichter und Verleger gemacht. Er lebte mit seiner Frau Selden Kirby-Smith (bekannt als Kirby, Enkelin des konföderierten Generals Edmund Kirby-Smith) in San Francisco und hatte 1953 zusammen mit Peter D. Martin den City Lights Pocket Bookshop eröffnet. Zwei Jahre später startete er mit der Veröffentlichung seines eigenen Debüts Pictures of the Gone World (nicht ins Deutsche übersetzt) die Pocket Poets Series. 1956 verlegte er Allen Ginsbergs Howl (dt.: Geheul), was zu seiner Verhaftung und einer Anklage wegen Veröffentlichung obszönen Materials führte. Er gewann den Fall mit Hilfe der ACLU (American Civil Liberties Union). 1958 erschien dann sein bahnbrechender Gedichtband A Coney Island of the Mind bei New Directions (dt.: Ein Coney Island unseres Geistes).
So kam es, dass Ferlinghetti in den 1960er Jahren kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten reiste und als Gast auf Literaturfestivals in der ganzen Welt aus seinen Gedichten vorlas. Die Journale der 1960er Jahre beginnen mit seiner Reise zur internationalen Literaturkonferenz in Concepción, Chile, dem Primer Encuentro de Escritores Americanos. Ferlinghetti und Ginsberg waren die ersten US-Dichter der Gegenkultur, die zu einer solchen internationalen Veranstaltung eingeladen wurden. Seitdem nahm Ferlinghetti Jahrzehnt um Jahrzehnt an derartigen Veranstaltungen teil, so 1965 am Festival of Two Worlds in Spoleto, Italien, diversen wilden Happenings, die von dem radikalen französischen Künstler Jean-Jacques Lebel organisiert wurden, am One World Poetry Festival, das 1980 und 1981 in Amsterdam vom niederländischen Impressario der Gegenkultur und Kommunarden Benn Posset ins Leben gerufen wurde, 1984 am International Festival of Poetry in Morelia (das in letzter Minute nach Mexiko-City verlegt wurde) oder dem Festival im griechischen Delphi, das 2001 von der UNESCO gesponsert wurde. Unterdessen führte ihn seine verlegerische Arbeit nach British Columbia, Marokko oder London, um sich die Rechte an Malcolm Lowrys Gedichten, Paul Bowles’ AHundred Camels in the Courtyard (nicht ins Deutsche übersetzt) und William Burroughs’ Yage Letters (dt.: Auf der Suche nach Yage) zu sichern. 1967 besuchte Ferlinghetti im Anschluss an eine Lesung im Literarischen Colloquium Berlin die Sowjetunion. Seine Verbindung zu den berühmten sowjetischen Dichtern Andrei Wosnessenski und Jewgeni Jewtuschenko während des Kalten Krieges erleichterte ihm den Zugang zu literarischen Kreisen hinter dem Eisernen Vorhang. Auch seine kurzen Erinnerungen an eine Begegnung mit den beiden in San Francisco im Jahr 1966 sind in den Journalen enthalten.
Dennoch stellen die offiziellen Literaturveranstaltungen nur Ausgangspunkte, keine Schwerpunkte in den Aufzeichnungen dar. In vielen Fällen werden Lesungen und Zusammenkünfte gar nicht beschrieben – vielmehr andere Details wie Erlebnisse, Impressionen oder auch die Landschaft, die für den Dichter wichtig waren. Nach seinen Aufenthalten in Berlin und Moskau im Jahr 1967 fuhr Lawrence mit der Transsibirischen Eisenbahn quer durch den Kontinent bis an die Ostküste und schilderte die damit verbundenen Abenteuer und Schwierigkeiten in seinem Russischen Winter-Journal. Die opulenten, traumartigen Aufzeichnungen aus dem Jahr 1972, als er mit seinem Sohn Lorenzo durch Fidschi, Australien und Tahiti reiste, entstanden auf dem Weg zu einer Lesung auf dem Adelaide Festival of the Arts, an dem er mit Allen Ginsberg und Andrei Wosnessenski teilnahm, das Festival selbst wird jedoch kaum erwähnt. Später führt seine Beschreibung des berauschenden One World Festivals in Amsterdam 1981 zu einem der komischsten satirischen Texte im ganzen Buch: dem im Rhein-Journal geschilderten Aufenthalt im touristischen Deutschland. Exzentrische Charaktere, heruntergekommene Hotels, unbeschwerte Wortspiele, die Vitalität menschlicher Verbundenheit und die Präsenz des Meeres sind hier letztlich wichtiger als die Beschreibung des literarischen Lebens.
In Zeiten politischer Turbulenzen auf der ganzen Welt bildet Ferlinghettis linke politische Einstellung einen weiteren wichtigen Akzent seiner Travelogues. Nachdem eine Revolution in Kuba den Diktator Batista gestürzt hatte, engagierte er sich im Fair Play for Cuba Committee, und in den späten sechziger Jahren besuchte er Kuba, um sich einen persönlichen Überblick darüber zu verschaffen, was die euphorische Verheißung der Revolution bringen könnte; seine Begegnungen beschreibt er auf lebendige Art und Weise in den Notizen des Dichters zu Kuba.
Seine Freundschaft mit Jean-Jacques Lebel führte dazu, dass er im Mai 1968 an der Pariser Studenten- und Arbeiterrevolte teilnahm und durch die Augen eines Dichters darüber berichtete; die gescheiterte Revolution, die Proteste vom Mai 68 tauchen in seinen Notizen immer wieder auf. Ferlinghetti nahm auch an Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg teil und beschrieb im Santa-Rita-Journalseine Zeit im Gefängnis wegen der Blockade des Oakland Army Induction Center, an der er beteiligt gewesen war. Auch wenn der Zweck einer Reise nicht politisch war, hatte er die politische Landschaft immer im Blick. Deshalb sind die Nerja-Journale, in denen er einen dreimonatigen Aufenthalt in Francos Spanien festhält, mit Kommentaren über die repressive Diktatur gespickt. Die Saltonsee-Notizen zeichnen ein humorvolles und bissiges Porträt des Hinterlandes der Vereinigten Staaten.DieNotizenausBoulder dokumentieren eine Konferenz im Jahr 1984 zum fünfundzwanzigsten Jahrestag von Jack Kerouac’s OntheRoad (dt.: Unterwegs) im Naropa Institute.
Im Laufe der Jahrzehnte wurden Lawrences direkte Aufzeichnungen seltener. Das trifft vor allem auf die siebziger Jahre zu. Nicht weil Lawrence nicht mehr reiste oder weniger schrieb, sondern weil sich die Art und Weise änderte, mit der er schreibend auf die Orte, die er bereiste, reagierte. Die Notizen, die er sich unterwegs machte, bestanden zunehmend aus Entwürfen für Gedichte, die er später veröffentlichte, weniger aus tagebuchartigen Einträgen, die in Prosa verfasst wurden. Viele seiner Gedichtbände hatten ihren Ursprung in seinen Reisen, und die Entstehung von Starting from San Francisco (dt. Angefangen mit San Francisco), Over All the Obscene Boundaries: European Poems and Transitions oder Wild Dreams of a New Beginning spiegeln die Erfahrungen aus dem vorliegenden Buch wider.
Zwei der hier versammelten Journale sind bereits in Buchform erschienen: 1970 veröffentlichte New Directions Mexican Night (dt. Mexikanische Nacht). Auf der Rückseite des Covers ist vermerkt, dass es sich um den ersten Band einer Reihe von Ferlinghettis Travelogues mit dem Titel Writing Across the Landscape (dt.: Notizen aus Kreuz und Quer) handelt. Tatsächlich war es das einzige Journal, das bislang in Buchform erschienen und seit Langem vergriffen ist. Mexikanische Nacht enthält mehr als ein Jahrzehnt dessen, was Ferlinghetti in Mexiko geschrieben hat, ein Land, das er häufiger als alle anderen bereiste. Es war ein wichtiger Schauplatz für mehrere Autoren, die er als maßgeblich empfand – D. H. Lawrence und Malcolm Lowry, aber auch Antonin Artaud, den visionären französischen Dramatiker, Dichter und Theaterregisseur, dessen Leben und Werk am Rande des Wahnsinns verlief. Ihre Stimmen hallen in der Mexikanischen Nacht wider, doch Ferlinghettis Vision von Mexiko ist ganz und gar seine eigene. Seine Zusammenführung von Reisenotizen und traumartiger Prosadichtung als Journal sei für dieses Buch als Beispiel für Ferlinghettis Abweichung eines geradlinigen, chronologischen Schreibens hervorgehoben.
1984 veröffentlichte City Lights die zweite Auskopplung seiner Travelogues: Seven Days in Nicaragua Libre (dt.: Sieben Tage in Nicaragua Libre), das ebenfalls vergriffen ist. Während der Reagan-Jahre engagierte sich Ferlinghetti weiter gegen den rücksichtslosen Kapitalismus und Militarismus und nahm die linksgerichtete Politik unter die Lupe. 1979 hatte die Sandinistische Revolution den von den Vereinigten Staaten unterstützten Anastasio Somoza in Nicaragua gestürzt. 1983 veröffentlichte City Lights eine Sammlung radikaler mittelamerikanischer Gedichte mit dem Titel Volcán, und als Ferlinghetti von seinem Freund, dem Dichter Ernesto Cardenal (damals Sandinistischer Kulturminister) nach Nicaragua eingeladen wurde, nahm er die Gelegenheit als selbsternannter „Revolutionstourist“ wahr, um einen persönlichen journalistischen Bericht zu schreiben.
In den neunziger Jahren wurde Europa zum häufigsten Ziel von Ferlinghettis Reisen. Mittlerweile war er so etwas wie eine Vaterfigur der Gegenkultur, das Vorbild einer neuen Generation radikaler Literaten. Das wird offensichtlich, als er in Italien zwei literarische Zentren besucht, Calusca City Lights und City Lights Italia, beide nach seiner eigenen legendären Buchhandlung benannt. Und während einer Reise nach Prag im Jahr 1998, fast zehn Jahre nach der Samtenen Revolution, hieß man ihn in einer großen Kirche auf dem Altstädter Ring mit einer Marathon-Lesung seiner Gedichte willkommen, die rund um die Uhr stattfand – eine Erinnerung daran, dass sein A Coney Island of the Mind seit Jahren in Samisdat-Ausgaben hinter dem Eisernen Vorhang in ganz Osteuropa kursierte. 1998 wurde Lawrence zum ersten Poeta Laureatus von San Francisco ernannt. Die Hoffnungen und der Humor, die in den Journalen dieses Jahrzehnts oft zum Ausdruck kommen, wechseln sich mit düsteren, apokalyptischen Stimmungen angesichts der Möglichkeit einer ökologischen oder nuklearen Katastrophe ab. Inzwischen hatten auch seine Malerei und visuelle Kunst internationale Anerkennung erlangt. In Italien wurde er durch den Kunstsammler Francesco Conz aus Verona von der Fluxus-Gruppe willkommen geheißen, und viele der hier enthaltenen Journale beschreiben weitere Europareisen zu diversen Veranstaltungen und Ausstellungen.
In den Nullerjahren entsteht der Eindruck, als schlösse sich der Kreis, und Ferlinghetti kehrte zu seinen frühen Jahren zurück. Hier findet sich das ausführlichste Porträt seines alten Freundes George Whitman. Die Suche nach seinen Wurzeln konzentrierte sich auf Italien. Gedanken über die Reise seines Vaters aus der Alten in die Neue Welt und seine Brüder in Amerika tauchten in den Notizen aus dieser Zeit immer wieder auf. Während seiner Reisen entdeckte Ferlinghetti, dass sein Vater aufgrund seines Nachnamens aus dem Norden Italiens stammen müsse. Schließlich fand er 2004 mit Hilfe von Riccardo und Fausta Ferlinghetti die Geburtsurkunde seines Vaters in Brescia und machte sich auf die Suche nach dem Haus, in dem er geboren wurde. Der absurde Vorfall, der sich daraus ergab, und dessen emotionales Fundament inspirierten später den sanften Fluss von RunningThoughts (dt.: Gedankenstrom). Das lyrische Gedicht At Sea(dt.: AmMeer)schließlich, das 2010 in Belize entstand, kennzeichnet den eigentlichen Höhepunkt der Reisen des Dichters um die Welt und ist gleichzeitig sein Vermächtnis, die arspoetica seines Lebens.
Notizen aus Kreuz und Quer
Travelogues
1960–2010
Das erste Mal im Ausland
In einem kleinen Hinterzimmer in South Yonkers, N.Y., hörte mein Bruder Harris meinen allerersten Schrei.
Doch meine eigene früheste Erinnerung stammt aus dem Ausland. Straßburg in den frühen 1920er Jahren. Jemand trägt mich auf dem Arm und steht auf einem dieser klassischen umlaufenden Balkone eines französischen Mietshauses. Vielleicht bin ich ein Jahr alt oder zwei. Auf dem Boulevard unten zieht eine Parade vorbei. Jemand hält mich fest, vielleicht meine geliebte Tante Emilie. Sie winkt der Parade mit meiner Hand zu. Ich erinnere mich an weiße Berge in der Ferne hinter der Stadt. Die weißen Berge des Elsass, zweifellos die Vogesen. Wessen Parade es ist und wer da marschiert, weiß ich nicht. Ich winke. Die Szene verblasst, und das ist alles, was mir damals vom Elsass, von Frankreich im Gedächtnis geblieben ist.
Invasion der Normandie
6. Juni 1944
Wir waren so jung, aber es war uns nicht bewusst, und wir lenkten ein Schiff. Genauer gesagt, der befehlshabende Offizier Eugene Feinblatt, Leutnant der United States Navy Reserve, vier- oder fünfundzwanzigjährig, hatte das Kommando, er erledigte den ganzen lästigen Kram, der ein Schiff am Laufen hält, kümmerte sich um die Versorgung, trainierte die Crew usw. Ich als Skipper (genauso alt wie Gene) musste die USS SC-1308 nur „steuern“ – d. h. auf Kurs halten. Es war ein großartiges Schiff, das einiges aushalten konnte. Und genau das tat es.
Es war noch vor der Morgendämmerung, 6. Juni 1944, wir gehörten einer Konvoi-Eskorte zur U-Boot-Abwehr an. Wir waren aus Plymouth ausgelaufen und fuhren in Formation Richtung Ostnordost durch den Ärmelkanal auf die Strände der Normandie zu. Dreiunddreißig Mann und drei Offiziere auf einem vierunddreißig Meter langen Holzrumpf-Dieselmotor-U-Bootjäger. In der Nacht vor der Verladung in Plymouth waren die zerfurchten Landstraßen zwischen den Heckenreihen verstopft von Truppen- und Waffentransportern mit Abertausenden von Soldaten in Kampfmontur, alle verdunkelt und schweigsam. In den flüsternden Feldern ringsum große Zeltlager, wo ganze Armeen um kleine abgedeckte Feuerstellen biwakierten. Es war die Nacht vor Agincourt, als der König seine Männer an den Lagerfeuern in der stillen Dunkelheit besuchte. Jetzt war es 4 oder 5 Uhr früh auf der verdunkelten Brücke unseres kleinen Schiffs, das erste Licht brach durch den schwarzen östlichen Horizont, alle Mann an Deck auf Kampfstation, Gene, ich selbst und der Signalgast auf der Brücke, Doug Crane, der dritte Offizier darunter. Und im allerersten Licht am westlichen Horizont hinter uns sahen wir einen Mastenwald schwach unterhalb des Horizonts aufragen, zuerst nur die Mastspitzen, danach die Rümpfe – eine riesige Armada aus Tausenden von großen Schiffen, Truppenlandungsbooten und Geleitbooten aus den verschiedensten Häfen, die zusammenkamen und sich im ersten Licht vor der Küste der Normandie vereinten. Wir hörten Wellen von alliierten Bombern, die hoch über uns die noch in Dunkelheit gehüllten Strände Utah und Omaha anflogen, und dann wurden die fernen Explosionen zu einem Brüllen in der Dunkelheit, während wir unsere Posten einnahmen, Gene mit seinem Helm, unter dem sein rotes Haar hervorlugte, die Feldstecher auf die französische Küste gerichtet, die jetzt im Dämmerlicht in Reichweite kam, als die Armada volle Kraft voraus auf die Strände zusteuerte, den Tod im Auge.
Und günstig stand der Wind für Frankreich!
I. Die Sechziger
Lateinamerika
Januar–Februar 1960
Wir fliegen von San Francisco nach Santiago, meine Frau Kirby und ich, treffen uns zum Umsteigen mitten in der Nacht mit Allen (Ginsberg) in Panama-Stadt und sehen nichts als den einer Busstation ähnlichen Flughafen. Vor etwa fünfzehn Jahren passierte mein Körper diesen Kanal auf einem Landungsschiff der US-Marine, um Japan zu besetzen ... Um Seekarten im Hydrographischen Amt der Marine zu besorgen, war ich als unser Navigator an Land und auf dem Rückweg zum Schiff in ein paar Bars mit Schwingtüren gegangen und schaffte es gerade noch an Bord, ehe das Schiff den Kanal verließ ... Jetzt sitzen wir in einem schummrigen Wartesaal, während die Maschine aufgetankt wird ... Allen und ich quetschen uns in einen Fotoautomaten, nicht größer als ein Telefonhäuschen, und ziehen Grimassen.
Es ist unsere erste gemeinsame Auslandsreise als Dichter – eine internationale Literaturkonferenz, die Fernando Alegría organisiert hat, der chilenische Poet und Professor an der U.C. Berkeley. Es wird das erste umfassende Treffen von Schriftstellern aus allen lateinamerikanischen Ländern sein. Wie sich herausstellt, darf die Hälfte von ihnen – die wichtigsten Vertreter in ihren jeweiligen Ländern – aus politischen Gründen nicht in die Vereinigten Staaten einreisen. Bloß keine schmutzigen fremden Einflüsse. Während wir Dinge vereinheitlichen (wie Borden’s Milch), kämpft Lateinamerika darum, sich selbst ausreichend zu homogenisieren, um über die Grenzen seines eigenen Kontinents hinaus zu kommunizieren, Ideen oder Bücher auszutauschen usw. ... Wir werden bis zum 21. Jahrhundert warten müssen, ehe sie für die Vereinigten Staaten von Lateinamerika bereit sind.
Die Konferenz findet in der Universität von Concepción statt. Am ersten Abend hält Allen eine großartige, wilde Rede auf Spanisch und liest Whalen, Lamantia, Snyder in der Übersetzung von Luis Oyarzún. In der gegenseitigen Befruchtung schwingt ein Gefühl literarischer Begeisterung. Zendejas1 unterbricht seine feierliche Rede und fordert eine Schweigeminute für den verstorbenen Alfonso Reyes. Wird gewährt. Alle erheben sich und schweigen. Fünf Minuten später steht er auf und unterbricht erneut – diesmal fordert er zwei Schweigeminuten. Fünf Minuten später drei Schweigeminuten. Einmal organisiert die örtliche Kommunistische Partei einen Ausflug zur Mine von Lota, einem Kohlebergwerk unter dem Meer. Als wir ankommen, beenden die Bergarbeiter gerade ihre zwölfstündige Schicht. Sie kommen in kleinen Aufzügen, die aussehen wie Tierkäfige in einem Zoo, an die Oberfläche. Die Gesichter der Kumpel sind nicht zu erkennen unter dem Kohlenstaub, der sie von Kopf bis Fuß bedeckt, weiße Augen starren aus schwarzen Masken. Angeblich verdienen sie einen Dollar pro Tag. Sie müssen etwa eine Meile weit unter dem Meer entlang gehen, bis sie an die Schachtöffnung kommen ... Natürlich hat die Kommunistische Partei auch die Presse eingeladen, um unsere Reaktion zu beobachten. Man hält uns Mikrofone unter die Nase und fragt, was wir davon halten. Zurück in der Universität verteilt man Fragebögen. Die Fragen lauten: Welches ist Ihrer Meinung nach die wichtigste lateinamerikanische Literatur? (Meine Antwort: Die Gesichter von Lotas Kumpeln). Was stellen Sie sich unter der Zukunft von Südamerika vor? (Meine Antwort: Die Gesichter von Lotas Kumpeln). Wen halten Sie für Chiles größten Dichter? (Die Gesichter von Lotas Kumpeln). Es gab zwanzig solcher Fragen. Ich antwortete immer gleich – das Ganze wurde später in einer großen Zeitung von Santiago veröffentlicht.
Mein Eindruck ist, dass ein großer, fetter, allesfressender Krebs namens Vereinigte Staaten von Amerika über der pan-amerikanischen Hemisphäre hockt und ihrem weichen Unterleib das Mark aussaugt. Die Coca-Kolonialisierung der Welt …
La Paz, Bolivien, 27. Januar
Einheimische Indiofrau in halb zerfallener Kirche von San Francisco – kniend mit Baby im Tragegurt auf dem Rücken, betet laut zu den weißen Abbildern Gottes am Altar – aber es war nicht nur ein Gebet, sondern eine laute Klage, ein Wimmern mit hoher Mädchenstimme, die Stimme eines Kindes, das schrie: Lass mich raus! Rette mich! Hilf mir, dieser unfassbaren schwarzen, stummen, verzweifelten Lebenslage zu entkommen! Gott, Gott, Gott! Was mache ich hier?
La Paz – erbärmliches, schlammverkrustetes Drecksloch der Menschheit auf dem Dach der Welt mit einem schönen baumbestandenen Prado, der sich quer durch diese Hölle siechender Indio-Bettler, Gauner und deutscher Faschisten zieht …
Bolivien – 4 Millionen Einwohner, 3,5 Millionen davon „Sklaven-Population“ – Indios, die von 500.000 Weißen europäischer Herkunft unterdrückt werden. Die Indiofrauen tragen weiche braune Hüte mit einem hohen runden Kopf, die Männer Filzhüte und Schuhe aus alten Gummireifen.
Die Indios wurden möglicherweise von methodistischen & katholischen Missionaren konvertiert, beten aber nach wie vor den Gott der Erde an. Ich sah den alten Gott der Erde im Profil eines Berghangs – mit dem Gesicht nach oben begraben im Krater/Berg von La Paz – eine riesige Felszunge als Nase, grünes Gras auf Wangen und Kinn, das Auge ein düsterer Baum.
30. Januar – Von La Paz nach Cuzco mit Schiff & Bahn: im elektrischen Zug durch die Anden.
Nach Einbruch der Dunkelheit schlugen Inka-Regentropfen, geformt wie kleine Boote aus Balsaholz, gegen das Abteilfenster, glühendes Silber vor der Nacht draußen, und das Fenster wurde zu einem Tuch aus Silber, einem silbernen Netz.
Drei Jesuitenpater im Zug, alle sehr jung, frisch geweiht, in brandneuer Ordenstracht – neue Schuhe, neue Soutanen, neues Leinen – zwei spielten Karten, tranken Whiskey aus einem hölzernen Flachmann in Form eines Inka-Gottes und rauchten amerikanische Zigaretten – der dritte rauchte nicht, spielte nicht, trank nicht. Sie waren auf dem Weg nach Cuzco, um dort ein halbes Jahr zu studieren – kamen gerade aus der von einem heftigen Erdbeben zerstörten Region Arequipa. Wie konnte es sein, dass sie so elegant waren, wenn sie aus Arequipa kamen? Das Handbuch für die Christian Perfection, das einer dabeihatte, wurde während der Fahrt kein einziges Mal aufgeschlagen. Dafür lasen sie die spanische Ausgabe von Reader’s Digest. Vom Titicacasee nach Cuzco ging es durch ein weites, wildes Tal, das immer fruchtbarer wurde, während wir aus viertausend Metern Höhe abwärts fuhren, Bäche wurden zu Flüssen, Strohhütten zu Lehmhäusern mit roten Ziegeldächern, umgeben von Mauern aus Lehm, die Städte wurden größer, überall Lehmhäuser, alle mit Ziegeldach ... Fuhren bei Anbruch der Nacht in Cuzco ein, und im dunklen Dröhnen des Zugs ein plötzlicher Ruck, als wir gegen ein paar große Felsbrocken prallten, die von den Berghängen auf die Gleise gestürzt waren. Alles blieb stehen. Als die Gleise schließlich geräumt waren, rumpelten wir weiter.
Jemand hatte während eines Halts einem Indio ein Fuchsbaby abgekauft; es hatte sich losgerissen, und niemand konnte den Kleinen unter dem Sitz hervorholen. Er biss in alle ausgestreckten Hände. Schließlich zog ihn jemand mit einem Handtuch hervor.
30. Januar
In Cuzco klingen die Glocken der Kathedrale wie eine große Schmiede um sechs Uhr morgens. Zwei verschiedene Arten von höllischem Geläute rütteln die Stadt wach … Die Spanier haben in Cuzco all die Kirchen gebaut, um mit ihnen die Inkas in die Knechtschaft zu locken.
Ich steige nie in den besten Hotels ab, bin aber ein getreuer Benutzer ihrer Toiletten. In der Männertoilette von Cuzcos vornehmstem Hotel ein Hakenkreuz.
Die Hähne krähen die ganze Nacht. Als stünde das Ende der Welt bevor.
Ein kurzer Ausflug nach Machu Picchu
Von Cuzco, der alten Hauptstadt des Inkareiches in den Anden, nach Machu Picchu, der verlorenen Stadt der Inkas, die von den Spaniern nie entdeckt wurde. Es musste ein gewisser Hiram Bingham von der Yale University kommen, um circa 1915 auf sie zu stoßen (und sich mit seinen erbeuteten Kunstgegenständen aus dem Staub zu machen).
Jetzt geht es in einem elektrischen Schienenbus über gegabelte Gleise im Zickzack die Höhen oberhalb von Cuzco rauf, vor- und rückwärts schlingernd, ohne zu wenden, unter uns erstreckt sich Cuzco über die Ebene, Ziegeldächer, Lehm und Schlamm, mit Friedhöfen wie große, blühende, verwahrloste Gärten ... Wir schlängeln uns nordwärts über das Hochland, drehen uns ein ums andere Mal zwischen kleinen Hügeln und Bergkämmen in dreitausendsechshundert Metern Höhe … Dreißig Passagiere, meistens Amerikaner und Deutsch-Argentinier ... Ganz oben rennt ein Indioschäfer mit Schafen und Lamas über eine grüne Weide … wozu die Eile, hier oben, ganz allein mit seinen stummen Tieren und der Ewigkeit ... Ein Amerikaner mit Kamera und Sportsakko sagt zu seiner Frau: „Hier gibt es mehr als zweihundert verschiedene Kartoffelsorten.“ Bauernhöfe aus Lehm, Feldwege, Inka-Ruinen an den Hängen, Höhlen mit Kreuzen im Innern, von schlammfarbenen Rindern zertrampelte Schlammfelder, weiter oben Schafherden auf steinigen Hügeln, die jungen Hirten haben dieselbe Farbe wie ihre Schafe, lehmbraun ... „Sehr malerisch“, sagt eine amerikanische Tea-Lady mit Vogelnest-Hut ... Maisfelder und Flüsse in kleinen Tälern, die sich über die Horizonte schlängeln … In den kleinen Bahnhöfen Indios mit sarapes, Schultertüchern, sie winken nicht zurück, wenn der Touristenzug an ihnen vorbeifährt … Lastwagen mit zusammengepferchten Indios auf der offenen Ladefläche holpern im grauen Morgennebel die Feldwege hoch ... es ist Frühling, Februar, strohgedeckte Hütten zwischen Feldern von gelben Blumen, Kühe fressen zertrampelte rote Blüten ... Reihen von Pappeln und Eukalyptusbäumen, darunter moosbewachsene Pfade ... Jetzt flitzen wir durch einen Eukalyptuswald und dann durch ein weiteres Dorf, am Bahnhof schwenkt ein brauner Mann mit Kind seinen Stock, ein schwarzer Hund bellt, springt zwischen den Bäumen umher, jagt kläffend hinter dem Zug her, ein kleiner Junge pinkelt auf zerfurchtem Pfad neben den Gleisen, als wir vorbeidonnern ... „Jede Menge Kartoffeln hier“, sagt der Amerikaner ... Jetzt Zwischenstopp an einem Landbahnhof, Scharen von Indios mit Bündeln, Körben, Strohtaschen, in sarapes gehüllt, Babys auf dem Rücken, Männer mit Cowboyhüten aus Filz, Frauen mit hohen weißen Panamahüten, die mit breiten schwarzen Banderolen verziert sind, und langen schwarzen Zöpfen auf dem Rücken … ACCIÓN POPULAR in weiß auf eine Lehmwand gepinselt ... Schweine in Straßenpfützen, Esel mit Milchkannen auf dem Rücken, die durch schlammige Bachläufe getrieben werden ... Jetzt eine weite Hochebene mit Mais, umringt von den noch höheren Anden, die Gipfel in Wattewolken verborgen ... „Jede Menge Tiere hier“, sagt der Amerikaner ... Die Ebene füllt sich allmählich mit grasenden Kühen, Pferden, Ferkeln, Eseln, einsamen dreckigen Hühnern. „Irgendwo in der Nähe muss eine Hühnerfarm sein.“ Inka-Terrassen an verlorenen Berghängen in der Ferne ... Ständig laufen Hunde hinter dem Zug her ... Wir kommen an einem Feld mit Indios bei der Arbeit vorbei. Eine deutsche Frau im Tweedkostüm auf dem Sitz hinter uns sagt, die Dörfer hier seien alle nach dem alten sozialistischen System der Inkas organisiert, mit Bürgermeistern, Richtern usw., die jeden Januar neu von den Bauernversammlungen gewählt werden. Außerdem sagt sie, dass alle, die hier heiraten wollen, vor der Hochzeit ein Jahr mit ihren zukünftigen Partnern zusammenleben müssen. Sie hat den Arm um ein junges Mädchen gelegt, das mit ihr reist. Jetzt schlängeln wir uns durch enges abschüssiges Tal, wie der Feather River Canyon in Nordkalifornien, folgen einem rauschenden Bergbach ... An einen steilen Hang geritzte Wörter in Rot: „VIVA---“ (der Rest unleserlich) ... 300 Meter über dem Zug hängen große Klippen, schmale Pässe, mit dazwischen gequetschten Gleisen und dem Fluss. Er wird zu einem rauschenden Gebirgsstrom, dem Urubamba, der dem Amazonas entgegenstürzt ... eine Frau mit silbergrauem Haar und blumengeschmücktem Hut auf dem Platz vor uns erzählt, sie sei aus Berkeley ... Halt an einem Bergbahnhof, alle steigen aus, spazieren durch den Bahnhof aus Adobeziegeln, die Frau aus Berkeley ruft: „Oh, der Zug hat ja nur einen Wagen!“ Dann hält ein weiterer Zug hinter uns an – ein ehemaliger Bus, dessen ursprüngliche Reifen durch Eisenbahnräder ersetzt wurden, vollgestopft mit einem Stamm von Indios in roten sarapes,diemit ihren Gitarren auf dem Weg zu einem Festival in Machu Picchu sind, zu Ehren des mexikanischen Präsidenten, der morgen erwartet wird … Der Bürgermeister von Urubamba ist mit von der Partie, er wird eine Willkommensrede auf Quechua halten. Auch ein normaler, mit Lamas beladener Güterwagen hält ächzend auf den Gleisen hinter uns ... Die Trillerpfeife ertönt, und weiter geht’s durch sich langsam öffnende Schluchten, am heiligen Fluss der Inkas entlang ... Wir überholen eine Draisine, die von sieben Indios angetrieben wird, alles hält ächzend an, die Draisine wird vom Gleis gehoben und anschließend wieder aufgesetzt, unter uns Terrassen von Inka-Farmen, Steppen breiten sich immer weiter nach oben aus, und dann eine alte Inka-Festung am Flussbett, dahinter eine verlassene Hängebrücke der Inkas zwischen hohen Klippen, abgerissene Seile hängen herab, die Brücke von San Luis Rey, zu der kein Weg führt. Der rauschende Fluss, inzwischen dunkelbraun, wird immer breiter, stürzt in riesigen Stromschnellen herab, von sprudelnden teegrünen Bächen gespeist, die aus allen Schluchten herbeiströmen ... Jetzt ein weiterer Halt auf dem Berg, wieder steigen alle aus, neben den Ruinen einer alten Inka-Festung; eine Gruppe von mongolisch anmutenden Indios in identischen roten sarapes, Männer mit schwarzen, tellerartigen, mit Fransen verzierten Filzhüten und sehr langen Bambusflöten, die Frauen alle im gleichen Rot gekleidet, mit Schals und Körben voll gelber Birnen. Alle warten gemeinsam an den Gleisen, eine stille Gruppe, im Hintergrund Lamas mit zusammengebundenen Beinen und bellende Hunde, und so gut wie alle aus dem Zug schießen Fotos mit deutschen Kameras. Die Indios bleiben dafür reglos stehen, abgesehen von einem im Hintergrund, der wie wild auf seiner langen Flöte spielt und dazu etwas rezitiert, ein Inka-Beat-Poet ... Mehrere Amerikaner werfen ihm und dem Rest der Gruppe Münzen zu, damit sie für weitere Fotos posieren ... Der Touristenführer, ein dicker Mann mit Schnurrbart, westlichem Anzug und safariartigem Tropenhelm erklärt die Szene in gebrochenem Englisch ... „Essen Sie die Birnen nicht, ohne sie vorher zu waschen“, sagt eine texanische Stimme. Alle steigen wieder ein, weiter geht’s, am schokoladenbraunen Fluss entlang. Ein Mann hinter uns fragt einen anderen: „Waren Sie jemals in den Staaten?“ … Der Fluss schwillt an, überspült die Gleise vor uns. „Das Wasser wird heiß sein, wenn es da ankommt, wo es hinfließt“, sagt eine Stimme. Eine andere sagt: „Von jetzt an werden wir jeden Montag, Mittwoch und Freitag ein Treffen in der landwirtschaftlichen Abteilung abhalten – wir haben Büros in São Paulo, Rio, Lima und Mexiko-City. Es ist ein großes Unternehmen. Meine Frau und ich sind in Sacramento geboren, aber inzwischen wohnen alle in Los Angeles. Der Dow International hat letztes Jahr hier unten eine rasante Entwicklung hingelegt. Manche finden es übertrieben, sie fürchten Verluste, aber die Leute, die ich kenne, sind ganz zufrieden ...“ Der Zug fährt an einer Höhle mit einem aus bemalten Steinen zusammengelegten, lächelnden Gesicht vorbei, das herausschaut ... Später seltsame Schriftmalereien auf den Felsen wie seltsame Symbole von Morris Graves … „Haben Sie den Madison gesehen“, fragt die texanische Stimme, „da, wo er aus Yellowstone kommt, nun, er ist nicht so wild wie das hier. Der Señor und ich wollten dort eine Kanufahrt machen, haben es aber dann aufgegeben.“ … „Dieser Ausflug ist unvergleichlich“, sagt eine alte Dame, und eine andere alte Dame nickt ... Jetzt durch Bergtunnel und hinaus auf ein Feld mit blauen Zypressen. Der Fluss schwillt noch immer an. Von einer Strohhütte mit offener Seite baumeln drei weiße Gestalten an Kreuzen, menschliche Geister in einer Grotte. „Sagten Sie nicht, Sie wären in der Luftfahrt tätig?“ Die Antwort verliert sich in einem weiteren quietschenden Halt. „Ich muss irgendwo mein Obst waschen“, sagt Texas. Wir haben in einer Schlucht angehalten, über uns schweben gewaltige Klippen. Ich steige aus und gehe am Gleis entlang, blicke nach oben. Ein Mann von Bedeutung mit silbernem Haar und Kamera hinter mir meint: „Ziemlich wild hier, was?“ Auch die deutsche Frau taucht plötzlich auf und erklärt: „Hier verkaufen sie eine Medizin gegen Traurigkeit. Ich habe dem Mann dort drüben gesagt, ‚Bitte, ich würde gern etwas davon haben.‘ Er sagt, er will mir nichts geben. ‚Sie würden nicht geheilt werden, weil sie nicht daran glauben‘, sagt er.“ Ich gehe rüber, um mir das anzusehen. Ein buckliger, gebeutelter Indio lächelt mir in die Augen und gibt mir etwas. Es ist nicht yagé. Der ehemalige Bus auf Eisenbahnrädern hält erneut hinter uns, mit noch mehr zusammengepferchten Indios, andere klammern sich an der Außenseite fest, einer spielt im Innern ein altes Lied auf einer verstimmten, blechern klingenden Gitarre ... Wir stürzen weiter abwärts, steile Hänge schaukeln am Himmel über dem Zug, der wilde Fluss fällt jetzt in den tiefen Dschungel hinab, mit riesigen ineinander verschlungenen Bananenstauden und wilden Weinreben, Affen lugen zwischen großen Blättern hervor, der Fluss strömt immer schneller hindurch, der Zug pfeift und heult, während er vorwärts saust, das rauschende Wasser umspült seine Räder. „Man kann die Kannibalen beinah sehen“, sagt der Mann vor uns. Ein Kreuz auf einem Felsen, wo jemand ertrunken sein muss, fliegt vorbei ... Nebel über den verlorenen Gipfeln sechshundert Meter oberhalb von uns, der Zug pfeift, schlingert vorwärts, hält schließlich quietschend an, damit eine weitere Draisine mit Indios aus den Gleisen gehoben werden kann. Ich sehe einen kleinen grauen Schmetterling mit einem großen, vollkommen weißen Fleck auf jedem Flügel allein über den Fluss flattern ... Jetzt kommen wir an einem Wasserkraftwerk und einer großen Mine mit Lastkränen vorbei ... Rauschen durch eine Lichtung in den Dschungel, der Fluss überflutet die Gleise, aus zehn Metern Höhe ergießen sich Wellen über die Felsen, ganze Inseln werden überflutet, im Wasser treiben Bäume, die Wurzeln nach oben gerichtet wie wilde zerzauste Köpfe ... Ein gewaltiger Wasserfall taucht auf, ergießt sich auf uns, als wir darunter entlang zischen. Dann stürzt ein mächtiger Felsen herab, so groß wie ein Haus. Ich schaue zu dem gewölbten Oberlicht auf und sehe ihn senkrecht herunterfallen. Die Frau aus Berkeley auf dem Sitz vor uns rückt ihren Hut zurecht, ich hebe die Kamera und halte den Felsen mit einem Klick in der Luft fest, kurz bevor er aufschlägt.
Kurz vor Machu Picchu kommen wir schlitternd zum Stehen und torkeln zu einem großen alten Bus mit Holzsitzen, der Fahrer trägt einen Cowboyhut, mehrere Kruzifixe hängen vom Rückspiegel, als bräuchte er sie, und so fahren wir den steilen Hang hinauf, weiter und immer weiter, schlängeln uns stundenlang voran, niemand sagt ein Wort, alle warten. Schließlich bleiben wir mit einem Ruck stehen, da, wo es scheinbar nicht mehr weiter geht, außer in den Himmel, und wir sind da, vor uns breitet sich Machu Picchu in der späten Sonne aus, in seltsamer Stille. Kein Gasthof oder irgendein anderer Hinweis auf Touristen, obwohl es hier angeblich ein staatliches Hotel geben soll. „Die Zivilisation“ hat es noch nicht bis hierhin geschafft.
Ich denke an Nerudas „Alturas de Machu Picchu“ (dt. Die Höhen von Machu Picchu). Hier und jetzt, nichts als die großen eingestürzten Ruinen, die sich vor uns erstrecken, mit einem gewaltigen gezackten Gipfel, der sich über alles erhebt, und kleineren zerklüfteten Gipfeln ringsum, und wir stehen da wie überwältigte Wanderer und schauen hinab auf die alten Ruinen. Wir kriechen zwischen den nicht überdachten Tempeln und Kuppeln, offenen Eingängen, Rinnen, die einst Straßen waren, und eingestürzten Lagerhäusern entlang. Die gesamte verfallene Stadt ist vor uns ausgebreitet, still unter der späten Sonne ... Die verborgene Tür der Anden in knapp zweieinhalbtausend Metern Höhe, darunter die ferne Meeresküste ... Die untergehende Sonne färbt sich rot ...
Ein paar Indios tanzen an uns vorbei, spielen auf ihren Flöten, schlagen auf ihre Trommeln.
Amerika! Amerika!
März–November 1960
Mit dem Zug nach Burlington, Vermont – Mittwochmorgen, 30. März – einundvierzig Jahre alt, Herr meiner Sinne und Unsinne ... Die Boston & Maine mit Lokführern, die aussehen wie Calvin Coolidge. Springfield, Northhampton, Greenfield, East Northfield, und weiter nach Vermont. White River Junction & hundert Dartmouth-Studenten steigen aus. Weiter durch triefende Schneeberge & schmelzende Flüsse, der Frühling kommt, den ganzen dunklen Nachmittag lang, die weite weiße Landschaft löst sich auf in Schwarz. Die Dämmerung senkt sich über die Berge von Vermont herab, und als der Diesel-Zug mit seinen zwei Wagen leise in die Essex Junction rumpelt, wird es Nacht …
Hier, auf der Vermont Conference werde ich aus meinen Gedichten lesen, und mein Thema ist „Liebe und Tod“. Was weiß ich über das Geheimnis dieser beiden? In der Konferenz spricht auch ein Vertreter des Atomphysikers Dr. Teller – Mr Christofilos2 (Christ & Philosoph), der das Gegenteil dessen behauptete, was Christus gesagt hätte – ein Militarist ... bang bang. Frage eines ernsthaften Studenten vor einer großen Menschenmenge der University of Vermont Conference: „Sir, wie stehen Sie zum Geschlechtsverkehr?“
Antwort: „Während des Geschlechtsverkehrs stehe ich normalerweise nicht, sondern liege.“
Zweite Frage: „Glauben Sie wirklich, dass Gott tot ist?“
Antwort: „So wie sich die Welt heute aufführt, möchte man es glauben. Heute Abend ist er nicht hier, oder? Ich sehe ihn nicht.“
Stimme im Hörsaal: „Ich bin hier hinten.“
New York, N.Y., 1. April
Zusammen mit Jack Kerouac torkele ich die East 2nd Street runter, als aus einem heruntergekommenen Mietshaus plötzlich kopfüber ein ganzes Wohnzimmer hervorbricht: dunkelhäutige Puerto-Ricaner tragen umgedrehte Couchtische und Sessel auf dem Kopf und fauchen uns an, als sie an uns vorbeirennen und um die Ecke biegen.
Was mache ich hier mit ihm, falls irgendwann in ferner Zukunft jemand danach fragt? Tja, das ist eine lange Geschichte, so wie alles. Ich bin nicht der Hüter meines Bruders, trotzdem empfinde ich für ihn das Mitgefühl eines älteren Bruders... Na ja, Jack hat nichts mit den Beats oder Beatniks zu tun, außer in den Köpfen von Tausenden Lesern, die Unterwegs gelesen haben und ihn für eine Art wilden Rebellen halten, dabei ist er in Wirklichkeit nur ein Kumpel aus dem kleinen alten Lowell und garantiert kein Rebell. Ich sage ihm immer wieder, dass er aufhören soll, um die Welt zu wandern, nach Lowell (Mass.) zurückgehen und dableiben soll, obwohl das vermutlich nicht gelingen würde, weil er nur durch die Bars ziehen und kein Zuhause finden würde … und seine alten Freunde hätten sich verändert, usw. … Dabei muss ich die ganze Zeit an Thomas Wolfes Schau heimwärts, Engel denken, eins unserer gemeinsamen Lieblingsbücher.
Habe die ganze Nacht mit ihm durchgemacht, bis wir schließlich im Haus seiner Freundin in den West Seventies landeten. Wachte um zehn Uhr morgens auf. Sonnig und warm. Ich verlasse das Haus mit Kerouacs Manuskript des Traum-Tagebuchs, um es bei City Lights zu verlegen, und allein das war die Reise wert … Ein Haufen wunderbar wilder, unzensierter Träume, kein Stoff für analysebesessene Freudianer …
7. April
Verließ N.Y. unter einer Wolke – noch immer verkatert – Hatte eine Vision des Bösen auf der Halbschale – im Flieger nach Chicago.
Zug – Zephyr – Chicago nach San Francisco, 8. April
Westlich von Chicago betrachte ich die Landschaft. Gelbe Schuppen, gelbe Häuser, lila Hügel, Lavendel, goldene Maisfelder im späten Sonnenlicht, Windmühlen, Silos, Heuschober, weiße Häuser mit grünen Dächern, Telefonkabel , braune Erdhügel, ölverschmierte Eisenbahnschwellen, alle Tiere schon für die Nacht in die Ställe gebracht, es dämmert, weiße Zäune, noch mehr Mais, noch mehr Bäume, die bleichen Knochen der Bäume am Fluss, filigran vor dem Himmel, kniehoch im Wasser, Äste wie gespiegelte Armknochen, der Himmel jetzt grau, Backsteinhäuser, braune Blätter, graue ungestrichene Schuppen, der Tag verabschiedet sich, ein einsamer Vogel, davongeweht … Rote, auf die Erde geschleuderte Sonnenkugel.
Überquerte den Mississippi bei Burlington, Iowa – ein letztes Licht am Himmel – in der Ferne glitzernde Fenster, Neonlampen blitzen auf, erleuchtete Tankstellen, Ding-Dong, ein rotes Zugsignal schwebend & schaukelnd an einer Schranke ... im Zentrum einer bewaldeten Stadt ... Die traurige unveränderliche Einsamkeit von Häusern an Hängen, verloren zwischen den Bäumen, im Innern weißes Licht … Friedhöfe ziehen vorbei, genauso verlassen … aber irgendwie nicht so einsam wie die Lebenden ... Jetzt schwarze Bäume auf kleinen Hügeln ... Nacht, Nacht. Dunkle Teiche und Tümpel.
Später nichts als Nacht, allein im Aussichtswagen spähe ich nach draußen ... Nur Mond und Sterne, die Nacht rauscht vorbei – ein Schlitzauge mit Koffern auf einem Charles-Sheeler-Bahnsteig – lautlos hinter dem Glas – wandert mit Sack und Pack in der Hand verloren durch die amerikanische Nacht ... Thomas Wolfes, Whitmans, Kerouacs, dein, Ferlinghettis Amerika ... Land der Indios, durch das ich vor langer Zeit getrampt bin. Der ganze alte Kontinent der Indios nun von „Amerikanern“ besetzt.
28. April
Hörte letzte Nacht Thelonious Monk im Blackhawk in San Francisco. Er spielte banale Bestattungsmusik. Später, während einer Pause, sah ich ihn hastig die dunkle Straße entlanggehen und um die Ecke biegen, als wäre er auf der Suche nach einem Dealer vor dem nächsten Set im Hawk – Erinnerte mich daran, wie ich in Trauerkleidung von der Beerdigung meines Pflegevaters floh und auf dem Fahrrad über die freien Frühlingsstraßen flog.
*****
10. November – Southern Pacific Coach
Weiße Morgendämmerung bricht über Ebenen, Landinseln in der Ferne, Tafelberge, Plateaus herein, alles flach, alles abgelegen, großartige, herrliche Sonne; eine Holzbrücke über dem Wasser. Im stillen Licht bewegen wir uns vorwärts. VORWÄRTS?
Kreuz und quer über den Kontinent, bang bang, auf allen möglichen Arten von Rädern, im Zug, im Wagen, im Kinderwagen, in der Postkutsche, zu Fuß, über die Great Plains, mit Planwagen in die Nacht. Auf ewig. Den ganzen Tag rollen wir durch Wyoming, Schnee auf den Steppen und Prärien, Bergbaustädte, einst blühend, jetzt bis auf den Bahnhof geschrumpft, die Straßenlaternen trunken vor Einsamkeit. Weite Räume von unbeugsamem, immer noch neuem Land – Horizonte von Tafelbergen – wie die Welt von Don Quijote, mit scharf erodierten Felstürmen, solchen verlassenen Windmühlen ohne Propeller. Große eckige Steininseln auf Ebenen, wie Festungen, riesige Frachter, in eine Flaute geraten, führungslos, gestrandet ... Schließlich etwas ähnliches wie eine Stadt, gefolgt von einsamen Pumpstationen, jede mit einem Tank, einem Wagen, einer Hütte, einem Hund, von Menschen keine Spur. Irgendwo muss ein Cowboy sein. Eine einsame Kirche ragt „im Nirgendwo“ empor. Das muss so was wie eine Interzone zwischen Himmel und Brooklyn sein. Ob sie hier wie in Telefonbüchern im hinteren Teil der Bibel einen Anzeigenteil haben? – Sonst würden sie ja nie was finden... Versuch es mit Instant Zen.
Später wieder wagon-lits, Schlafwagen mit darin eingenisteten menschlichen Körpern, undurchschaubar, die horizontal durch die Nacht rasen …
Gewaltige Schneefelder, in einem fort und weiter, und noch immer keine Seele in Sicht … Die Ind sind alle nach Florida. Oder Kuba! Vögel flattern von Zäunen und Gerüsten auf … Sonnenuntergang und seltsame Wolken, wie Euter, von unten, mit Licht bestrahlt. Die Hand einer Gottheit sticht heraus. Schwarze Bäume treten hervor. Die Welt ist eine Winterfarm ... Viel später das Gesicht eines Bremsers in der Nacht, mit hoher Schirmmütze aus grau gestreiftem Stoff; er schwenkt eine Eisenbahnlaterne, während unser Fenster vorbeisaust, seine Gestalt blitzt darin auf, schief, sehr groß, wie ein Muezzin in der Dunkelheit & verschwindet wieder … Wer hat Amerika umgebracht?
12. November
Die einzigen Menschen, die heute noch Fernzüge nehmen, sind alte Frauen & Babys & ausgediente Männer und Militärangehörige – und hässliche Frauen – Unmengen davon ... Und Gott, diese riesige, weite Leere im Norden von Wyoming und Richtung Great Divide – und die tristen Scheußlichkeiten, die sie hier gebaut haben und immer noch als „Städte“ bezeichnen – dazu verurteilt zu sein, hier für immer zu leben, wäre Mord – das Sibirien von Amerika ...
Nebraska, Iowa – hier sind die Wälder poetischer – intimer, dichter, kleiner und einander näher als in Wyoming, wo sie weit weg am Horizont stehen, in enormer Entfernung, ohne Pächter. Die Farmen hier sind kleiner, man sieht Menschen in den Häusern – „poetischer“, weil menschlicher. Wieder so ein pathetischer Irrtum ...
Aber diese Herbstwälder – kahle Bäume – Sümpfe voller Laub – hohes welkes Gras – Felder mit gelbbraunen Maisstoppeln – das ist der Osten – die Sehnsucht nach dem, was ich einst kannte –
Schließlich Chicago, am Mittag, ich spaziere hinein in die Stadt, mit Regenmantel, kleiner Umhängetasche, Büchern, habe meine Bleistifte dabei. Später, gegen Abend werden Straßenlaternen von letzten Sonnenstrahlen erhellt, nachdem sie sich tagsüber daran berauscht haben ... Lief quer durch die Stadt von der Union Station, die Dearborn Street vom Loop Richtung Norden, am Gate of Horn vorbei, wo ich morgen Abend meine Gedichte lesen werde, weiter zu Paul Carroll3, bei dem ich vermutlich übernachte. Kam mitten am Nachmittag zu einem wunderschönen Park vor einer Steinkirche & der Newberry Library, setzte mich auf eine Bank, schrieb das hier oben … Tauben natürlich, Herbstlaub auf der Erde natürlich. Die Tauben gurren leise, frustriert. Kahle Bäume natürlich, schwarze Zweige vor einer schwarzgrauen Bibliothek, alte Männer mit Filzhüten auf Holzbänken natürlich. Blauweißer Himmel, darin andere Vögel, kreisend, kreischend, kleiner runder Springbrunnen, trocken natürlich, mit lauter aufgereihten Tauben, alle nach innen gewandt, ein steinernes Karussell, das sich niemals drehen wird, natürlich. Ein Eichhörnchen kommt von einem hohen Baum herunter, der noch Blätter trägt, und verschwindet, als ich den Blick senke, um das hier zu schreiben.
13. November
Ankunft in Greensboro, North Carolina – wie deprimierend nach der großartigen Zeit in Chi – schmieriges Carolina bei Nacht – mit einem Southern Minibus in die Stadt & zum King Cotton Hotel. Mitten in der Nacht höre ich plötzlich Geheul auf der Straße – hört sich an, als würde da unten jemand abgemurkst – ich gehe ans Fenster und gucke runter – es ist Mitternacht, und auf der Straße vor dem Hotel steht ein Wagen – die Tür auf der Fahrerseite ist weit geöffnet. Der Fahrer muss eine andere Straße entlanggelaufen sein und dabei geschrien haben – ausrastend in einer Nacht des Südens. Zehn Minuten später kommt ein Streifenwagen. Die Polizisten steigen nicht aus, befragen aber jemanden in der Nähe – kein Mensch scheint zu wissen, was da los war.
14. November
Am nächsten Morgen wache ich zum Geräusch von Presslufthammern auf, die eine Straße unten aufreißen, die ewige Maschine, die überall die Straßen der Welt verschlingt ... Aber draußen ist es klar & hell! Zum ersten Mal sehe ich das Land – Herbstbäume – rostrot überall (nachts war alles schwarz & weiß, uninteressant, jetzt ist es farbig). Ein süßes, friedliches Herbstlicht strömt durchs Südfenster ...
Mittags: die Zwillingsvögel der Wasserhähne über der Hotelbadewanne zeigen einen kuriosen Aspekt – ihre Schatten fliegen zusammen davon, und trotzdem bleiben sie getrennt, jeder für sich. Einer flüstert – „Turteln wir – Ich bin heiß.“ Doch den anderen lässt das kalt.
16. November
Riesiges Publikum in N.C. State Raleigh. Ich hab es tatsächlich verzaubert.
17. November
Rückkehr nach Chapel Hill, meiner alten Alma Mater,4 nach fünfzehn Jahren, dieselben Bäume, dieselben Straßen, dieselben Gebäude dazwischen, dieselbe Hauptstraße, dieselben Menschen (jetzt allerdings etwas „kosmopolitischer“, genau wie die Geschäfte), und die Luft ist dieselbe, ja, dieselbe träge, süße Luft. Alles vergessen, nicht aus dem Sinn, nur vergessen, in der Zeit versteinert. Hatte erneut eine riesige Menschenmenge bei der Lesung in Chapel Hill.
St. Thomas – Puerto Rico
November 1960
22. November
Startete um fünf Uhr nachmittags nach San Juan, Puerto Rico – in viertausend Metern Höhe über den Schneefeldern der Wolken, bei Sonnenuntergang, roter Horizont über weißen Ebenen, ein bisschen wie Arizona – nur ist das ein Land, das es nie gab und auch jetzt nicht gibt – imaginäre Ebenen, Plateaus, Hochland, Sierras, Gebirgskämme, Schluchten, Klippen und Berggipfel ... eine Welt über der Welt, darunter Areale aus Luft, Blasen von Blasen, Leere im Nichts, vor uns nur Dunkelheit, die Nacht schleicht sich an. Trotzdem gibt es über dieser Wolkenebene noch einen anderen, wirklichen Himmel mit eigenen Wolken, noch höher, mit Sternen und einem Mond. Ich erkenne ihn als Mond.
Im Innern der Maschine ist es still. Kaum Passagiere, die Lämpchen sind an, Dutzende kleine weiße Kissen auf den leeren Sitzen, übereinander gestapelt ...
Die Papageien in Puerto Rico hängen kopfüber
So wie ich, wenn ich die runde Welt betrachte.
24. November (Thanksgiving)
Fuhr an Bord der SS Potomac nach St. Thomas auf den Jungferninseln. In der Lounge hängen Fotos von Franklin Delano und Eleanor Roosevelt, die ebenfalls mit diesem Schiff gereist sind ... Das Porträt von FDR in seinem Umhang wirkt sehr lebendig, er scheint mich als Amerikaner zu kritisieren, blickt kritisch auf mich herab. Die falschen Wolken im Hintergrund des Fotos unter dem Glas sehen aus, als wären sie feucht, das ganze Bild bewegt sich an der Wand mit, wenn das Schiff schlingert – es ist eins mit Flachkiel! Raue Überfahrt von Puerto Rico. FDR muss einen eisernen Magen gehabt haben.
Als ich an Deck kam, erschien mir St. Thomas wie Palma de Mallorca … Später Nachmittag ... viele Segelboote ... Kais ... kaum Autos in Sicht ... Sandhaufen ... der Rumpf eines alten Panzerlandungsbootes, ein paar kleine Tanker, ein großes niedriges modernes Gebäude auf einem hohen Hügel, Berge wie Marin & Tamalpais ... amerikanische Flagge … rote Dächer, weiße Häuser ...
Weshalb wir nach St. Thomas kamen, meine Frau Kirby und ich, ist tatsächlich eine lange Geschichte. Meine Mutter hieß Clemence Albertine Mendes-Monsanto und stammte von sephardischen Juden in Portugal ab. Ihre Vorfahren waren vor der spanischen Inquisition in die Neue Welt geflohen. Jahrelang glaubte ich, dass sie in Puerto Rico gelandet waren und erfuhr dann von einem Buchhändler namens Tram Combs, der irgendwann Anfang der Fünfziger mit seinem Buchladen von San Francisco nach St. Thomas umgezogen war, dass sie dorthin gekommen waren. Da ich ihm erzählt hatte, dass die Familie meiner Mutter aus der Karibik stammte, fing er an, in St. Thomas nach den Mendes-Monsantos zu suchen. So fand er meine Tante Gladys Woods und ihren Bruder Désir Mendes-Monsanto, die durch Heirat mit meiner Mutter verwandt waren, und Gladys erinnerte sich, dass meine Tante Emilie sich meiner angenommen hatte, als ich noch ein Baby war, weil mein Vater kurz vor meiner Geburt gestorben und meine Mutter zu verzweifelt war, um sich um mich zu kümmern.
St. Thomas war ursprünglich eine dänische Kronkolonie gewesen, und die Monsantos hatten sich mit Dänen, Holländern und später auch Engländern verheiratet. Im neunzehnten Jahrhundert waren sie ziemlich wohlhabend gewesen – Tante Gladys zeigte mir ein großes Anwesen im New-Orleans-Stil, das früher im Besitz der Familie gewesen war, mit geräumigen Veranden und filigranen Balustraden auf einem Hügel, und vergilbte Daguerreotypien in ovalen Rahmen von den Monsantos mit breitkrempigen Hüten und schwarzen Schleifenbindern – doch dann hatten sie in der Großen Depression der 1890er Jahre, als die Zuckerpreise abstürzten, alles verloren!
Außerdem nahm Tante Gladys mich mit zu William Smith, der ebenfalls ein Monsanto ist, aber wie genau er mit uns verwandt ist, weiß ich nicht mehr – vielleicht war er Gladys’ Vater – oder ihr älterer Bruder – mit Strohhut, Brille, ein Auge völlig blind, sprach wie ein Seemann – war sein Leben lang Fischer – kräftige Hände ... Er ist jetzt einundachtzig – seine Frau ist vor sechs Monaten gestorben. Er erzählte, dass sie ihm letzte Nacht im Schlaf erschienen ist, mit ihrem klappernden Gehstock sei sie gekommen und habe sich neben ihn gelegt und die ganze Nacht mit ihm verbracht.
Aber als er mir die Hand schüttelte, war er für mich wie ein imaginärer verlorener Vater oder Odysseus am Strand, neben den Fischernetzen, wo die Boote aneinanderstießen. Er wohnt in einer Gauguin-Hütte mit Blechdach – die Wände gepflastert mit Zeitungsartikeln, Postern, Pappe. Zwei ordentlich gemachte Betten, eine Seemannsbude auf der Windseite. Er hatte sein ganzes Leben lang an Stränden gelebt, in Hütten wie dieser, lange Zeit auf einer Insel vor St. Thomas, bis er zu alt war, um ständig hin & her zu pendeln – das war auf Thatch Quay. Inzwischen wohnte er schon seit fünfzehn Jahren oder länger in dieser Strandhütte auf St. Thomas – und jetzt würde ein Bauunternehmer kommen, ein Hotel bauen und ihn für immer vertreiben.
27. November
Wachte auf und hörte leises träges Glockenläuten – Frühmesse am Sonntag. Eine tiefe Glocke drang durchs Fenster, als wollte die ganze Kirche herein – ich sprang auf und machte mich auf die Suche, bog um die Ecke, und da stand die Kirche. Auf der Straße lag eine winzige runde heilige Münze – aus Silber – ich hob sie auf. Diese Kirche war durchs Fenster gestürzt und hatte mich aus dem Bett geworfen.
Noch immer Sonntag. Fuhr mit dem Boot auf die Insel Thatch Quay, die größtenteils Tante Gladys Familie gehört, und traf auf einen anderen Wikinger – einen Onkel, Bruder oder Sohn des anderen Smith. Dieser, Allyn Smith, sah aus wie eine Dänische Dogge, groß, weit über 1,90, schwer, aber nicht fett, ein kräftiger braungebrannter Mann mit Wikingergesicht und großer gebogener Nase – strahlende dunkle Augen – hohe Stirn. Ein alter Mann war er, um die siebzig – kräftig, mit zwei betrunkenen Söhnen oder Neffen, die genauso sprachen wie er – nur wild, betrunken, & ihre Sprache klang dänisch und/oder holländisch – Modulation auf jeden Fall skandinavisch, nur mit seltsam verdrehten englischen Worten voller Doppellaute – Wikinger aus dem Meer, daher die blauschwarz gefärbten Augen ... Die Familie war einst vom dänischen König in den Ritterstand erhoben worden, in Onkel Désir Monsantos Haus habe ich die dänische Urkunde gesehen; man hatte ihnen den Titel „Kamaraad“ verliehen.
Außerdem kramte Onkel Désir ein paar alte Daguerreotypien von meinem Großvater Herman und seinem Bruder Jacob hervor, die aussahen wie spanische Schwerenöter. Da war er: kein grauer alter Mann, sondern jung (Anfang dreißig), ein Lover-Boy, der später seine französische Frau (meine Großmutter) verließ, von N.Y. auf die Inseln zurückkehrte und mit mehreren anderen Frauen anbändelte, danach bei der guatemaltekischen Revolution mitmachte, sich mit Gelbfieber oder ähnlichem infizierte, und nach St. Thomas zurückkehrte, wo er mit achtunddreißig starb.
28. November – Wieder in San Juan, Puerto Rico
In der Nähe der imposanten Festung zwischen Zinnen und Ozean befindet sich ein großes Lager mit bettelarmen Democráticos in heruntergekommenen Hütten & Bretterbuden, alle mit bunten puerto-ricanischen Fahnen und der über ihnen flatternden Pan-Tierra-Libertad-Flagge, wie ein Lager vor Agincourt ... Alles hinter Stacheldraht; eine Enklave, die die Regierung gern loswerden würde, aber nicht loswerden kann ... politische Landbesetzer?
Malerisches Haiti
November–Dezember 1960
I
Port-au-Prince – Da war diese junge Mulattin, die aussah wie purer Sex und Menschen von der Stange verkaufte. Sie war groß, stand neben dem Ständer, an dem die Menschen wie Hosen und Kleider auf Bügeln hingen und hin und her baumelten, alle an Fäden, die irgendwo befestigt waren, und an denen sie, die aussah wie purer Sex, ziehen konnte, um die jeweilige Person so zu bewegen, wie sie sich bewegen sollte. Sie spielte mit den langen Fäden (so lang, dass sie die Illusion von echter Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit vermittelten) und sorgte damit für diverse Ausdrücke in den Gesichtern und Körpern der dunklen Bewohner, die an den Fäden hingen. Sie, die aussah wie purer Sex, hing nicht an einem sichtbaren Faden. Sie hockte sich hinter den Ständer und pisste. Jetzt hielt ein Wasserfaden sie fest ... IHR STÄNDER war der große Eisenmarkt von Port-au-Prince, die Kasbah der Karibik, ein riesiger, einheimischer mercado (wie in Guadalajara, La Paz, Cuzco, in allen Indio-Städten), ein ganzer Straßenzug voller Tod, Scheiße und verdammter Verzweiflung, eine Ausstellung von alledem, ein jeder auf seinem eigenen Hungerbügel. Irgendein auf Elend spezialisierter Fotograf sollte herkommen, um eine echte Death-Magazine-Reportage über diesen Eisenmarkt zu machen, einen Bienenstock, in dem es von obsidianfarbenen Indigenen wimmelt, die mit ihren Waren hinter dir herlaufen, schreien, weinen, lachen, essen und merkwürdige Blätter rauchen. Er könnte malerische Postkartenfotos von spindeldürren Kindern schießen, die sich Reste von Gummireifen um die Füße gebunden haben. Das Gebäude des Eisenmarktes selbst ist nach allen Seiten hin offen, die Arkaden voll mit bunten Lagern von Verkäufern und Familien, Babys und alte Frauen hocken zwischen Jutebündeln wie Reisende auf einem Weltuntergangsbahnhof oder einem in den Dschungel geplatzten Terminal der Third Avenue Elevated, ein Meccano-Erector-Set, alle Träger und Eisenplatten zusammengeschraubt und an gusseisernen Säulen aufgehängt, mit zwei viktorianisch-gotischen Eisentürmen darüber wie scheppernde Wachhäuschen in eisernen Gefängnissen … der eiserne Tod … ein gespenstischer Schnitter mit seiner Sense oben auf den Zinnen (keiner darf entkommen!) Wenn er Haut hätte, wäre sie weiß oder schwarz? Selbst wenn man verhungert, hat mal ein Konsul gesagt, hat man noch die Kraft, sein eigenes Grab zu schaufeln.
II
Trotz allem ist es eine wunderschöne tropische Insel, wirklich! Da ist der Champ de Mars