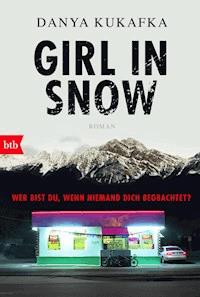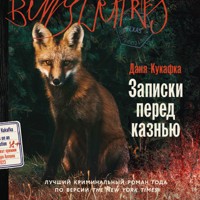9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Ein erschütternder Thriller über drei Frauen, die in den Bannkreis eines Serienmörders geraten.« Brit Bennett.
In 12 Stunden soll Ansel Packer hingerichtet werden. Doch dies ist nicht seine Geschichte. Dies ist die Geschichte der Frauen, die er zurückgelassen hat.
Ansel Packer weiß ganz genau, was er verbrochen hat, und wartet nun auf seine Hinrichtung – das gleiche grausame Schicksal, das er vor Jahren seinen Opfern auferlegt hat. Doch er will nicht sterben. Er will anerkannt und verstanden werden.
Durch ein Kaleidoskop von Frauen – eine Mutter, eine Schwester, eine Kommissarin der Mordkommission – erfahren wir die Geschichte von Ansels Leben. Atemberaubend spannend und mit erstaunlichem Einfühlungsvermögen zeichnet Kukafka ein erschütterndes Porträt von Weiblichkeit, während sie gleichzeitig das Narrativ des Serienmörders und unsere kulturelle Besessenheit von Kriminalgeschichten hinterfragt
»Brillant.« Chris Whitaker.
»Ein Muss.« The Times.
»Umwerfend.« Observer.
»Fesselnd.« New York Times.
»Meisterhaft.« Guardian.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Ansel Packer weiß ganz genau, was er verbrochen hat, und wartet nun auf seine Hinrichtung – das gleiche grausame Schicksal, das er vor Jahren seinen Opfern auferlegt hat. Doch er will nicht sterben. Er will anerkannt und verstanden werden.
Durch ein Kaleidoskop von Frauen – eine Mutter, eine Schwester, eine Kommissarin der Mordkommission – erfahren wir die Geschichte von Ansels Leben. Atemberaubend spannend und mit erstaunlichem Einfühlungsvermögen zeichnet Kukafka ein erschütterndes Porträt von Weiblichkeit, während sie gleichzeitig das Narrativ des Serienmörders und unsere kulturelle Besessenheit von Kriminalgeschichten hinterfragt
Über Danya Kukafka
Danya Kukafka gelang mit ihrem Debüt »Girl in Snow« auf Anhieb ein Bestseller, der in mehreren Sprachen erschienen ist. Das Buch wurde für zahlreiche Preise nominiert und wird als Amazon Prime Serie verfilmt werden. Danya Kukafka studierte an der New York University Creative Writing unter Colson Whitehead. Sie wuchs in Colorado auf und lebt heute in New York, wo sie als Literaturagentin arbeitet.
Andrea O’Brien, geboren 1967, übersetzt seit fast 20 Jahren zeitgenössische Literatur aus dem Englischen. Für ihre Übersetzungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Übersetzerstipendium des Freistaat Bayern und dem Literaturstipendium der Stadt München.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Danya Kukafka
Notizen zu einer Hinrichtung
Roman
Aus dem Amerikanischen von Andrea O'Brien
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Zitat
12 Stunden
Lavender — 1973
10 Stunden
Saffy — 1984
8 Stunden
Hazel — 1990
7 Stunden
Saffy — 1999
6 Stunden
Lavender — 2002
4 Stunden
Hazel — 2011
2 Stunden
Saffy — 2012
1 Stunde
Hazel — 2012
Saffy — 2012
Lavender — 2019
18 Minuten
Lavender — Jetzt
Saffy — Jetzt
Hazel — Jetzt
0
Woanders
Danksagung
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
»Wach bin ich dort, wo Frauen sterben.«
Jenny Holzer (1993)
12 Stunden
Du bist ein Fingerabdruck.
Als du an deinem letzten Lebenstag die Augen aufschlägst, siehst du deinen Daumen. Im gallegelben Knastlicht sind die Wirbel deiner Daumenkuppe ein trockenes Flussbett, Sand, vom Wasser zu einem schwieligen Muster geformt, einst gewesen, nun verschwunden.
Der Nagel ist zu lang. Du erinnerst dich an das Ammenmärchen aus deiner Kindheit: Wenn du tot bist, wachsen deine Nägel immer weiter und wickeln sich um deine Knochen.
Name und Nummer, Häftling!
Ansel Packer, rufst du. 999631.
Du drehst dich auf der Koje um. Die Decke hat das gewohnte Muster aus Wasserflecken. Wenn du den Kopf auf bestimmte Weise drehst, erkennst du in der feuchten Stelle in der Ecke einen Elefanten. Heute ist der Tag gekommen, sagst du in Gedanken zur feucht verfärbten Stelle, die den Rüssel bildet. Heute ist der Tag. Der Elefant grinst, als wäre er eingeweiht in dein schrecklichstes Geheimnis. Du hast schon viele Stunden damit verbracht, genau diesen Ausdruck nachzuahmen, wie der Elefant an der Decke zu grinsen – doch heute kommt er ganz von selbst. Du und der Elefant, ihr lächelt euch an, bis die Tatsache dieses Morgens zu einem aufregenden Pakt wird, bis ihr beide ausseht wie Wahnsinnige.
Du schwingst die Beine über die Pritschenkante, hievst dich von der Matratze. Schlüpfst in die Gefängnislatschen, schwarz, so groß, dass deine Füße darin herumrutschen. Lässt Wasser aus dem Metallhahn auf deine Zahnbürste laufen, drückst einen körnigen Haufen Putzpulver darauf, dann befeuchtest du dein Haar vor dem kleinen Spiegel – kein echtes Glas, nur pockennarbiges Aluminium, das bei einem Schlag nicht zerbrechen würde. Über dem Waschbecken nagst du dir jeden einzelnen Fingernagel zurecht, einen nach dem anderen, reißt vorsichtig das Weiße ab, gleichmäßig, bis alle gezackt, aber kurz sind.
Die letzten Stunden sind oft der schwierigste Teil, hat der Gefängnisseelsorger dir bei seinem Besuch gestern Abend erzählt. Eigentlich magst du ihn, den kahlköpfigen Mann, der gebeugt geht, als trüge er schwer unter der Last seines schlechten Gewissens. Der Seelsorger ist noch neu in der Polunski Unit – er hat ein weiches Gesicht, weit offen, als könnte man direkt hineingreifen. Der Seelsorger hat von Vergebung gesprochen, Befreiung von einer Last, akzeptieren, was wir nicht ändern können. Dann, die Frage.
Ihre Zeugin, sagte der Seelsorger durchs Besucherfenster. Kommt sie?
Du hast den Brief auf dem Regal in deiner engen Zelle vor Augen gehabt. Den cremefarbenen Umschlag, die Verheißung darin. Der Seelsorger hat dich mit unverhohlenem Mitleid angesehen – für dich war Mitleid schon immer die größte Beleidigung gewesen. Mitleid ist Zerstörung in der Maske des Mitgefühls. Mitleid macht dich nackt. Mitleid lässt dich schrumpfen.
Sie kommt, sagtest du. Dann: Sie haben da was zwischen den Zähnen. Du hast zugesehen, wie der Mann hektisch die Hand an den Mund hob.
In Wahrheit hast du dir über den heutigen Abend kaum Gedanken gemacht. Zu abstrakt, zu unberechenbar. Es lohnt sich nie, auf die Gerüchte in Gebäude 12 zu hören – ein Todeskandidat war zurückgekehrt – man hatte ihn knapp zehn Minuten vor der Hinrichtung begnadigt, schon auf der Pritsche festgeschnallt – und dann gemeint, man habe ihn stundenlang gefoltert, ihm wie in einem Actionfilm Bambusstäbe unter die Fingernägel geschoben. Ein anderer Insasse behauptete, er hätte Donuts gekriegt. Du denkst lieber nicht weiter darüber nach. Es ist okay, sich zu fürchten, hat der Seelsorger gesagt. Aber du fürchtest dich nicht. Nein, du staunst, findest es so faszinierend, dass es dir im Magen ganz flau wird davon – seit Neuestem träumst du, du würdest durch den klaren blauen Himmel fliegen, weit oben schweben über riesigen Kornkreisen. Deine Ohren ploppen beim Aufsteigen.
Die Armbanduhr, die dir in Trakt C vermacht wurde, ist fünf Minuten vorgestellt. Du bist gern vorbereitet. Sie behauptet, dir blieben noch elf Stunden und dreiundzwanzig Minuten.
Sie haben versprochen, dass es nicht wehtut. Sie haben versprochen, dass du gar nichts spürst. Da war mal diese Psychiaterin, die saß in piekfeinem Kostüm und teurer Brille vor dir im Besucherraum. Sie hat dir Dinge erzählt, die du schon immer geahnt hast und nun nie mehr vergessen kannst, Dinge, die du am liebsten nie gehört hättest. Eigentlich hätte dir ihr Gesicht mehr verraten müssen, normalerweise kannst du das erforderliche Maß Traurigkeit oder Bedauern gut abschätzen. Aber die Miene der Psychiaterin war blank, mit Absicht, und dafür hast du sie gehasst. Was fühlen Sie?, fragte sie. Völlig sinnlos, diese Frage. Gefühle haben keinen Gegenwert. Also hast du die Achseln gezuckt und die Wahrheit gesagt: Keine Ahnung. Nichts.
Um sechs Uhr legst du deine Utensilien zurecht.
Die Farben hast du schon am Abend zuvor gemischt, wie, das hat dir Froggy beigebracht, damals im Trakt C. Mit dem Buchrücken eines dicken Wälzers hast du ein paar Buntstifte zerstoßen und das Pulver mit Vaseline aus dem Gefängnisladen vermengt. Du hast drei Stiele in Wasser eingeweicht, von Eislutschern aufgespart, die du dir gegen Dutzende Ramen-Fertigsuppen teuer ertauschen musstest, und das Holz bearbeitet, bis es wie bei einem Pinsel zu aufgefächerten Borsten zerfaserte.
Jetzt breitest du alles auf dem Boden deiner Zelle aus. Mit großer Sorgfalt, die Kante deines Kartons direkt im Lichtstrahl, der vom Gang hereinfällt. Das Tablett mit dem Frühstück auf dem Boden ignorierst du, hast es nicht angerührt, seit man es dir um drei Uhr in der Früh reingeschoben hat, die Soße hat schon einen Film, im Konservenobst wimmeln unzählige Riesenameisen. Es ist April, doch es fühlt sich an wie Juli, die Heizung läuft oft auch im Sommer, das Stückchen Butter ist bereits zu einer Fettsuppe geschmolzen.
Ein einziges elektronisches Gerät darfst du in der Zelle haben – du hast das Radio gewählt. Du berührst den Knopf, spitzes statisches Rauschen. Die Männer in den umliegende Zellen brüllen gelegentlich ihre Wünsche über den Gang, R&B oder Classic Rock, aber sie wissen, was heute geschehen wird. Sie protestieren nicht, als du deinen Lieblingssender wählst. Klassik. Die Symphonie bricht plötzlich in die Stille, erschreckend, füllt jeden Winkel der Betonzelle. Symphonie in F‑Dur. Du gewöhnst dich an das Laute, lässt es herein.
Was malst du?, hat Shawna mal gefragt, als sie dir das Tablett mit dem Mittagessen durch die Türklappe schob. Sie neigte den Kopf, um das Bild zu erkennen.
Einen See, sagtest du. Ein früherer Lieblingsort.
Damals war sie noch nicht Shawna gewesen, sondern Officer Billings mit dem streng zu einem Nackenknoten zusammengezurrten Haar, deren Uniformhose an der ausladenden Hüfte Falten schlägt. Erst sechs Wochen später wurde sie zu Shawna, als sie die flache Hand gegen dein Fenster drückte. Den Ausdruck in Shawnas Augen kennst du von anderen Mädchen in einem anderen Leben. Ein Aufmerken. Sie erinnerte dich an Jenny – da war etwas in ihrem Begehren, so verletzlich und ungezähmt. Verraten Sie mir Ihren Vornamen, Officer?, hast du sie gebeten, woraufhin sie knallrot wurde. Shawna. Du hast ihn wiederholt, ihren Namen, andächtig wie ein Gebet. Du stelltest dir vor, wie ihr Puls einen nervösen Satz tat, ein Flattern der bläulichen Vene unter der bleichen Haut ihres dürren Halses, und spürtest, wie du größer wurdest, ein anderer Mensch wuchs über dich hinaus, verdeckte bereits dein Gesicht. Shawna lächelte, entblößte die Lücke zwischen ihren Zähnen. Verschämt, klaffend.
Als Shawna gegangen war, hatte Jackson zwei Zellen weiter dir grölend applaudiert, dich streitlustig provoziert. Du hast die ausgefransten Fäden deines Bettlakens zusammengebunden, ein Snickers daran befestigt und es ihm über den Flur hinweg hingeworfen, damit er die Klappe hielt.
Für Shawna hast du dich an einem anderen Motiv versucht. Du hast ein Foto von einer Rose gefunden, es in ein von dir in der Gefängnisbücherei bestelltes Philosophiebuch geschoben. Die Farben hattest du perfekt angemischt, aber die Blütenblätter waren falsch angeordnet. Die Rose hatte ein wirres Blutrot und die Umrisse waren schief, du hast das Bild weggeworfen, bevor Shawna es zu Gesicht bekam. Als Shawna dich das nächste Mal durch den langen grauen Gang entlang zum Duschraum führte, war es, als hätte sie es gewusst – ihre Hand glitt hinab zum Metall deiner Handschellen, sie drückte den Daumen gegen die Innenseite deines Handgelenks, ein Test. Der Wärter an deiner anderen Seite schnaufte behäbig durch die Nase, ahnungslos, während du schaudertest. Es war schon so lange her gewesen, dass du etwas anderes gespürt hattest als ruppige Arme, die dich aus dem Käfig zerrten, die kühlen Zinken einer Plastikgabel, die langweiligen Bespaßungsbewegungen deiner eigenen Hand in der Dunkelheit. Shawnas Berührung war elektrisierend.
Seitdem habt ihr euren Austausch perfektioniert.
Nachrichten, unters Tablett geschoben. Augenblicke, heimlich erhascht zwischen Zelle und Hofgang-Käfig. Erst vergangene Woche hat Shawna dir durch die Türklappe einen kleinen Schatz zugeschoben: eine kleine schwarze Haarklammer, eine von denen, die ihren festen schwarzen Haarknoten durchsetzen.
Jetzt tauchst du den Holzstiel in die blaue Masse und lauschst auf ihre Schritte. Dein Karton harrt geduldig an der Türkante, perfekt ausgerichtet. Heute wird Shawna eine Antwort haben. Ja oder Nein. Nach der gestrigen Unterhaltung ist der Ausgang offen. Du bist gut darin, Zweifel auszublenden und dich stattdessen auf die Erwartung zu konzentrieren, die wie ein Tier auf deinem Schoß sitzt. Eine neue Symphonie erklingt, erst leise, dann steigen Spannung und Tiefe – du verweilst beim hastenden Cello, denkst daran, wie alles nach Beschleunigung drängt, sich aufbaut und immer auf ein spektakuläres Crescendo hinausläuft.
Beim Malen betrachtest du die Form. Inventar eines Straftäters. Egal, wie Shawnas Antwort ausfällt, du wirst deine Sachen packen müssen. Drei rote Netzbeutel liegen am Fußende deiner Koje – sie werden deine allernötigsten persönlichen Gegenstände zur Walls Unit bringen, wo du noch ein paar Stunden mit deinen weltlichen Besitztümern verbringen darfst, bis sie dir auch diese wegnehmen. Gedankenlos stopfst du alles hinein, was du in den letzten sieben Jahren in der Polunski Unit gehamstert hast: tütenweise Zwiebelringe, scharfe Soßen und Zahnpastatuben. Jetzt ist alles wertlos. Du wirst es an Froggy in Trakt C vermachen – der einzige Insasse, der dich je beim Schach geschlagen hat.
Die Theorie wirst du hier zurücklassen. Alle fünf Notizblöcke. Was mit der Theorie geschieht, hängt von Shawnas Antwort ab.
Und da ist immer noch die Sache mit dem Brief. Da ist die Sache mit dem Foto.
Du hast dir geschworen, ihn nie wieder zu lesen. Das Meiste kennst du ohnehin auswendig. Aber Shawna ist spät dran. Deswegen prüfst du, ob deine Hände auch wirklich sauber und trocken sind, rappelst dich auf, streckst dich zum obersten Regal und ziehst den Umschlag herunter.
Blue Harrisons Brief ist kurz, knapp. Ein einziges liniertes Blatt. Sie hat deine Adresse mit schrägen Lettern geschrieben: Ansel Packer, P. U., Geb. 12, Trakt A, Death Row. Ein langes Seufzen. Du legst den Umschlag sanft auf dein Kissen, bevor du den Stapel Bücher zur Seite schiebst, um das Foto hervorzuholen, das du im Versteck zwischen Regal und Wand festgeklebt hast.
Dies ist deine Lieblingsstelle in der Zelle, nicht nur, weil sie nie durchsucht wird, sondern auch wegen der Graffitis. Du sitzt in dieser Zelle im Trakt A, seit man dir deinen Termin mitgeteilt hat, aber dein Vorgänger hat vor einiger Zeit mit viel Mühe klare Worte in den Beton geritzt: Wir sind fuchsteufelswild. Jedes Mal, wenn du das liest, musst du lächeln – es ist so bizarr, so unsinnig, so anders als alle anderen Knastgraffitis (überwiegend Bibelzitate und Genitalien). Darin steckt eine stille Wahrheit, die du angesichts der Umstände als nahezu lächerlich bezeichnen würdest.
Vorsichtig ziehst du den Klebestreifen von der Ecke des Fotos, damit es nicht reißt. Du sitzt auf der Pritsche, das Foto und den Brief im Schoß, Ja, denkst du. Wir sind fuchsteufelswild.
Bevor Blue Harrisons Brief eintraf, vor ein paar Wochen, war das Foto dein einziger heimlicher Schatz gewesen. Damals vor der Urteilsverkündung – deine Anwältin glaubte noch an die Verteidigungsstrategie mit dem angeblich erzwungenen Geständnis – hat sie angeboten, dir einen Gefallen zu tun. Sie musste ein bisschen herumtelefonieren, aber schließlich kam das Foto in einer E‑Mail vom Büro des Sheriffs in Tupper Lake.
Auf dem Bild wirkt Blue House klein. Schäbig. Es ist so aufgenommen, dass die Fensterläden auf der linken Seite nicht zu sehen sind, aber du erinnerst dich an die prächtigen Hortensienbüsche davor. Es wäre leicht, auf dem Foto nur das Haus zu sehen, knallblaue Farbe, die bereits abblättert. Es ist nicht auf Anhieb ersichtlich, dass es sich um ein Restaurant handelt. Auf der Terrasse flattert eine kleine Fahne: OPEN. Die Kiesauffahrt wurde verbreitert, um einen vorübergehenden Parkplatz für Gäste zu schaffen. Von außen wirken die weißen Vorhänge unauffällig, doch du weißt, dass sie innen ein rotes Karomuster haben. Du erinnerst dich an den Geruch. Pommes, Lysol, Apfelkuchen. Wie die Küchentüren klapperten. Dampf, Geschepper. Am Tag, als das Foto entstand, war der Himmel regenschwer. Wenn du es jetzt betrachtest, riechst du förmlich den scharfen Schwefelgestank.
Das Fenster im ersten Stock ist dir am liebsten. Der Vorhang ist nur leicht geöffnet, und wenn du ganz genau hinsiehst, erkennst du den Schatten eines Arms, von der Schulter bis zum Ellbogen. Der nackte Arm eines jungen Mädchens. Du stellst dir gern vor, was sie getan haben mochte im Moment der Aufnahme – sie muss sehr nah an ihrer Zimmertür gestanden, mit jemandem gesprochen oder sich im Spiegel betrachtet haben.
Den Brief hat sie mit »Blue« unterschrieben. Eigentlich heißt sie Beatrice, aber so hast du sie nie genannt, niemand hat sie damals so genannt. Sie war immer schon Blue: Blue mit ihrem geflochtenen Zopf, über eine Schulter geworfen. Blue, in diesem Sweatshirt mit der Aufschrift Tupper Lake Track and Field, die Ärmel verschämt über die Hände gezogen. Wenn du an Blue Harrison denkst, an deine Zeit in Blue House, erinnerst du dich daran, dass sie nie an einem Fenster vorbeiging, ohne einen nervösen Blick auf ihr Spiegelbild zu werfen.
Du weißt nicht, was das für ein Gefühl ist, das in dir aufsteigt, wenn du das Foto betrachtest. Liebe kann es nicht sein, man hat dich getestet, du lachst nicht an den richtigen Stellen, zuckst an den falschen zusammen. Es gibt Statistiken. Irgendwas über Emotionserkennung, Mitgefühl, Schmerz. Liebe, wie du sie aus Büchern kennst, verstehst du nicht, und Filme magst du nur, weil du sie studieren kannst, die Kunst, Gesichter zu verziehen und andere Mienen aufzusetzen. Jedenfalls ist es egal, welche Fähigkeiten sie dir attestieren, wenn du das Foto ansiehst, bist du wieder dort, in Blue House. An dem Ort, wo die schrillen Schreie verstummen. Die Stille ist eine köstliche Erleichterung.
Endlich hallt es im langen Gang. Vertrautes Schluffen, Shawnas Schritte.
Du bückst dich rasch, greifst die gekünstelte Pinselbewegung wieder auf: tüpfelst winzige, blutrote Blumen aufs Gras. Du zwingst dich zur Konzentration auf die spitzen Borsten, den Wachsgeruch der zerstoßenen Buntstifte.
Name und Nummer, Häftling!
Shawnas Stimme klingt immer so, als würde sie gleich brechen. Heute wird alle Viertelstunde ein Wärter nach dir sehen, um zu kontrollieren, ob du noch atmest. Du wagst nicht, von deinem Bild aufzuschauen, obwohl du weißt, dass sie dieselbe unverstellte Miene tragen wird, ihr Begehren entblößt, unverhohlen, jetzt aufgeregt oder vielleicht auch traurig, je nachdem, wie ihre Antwort lautet.
Es gibt Dinge, die Shawna an dir liebt, aber nichts davon hat viel mit dir zu tun. Eigentlich ist es deine Situation, die sie in den Bann zieht, deine Macht in Fesseln gelegt, und nur sie hat den Schlüssel dazu, im wahrsten Sinne des Wortes. Shawna ist eine Frau, die sich strikt an Regeln hält. Sie wendet sich pflichtbewusst ab, wenn die Wärter Leibesvisitationen durchführen, vor jedem Dusch- und Hofgang. Du verbringst zweiundzwanzig Stunden in dieser winzigen Zelle, sechs mal neun Quadratmeter, ohne jeglichen körperlichen Kontakt zu einem anderen Menschen, und Shawna weiß das ganz genau. Sie ist eine Frau, die Liebesromane liest, solche mit muskulösen Typen auf dem Cover. Du riechst ihr Waschmittel, das Eiersalat-Sandwich, das sie sich zum Mittagessen von zu Hause mitbringt. Shawna liebt dich, weil du ihr nicht zu nahe kommen kannst, weil zwischen euch eine Stahltür ist, die schmachtende Leidenschaft und Sicherheit verspricht. Unter diesem Aspekt betrachtet ist sie ganz und gar nicht wie Jenny. Jenny hat stets nachgebohrt, immer wollte sie sehen, was drinsteckt. Was fühlst du gerade?, fragte sie ständig. Gib mir alles von dir. Aber Shawna ergötzt sich an der Distanz, am berauschenden Unbekannten, das stets zwischen zwei Menschen existiert. Und jetzt lungert sie vor dem Türschlitz herum. Es kostet dich viel Selbstbeherrschung, nicht aufzuschauen, um deine Vermutung zu bestätigen. Shawna gehört dir.
Ansel Packer, wiederholst du ruhig. 999631.
Shawnas Uniform knirscht, als sie sich bückt, um sich den Schuh zu binden. Die Kamera in der Ecke deiner Zelle deckt den Gang nicht ab, und dein Bild ist perfekt positioniert. Es taucht nur als winziger weißer Lichtfleck auf, fast, als wäre es gar nicht da: nur ein kurzes Aufblitzen, als Shawnas Nachricht unter dem Türschlitz durchgleitet und problemlos unter dem Karton verschwindet.
Shawna glaubt an deine Unschuld.
So was könntest du niemals tun, hat sie mal geflüstert, als sie während einer langen Nachtschicht vor deiner Zelle stehen geblieben war, ihr Gesicht von Schatten durchschnitten. Nie und nimmer.
Natürlich weiß sie, wie sie dich in Gebäude 12 nennen.
Der Mädchenkiller.
Der Zeitungsartikel hat alle Details enthüllt: Nach deiner ersten Revision hat sich dein Spitzname hier wie ein Lauffeuer verbreitet. Der Schmierfink von der Presse hat sie alle in einen Topf geworfen, als hättest du sie absichtlich auserwählt, als hätten sie was gemeinsam. Die Mädchen. Im Artikel wurde dieses Wort verwendet, dieses verhasste Wort. Serienmörder sind was anderes – die Bezeichnung trifft auf Männer zu, die anders sind als du.
So was könntest du niemals tun. Shawna ist sicher, obwohl du es nie behauptet hast. Es ist dir nur recht, wenn sie sich ständig wiederholt, im Kreis dreht, sich von der Wut verleiten lässt. Es ist so viel einfacher als die Fragen. Fühlst du dich deswegen schlecht? Tut es dir leid? Was das heißen soll, weißt du nie so genau. Klar fühlst du dich schlecht. Logisch, denn du wärst lieber nicht hier. Du kannst nicht verstehen, wem Schuldgefühle nutzen sollen, doch seit Jahren hat diese Frage immer wieder im Raum gestanden, während der Verhandlung und der vielen fruchtlosen Revisionen. Bist du dazu fähig?, fragen sie. Bist du in der Lage, Empathie zu empfinden?
Du schiebst dir Shawnas Nachricht in den Hosenbund und blickst hinauf zum Elefanten an der Decke. Der Elefant mit dem Psychopatenlächeln, mal ist er echt, mal Phantasie. Allein die Frage ist absurd, geradezu irrwitzig – es gibt keine Grenze, die du überschreitest, keinen Alarm, der losgeht, kein Pendel, das ausschlägt. Bei der Frage, das hast du schließlich entschlüsselt, geht es gar nicht darum, ob du Empathie empfinden kannst. Die Frage lautet, wie es überhaupt möglich sein kann, dass du ein Mensch bist.
Und dennoch. Du hebst den Daumen ans Licht, untersuchst ihn genau. In diesem Fingerabdruck ist es zu sehen, unbestreitbar: das schwache, mausartige Zucken deines Pulses.
Es gibt da eine Geschichte über dich, die du kennst. Die jeder kennt. Als du Shawnas Nachricht aus deinem Hosenbund ziehst, fragst du dich, warum die Geschichte so verdreht wurde – wie kann es sein, dass nur noch deine schwächsten Momente gelten, wie konnten sie sich so ausbreiten, dass sie alles andere getilgt haben?
Du beugst dich über den Zettel, damit die Kamera in der Ecke deiner Zelle nichts mitkriegt. Da, in Shawnas zittriger Handschrift. Drei Worte.
Ich hab’s getan.
Hoffnung blitzt auf, ein grelles weißes Licht. Es dringt in jede Faser deines Körpers, reißt dich auf, lässt dich bluten. Du hast noch elf Stunden und sechzehn Minuten oder vielleicht, dank Shawnas Versprechen, ein ganzes Leben vor dir.
Da muss es eine Zeit gegeben haben, hatte der Reporter zu dir gesagt. Eine Zeit, als Sie noch nicht so waren.
Sollte es sie je gegeben haben, würdest du dich gern daran erinnern.
Lavender
1973
Wenn es ein Davor gegeben hat, dann begann es mit Lavender.
Mit ihren siebzehn Jahren wusste sie bereits, was es heißt, ein Leben auf die Welt zu bringen. Wusste um die Bedeutsamkeit dieses Ereignisses. Wusste, dass Liebe einen Menschen fest umhüllen, ihm aber auch Verletzungen zufügen konnte. Doch erst als es so weit war, verstand Lavender, was es bedeutete, zu verlassen, was im eigenen Körper herangewachsen war.
»Erzähl mir eine Geschichte«, stieß Lavender zwischen den Wehen hervor.
Sie lag breitbeinig in der Scheune, auf einer Decke, an einen Heuballen gelehnt. Johnny beugte sich mit einer Laterne über sie, sein Atem kräuselte sich weiß in der eisigen Novemberluft.
»Das Baby«, sagte Lavender, »erzähl mir vom Baby.«
Es wurde zunehmend klar, dass das Baby sie tatsächlich umbringen könnte. Jede Wehe führte ihnen vor Augen, wie entsetzlich unvorbereitet sie waren – obwohl Johnny so groß getönt hatte und ständig Passagen aus den ihm von seinem Großvater vermachten Medizinbüchern zitiert hatte, war sich keiner von ihnen im Klaren gewesen, was eine Geburt mit sich bringen würde. Davon hatte in den Büchern nichts gestanden. Von der apokalyptischen Blutung. Den Schmerzen, weißglühend und schweißgetränkt.
»Der wird Präsident, wenn er groß ist«, sagte Johnny. »Der wird König.«
Lavender stöhnte. Sie spürte, wie der Kopf des Kindes ihre Haut zerriss, eine Grapefruit, halb draußen.
»Du weißt doch gar nicht, ob’s ein Junge wird«, stieß sie keuchend hervor. »Außerdem gibt’s keine Könige mehr.«
Sie presste, bis die Wände der Scheune blutrot aussahen. Es fühlte sich an, als wäre ihr Körper voller Glasscherben, ein zackenscharfes, inneres Wringen. Lavender ließ sich in die nächste Wehe fallen, aus ihrer Kehle brach ein gutturaler Schrei hervor.
»Er wird toll«, sagte Johnny. »Er wird mutig, klug und mächtig. Ich sehe seinen Kopf, Lav, du musst weiterpressen.«
Blackout. Ihr ganzes Sein eine einzige berstende Wunde. Dann kam der Schrei, ein Wimmern. Johnny war bis zu den Ellbogen mit Schleim und Blut bedeckt, und Lavender sah zu, wie er die zuvor mit Alkohol sterilisierte Gartenschere nahm und damit die Nabelschnur durchtrennte. Sekunden später hielt Lavender es im Arm. Ihr Kind. Schleimverschmiert von der Nachgeburt, schaumgekrönt, ein Wirrwarr aus wutzappelnden Gliedern. Im Schein der Laterne wirkten seine Augen fast schwarz. Er sah nicht aus wie ein Baby, dachte Lavender. Ein kleiner purpurfarbener Außerirdischer.
Johnny ließ sich keuchend neben ihr ins Heu fallen.
»Schau«, krächzte er. »Schau, was wir geschaffen haben, mein Mädchen.«
Das Gefühl erfüllte sie gerade rechtzeitig: eine Liebe, so allumfassend, dass es sich wie Panik anfühlte. Und sofort danach überrollte sie eine Übelkeit erregende Welle der Schuld. Denn in dem Moment, als sie ihr Baby sah, wusste Lavender, dass sie diese Liebe nicht wollte. Zu viel. Zu hungrig. Aber dieses Leben war über Monate in ihr herangewachsen, und jetzt hatte es Finger, Zehen. Es schnappte nach Luft.
Johnny wischte das Neugeborene mit einem Handtuch ab und legte es fest an Lavenders Brustwarze. Als sie hinabspähte auf das zerdrückte, schuppige Bündel, war sie froh um die Dunkelheit in der Scheune und um ihr schweißnasses Gesicht – Johnny hasste es, wenn sie weinte. Als Lavender den Kopf des Neugeborenen umschloss, wurden ihre anfänglichen verräterischen Gedanken bereits von Bedauern besiedelt. Sie ertränkte das Gefühl mit Versprechungen, in die glitschige Haut des Kindes gemurmelt. Ich werde dich lieben wie der Ozean den Sand.
Sie nannten das Kind Ansel, nach Johnnys Großvater.
Hier ist die Liste von Johnnys Versprechungen:
Stille. Offener Himmel. Ein ganzes Haus nur für sie beide, ein eigener Garten für Lavender. Keine Schule, keine enttäuschten Lehrer. Überhaupt keine Regeln. Ein Leben ohne Beobachter, im Farmhaus waren sie allein, ganz allein, der nächste Nachbar zehn Meilen entfernt. Manchmal, wenn Johnny auf die Jagd ging, stand Lavender hinten auf der Veranda und schrie, so laut sie konnte, schrie, bis sie heiser war, denn sie wollte wissen, ob jemand herbeigerannt käme. Keiner kam. Nie.
Ein Jahr zuvor war Lavender noch eine ganz normale Sechzehnjährige gewesen. Es war 1972, ihre Tage bestanden aus Schlafen im Matheunterricht, in Geschichte und in Englisch, mit ihrer Freundin Julie hinter der Turnhalle kichern, während sie heimlich geklaute Zigaretten rauchten. Johnny Packer lernte sie in der Kneipe kennen, sie und Julie hatten sich eines Freitags reingeschlichen. Er war älter, attraktiv. Wie ein junger John Wayne, hatte Julie kichernd bemerkt, als Johnny zum ersten Mal vor der Schule auftauchte, in seinem Pick‑up. Lavender liebte Johnnys Zottelhaar, die wechselnden Frotteehemden, seine schweren Arbeitsstiefel. Johnnys Hände waren immer schmutzig von der Arbeit auf der Farm, aber Lavender liebte ihren Geruch. Nach Schmiere und Sonnenschein.
Als Lavender ihre Mutter das letzte Mal sah, hing sie zusammengesackt über dem Klapptisch, eine Kippe im Mundwinkel. Ihre Mutter hatte sich an einer Beehive-Frisur versucht – sie war plattgelegen, schief wie ein schlaffer Luftballon.
Hau ruhig ab, hatte Lavenders Mutter gesagt. Schmeiß die Schule hin, und zieh auf die dreckige Farm.
Ein feistes, zufriedenes Grinsen.
Warts nur ab, Schätzchen. Männer sind Wölfe, und manche Wölfe haben viel Geduld.
Lavender hatte sich auf dem Weg nach draußen noch das Amulett ihrer Mutter von der Flurkommode gemopst. Rund, aus rostigem Metall, mit einem leeren Fach darin. Seit sie denken konnte, hatte es in der Mitte ihrer kaputten Schmuckschatulle gethront – der einzige Beweis, dass Lavenders Mutter zu Wertschätzung fähig war.
Es stimmte, das Leben auf der Farm fiel nicht ganz so aus, wie Lavender es sich vorgestellt hatte. Sechs Monate nach ihrem Kennenlernen zog sie zu Johnny ins Haus, zuvor hatte er dort allein mit seinem Großvater gelebt. Johnnys Mutter sei gestorben, sein Vater habe sie verlassen und dann totgeschwiegen. Old Ansel war ein Kriegsveteran mit knarziger Stimme, der Johnny als Kind für jede Mahlzeit irgendwelche Arbeiten im Haus abverlangt hatte. Old Ansel hustete und hustete, bis er starb, ein paar Wochen vor Lavenders Ankunft. Sie begruben ihn im Hof unter der Fichte; Lavender machte stets einen Bogen um den kleinen Erdhügel. Sie lernte die Ziege melken, den Hühnern vor dem Rupfen und Ausnehmen die Hälse umdrehen. Sie kümmerte sich um den Garten, der zehnmal größer war als das Fleckchen Erde hinter dem Trailer ihrer Mutter – immer drohte er ihr über den Kopf zu wachsen. Regelmäßig duschen gab sie schnell auf, es war zu umständlich unter dem Wasserhahn draußen, und ihr Haar wurde wirr.
Johnny übernahm das Jagen. Er reinigte das Wasser. Reparierte das Haus. Manchmal rief er Lavender nach einem langen Tag auf dem Hof zu sich ins Haus – dort stand er schon in der Tür, den Hosenstall offen, prall und erwartungsvoll, ein Feixen im Gesicht. An diesen Abenden stieß er sie gegen die Wand. Wenn sich ihre Wange fest in das abgesplitterte Eichenholz drückte und Johnny ihr seine Wut in den Nacken knurrte, ergab sie sich der Essenz dieses Augenblicks. Seiner stoßenden Bedürftigkeit. Diesen schwieligen Händen, die sie priesen. Mein Mädchen, mein Mädchen. Lavender wusste nicht, ob sie sich über Johnnys Härte freuen sollte oder darüber, dass sie sie besänftigen konnte.
Weil sie keine Windeln hatten, wickelte Lavender Ansel nach der Geburt in einen sauberen Lumpen und verknotete ihn an den Beinchen. Dann hüllte sie das Neugeborene fest in eine Decke aus der Scheune und rappelte sich auf, um Johnny hinterherzuhumpeln.
Sie schlappte barfuß zurück zum Haus. Schwindelig. Sie hatte solche Schmerzen gehabt, dass sie nicht mehr wusste, wie sie überhaupt in die Scheune gekommen war, nur, dass Johnny sie getragen hatte, doch jetzt hatte sie keine Schuhe mehr – die Novemberluft war klirrend kalt, und Lavender hielt den spuckenden Ansel an die Brust. Sie schätzte, dass es schon fast Mitternacht war.
Das Farmhaus stand auf einem Hügel. Sogar in der Dunkelheit wirkte es windschief, es hatte links gefährliche Schlagseite. Das Haus war nie fertig, immer gab es was zu reparieren. Johnnys Großvater hatte ihnen gebrochene Rohre hinterlassen, ein undichtes Dach, fehlende Fensterscheiben. Normalerweise störte sich Lavender nicht daran. Die Momente, die sie allein auf der Veranda stehen und die unendliche Weite der Weiden betrachten konnte, machten das allemal wett. Im Morgenlicht glänzte das rauschende Gras silbern, am Abend leuchtete es orangefarben, und dort, wo das Weideland endete, konnte sie die gneisigen Gipfel der Adirondack Mountains ausmachen. Die Farm lag am Ortsrand von Essex, New York, Kanada war nur eine Stunde Autofahrt entfernt. An klaren Tagen spähte sie gern ins Grelle und malte sich eine unsichtbare Linie aus, wo die Ferne in ein ganz anderes Land überging. Die Vorstellung war wundersam, bezaubernd. Lavender war nie aus New York State herausgekommen.
»Machst du Feuer?«, fragte sie, als sie das Haus erreicht hatte. Ihr war eiskalt, die kalte Asche der vergangenen Nacht lag staubig im Holzofen.
»Ist schon spät«, sagte Johnny. »Bist du nicht müde?«
Es lohnte sich nicht, darüber zu streiten. Lavender quälte sich die Treppe hoch, wischte sich mit einem Lappen das Blut von den Beinen und zog sich um. Ihre alten Kleider passten ihr nicht mehr: die Schlaghose aus Cord, mit Julie beim Secondhandladen erstanden, lag zusammen mit ihren besten Blusen in einem Karton, alles war zu eng geworden für ihren geschwollenen Bauch. Als sie endlich zu Johnny ins Bett kroch, in seinem alten T‑Shirt, schlief er bereits, und Ansel, ein kleines Bündel, greinte auf ihrem Kissen. Lavender dämmerte aufrecht sitzend vor sich hin, das Kind in ihren Armen, ihre Haut war im Nacken starr von getrocknetem Schweiß und sie zu besorgt, um einzuschlafen.
Am frühen Morgen bemerkte sie, dass Ansels Lumpen nass war, Durchfall lief ihr glitschig über den erschlafften Bauch. Als Johnny beim Erwachen den Gestank roch, fuhr er hoch, woraufhin Ansel zu weinen begann, schrill und aufgebracht.
Johnny stand auf, tastete nach einem alten T‑Shirt, das er aufs Bett warf, allerdings zu weit weg für Lavender.
»Wenn du ihn kurz halten könntest …«, sagte sie.
Dieser Blick in seinen Augen. Diese Erbitterung gehörte nicht in sein Gesicht – so eine Hässlichkeit konnte nur von Lavender selbst stammen. Es tut mir leid, wollte sie sagen, doch was genau ihr leidtat, wusste sie nicht. Als sie Johnnys Schritte auf der knarzenden Treppe hörte, drückte Lavender die Lippen auf den Kopf des schreienden Kindes. So lief es doch immer. All diese Frauen, die ihr vorausgegangen waren, in Höhlen und Zelten und Planwagen. Erstaunlich, dass sie dieser uralten, zeitlosen Tatsache nie Beachtung geschenkt hatte. Mutter sein, das machte frau allein, so war es von der Natur vorbestimmt.
Hier ist die Liste der Dinge, die Johnny einst geliebt hatte: den Leberfleck in Lavenders Nacken, den er vor dem Einschlafen gern küsste. Ihre Fingerknochen, so zart und fein, er schwor, er könne jeden einzelnen ertasten. Ihren Überbiss. Krummzahn, nannte er sie scherzhaft.
Ihre Zähne sah Johnny jetzt nicht mehr. Stattdessen waren da Kratzer in ihrem Gesicht, von Ansels winzigen Nägeln verursacht.
»Herrgott noch mal!«, rief er, wenn Ansel schrie. »Sorg dafür, dass er still ist.«
Johnny saß am narbigen Holztisch und führte Ansels fettes Fingerchen durch den Soßenrest auf seinem Teller, um Tiere zu malen. Hund, erklärte Johnny, und seine Stimme brach vor Zärtlichkeit. Huhn. Ansels Gesicht war plump, unverständig – wenn der Kleine dann wie immer anfing, zu weinen, reichte Johnny ihn an Lavender weiter und ging raus, seine abendliche Zigarre rauchen. Wieder allein, während Ansel mit seinen Fettfingern ihr Hemd einschmierte, bemühte sich Lavender, diese Szene gut im Gedächtnis zu bewahren. Wie Johnny seinen Sohn angesehen hatte, in diesem kurzen, perfekten Augenblick, als wollte er einen Teil von sich an sein Kind weitergeben. Als wäre DNA nicht genug. Mit dem Baby auf dem Schoß, säuselnd und liebevoll, sah Johnny wie der Mann aus, den Lavender vor so langer Zeit in der Kneipe kennengelernt hatte. Sie konnte Julies Stimme förmlich hören, nuschelnd und biersauer.
Ich wette, der hat einen weichen Kern, hatte ihre Freundin geflüstert. Ich wette, der ist zum Reinbeißen weich.
Als Ansel schon allein sitzen konnte, war Lavenders Erinnerung an Julies Gesicht bereits verblasst – nur noch ihre Wimpern und ihr verschlagenes Grinsen blieben ihr im Gedächtnis. Ausgefranste Jeans und enge Halskette, Nikotin und selbstgemachter Lippenbalsam. Julies Stimme, wenn sie bei den Supremes mitsummte. Was ist mit Kalifornien?, hatte Julie gekränkt gefragt, als Lavender ihr eröffnet hatte, dass sie ins Farmhaus ziehen würde. Was ist mit den Protesten? Ohne dich ist es nicht dasselbe. Lavender erinnerte sich an Julies Silhouette im Fenster eines abfahrenden Busses, ein selbstgemaltes Protestschild irgendwo zu ihren Füßen. Stoppt den Vietnamkrieg! Julie hatte gewinkt, als der Greyhound davongerattert war, und Lavender hatte sich nicht gefragt – hatte keinen Gedanken daran verschwendet –, ob Lebensentscheidungen einen Menschen zerstören konnten.
Liebe Julie.
Lavender formulierte Briefe im Kopf, weil sie keine Adresse hatte und auch keine Möglichkeit, auf ein Postamt zu gehen. Sie konnte nicht Auto fahren, und Johnny benutzte den Pick‑up nur einmal im Monat, wenn er allein zum Einkaufen fuhr. Die Farm erforderte so viel Arbeit, sagte er – was wollte sie in der Stadt? Johnny war mürrisch, wenn er die Essenskonserven entlud, murmelte mit der Stimme seines Großvaters. Teuer, euch beide durchzufüttern.
Liebe Julie.
Erzähl mir von Kalifornien.
Ich denke oft an dich, stelle mir vor, wie du irgendwo an einem Strand liegst und dich sonnst. Hier ist alles gut. Ansel ist schon fünf Monate alt. Er hat so einen seltsamen Blick, als würde er direkt durch dich hindurchsehen. Jedenfalls hoffe ich, dass es wärmer ist, dort, wo du bist. Irgendwann, wenn Ansel alt genug ist, kommen wir zu dir. Er ist ein gutes Kind, du wirst ihn mögen. Dann sitzen wir alle im Sand.
Liebe Julie, Ansel wird heute acht Monate alt. Er ist so ein Wonneproppen, an den Beinchen hat er Speckrollen, die aussehen wie Brotteig. Er hat auch schon zwei Zähne, unten, mit einer Lücken dazwischen, wie einzelne kleine Knochen ragen sie hervor.
Ich denke immer an den Sommer, als wir ans Ende unseres Grundstücks gewandert sind, wo Himbeeren wachsen. Johnny hat sie Ansel vom Strauch direkt in den Mund geschoben, und seine kleinen Hände waren vom Saft ganz rot. Sie sahen aus wie eine Bilderbuchfamilie, ich stand ganz neben mir, als ich ihnen beim Spielen zuschaute. Eine Fremde. Wie ein Vogel auf einem fernen Zweig. Oder eines von Johnnys Kaninchen, an den Hinterläufen aufgeknüpft.
Liebe Julie, ich weiß, ich weiß. Schon wieder Frühling. Ansel kann laufen, steckt überall die Nase rein. Er hat sich an irgendeinem Gerät im Hof den Arm aufgeschlitzt, und natürlich hat sich die Wunde entzündet. Er hatte Fieber, aber Johnny wollte nichts ins Krankenhaus. Du weißt, ich glaube nicht an Gott oder so was, aber damals habe ich fast gebetet. Bald kommt der Winter – du kennst das ja. Ich kann mich nicht mal mehr an die letzten Wochen erinnern. Es kommt mir vor, als hätte ich sie glatt verschlafen.
Liebe Julie, hast du je Auto fahren gelernt? Ich weiß, wir haben uns geschworen, es zusammen zu lernen. Hätten wir es nur getan, als wir die Gelegenheit hatten. Seit Ansel auf der Welt ist, habe ich den Hof kein einziges Mal verlassen – er ist jetzt fast zwei Jahre alt, kannst du dir das vorstellen?
Gestern hat Johnny Ansel zum Jagen in den Wald mitgenommen. Ich habe ihm gesagt, dass Ansel noch zu jung dafür ist. Als sie zurückkamen, hatte Ansel lauter blaue Flecken an den Armen.
Die solltest du mal sehen, Julie. Sie haben die Form von Fingern.
So klein hat es angefangen. Harmlos, leicht zu ignorieren. Ein Brummen, eine wütend zugeschlagene Tür – ein gepacktes Handgelenk, ein gekniffenes Ohr. Eine Hand, die spielerische Ohrfeigen verteilt.
Als Lavender das nächste Mal aufschaute, war Ansel drei Jahre alt. Ihre Tage und Nächte waren eine lange, immergleiche Kette, Zeit wurde von der einsamen Leere im Farmhaus verschluckt.
Es war Hochsommer, ein verschwitzter Nachmittag, als Ansel in den Wald lief. Lavender kniete im Garten. Als sie sich von den verblühten Dahlien aufrichtete, war der Hof leer, und die Sonne stand hoch am Himmel. Sie hatte keine Ahnung, wie lange Ansel schon weg war.
Ansel war kein hübsches Kind, nicht mal niedlich war er. Seine Stirn war zu groß und seine Augen glupschig. Seit einiger Zeit spielte er Lavender Streiche. Versteckte den Pfannenwender, wenn sie kochte, füllte ihr Trinkglas mit Wasser aus der Toilette. Aber das hier war anders. Noch nie war er allein bis ans Ende der Weide gegangen.
Die Panik überrollte sie wie eine Welle. Lavender stand am Waldrand und rief Ansels Namen, bis sie heiser war.
Johnny hielt oben im Haus seinen Mittagsschlaf. Er murrte, als Lavender ihn wachrüttelte.
»Was?«
»Ansel«, stieß sie hervor. »Er ist in den Wald gelaufen. Du musst ihn suchen, Johnny!«
»Krieg dich wieder ein.« Johnnys Atem stank sauer.
»Er ist erst drei!« Lavender verachtete sich für ihre hysterische Stimme, wie schrill sie klang. »Er ist ganz allein im Wald.«
»Warum suchst du nicht selbst?«
Johnnys Erektion ragte aus dem Schlitz seiner Unterhose. Eine Warnung.
»Du kennst dich aus im Wald. Und du bist schneller.«
»Was gibst du mir dafür?«, fragte er.
Ein Scherz, dachte sie zuerst. Doch er grinste verschlagen. Seine Hand rutschte nach unten, unters Gummiband seiner Unterhose.
»Das ist nicht witzig, Johnny. Überhaupt nicht.«
»Siehst du mich lachen?«
Er befingerte sich, rhythmisch, feixend. Lavender konnte sich nicht beherrschen, die Tränen saßen ihr in der Kehle, dick und schmerzhaft. Als sie weinte, blieb Johnnys Hand stehen. Sein Lächeln gerann zu einer Grimasse.
»Na gut«, sagte Lavender. »Aber du versprichst mir, dass du ihn danach suchst?«
Sie setzte sich rittlings auf ihn. Tränen liefen ihr salzig in den Mund, während sie ihre Leinenunterhose abstreifte. Als sie Johnny in sich hineinschob, sah sie ihr Baby vor sich, wie es erschreckt in einen Bach stürzte. Sie stellte sich vor, wie Wasser seine winzige Lunge füllte. Sah einen Geier, der über ihm seine Kreise zog. Eine steile Schlucht. Lavender bewegte sich mechanisch, wie betäubt – und als Johnny endlich in ihr erschlaffte, hatte ihn das spöttische Grinsen im Gesicht völlig verwandelt.
Ich glaube, du kannst einen Menschen nie ganz kennen, hatte Julie einmal gesagt. Als Johnny sie wegstieß, faltig und zornig, erkannte Lavender seine Geringschätzung. Sein Mondgesicht, die Krater auf der Rückseite entblößt.
Der Nachmittag floss in den Abend; Lavender marschierte völlig hysterisch im Hof auf und ab. Johnny war aus dem Haus gestürmt – um seinen Sohn zu suchen, hoffte sie –, und sie hatte auf der untersten Stufe der Veranda gesessen, die Knie umschlungen und sich rastlos gewiegt. Als Lavender endlich ein Rascheln im Wald hörte, war es bereits Nacht, und ihre Sorge hatte sich zu einem scharfen, verzweifelten Schrecken verhärtet.
»Mama?«
Es war Ansel, er kauerte im Dämmerlicht am Waldrand. Seine Füße waren völlig verdreckt, seine Lippen schmutzverkrustet. Lavender eilte zu ihm, sah nun genauer hin: Sein Körper war tiefrot besudelt und stank nach Rost. Blut. Panisch tastete sie ihn ab, kontrollierte jeden seiner kindlichen Knochen.
Wie sich herausstellte, kam das Blut von seiner Hand. In Ansels Faust steckte ein Streifenhörnchen, der Kopf fehlte. Im Schatten sah es aus wie ein verstümmeltes Stofftier, eine enthauptete Puppe. Es schien ihn nicht weiter zu kümmern – nur ein vergessenes Spielzeug.
In Lavenders Kehle schwoll ein Schrei, doch sie war zu erschöpft, um ihn hervorzustoßen. Stattdessen verfrachtete sie Ansel auf ihre Hüfte, kehrte mit ihm zum Haus zurück und schob ihn draußen unter die Dusche. Unter der von einer Insektenwolke umschwirrten nackten Glühbirne wischte Lavender mit dem stockfleckigen Schwamm über Ansels Zehen, jeden einzelnen bedachte sie mit einem Kuss, als Entschuldigung für das schmerzhaft kalte Wasser.
»Komm«, flüsterte sie beim Abtrocknen. »Wir machen dir was zu essen.«
Als sie das Küchenlicht anknipste, fühlte sie sich wie ein Trichter, die Erleichterung lief ihr langsam aus den Gliedern und versickerte.
Im Haus war es still. Johnny war weg. Doch während Lavender das Grundstück abgelaufen war, hatte er dem Schuppen einen Besuch abgestattet. Die verstaubten alten Schlösser seines Großvaters hervorgeholt und sie an die Tür zur Vorratskammer geschraubt. Johnny hatte sämtliche Konserven weggesperrt, den Kühlschrank abgeschlossen, ein Loch in den Schrank über der Spüle gebohrt, um auch die Nudeln und die Erdnussbutter hinter Schloss und Riegel zu bringen.
Lavender hörte seine Worte, wie ein Ohrwurm liefen sie auf Dauerschleife in ihrem Hirn: Du und dieser Junge, ihr müsst lernen, euren Unterhalt zu verdienen. Egal, wie viele Nachmittage sie im Garten ackerte, damit die Tomatenpflanzen endlich Früchte trugen. Egal, wie viele Vormittage sie mit Ansel über dem ledergebundenen Wörterbuch saß, egal, wie viele Abende sie damit zubrachte, Dreck aus Johnnys alten Jagdstiefeln zu kratzen. Johnny hatte sich klar ausgedrückt. Er hatte die Aufgabe, für ihren Unterhalt zu sorgen. Lavender konnte nicht ganz erraten, welche Aufgabe ihr zugedacht war, doch offensichtlich erfüllte sie sie nicht.
Okay, dachte sie, als sie die verschlossene Kammer sah. Im Kopf purzelte alles durcheinander. Okay. Dann essen wir eben erst Morgen.
In dieser Nacht wagte sie es nicht, in ihrem Bett zu schlafen. Sie wollte ihn nicht sehen, wollte nicht wissen, was oder wen sie vorfinden würde. Stattdessen legte sie sich auf den harten Boden in Ansels Zimmer und kuschelte sich mit ihm unter eine alte Decke aus der Scheune. Hunger, murmelte Ansel in die Nacht, während Johnny donnernden Schritts die Treppe hinaufstieg. Als Ansel dann begann, mit den Zähnen zu klappern, streifte Lavender den nach der Dusche übergeworfenen Bademantel ab und wickelte ihn darin ein. Nackt auf dem Boden, die entblößten Brüste zum Fenster gedreht, fiel Lavenders Blick auf das Amulett ihrer Mutter, das in der Dunkelheit glänzte – das Einzige, was sie je besessen hatte. Sanft löste sie den Verschluss und hängte es Ansel um den Hals.
»Das gehört jetzt dir«, sagte sie. »Es wird dich immer beschützen.«
Ihre Stimme zitterte, aber die Worte schienen den Jungen in den Schlaf zu lullen.
Lavender wartete, bis im Haus völlige Stille herrschte, bevor sie sich nach unten schlich und eine Jacke von Johnny aus dem Schrank zog. Bis zu diesem Moment hatte sie ihre Sorge noch kleinreden können. So etwas hatte Johnny nie zuvor getan – er hatte sie lediglich unnötig grob am Handgelenk gepackt und sie auf dem Weg nach oben zur Seite gestoßen. Die verschlossenen Schränke waren ein Versprechen und eine Drohung, weil sie nicht mal das Einfachste hinbekam: Mutter sein.
Am Rand der Weide ragte der Pick‑up auf. Lavender watete barfuß durchs hohe, feuchte Gras. Die Nacht war so finster. Kein Mondlicht. Sie fühlte sich schwach, verschrumpelt. Seit dem Frühstück hatte sie nichts mehr gegessen. Der Schlüssel glitt ins Schloss, quietschend öffnete sich die Tür.
Lavender rutschte auf den Fahrersitz.
Es war so verlockend: Fast. Fast hätte sie den Schlüssel in die Zündung gesteckt. Fast wäre sie in die Nacht hinausgefahren, bis ans Meer. Doch mit dem Anblick des Schaltknüppels überrumpelte sie die Erkenntnis, umso verheerender, weil sie es bis hierher geschafft hatte. Sie konnte nicht Auto fahren. Sie wusste nicht, ob der Tank voll war, und es war auch egal, denn sie wusste nicht, wie man ihn füllte. Sie trug nicht mal ein Hemd und konnte sich auch keins besorgen, denn dazu müsste sie ins Schlafzimmer gehen, wo Johnny lag. Die Situation war auswegslos. Sie würde es nie schaffen.
Lavender krümmte sich übers Steuer und gab sich ihren Tränen hin. Sie weinte um Ansel, um das Streifenhörnchen, um ihren knurrenden Magen. Sie weinte um alles, was sie je gewollt hatte und sich nun nicht mal mehr vorstellen konnte. Es war, als hätte sie ihre Wünsche so lange in der Hand gehalten, bis sie zu Tand verkommen waren, bedeutungslos, sinnlos, reine Platzverschwendung.
Als sie am nächsten Morgen erwachte, duftete es nach gebratenem Speck.
Lavender lag allein auf dem Boden in Ansels Zimmer, die verwickelte Decke zu ihren Füßen, die Sonne schien mit grellem, teigbleichen Licht zum Fenster herein. Sie schlüpfte in ihren Bademantel, der in einem Haufen auf dem Boden gelegen hatte, und tappte nach unten.
Johnny stand wie immer am Herd. Sein massiger Körper, vertraut. Lavender kannte seinen Körper so gut, es war, als wäre er ein Teil von ihr, und jetzt kamen ihr die nächtlichen Gedanken an den Highway lächerlich vor. Johnny reichte ihr einen Teller. Dampfendes Rührei und zwei knusprige Streifen von dem Speck, den sie für besondere Gelegenheiten eingefroren hatten. Ein rascher Blick sagte ihr: Die Schränke waren wieder abgesperrt, die restlichen Lebensmittel weggeräumt und dahinter verstaut.
Ansel saß zufrieden am Tisch und trank seine Milch.
»Bitte«, sagte Johnny. Ganz weich war er jetzt. »Iss doch, Liebes.«
Lavender erkannte Johnnys versöhnlichen Ton. Sie ließ es zu, dass er ihr Haar auf seine Finger zwirbelte. Sie ließ es zu, dass er den Rand ihrer Oberlippe küsste. Sie ließ es zu, dass er es tut mir leid, es tut mir leid flüsterte, bis es klang, als stammten die Worte aus einer fremden Sprache.
Während Johnny ein Schläfchen hielt, saß Lavender mit Ansel im Schaukelstuhl. Die Kette hatte grün auf seinen Hals abgefärbt, und ihre Angst steigerte sich zur Panik, weil es aussah, als wäre er verletzt.
Sie zogen Bücher vom Regal – technische Handbücher und Karten von den Philippinen, Japan, Vietnam –, bis sie sie gefunden hatten. Eine topographische Karte der Adirondacks. Lavender rückte Ansel auf ihrem Schoß zurecht und breitete die Karte auf ihren Beinen aus.
»Wir sind hier«, flüsterte Lavender. Sie nahm Ansels Hand und zeichnete den Highway nach. Von der Farm zur Stadt bis zum Rand der Karte.
Es war ein besonderer Akt der Gewalt, das Weiß ihrer Unterhose. Vier Wochen überfällig, dann sechs: Lavender betete um einen Blutstropfen. Ihr Körper betrog sie jeden Morgen, verwandelte sich ohne ihren Willen. Sie erbrach sich in die verkrustete Toilettenschüssel, das Entsetzen hob sich mitsamt ihren Eingeweiden – ein Tideschwellen, furchterfüllt.
Liebe Julie,
erinnerst du dich daran, wie sehr wir die Manson Girls bewunderten? Wie wir die Gerichtsverhandlung verfolgten, als wäre sie eine Fernsehshow? Ich frage mich, ob Susan Atkins sich je so gefühlt hat. Ob es in der Finsternis ihres Verstands eine leise Stimme gegeben hat, die flüsterte: Geh.
Es wächst, Julie. Ich kann es nicht aufhalten.
Lavender fand in der Scheune einen Jutesack. Sie legte eine armselige Dose Mais hinein, gestohlen, als Johnny mal nicht aufgepasst hatte, eine Beule unter ihrem Hemd, ihr wagemutiges Herz wie wild schlagend. Sie stopfte einen alten Wintermantel in den Sack, der zu klein war, Ansel aber zur Not warmhalten würde. Zum Schluss schob sie noch ein rostiges Messer dazu, das hinter die Spüle gefallen war. Den Sack schob sie in den äußersten Winkel des Kleiderschranks in Ansels Zimmer, wo Johnny nie nachsehen würde.
In jener Nacht schnarchte Johnny wie immer, und Lavender legte eine Hand auf ihren Bauch, der sich angeschwollen und fremd anfühlte. Sie dachte an den Sack im Schrank, seine strahlende Verheißung. Als sie Johnny von dem Baby erzählt hatte, auf seinen Wutausbruch gefasst, hatte er nur gelächelt. Unsere kleine Familie. Ihr stieg die Galle hoch, hing ihr verräterisch in der Kehle.
Lavender wurde dicker. Mit ihrem dicken Bauch bezog sie Stellung im Schaukelstuhl an der Hintertür – jeden Morgen ließ sie sich darauf nieder und erhob sich nur, um auf die Toilette zu gehen. Ihr Hirn war wie ein Sieb, gehörte ihr nicht mehr. Das neue Kind fraß ihre Gedanken, sobald sie aufstiegen, während Lavender nur eine Hülle war, eine Untote, ein Behältnis.
Ansel hockte permanent zu Lavenders Füßen. Er zerdrückte Insekten zwischen seinen Fingern und präsentierte sie ihr wie Gaben. Mit seinen Milchzähnen zerbiss er Eicheln und gab ihr die zersplitterten Hälften. Johnny verschwand tagelang, und Ansel holte Lavender die von seinem Vater auf dem Tresen bereitgestellten Suppendosen. Ihre Ration. Abwechselnd löffelten sie die kalte Brühe. Bei seiner Rückkehr war Johnny reizbar wie ein Raubtier – Lavender dachte an den Sack im Schrank, die Jacke, das Messer. Sie war zu dick, um die Treppe hochzukommen.
Liebe Julie,
ich stelle mir die Frage nach unseren Lebensentscheidungen. Wie sie uns erzürnen, wir sie bedauern – während wir ihnen beim Wachsen zusehen.
Die Wehen kamen früh. Ein sengender Schmerz an einem kaltbleichen Morgen. Lavender flehte: Kein Schuppen. Lass uns hierbleiben.
Johnny breitete die Decke neben dem Schaukelstuhl aus. Er und Ansel standen über Lavender, während sie kreischte und blutete und presste. Diesmal war es anders – als wäre sie nicht in ihrem Körper, als hätte der Schmerz sie verzehrt und sie wäre lediglich Zuschauerin dieses Dramas. Irgendwann warf sich Ansel auf sie, drückte ihr besorgt die klebrige Hand auf die Stirn, und da spürte Lavender das urzeitliche Reißen, dass sie kurz wieder zurückkehren ließ in ihren Körper: So mächtig war das Schwellen ihrer Liebe, so unausweichlich zum Scheitern verurteilt, dass sie nicht wusste, wie sie es überleben sollte.
Danach herrschte Ruhe.
Lavender wünschte, der Boden würde sich unter ihr auftun und sie in ein anderes Leben fallen lassen. Sie war sicher, dass gemeinsam mit dem Kopf, den Fingern und den Zehen des Kindes auch ihre Seele ihren Körper verlassen hatte. Als Johnny Ansel das Bündel reichte und versuchte, sie zum Aufstehen zu bewegen, kam Lavender die Erkenntnis, dass Wiedergeburt tatsächlich der letzte Ausweg war: Es gab anderes Leben auf dieser einen Welt. Kalifornien. Sie bewegte das Wort in ihrem Herzen, ein Bonbon, das ihr auf der Zunge zerging.
Sie konnte keines ihrer kränkelnden, rotznäsigen Kinder ansehen. Ansel mit seinem seltsamen Monstergesicht. Das Neugeborene, ein Bündel aus warmer Haut. Es war ihr unerträglich, das Kind zu berühren, aus Angst, sie könnte sich eine Krankheit holen. Welche, wusste sie nicht. Aber sie würde sie hier gefangen halten.
Lavender versank im harten Holzboden. Sie wünschte, sie wäre ein Staubteilchen an der Decke.
Wochen vergingen, und das Neugeborene hatte noch immer keinen Namen. Ein Monat zerfloss zu zwei. Baby Packer, sang Ansel, während er mit dem Bündel auf dem Boden am Kamin spielte. Ein Liedchen, das er erfunden hatte, schief und ohne Melodie. Baby Packer iss, Baby Packer schlaf. Bruder liebt dich, Baby Packer. Bruder liebt dich.
Johnny hatte gelegentlich Anfälle von Zärtlichkeit, halbherzige Versuche, sie wieder zum Leben zu erwecken. Übers Matratzenende gebeugt massierte er Lavender die Füße. Er reinigte ihre Wunden mit einem Schwamm, zerrte ihr eine Bürste durchs verfilzte Haar. Sie vergrub sich im Bett, wenn Johnny das Baby zum Stillen brachte – den Rest der Zeit strampelte Baby Packer unter dem wachsamen Auge des vierjährigen Ansel vor sich hin.
Während der paar Minuten, die Lavender das Kind täglich in Armen hielt, fragte sie sich, wie es auf die Welt gekommen war, ob dieses süße, nuckelnde Wesen überhaupt ihr gehörte. Bei Ansel war es ihr genauso gegangen, aber damals war ihre Liebe so frisch gewesen, so intensiv. Jetzt fürchtete sie, dass sie schon aufgebraucht war.
»Nimm ihn«, sagte sie monoton, wenn das Baby satt war. »Ich will ihn nicht bei mir.«