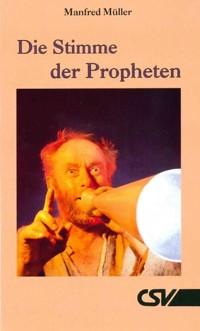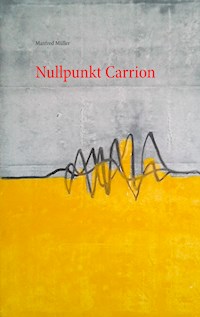
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der sechzigjährige Peter Pistorius reist, nach dem Tod seiner Frau Susanne, in den Ort seiner Jugend, wo er bei einfachen Menschen, in einer erhabenen Natur und der Geborgenheit eines Kosters, Orientierung und seine erste Liebe, Anna, gefunden hatte. Als ein letzter verzweifelter Versuch bricht er auf in der Hoffnung, erneut dort sein Glück zu finden. An einem einzigen Tag durchstreift er den Ort und seine Vergangenheit. In der Erinnerung an seine verschollene und seine tote Lieben und in der Auseinandersetzung mit der Gegenwart findet er zum Ende des Tags die Erlösung auf mysteriöse Weise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Niemand ist fort, den man liebt. Liebe ist ewige Gegenwart. Stefan Zweig
Wieder geht er die schmale, gewundene Straße hinunter, vorbei an den verwinkelten Häuserzeilen im Schatten der Morgensonne, langsam, allein. Wieder nimmt er diesen unvergessenen Geruch wahr, diese Mischung aus feuchtem Staub und Stroh und Rosmarin oder Thymian, der aus der Ebene hereingeweht wird und von der Straße im Morgentau aufsteigt. Wieder sucht er zu entkommen.
Die Häuser rechts und links von ihm und soweit er die Straße hinunter blicken kann stehen, so wie er sie in Erinnerung hat, dicht aneinandergedrängt, niedrig und hoch, ein und zwei Stockwerke, zurückversetzt und vorgezogen, aber mit neuen Anstrichen von Weinrot, Bananengelb, Ockerbraun, Cremeweiß und mit Fassaden in glänzendem Klinker und Sichtmauerwerk aus roten und braunen Ziegelsteinen, protzig ausstaffiert mit Balkongittern und Stuckverzierungen und dazwischen scheue Häuschen mit bröckelndem Putz mit Stromkästen an den Außenwänden aus denen schwarze oder weiß übertünchte Kabelstränge quellen, die kreuz und quer zwischen den Fenstern verlaufen. Er versucht Anfang und Ende einer Leitung zu verfolgen und verheddert seinen Blick in diesem Wirrwarr.
Die breitkrempigen Dachvorsprünge über den Fassaden, manche an ihren Unterseiten mit Holzschnitzereien verziert, lassen diese bunte Baugesellschaft behütet aussehen; aufgereiht und dienstbereit stehen sie, zur Straße geneigt, einladend, trotz der offensichtlich verriegelten Fenster und verrammelten Türen zu dieser Morgenstunde. Überall hängen späte Geranien aus ihren Kästen an Fenstern und Balkonen, erschöpft und Petunien recken sich nach oben ausgewuchert vom langen Sommer mit letzter Kraft.
Verwundert ist er über die Unmenge von Läden zu beiden Seiten der Straße. Es scheint ihm als ruhte jedes Haus auf einem Geschäft. Damals gab es hier nur, wenn er sich richtig erinnert, eine Cafeteria genannt „Bar Central“, eine Apotheke und ein Kolonialwarengeschäft in dieser einst so stillen verträumten Hauptstraße. Jetzt stößt er schon an der ersten Straßenecke an der er seinen Weg durch den Ortskern beginnt auf einen Blumenladen dessen Blumenständer und Regale leer und windschief vor dem Eingang stehen, daneben, fensterlos, eine Beerdigungsfirma wie er auf einer wuchtigen Schrifttafel liest über der Tür die aussieht als wäre sie schon lange nicht mehr geöffnet worden; daneben eine Boutique, die sich nur an den übergroßen, weißen Buchstaben auf der grauen Hauswand als solche zu erkennen gibt, weil Tür und Fenster verbarrikadiert sind und ein Haus weiter, das Café Ines, dessen einziger Rollladen herabgelassen ist; gegenüber eine Cafeteria, aus der zu dieser frühen Stunde schon die Bässe einer Popmusik wummern. Einen einzigen Gast sieht er, der, mit einer Tasse und einer Zigarette in den Händen, am Eingang herumsteht. Er muss dicht an ihm vorbeigehen und grüßt ihn mit einem Kopfnicken und einem Guten Morgen. Der Mann hebt seine Hand mit der Tasse in die Höhe, nickt und verzieht seine Mundwinkel nach oben. Das freute ihn. Er wird freundlich wahrgenommen! Der Mann, Bauer, Landarbeiter oder vom Bau, seinem Wind-und-Wettergesicht nach zu schließen ist jünger als er; im Rücken dieses Kaffeetrinkers die Glastür zum Lokal. Durch sie hindurch erblickt er den Wirt hinter der langen Theke, der ihn beobachtet; auch er ist zu jung für ihn - er muss nicht befürchten, von beiden erkannt zu werden. Das will er vermeiden. Er will hier nicht erkannt werden und sich nicht zu erkennen geben.
Weiter geht er, die Straße abwärts, an Waren vorbei, die in bodentiefen Schaufenstern untergebracht sind oder hinter kleinen Fenstern früherer Wohnzimmer, wahrscheinlich. Er spürt die Absicht der Ladeninhaber alles zu zeigen, was sie haben ohne mit Dekoration oder Design sich groß abgeben zu wollen, möglichst viel, gestapelt hinter Glas. Vorbei geht er an Werbetafeln, Plakaten und Zetteln an Türen, Fenstern und Glaswänden. Er geht an einer moosgrünen Fassade vorbei und versucht die glänzende Messingtafel an der Haustür zu entziffern, als sie sich öffnet und ein Mann in den Rahmen tritt. Sie berühren sich beinahe. Er macht einen Schritt zur Seite, murmelt:
„Guten Morgen“ und wirft einen Blick in das Schaufenster vor seinem Gesicht: Bürsten, Handschuhe, Dosen. Der Mann starrt ihn an, schlaftrunken:
„Wollen sie zu uns? Wir haben noch geschlossen.”
„Entschuldigung, mich hat ihr schönes Schild hier interessiert. Sie sind Psychotherapeut?“
„Mein Sohn. Er hat hier seine Praxis, aber sie ist noch geschlossen. Ab zehn Uhr dreißig ist er für sie da.“
„Nein, ich glaube ich brauche im Moment noch keinen Psychotherapeuten. Gibt es denn genügend Patienten für ihren Sohn in einem so schönen, ruhigen Ort und in solcher Umgebung? Ich denke, die Leute hier müssten alle glücklich sein oder wenigstens unbeschwert.“
„Ich darf ihnen keine Auskunft über unsere Patienten geben. Das werden sie verstehen. Aber das ist auch hier nicht alles Gold was glänzt. Sie verstehen? Sie können auch ohne Anmeldung täglich ab zehn Uhr dreißig kommen. Fürs Wochenende müssten sie sich allerdings vorher anmelden.“
„Wie schon gesagt, ich habe zurzeit keinen Bedarf. Es war nur ihr Schild, das mich anlockte.“
„Kommen sie immer, wenn ihnen danach ist.“
Er nickt mehrmals und tritt zurück und die Tür schließt sich. In diesem Moment blitzt der goldglänzende Türklopfer auf, getroffen von einem Sonnenstrahl, der wohl vom Fenster gegenüber reflektiert wurde. Die Sonne, tief im Osten, dringt noch nicht bis in diesen Häusergraben vor. Hin und wieder sieht er ihren Schein auf den höchsten Gebäudeteilen zwei, zweieinhalb Stockwerke hoch, auf dem blendenden Putz dort oben, der seinen Widerschein auf die Häuser gegenüber wirft, die dadurch leicht und heiter wirken, während ihre dunklen Nachbarn daneben noch zu träumen scheinen.
Er blickt zurück, die Straße hinauf, wo er seinen Morgengang begonnen hat. Die Musikcafeteria, mit dem Gast an der Tür und die anderen Läden verlieren sich in einem blauen Dunst. Der Streifen Himmel zwischen den Häuserzeilen ist von einem so kristallklaren Tiefblau, dass die Luft und die Schatten bis zum Boden von ihm durchdrungen sind.
Die Luft ist leicht und würzig. Er atmet sie tief ein und aus. Er will seine Lunge vom Hotelzimmermief reinigen, dem er vor kurzem entgangen ist. Ein paar Menschen sind jetzt mit ihm unterwegs: vor allem alte Frauen und Männer in Hausschuhen, geschäftig, mit einer Plastiktüte in der Hand, aus der Weißbrotstangen ragen. Sie scheinen sich alle zu kennen, so wortreich, wie sie einander begegnen. Sie sehen ihn im Vorbeischlurfen neugierig, fast freundlich an; das gefällt ihm. Er wird auch von ihnen wahrgenommen. Seine Befürchtung, ein Alter könnte sich an ihn erinnern, kommt ihm jetzt abwegig vor. Zu viele Jahre sind inzwischen vergangen.
Er hört seine Schritte auf den hellen, blauschattigen Bodenplatten, die sich zur Straßenmitte neigen und so eine Regenrinne bilden. Einen Gehsteig gibt es nicht. Die morgendliche Feuchtigkeit vom Anfang seines Wegs ist inzwischen getrocknet. Es könnte ein heißer, blauer Tag werden. Vor ihm stellt ein Mann im Overall, Waren auf den Boden, entlang der Hauswand seines Ladens: Blumenkübel, Klappstühle, Farbeimer, eine Farbentafel, Kunstblumen, Sämereien auf einem Drahtgestell, bunte Gartenfiguren aus glänzendem Kunststoff. Jedes Mal, wenn er vom Inneren auf die Straße tritt, mit neuen Sachen beladen, singt er die letzten Zeilen eines Liedes, das er wahrscheinlich im Laden begonnen hat, gekonnt, mit heller Stimme. Eine Nachbarin im Haus gegenüber legt Decken auf ihre Fensterbrüstung und beugt sich aus dem Fenster zu dem Mann hinunter:
„So lustig schon am Morgen! Noch von der Hochzeit gestern Nacht? Ich konnte kein Auge zumachen wegen des Lärms und dem Gesang die ganze Nacht hier vor meinem Fenster. Die Menschen nehmen heutzutage keine Rücksicht mehr. Hauptsache, sie haben ihren Spaß!“
„Ach, hallo Frau Nachbarin! Tut mir leid. Ich bin schon leise“, sagt der Mann zum Fenster hoch und flüchtet in seinen Laden.
Seine Waren und das Haus vertragen sich nicht. Vornehm streckt es sich zwei Stockwerke hoch bis zur weit vorgezogenen Dachtraufe, deren Sparren und Balken gedrechselt und bemalt sind. Die hohen Bogenfenster und Türen mit ihrem schweren Holzwerk lassen ihn an die ehemaligen Bewohner denken, die immer fein gekleidet, mit gemessenen Bewegungen, offensichtlich voller Besitzerstolz, ihres Ansehens in der Straße bewusst, hier ein und aus gingen. Wer sie waren hat er vergessen. Sie gaben sich zurückhaltend auch ihm gegenüber. Die mit Blattwerk und Ranken üppig verzierten Balkongitter scheinen ihm altes Kunsthandwerk zu sein; wertvoller sehen sie aus, als all die Plastiksachen zu ihren Füßen. Er sieht die Fenster gefüllt mit Kartons voller Plastikblumen, die ihre Köpfe an die Glasscheiben drücken, und Kunststoffnippes und bunte Geschenkschachteln. Selbst hinter den halbrunden Türstöcken sind Schachteln gelagert, aus denen ihr Blumeninhalt quillt.
Nach ein paar Schritten kommt er zu einem Hauseingang, der ringsum mit Girlanden und Blumen geschmückt ist, die müde ihre Köpfe hängen lassen: das Haus der Hochzeiter geht ihm durch den Kopf. Nun muss er sich immer wieder an die Hauswände oder in Türnischen stellen, um Lieferautos vorbeifahren zu lassen.
Die Bar Central, die er hier irgendwo vermutet, hätte er übersehen, müsste er nicht einem Kastenwagen ausweichen und sich an ein Glastor stellen, dessen giftgüne Eisenrahmen ihn irritieren. Er schaut durch die Scheibe, mit beiden Händen die Augen abgeschirmt, und sieht in dem schwachen Licht dahinter einen tiefgestreckten Raum und in seinem Hintergrund eine wuchtige Theke und darüber, in grünen Lettern: BAR CENTRAL. An den Wänden hängen große Bilder, wie in einer Ausstellung, und darunter sind Alutische aufgereiht, auf denen Alustühle stehen wie nach einem Hausputz. Ein Gitter im gleichen Grün wie das Tor, mit goldenen Kugeln besetzt, trennt die Bestuhlung vom Mittelgang, in dem Topfpflanzen abgestellt sind; zwischen ihnen entdeckt er eine offenbar schlafende Frau. Sie sitzt in sich versunken auf einem Stuhl, halb verdeckt von einem Oleanderstrauch. Wohl von seinem Schatten an der Tür aufgeschreckt fährt sie hoch und schaut ihn mit leerem Blick an. Er hebt abwehrend seine Hand zur Entschuldigung. Er möchte hier nicht störend auftreten. Dass er wahrgenommen wird von Leuten, die ihn früher nie gesehen haben dürften, kann ihm gefallen. Aber er will unter keinen Umständen auffallen und Gefahr laufen gar wiedererkannt zu werden.
Früher gab es keine Tische und Stühle in der alten Bar Central. Die Gäste standen am Tresen gelehnt oder im Raum, wie auf sich selbst gestützt. Viel Platz war nicht und wurde auch nicht vermisst. Das Ganze war ein Schacht aus rohem Mauerwerk, von ein paar nackten Glühbirnen beschienen. Die schwache Beleuchtung reichte aus, sein Glas zu finden und seine Gegenüber zu erkennen. In diesem Halbdunkel verbarg sich das Gerümpel ringsum oder konnte leicht übersehen werden. Hin und wieder wurden Kerzen aufgestellt, wenn der Strom ausfiel. Dann tanzten ihre Schatten an den Bruchsteinwänden. Der kleine Wirt arbeitete auch dann noch routiniert im flackernden Licht. Blind machte er die immer gleichen Handgriffe zum Zapfhahn, in die Getränkekisten am Boden, zu den Gläsern und Flaschen im schiefen Wandregal mit der bescheidenen Auswahl an Cuba Libre, Wein, rot und weiß, als Hausmarke, drei, vier Schnapsmarken. Sonst gabs nur noch Oliven im Blecheimer, den er unter der Theke hervorholte und Tüten mit Kartoffelchips im Karton auf der Thekenplatte. An eine Kaffeemaschine, Statussymbol jeder ordentlichen Bar, erinnert er sich nicht.
Da stand er oft nachdem er Anna aus dem Café Conde heimbegleitet hatte bis tief in die Nacht mit seiner Clique. Er wusste sie mochten ihn, er war gern gesehen. Sie luden ihn immer ein mit ihnen zu trinken, nie durfte er bezahlen; aber er schuldet ihnen keine großen Geldbeträge, hofft er jetzt, wo er in diesen fremden Saal späht. Wie sie aussahen und wer sie gewesen sind hat er vergessen. Sie waren alle im gleichen Alter; der Banker war älter, aber er passte sich ihnen an; nur weinte er oft, wenn er betrunken war, weil sie hier so verloren wären und vereinsamt und vergessen, wie er zu vorgerückter Stunde ohne jeden Zusammenhang von sich gab mit schwerer Zunge. Dieses Lamentieren störte sie nicht. Sie waren es gewohnt. Sie konnten ihn auch nicht beruhigen oder umstimmen. Er hörte mit seinem Gejammer von allein auf sobald er sich selbst so leidtat, dass er es nicht mehr ertragen wollte und anfing, sich zu beschimpfen, er sei selbst schuld an seinem Elend. Danach verfiel er in ein unverständliches Brabbeln, wurde still, stand steif an ihrer Seite und tatsächlich rollten Tränen über sein Gesicht, das ganz grau wurde. Da erbarmte sich immer einer von ihnen und legte seinen Arm um ihn. Er konnte das nicht, diese Nähe suchen, aber er tat ihm auch leid. Er erinnert sich so deutlich an ihn, weil er einmal festgestellt hatte er sähe wie Humphrey Bogart aus, wenn seine Augen nicht verheult waren und sein Gesicht nicht so grau wurde. Er lebte in seinen mittleren Jahren allein. Das wusste er von seinen Klagen, keine Frau wolle ihn. Das verstand auch er nicht, denn er sah gut aus, hatte einen soliden Job und gutes Einkommen und vielleicht hätte er mit einer Frau weniger getrunken. Er hatte keine Ahnung, wo seine Wohnung lag und was er außerhalb seiner Bankarbeit trieb. Das schien das Geheimnis ihres langen, ungetrübten Zusammenhalts zu sein, dass sie sich oft am späten Abend hier einfanden, wie zufällig, zur gleichen Zeit, am gleichen Platz, aber keinen weiteren Kontakt pflegten. Begegneten sie sich gelegentlich auf der Straße grüßten sie, nickten, hoben die Hand, aber mehr als ein Hallo wurde nicht gesagt. Bevor sie aus der Bar gingen sangen sie vielstimmig und er spielte Mundharmonika dazu in freier Improvisation, bis der Wirt - er kommt nicht auf seinen Namen - die spärliche Beleuchtung einfach abstellte, denn er war zu schüchtern, um zu rufen:
„Haut jetzt endlich ab!“
Frauen sah er hier nie oder sie hinterließen keinen so tiefen Eindruck, dass er sich an ihre Anwesenheit erinnern müsste; er hatte ja auch nur Augen für Anna. Der Landarbeiter, der manchmal in ihrer Nähe am Tresen stand, gehörte nicht zu ihnen. Es gab einen ausgeprägten Standesdünkel unter ihnen, vielmehr bei den anderen. Er ahnte nichts davon, bis er einmal zu dem Arbeiter sagte, er wolle auch auf dem Feld arbeiten. Da meinte der dann würde er nicht mehr dazugehören, dann würde die Clique ihn schneiden. Obwohl die Freunde jedes Mal schräg schauten, wenn er sich zu dem Landarbeiter stellte, redete er mit ihm, der älter war und ziemlich ernsthaft und den er nie lachen gesehen hat. Er hatte ein Gesicht, das er gern betrachtete; es strömte so etwas wie Vertrauen und Teilnahme aus. Einmal sagte der Landmann zu ihm:
„Du gehst viel wandern. Ich sehe´ dich manchmal, wenn du über die Felder läufst schon von weitem. Beim nächsten Mal komm´ doch vorbei. Wir könnten was zusammen trinken!“
Nach einem langen Stehen am Tresen verabredeten sie einen Tag und einen Ort in der Ebene. Einige Tage danach traf er ihn wieder in der Bar. Der sagte:
„Du bist nicht gekommen. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe früher mit der Arbeit angefangen, damit wir mehr Zeit hätten. Ich habe Wein und Brot und Schinken mitgebracht!“
Er war tief betroffen und beschämt. Er hatte nicht geglaubt, dass die Verabredung ernst gemeint war. Hier wurde soviel gesprochen und versprochen und nicht gehalten, an der Theke, besonders nachts! Der Landarbeiter sprach nicht mehr mit ihm. Er sah ihn nicht mehr in dieser Bar. Er ging ihm aus dem Weg. Seinen Namen hat er vergessen
Einmal wurde er zur Hintertür gewunken. Der Wirt - er kann sich einfach nicht an seinen Namen erinnern - hatte Rebhühner geschossen, was er nicht durfte, und in einem hohen Topf heimlich zubereitet; der stand auf einem Hocker mitten im Raum. Um ihn saßen bereits drei, vier Esser, die mit langen Gabeln im Fleisch stocherten. Er erkannte sie nicht. Die nackte Glühbirne, die dicht über dem Topf hing, blendete; ansonsten war es dunkel um sie. Auch er bekam eine lange Gabel in die Hand gedrückt und wurde auf einen Holzklotz zwischen die anderen gewiesen. Er sah einen Korb mit Weißbrot und mehrere Flaschen Rotwein neben dem Topf. Schweigend wurde gegessen und ab und zu ein Laut zum Zeichen großer Zufriedenheit von sich gegeben. Die Mitesser schoben ihm immer wieder besonders gute Fleischbrocken zu, wie sie sagten. Er, der kein Fleisch mochte, schon gar nicht diese schwabbelige Gehirnmasse, tat sich schwer seine Befriedigung zu zeigen.
Das war, als er längst befreundet war mit dem Wirt, ein stiller, kleiner, geschäftiger Mann und seine besten Gäste. Die hatte er in der zweiten Nacht seiner Ankunft im Ort hier angetroffen. Sie hingen schon schwer am Tresen und hörten einem Mundharmonikaspieler zu, seiner quietschenden Musik. Er bat um das Instrument und musizierte vor ihnen, die in laute Begeisterung ausbrachen. Danach gehörte er zu ihnen in der Bar Central, das heißt, wann immer er am späten Abend hier hereinkam, standen sie schon da und begrüßten ihn mit Hallo und breitem Grinsen und Schulterklopfen. Oft standen sie dann solange zusammen, bis sie die Letzten waren, die durch die schlafenden, düsteren Gassen nachhause gingen. An Straßenbeleuchtung erinnert er sich nicht. Manchmal, wenn sie noch ein Stück gemeinsamen Wegs durch die Dunkelheit nahmen, klopfte der Bankmann an das helle Kellerfenster der Bäckerei und sein Freund öffnete und reichte ihm Stangen Weißbrot auf die Straße und rief jedes Mal das gleiche von unten herauf:
„Anständige Leute schlafen oder arbeiten jetzt, und ihr Saufköpfe habt nichts anderes zu tun, als sie zu stören“, und lachte.
Ihr Freund nahm das Brot entgegen, brach es sofort und verteilte es unter ihnen und sie aßen die heißen Stücke auf der kalten Straße bevor sie sich endgültig trennten. Den Gang danach, allein durch die dunklen, schweigenden Gassen, bei dem der Wind aus dem Osten zu seinem einzigen Begleiter wurde und er die schlafenden Menschen hinter den schemenhaften Hausfassaden fühlte, in ihrer nächtlichen Wärme und Geborgenheit, und er, der Einsamste, Verlorenste und Größte war. Diesen Gang hätte er nicht ertragen ohne den Wein in sich und ohne den Blick nach oben zur Milchstraße, zu diesem überquellenden Funkeln in den klaren Nächten der Hochebene, wo er sich dem Himmel näher fühlte, manches Mal. Wenn er dann in sein Zimmer im Kloster angekommen war, durch das Eingangsportal, das eigens für ihn angelehnt stand, und sich im Kalten und Dunklen entkleidete und seine Sachen auf den einzigen Stuhl ablegte und dann unter die dicke Wolldecke seines Betts kroch und noch dem Wind zuhörte, der draußen pfiff, wimmerte und ächzte, dann fühlte er etwas, wie nie zuvor, das vielleicht Glück war, überlegte er.
Er hat ihr Aussehen, ihre Gesichter, ihre Namen, ihre Herkunft, einfach alles vergessen.
Susanne hatte immer zu ihm gesagt:
„Das kommt davon, weil du dich für die Menschen nicht wirklich interessierst.“
Er antwortete dann:
„Nein, es liegt an meinen Augen. Ich schaue nie richtig hin.“
Er wendet sich ab vom Glasportal dieser modernen Bar. Seine Erinnerungen und das, was er jetzt hier vorfindet, passen nicht zusammen, ebenso wie auf seinem weiteren Gang: wo sich einmal ein ruhiges Wohnhaus an das andere anlehnte, da geht er jetzt von einem Geschäftsgebäude zum nächsten: ein Finanzberater, ein Schreibwarenladen, ein Gemischtwarenhandel, Metzger, Bäcker, Friseur, Juwelier, Korbverkauf, Kleider, Schuhe, Küchenwaren und so fort.
Zwischen zwei fein renovierten Apotheken mit weißem Stuck um Fenster und Türen und grünlackierten Fensterrahmen und Zierrat überall, eingezwängt die kleine, romanische, bräunliche Kirche: heller, als in seiner Erinnerung, sauberer kommt sie ihm vor, aber auch gedrungener. Das Rundportal vor ihm, darüber ein Figurenfries entlang der Stirnwand und schon der breite Dachvorsprung: sie ist niedriger als manches Haus hier und niedriger als die zwei Apotheken, die sie von beiden Seiten bedrängen. Er schaut hoch zum Fries und erkennt Gottvater in hellem Sandstein: breitbeinig und barfüßig sitzt er mit seinem Faltenrock im Kreis von Engel, Adler, Löwe und Stier, die sich dicht an ihn schmiegen, vielmehr an einen Rosenbogen, der um ihn gewunden ist. Er streckt seinen schön ziselierten Kopf aus der Rückwand, zu ihm nach unten geneigt; aufgereiht zu seinen beiden Seiten, zwölf Männer in langen Gewändern, von denen nur noch fünf ihre Köpfe behalten haben, und ihm scheint, als wollten einige wieder in die Steinwand zurücktreten, so verwittert wie ihre Körper sind.
Drinnen hatte er manche Messe mitgefeiert. Nein! In Nähe des Ausgangs stehend, eine passende Gelegenheit zum vorzeitigen Weggehen abwartend. Dann war er durch die sonntäglich menschenleeren Gassen, am Spalier der gelb, in den blauen Himmel lodernden Pappeln vorbei, ein Stück in die Ebene gelaufen und hatte seine Sonntagsgedanken hinausgetragen in die blaue Luft und kam zum Ende der Feier zurück und mischte sich unter die Menschen vor der Kirche und auf dem Platz. Freunde machten lachend Bemerkungen, dass er, während andere brav in der Kirche saßen, sich traute über die Äcker zu spazieren; aber das störte ihn nicht. Manchmal ging er werktags in die dämmrige Halle, setzte sich in eine der Bankreihen und hörte in die kühle Stille. Die Leere und die Rundbögen und das schwere Mauerwerk machten ihn sanft und er dachte, es würde schon alles gut werden und meinte sein neues Leben in dieser fremden, kleinen Stadt.
Jetzt, vor diesem Portal, denkt er es sei ein guter Anfang für seinen Gang in die Vergangenheit sich kurz in die Kirche zu setzten. Das blechbeschlagene Kirchentor ist verschlossen. Es gibt keinen Türgriff und keinen Seiteneingang. Er sucht einen Aushang, einen Hinweis auf die Öffnungszeiten und entdeckt stattdessen eine Inschrift aus Metalllettern an der Außenmauer: MUSEUM SANTIAGO; die Kirche ist ein Kunsttempel geworden! Da hat er keine Lust mehr; nicht einmal die Steinfigürchen im Portalbogen will er noch betrachten. Er wendet sich ab und geht die paar Stufen hinunter auf die Straße. Hier ist ihre schmalste Stelle. Sie zwängt sich zwischen den Stufen des Kirchenportals und einem herrschaftlichen Hauskasten hindurch. Der steht hoch aufgerichtet im weißen und gelben Putz mit zwei prächtigen, schwarzen Balkonfensterreihen und Mansarden und, zur Straße hin, mit hohen holzgerahmten Bogenfenstern hinter denen er Bankschalter, Geldautomaten und ein paar Personen erkennt. Dieses Herrenhaus erdrückt das Kirchlein beinahe. Die Morgensonne scheint auf die obere Hauspartie. Ihr Putz dort leuchtet und wirft seinen Lichtschimmer zu Kirchenfassade und Turm, der dadurch leicht und luftig wird und im flirrenden Himmelblau zu schweben scheint. Mit seinem kahlen, viereckigen Dastehen ist er entrückt dieser lockeren, bunten Konsumwelt zu seinen Füßen.
Er denkt an das Abendessen an Silvester, zu dem er damals in dieses Haus geladen war. Er kannte die Leute nicht, nur ihren Sohn, der nicht teilnahm, weil er verhindert sei, weil er bei seiner Verlobten in deren Familie feierte, wie sie im Laufe ihres Abends, mit offensichtlichem und für ihn unverständlichem Stolz berichteten. Er war den Umgang mit solch feinen, wohlhabenden Bürgern nicht gewohnt und erschrak, als ein Hausmädchen ihm die Tür öffnete und zu dem Ehepaar führte, das wartend wie auf einen hohen Gast, im Zimmer stand. Der Saal, in dessen Mitte sie dann zu dritt aßen, war voll edler Dinge. Er hatte den Eindruck, er würde nur zu besonderen Anlässen genutzt, so neu und geordnet erschien ihm alles. Er erinnert sich an einen Marmorkamin mit ausladendem Sims, der von zwei nackten, weiblichen Säulenfiguren getragen wurde, die er während des Essens immer im Blickfeld hatte, sobald er zwischen den beiden Gastgebern hindurchschaute. Ihre weiße, dralle, glattpolierte Nacktheit, neben dem Gesicht seiner Tischdame verwirrte ihn. Er erinnert eine hochglänzende Anrichte mit goldenen Beschlägen und darüber einen Wandspiegel im goldenen Barockrahmen, der so von der Wand hing, dass sich die Tischgesellschaft darin spiegelte. Wenn er während des Essens den Blick hob, sah er sich darin, schräg von oben, wie einen Fremden. Da waren ein ebenfalls hochglänzender Holzboden und, entlang der Wand und um ihre Tafel, mit rotem Samt gepolsterte Stühle mit holzgeschnitzten Rückenlehnen, auf denen er aufrecht und steif sitzen musste. Und die drei hohen Bogenfenster waren mit dicken, grünen Samtvorhängen bedeckt. Der Hausherr führte ihn nach seinem Eintreten zum Fenster und nahm einen der Vorhänge zur Seite und zeigte mit einer großen Geste, als wäre dies sein Werk, auf den Figurenfries der Kirche, zum Greifen nahe vor ihnen, in Höhe ihrer Augen, vom Licht aus dem Saal in ihrem Rücken erhellt, denn die Straße lag schon im Dunkel. Sie sahen Gottvater von oben auf seinen haarigen Scheitel. In der Deckenmitte über ihrem Tisch war ein mächtiger Kronleuchter, der in den Regenbogenfarben funkelte und den Raum sehr hell ausleuchtete. Trotzdem brannte ein mehrarmiger Kerzenständer inmitten des runden Tisches. Auf den ersten Blick verwirrten ihn die Menge und Anordnung der Gläser, des Geschirrs und Bestecks, was um