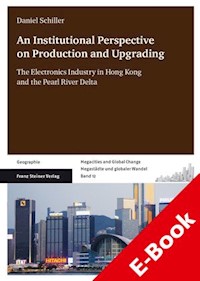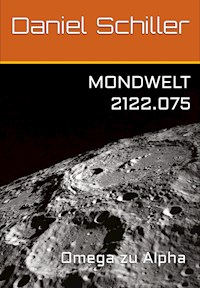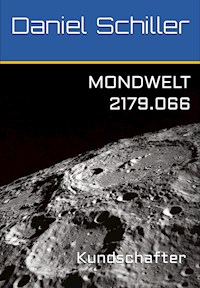Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gesunde Menschen bringen der Pharmaindustrie kein Geld! Fast jeder zweite in Deutschland leidet an Krebs. Die Kosten einer solchen Therapie und Nachsorge sind enorm, wodurch die Pharmaindustrie jedes Jahr mehrere Milliarden Euro verdient. Was wäre, wenn es bereits einen Durchbruch bei der Bekämpfung von Krebs gäbe und man ihn heilen könnte, aber niemand Interesse daran hätte, das Milliardengeschäft der Zytostatika-Therapien zu riskieren? Um einen solchen möglichen, von der Pharmaindustrie totgeschwiegenen Durchbruch handelt "Observiert – Freundschaft der anderen Art". Im Mittelpunkt steht der Jugendliche Christoph Meier, Auszubildender der Gesundheits- und Krankenpflege, dem immer mehr denkwürdige Ereignisse widerfahren. Wird er je herausfinden, wer dahintersteckt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Schiller
Observiert
Freundschaft der anderen Art
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Kapitel 1: Freund oder Feind?
Kapitel 2: Ein vertrautes Gesicht
Kapitel 3: Die erste Leiche
Kapitel 4: Unter strenger Beobachtung
Kapitel 5: Der tragische Fall ‚Frau Herrmann‘
Kapitel 6: Fredericks Lieblingsort
Kapitel 7: Verhängnisvolle Wahrheit
Kapitel 8: Wer ist Frederick?
Kapitel 9: Die Global Anti-Cancer Company – G.A.C.
Kapitel 10: Operation Observation
Kapitel 11: Abschiedsbrief
Nachwort
Impressum neobooks
Vorwort
Kennen Sie jemanden, der Krebs hat? Hatten Sie schon womöglich mit einer Krebserkrankung zu kämpfen oder gehören zu denen, die immer noch darunter leiden?
Dies trifft leider auf fast jeden Zweiten in Deutschland zu. Auch ich wurde in meinem privaten Umfeld des Öfteren mit dieser Krankheit konfrontiert und verlor dadurch einige meiner lieben Angehörigen.
Als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Intensivstation behandle und pflege ich schwerkranke Menschen allen Alters. Nicht wenige davon ereilt das traurige Schicksal, gegen Krebs kämpfen zu müssen.
Nach wie vor gehört dieser zu den nur schwer heilbaren Erkrankungen. Einigen wird überdies diagnostiziert, dass ihr Krebs unheilbar sei. Wenn das auf Sie zutreffen sollte, dann gebührt Ihnen mein allergrößter Respekt! Nichts würde ich mir für Sie mehr ersehnen, als dass es in naher Zukunft doch noch zu einem alles entscheidenden Durchbruch in der Medizin- und Krebsforschung käme.
Um einen solchen möglichen Durchbruch geht es in dieser nachfolgenden Erzählung. Ich hoffe, Sie und viele andere mit diesem Roman, inspiriert von meinen Erfahrungen und Erlebnissen als Gesundheits- und Krankenpfleger, aus dem schnelllebigen Hier und Jetzt zu entführen und in ein fesselndes Geschehen eintauchen zu lassen, in dem Sie sich möglicherweise selbst wiederfinden werden.
Bedenken Sie, dass alle Personen, Dialoge und Umstände in dieser Erzählung frei erfunden sind.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Kapitel 1: Freund oder Feind?
Das war‘s. Nun sitze ich hier und schreibe im Dunkeln ein paar Zeilen, wohlwissend, dass es meine Letzten sein werden. Ich habe die Hoffnung, dass jemand diesen Brief findet und meiner Nachwelt Bericht erstattet – jemand, der meinen Mord aufklären wird.
Ich habe große Angst. Angst vor dem, was auf mich zukommt. Ich will nicht sterben! Wenn ich doch nur wüsste, wer das alles war! Wer es auf mich abgesehen hat! Warum? Was haben meine Eltern verbrochen? Wer waren diese Leute im Auto? Wer?
War es Frederick? -
Ich dachte tatsächlich, wir wären wahre Freunde. Doch war das nur Schein? Konnte ich mich so in ihm getäuscht haben? Ist er wirklich zu so etwas Entsetzlichem fähig?
Wer kann mich bitte aus dieser Lage befreien?
Im Glauben daran, dass ich versteckt in dieser völligen Einsamkeit und Dunkelheit Zeit gewinnen kann, wird dieses nasse Stück Papier in meinen Händen, getränkt mit Tränen, das Letzte sein, was ich zurücklassen werde und kann.
So findet doch bitte bald meinen Mörder und helft, dass sich diese schrecklichen Ereignisse nicht woanders wiederholen!
Bitte! Das darf nicht noch einmal passieren!
Nanu? Was war das? Ich höre eine Tür. Ob ER das ist? Ich zittere. Ich spüre, wie er sich nähert, wie seine Schritte auf mich zukommen. Mein Puls und meine Atmung werden schneller. Eine Träne nach der anderen kullert meine Wangen hinunter.
Wenn ich doch bloß wüsste, was ich falsch gemacht habe! Ich würde um Verzeihung bitten, immer und immer wieder. Ich würde alles wiedergutmachen. Ich würde mich wirklich anstrengen. Doch das bleibt mir wohl verwehrt. Ich werde bestimmt unwissend sterben müssen.
Kapitel 2: Ein vertrautes Gesicht
Mein Name ist Christoph Meier. Ich wurde am 22. August 1995 in einer kleinen Stadt im Südosten Deutschlands geboren. Dort wohnte ich mit meinen Eltern in einer Doppelhaushälfte, die leider noch nicht ganz abbezahlt war.
Unser Haus bestand aus einem Flur, über den man durch sechs Türen weitere Zimmer erreichen konnte, drei auf jeder Seite. Gleich rechts nach dem Hauseingang befand sich das Wohnzimmer, gegenüber das Schlafzimmer meiner Eltern. Die rechte mittlere Tür führte in die Küche, die linke zu meinem Zimmer. Durch die beiden hinteren Türen gelangte man rechts ins Bad und links in eine Abstellkammer.
Meine Eltern hatten beide Jobs, die uns zwar kein wohlhabendes Leben ermöglichten, aber durch die wir uns dennoch hin und wieder etwas leisten konnten, wie beispielsweise einen All-Inclusive Urlaub in Dubai. Meine Mutter arbeitete Frühmorgens als Reinigungskraft in einem Supermarkt und mein Vater wurde bei einer Sicherheitsfirma angestellt.
Ich besuchte in meinem nicht sehr besiedelten und im Winter sehr tristen Ort die Grundschule und ging danach auf die einzige Realschule der Stadt.
Leider erlaubten mir es meine Noten nicht, das Gymnasium zu besuchen oder wenigstens das Fachabitur zu erlangen. Das brauchte ich aber auch gar nicht, denn für mein Vorhaben genügte mir meine befriedigende mittlere Reife.
Mein damals bester Freund, Tim Krügel, mit dem ich auch sechs lange Jahre auf die gleiche Schule ging und wir so gut wie immer nebeneinander saßen, hatte die fantastische Idee, als Anlaufstelle für das Schülerpraktikum der neunten Klasse das renommierte, städtische Altenheim zu wählen.
Man kann sich womöglich gut vorstellen, wie befremdlich mir die Arbeit mit älteren Menschen anfangs viel. Nicht nur, weil ich mein bisheriges Leben überwiegend mit Gleichaltrigen verbracht hatte, sondern auch, weil ich noch nie einen anderen Menschen beim Essen oder Gehen helfen musste.
Das Schwierigste für mich war aber der Toilettengang mit den Bewohnern des Altenheims, die sich danach nicht mal selbst das Gesäß säubern konnten und mir nun diese Aufgabe zukam.
Das Praktikum belief sich auf insgesamt zwei Wochen und dank meiner kompetenten Bezugsperson während dieser Zeit, konnte ich viel über den Umgang mit Menschen, Beschäftigungstherapien, Essenseingabe und auch Medikamentengabe lernen. So ist es zum Beispiel gerade bei bettlägerigen Bewohnern sehr wichtig, nach dem Essen oder Schlucken einer Tablette, den Mund auf Rückstände zu kontrollieren, da diese sonst in die Trachea, also Luftröhre, gelangen und diese dort schlimmstenfalls verschließen und zum Ersticken führen könnten.
Dieses Praktikum bestärkte mich in dem Entschluss, später einmal mit Menschen zu arbeiten.
Doch gab es einen Beruf, bei dem man nicht nur mit älteren, sondern auch mit jüngeren Menschen in Kontakt treten könnte, um diesen zu helfen?
Ja, diesen gab es! So schrieb ich noch während der Schulzeit eine Bewerbung an das örtliche Krankenhaus – das Forte-Klinikum. Allerdings reichte ein schlichtes Bewerbungsformular nicht aus. Ich musste eine Kopie meines Impfpasses beilegen, sowie meines Ersten-Hilfe-Ausweises. Auch wurde mir geraten, mich einer freiwilligen Blutuntersuchung zu unterziehen.
Nach ungefähr drei Wochen kam ein Schreiben des Forte-Klinikums. Ich sollte doch bitte zunächst ein einwöchiges Praktikum in Erwägung ziehen, hieß es darin. Sobald ich dann das Praktikum beginnen würde, dürfte ich mich auch bei dem Betriebsarzt des Klinikums vorstellen, der mit Freuden einen Gesundheitscheck und auch die freiwillige Blutuntersuchung durchführen würde.
Natürlich nahm ich dieses Angebot an und vereinbarte daraufhin ein Praktikum. Auch wenn ich dadurch noch nicht unbedingt Geld verdienen konnte, war es eine gute Möglichkeit, weitere Einblicke in dieser Berufswelt zu gewinnen.
Es war April 2012, als ich das Praktikum beginnen durfte. Manch einer hätte Mitleid bekommen und sich dabei denken können, wieso er nur seine wertvollen Osterferien dazu opferte, doch weil mich dieser Beruf so sehr fesselte, fiel mir das nicht sonderlich schwer.
Gleich zu Beginn des Praktikums hatte ich einen Termin beim Betriebsarzt Dr. Schieter. Er befand sich im Untergeschoss des Klinikums. Leicht zu finden war er nicht, allerdings war das Personal des Klinikums so nett, mich zu ihm zu führen.
Lange warten, wie normalerweise bei Ärzten üblich, musste ich glücklicherweise nicht. Ich wurde sofort zu ihm hineinbestellt.
Nach der Begrüßung nahm er meine persönlichen Daten auf und befragte mich über Allergien und chronische Erkrankungen, an welchen ich zum Glück nicht litt.
Im Anschluss sollte ich noch eine Urinprobe abgeben und mich einer Blutentnahme unterziehen. Beiden Untersuchungen stimmte ich zu. Nur wenige Stunden würde es brauchen, bis mein Blut analysiert würde, da ein Labor direkt in der Klinik errichtet wurde. Allerdings würde die schriftliche Analyse immer per Post nach Hause geschickt werden, da diese zu den persönlichen Daten der Mitarbeiter gehöre. So soll verhindert werden, dass Kollegen einen nicht gewollten Einblick in solche empfindliche Daten bekommen könnten.
Nach dreißig Minuten wurde ich bei Dr. Schieter entlassen und durfte nun auf meine Station. Es war die Station I4, eine Station der inneren Medizin. Das Forte-Klinikum besaß zwölf Stationen, davon sechs für die innere Medizin und sechs für die Chirurgie. Daneben gab es, wie ich schon anmerkte, ein Labor, eine Radiologie, eine Pathologie, eine kleine Intensivstation und auch einen OP, der nochmals über sechs Operationssäle verfügte.
Im zweiten und zugleich obersten Stockwerk des Klinikums angekommen, suchte ich meine Station auf. Die langen Gänge sahen für mich anfangs alle gleich aus. Es brauchte eine gewisse Zeit, bis ich mich an die Wege des Klinikums gewöhnte. Nach wenigen Minuten erreichte ich schließlich mein Ziel – die Station I4.
Die dortige Leitung, Schwester Erika, nahm mich auch sofort in Empfang, als ich mich mit meinem Namen vorstellte. Anscheinend wurde ich schon rege erwartet.
Schwester Erika zeigte mir daraufhin die Umkleidekabinen der Männer und gab mir passende Kleidung mit. Das strahlende Weiß durfte ich allerdings nicht tragen, dies war nur den examinierten Pflegekräften vorbehalten. Stattdessen bekam ich diese Uniform in einem satten Blauton. Sofort nutzte ich den Spiegel in der Männerumkleide und schoss ein Selfie. ‚Kommt bestimmt gut auf meinem Instagram-Account an‘, dachte ich mir.
Fertig umgezogen suchte ich wieder meine Station auf und meldete mich dort erneut bei Schwester Erika. Sie stellte mich daraufhin meiner Bezugsperson vor, dem Pfleger Oliver. Ein wirklich äußerst humorvoller Mitarbeiter, mit dem das Arbeiten sehr viel Spaß machte.
Oliver ist ein Mann mittleren Alters. Er besitzt kurze, gelockte Haare und trägt überwiegend einen Dreitagebart. Mit seinem kleinen Wohlstandsbäuchen sorgt er bestimmt auch heute noch für Spaß und Unterhaltung, zumal er sich nie zu schade dafür ist, auch hin und wieder über sich selbst zu lachen.
Oliver ging nun mit mir über die ganze Station und zeigte mir wichtige Räume, wie die Küche, das Gemeinschaftsbadezimmer, die Toilette, die Lagerräume mit den Schieberspülen und natürlich die achtzehn Patientenzimmer.
„Hörst du das?“, fragte mich Pfleger Oliver.
„Meinst du das Piepsen? Dann ja!“, antwortete ich.
Genau das meinte er. Er sagte, dass dies das Glockensystem der Station sei. Jeder Patient habe eine Art Fernbedienung über seinem Bett hängen, mit dem er ebendiesen >Schwesternruf< betätigen könne. Daraufhin ertöne ein Piepsen über der Station. Im Stationsstützpunkt könne man dann an einem Monitor direkt ablesen, welcher Patient diese Klingel benutzte.
Deshalb ging Pfleger Oliver mit mir, nachdem wir das Piepsen wahrgenommen hatten, in den Stützpunkt zurück und lasen auf dem Monitor über der Arbeitsfläche „Zimmer 14“. Olli, wie ich meine Bezugsperson auch oft nannte, und ich machten uns dann auf den Weg ins Zimmer vierzehn.
Ich wusste zuerst nicht, was mich dort erwarten würde. War der Patient in einer lebensbedrohlichen Lage? Hatte er irgendwo starke Schmerzen? Blutete er aus einer Wunde? So viele Fragen schossen mir durch den Kopf.
„So, Christoph. Klopfe an und öffne dann die Türe“, bat mich Olli.
„Meinst du, ich kann das schon?“, fragte ich skeptisch. Olli lachte nur und nickte mit dem Kopf. Also klopfte ich an und öffnete die Tür, genau so wie Olli es wollte.
„Guten Morgen, Frau Helm, wie kann ich Ihnen denn helfen?“ Zum Glück übernahm meine Bezugsperson das Wort, denn ich war schlichtweg mit der Situation überfordert. Olli sagte später, dass man oftmals nachfragen muss, wer denn im Zimmer geklingelt hätte, denn sobald zwei oder mehrere Patienten in einem Zimmer lägen, ist weder an der roten Lampe über der Zimmertür, die ebenfalls beim Betätigen der Glocke vor einem jeden Zimmer erleuchten würde, noch auf dem Monitor im Stützpunkt zu ersehen, wer darin Hilfe bräuchte. Doch bei Frau Helm war es ganz einfach, denn sie lag in einem Einzelzimmer.
Und als diese Patientin dann ihr Anliegen aussprach, schwanden meine ganzen Sorgen und Fragen, die mir durch den Kopf schossen, sofort dahin.
„Können Sie mir mal bitte das Kopfkissen aufschütteln? Ich liege hier so flach da!“
Als ich das hörte, fragte ich mich, ob man denn für solch eine Bagatelle wirklich hätte klingeln müssen, weswegen ich das auch Olli fragte, als wir wieder das Patientenzimmer verlassen hatten.
„Weißt du, Christoph. Die Patienten liegen hier oftmals nur wenige Tage, doch dann gibt es auch solche, wie Frau Helm, die viele chronische Erkrankungen haben und mehrere Wochen bei uns auf der Station ausharren müssen. Nach so langer Zeit, wo Frau Helm weder gehen, noch stehen und nur schwierig selbst essen und auf Toilette gehen kann, ist es für sie äußerst wichtig, ihr persönliches Reich – das Patientenzimmer – und ihren Erholungsplatz – das Patientenbett – so zu haben, dass sie sich am wohlsten darin fühlt. Da kann es schon mal stören, dass die Decke nicht überall gleich mit Federn gefüllt, oder das Kopfkissen zu flachgelegen ist. Wir als Pfleger sind zwar keine Buttler, aber uns liegt durchaus das Wohl der Patienten am Herzen. Das wirst du hier aber alles noch lernen und selbst erleben.“
Sehr gut, dass Olli mir das so ausführlich erklärte. Ich hätte womöglich sonst sehr bald Frust entwickelt und vielleicht das sogar dem Patienten spüren lassen. Doch nun weiß ich, was den Patienten zu schaffen macht. Es ist nicht immer die Erkrankung an sich, sondern oft die Situation, die diese mit sich bringt. Die Einschränkungen, die man dadurch erleiden muss - bestimmte Bewegungen, die einfach nicht mehr funktionieren, wie den Löffel zum Mund führen.
Für einen kurzen Moment hielt ich inne und fragte mich, ob ich das wirklich kann, so viele leidende Menschen zu sehen.
Es mag vielleicht hart klingen, aber schwerkranke, ältere Menschen zu sehen, war für mich persönlich leichter zu verkraften, als jüngere Menschen. Möglicherweise lag es an dem Gedanken, dass ältere Menschen schon mehr als die Jüngeren in ihrem Leben gesehen hatten.
Doch Leid ist selbstverständlich in jedem Fall und jedem Alter etwas Schlechtes, was man keinem wünscht.
„Wieso liegt Frau Helm eigentlich hier?“, fragte ich Olli danach.
„Sie hat eine chronische Rechtsherzinsuffizienz. Das bedeutet, dass ihre rechte Herzhälfte keine ausreichende Pumpfunktion mehr besitzt. Normalerweise hat die rechte Herzhälfte, die aus einem Vorhof und einer Kammer besteht, genau wie die linke Herzhälfte, genügend Kraft, das kommende Blut aus dem Körper in die Lungen weiter zu transportieren, doch genau dies ist bei der Rechtsherzinsuffizienz eingeschränkt. Es kommt sozusagen zum Rückstau des Blutes im Körper. Oftmals entwickeln dadurch die Patienten Ödeme, also Wassereinlagerungen, in den Beinen und das wiederrum behindert sie beim Aufstehen und Gehen. Darum liegt sie hier bei uns und profitiert hoffentlich von einer guten medikamentösen Therapie. Es gibt nämlich Medikamente und Arzneimittel, die das Wasser aus den Beinen ausschwemmen können und das Herz stärken, doch um die bestmögliche Dosierung der Medikamente zu bestimmen, müssen sie hier bei uns beobachtet werden und das kann unter Umständen Wochen dauern.“
Natürlich konnte ich als Neuling mit den ganzen Fachbegriffen nicht sofort etwas anfangen, doch Olli war die ganze Zeit stets bemüht, mir mit relativ einfachen Worten den Sachverhalt zwischendurch genau zu erklären und das gelang ihm auch überwiegend.
Ab da fing ich an, mich auch für die Medizin und medizinischen Berufe zu interessieren. Ich wollte mich auch unbedingt mit so vielem auskennen wie Olli und mein Wissen mit Patienten, deren Angehörigen und neuen Mitarbeitern teilen.
Olli ging mit mir anschließend in drei weitere Patientenzimmer, deren Glocken ebenfalls ertönten und zeigte mir, wie man mit Patienten passend kommuniziert und worauf man alles achten muss, wenn man das Zimmer eines Patienten betritt.
So ist es wichtig, auf bestimmte Gerüche richtig zu reagieren und auf die Sprache des Patienten, sowie deren Reaktionen zu achten. All diese Dinge könnten schon Anzeichen auf bevorstehende Risiken sein.
Dadurch, dass ich so beschäftigt war, Olli zuzuhören und von ihm zu lernen, verging die Zeit für mich rasend schnell und bekam gar nicht mit, dass es schon Mittag war. Kurz vor zwölf Uhr kam nämlich der Essenswagen mit den Patientenessentabletts. Es war die Aufgabe der Pfleger, diese zu verteilen und das Essen den mobilitätseingeschränkten Patienten zu verabreichen.
„Komm mit Christoph, wir gehen zu Herrn Kämpfer. Er liegt hier wegen einer Myokarditis, eine sogenannte Herzmuskelentzündung, bei uns auf Station. Normalerweise ist dies kein Grund, weshalb wir ihm beim Esseneingeben helfen müssten, doch leider litt dieser Patient auch schon bereits an einem Apoplex von vor zwei Jahren. Durch diesen Schlaganfall ist es ihm leider nicht mehr möglich, seine linke Körperhälfte zu bewegen. Auch sonst ist er durch sein hohes Alter von zweiundneunzig Jahren in seiner Bewegung stark eingeschränkt. Deswegen werden wir ihm heute beim Essen helfen.“
Ich stimmte Olli sofort zu und wir gingen zusammen zu Herrn Kämpfer.
„Mahlzeit, Herr Kämpfer. Christoph und ich wollen Ihnen gerne beim Essen helfen“, sprach Olli.
Mit etwas verwaschener und leiser, aber sehr freundlicher Stimme sagte Herr Kämpfer: „Das ist sehr lieb von euch, aber ich habe keinen großen Hunger.“
Olli entgegnete: „Sie müssen auch nicht viel Essen, nur das, was Sie können. Wir helfen Ihnen dabei.“
Danach setzten wir uns zu Herrn Kämpfer und schoben das Nachtkästchen mit ausklappbarem Betttisch über sein Bett. Wir stellten das Essenstablett darauf und bereiteten es mundgerecht vor. Es gab Kartoffelpüree mit püriertem Fleisch. Natürlich habe ich schon wesentlich Appetitlicheres gesehen, doch aufgrund seiner Vorerkrankungen und seines hohen Alters, sollte Herr Kämpfer vorwiegend weiche Kost zu sich nehmen.
Olli gab ihm dann einen Löffel in die Hand. Ich wunderte mich darüber. Immerhin sagte er vor ein paar Sekunden, dass wir ihm helfen würden und kurz darauf gab er dem Patienten den Löffel in die Hand, sodass er doch selbst essen müsste. Ich rechnete damit, dass wir ihm das Essen eingeben, aber dem schien nun nicht mehr so zu sein.
Olli stand Herrn Kämpfer bei und ermutigte ihn, selbst zu essen. Er half ihm Püree und Fleisch mit seinem Löffel aufzunehmen und den Löffel an den Mund zu führen. Dies dauerte ungefähr zwölf Minuten, bis Herr Kämpfer schließlich sagte, er wäre satt und zufrieden.
Abschließend gab er ihm zum Durchspülen des Mundes einen Becher Wasser und wir verabschiedeten uns freundlich.
Als wir aus dem Zimmer gingen und wieder Richtung Stationsstützpunkt liefen, fragte ich Olli: „Sag mal, wieso hast du ihn eigentlich selbst essen lassen? Wenn du ihn gefüttert hättest, dann wären wir bestimmt schneller fertig gewesen.“
Olli lachte wieder. Ich musste ihm wohl sehr naiv vorgekommen sein.
„Weißt du, Christoph. Zuallererst sag bitte nicht ‚füttern‘, wenn du bei einem Patienten bist. Wir helfen unseren Patienten, Essen aufzunehmen, beziehungsweise geben ihnen das Essen ein. ‚Füttern‘ klingt sehr unmenschlich, deswegen würde ich dieses Wort nicht gebrauchen.“
Ich nickte verständnisvoll.