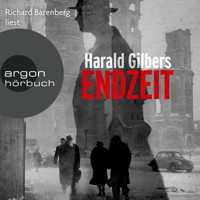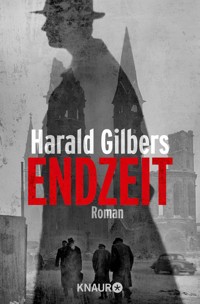9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kommissar Oppenheimer
- Sprache: Deutsch
Kommissar Oppenheimer ist untergetaucht und muss sich mit Schwarzmarktgeschäften über Wasser halten. Als dabei ein brutaler Mord geschieht, wird seine Unterstützerin Hilde verhaftet, denn der Tote ist ihr Ehemann, SS-Hauptsturmführer Erich Hauser. Zwar sind die beiden seit Jahren getrennt, doch Hilde als Regimegegnerin hätte ein Motiv: Der skrupellose Mediziner Hauser war KZ-Lagerarzt im Osten und hat dort Versuche an Menschen durchgeführt. Oppenheimer muss alles riskieren, um Hilde aus den Fängen der NS-Justiz zu retten. Schon bald findet er Hinweise darauf, dass ein mysteriöser Kult in den Mordfall verstrickt ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Harald Gilbers
Odins Söhne
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin, Januar 1945: Kommissar Oppenheimer ist untergetaucht und muss sich mit Schwarzmarktgeschäften über Wasser halten. Als dabei ein brutaler Mord geschieht, wird seine Unterstützerin Hilde verhaftet. Der Tote ist Hildes Ehemann, SS-Hauptsturmführer Erich Hauser. Zwar ist das Paar seit Jahren getrennt, doch Hilde als Regimegegnerin hätte ein Motiv: Der skrupellose Mediziner Hauser war KZ-Lagerarzt im Osten und hat dort Versuche an Menschen durchgeführt. Oppenheimer muss alles riskieren, um Hilde aus den Fängen der NS-Justiz zu retten. Schon bald findet er Hinweise darauf, dass ein mysteriöser Kult in den Mordfall verstrickt ist …
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
Nachwort
Literaturhinweise
Für Rüdiger Doppler
1
Konzentrationslager Auschwitz II, nahe Birkenau Donnerstag, 18. Januar 1945
Seit seiner Begegnung mit Hitler wusste er, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Doch Hauser hatte jetzt keine Zeit, über diese ironische Schicksalswendung nachzudenken. Seinen Koffer unter den Arm geklemmt, hastete er den Stacheldrahtzaun entlang. Die eisige Luft stach in seinen Lungen.
Mit einem Krächzen flatterte ein aufgeschreckter Rabe in den Morgenhimmel, nur um sich wenige Meter entfernt wieder auf dem Boden niederzulassen. Vermutlich hatte der Vogel das Fleisch der Getöteten gekostet. Nun wartete er geduldig, denn er wusste, dass hier einiges für ihn zu holen war.
So etwas wie Ordnung schien im Lager nicht mehr zu existieren. Überall, wo man hinsah, liefen aufgescheuchte Uniformträger umher, wurden Befehle gerufen und kurvten ziellos Fahrzeuge herum. Nur die Evakuierungskolonnenführer schienen nach einem bestimmten System zu verfahren, während sie die weiblichen Häftlinge zusammentrieben, um sie in kleinen Trupps abmarschbereit zu machen.
In der SS-Unterkunft hatte Hauser seine letzten Habseligkeiten in die Manteltaschen gestopft, denn im Koffer war kein Platz mehr dafür. Nun lief er an der Hauptwache vorbei zurück in Richtung Süden. Er folgte im Schnee seiner eigenen Spur. Das war immer noch besser, als über die geräumten Wege zu laufen, auf denen sich trotz der Kälte Schlamm gebildet hatte. Hauser hielt auf den nächsten Wachturm zu, weil er noch etwas zu erledigen hatte.
Er musste desertieren.
Es war zwecklos, sich noch etwas vorzumachen. Dies waren zweifellos die letzten Tage des Konzentrationslagers. In der vergangenen Woche, als die Winteroffensive der sowjetischen Armee begann, hatte sich Hauser bereits eine Strategie zurechtgelegt. In der Hektik des Aufbruchs durfte er sich nicht verwirren lassen. Seinem Plan zu folgen war die einzige Chance, sich unbeschadet aus der Affäre zu ziehen.
Hitlers Strategen hatten den jüngsten Vorstoß der Roten Armee bereits erwartet. Seit Ende November wurde im Konzentrationslager Auschwitz daran gearbeitet, die Spuren des Todeshandwerks zu verwischen.
Von Reichsführer SS Heinrich Himmler war der persönliche Befehl gekommen, die Krematorien zu demontieren. Die Motoren, mit denen die Luft aus den Gaskammern gepumpt wurde, kamen ins Konzentrationslager Mauthausen, die Rohrleitungen waren für Groß-Rosen bestimmt. Um die Sprengung der Krematorien und Gaskammern vorzubereiten, mussten Häftlingskommandos unzählige Löcher in die Wände schlagen. Die Verbrennungsgruben waren bereits zugeschüttet und bepflanzt worden.
Als die russische Offensive schließlich begonnen hatte, waren nicht wenige von Hausers Kameraden erleichtert. Die Zeit des Wartens war nun vorüber, die Anspannung vorbei.
Doch die raschen Gebietsgewinne von Stalins Armee wurden zu einer bösen Überraschung. Gestern Nachmittag traf schließlich die Meldung ein, dass der Feind dicht an das Konzentrationslager herangerückt war. Seitdem herrschte blanke Panik. Mit quietschenden Reifen waren in der Nacht Fahrzeuge vom Stammlager vorgefahren. SS-Sanitätsdienstgrade hatten den Auftrag bekommen, noch hastig die Akten aus dem Frauen-Krankenbaulager zu verbrennen.
Ein letztes Mal stieg Hauser die Treppe des Wachturms empor. Der SS-Schütze, der heute den Posten übernommen hatte, war ein Jüngling mit weichem Kinn, vielleicht gerade mal zwanzig Jahre alt. Hauser kannte ihn gut. Es war für ihn ein Kinderspiel gewesen, den Schützen zu beeinflussen. Und er hatte pariert, hatte ihm dabei geholfen, in aller Heimlichkeit seine Flucht vorzubereiten.
Hauser betrat die Plattform. Der Jüngling wandte sich um und salutierte. Dumpf knallten die Hacken seiner Stiefel aneinander. »Herr Hauptsturmführer!«
»Stehen Sie bequem«, antwortete Hauser mit einem Lächeln und bot ihm eine Zigarette an. »Ich möchte mich noch für die Sache mit dem Eisenbahnwaggon bedanken.«
»Es hat also geklappt? Und die Papiere?«
»Das war kein Problem. Gestern ist alles rausgegangen. Gerade noch rechtzeitig.«
Ein letztes Mal blickte Hauser auf die Baracken hinab. Es war der Block BIa, den man schon im November geräumt hatte. Die dort untergebrachten weiblichen Häftlinge und Kinder wurden in das ehemalige Zigeunerlager BIIe überstellt, das jetzt als Transportlager fungierte. Wegen des Schnees, der sich auf den Dächern der unbewohnten Hütten angesammelt hatte, wirkten die braunen Ziegelwände noch schmutziger, als sie es schon waren.
Plötzlich bemerkte Hauser, wie die Müdigkeit ihn erfasste. Die ganze Nacht über war er auf den Beinen gewesen, doch an Schlaf war jetzt nicht zu denken. Wenn er sich nicht verdächtig machen wollte, musste er zumindest noch die letzten Befehle ausführen.
Hauser überlegte. Nein, er hatte nichts vergessen.
Es war noch dunkel gewesen, als er vor ein paar Stunden mit dem Auto die fünf Kilometer ins Hygiene-Institut nach Rajsko gefahren war, um die eilig zusammengesammelten Forschungsunterlagen in seinem Gepäck zu verstauen. Dann hatte er die beiden gefüllten Flaschen aus ihrem Versteck geholt, sorgsam in Papier gewickelt und sie im Koffer zwischen den Akten so fest verkeilt, dass ihr kostbarer Inhalt geschützt war.
»Sind die Russen tatsächlich schon da?«
Die Frage des jungen SS-Schützen riss Hauser aus seinen Überlegungen. Der Jüngling blickte über die weite Landschaft nach Osten.
»Gestern haben sie Krakau angegriffen«, erklärte Hauser. »Kamen von Nordwesten. Unsere Stellungen wurden überrumpelt. Aus dieser Richtung hatten sie keinen Angriff erwartet. Das ist kein Rückzug mehr, was die Wehrmacht dort veranstaltet. Das ist Flucht. Generalgouverneur Frank ist bereits getürmt.«
Nur noch fünfzig Kilometer trennten sie von der Front. Auf einem ebenen Gelände wie hier war das eine erschreckend kurze Distanz. Hauser strengte seine Augen an, doch jenseits der Stadt Auschwitz konnte er nichts erkennen.
Stattdessen glaubte er, etwas zu hören.
Ein tiefes Grollen ertönte aus der Ferne. Schwere Motoren, Panzerketten. Am Horizont braute sich etwas zusammen. Und die Donnerwalze hielt genau auf das Lager zu.
Doch mit Erleichterung registrierte Hauser, dass sein Rückzugsweg über Kattowitz noch frei war.
Als er sich verabschiedete, fragte der SS-Schütze: »Sehe ich Sie dann in Groß-Rosen?«
Groß-Rosen war ihr Auffanglager, doch Hauser wusste, dass er dort nicht mehr auftauchen würde. Er hatte ein anderes Ziel im Sinn.
»Aber natürlich«, erwiderte er mit einem falschen Lächeln und ergriff seinen Koffer. »Bis später.«
Damit sein Auto in dem Durcheinander nicht gestohlen wurde, hatte Hauser es nahe der abgelegenen Kartoffellagerhalle geparkt.
Doch als er den letzten Wachturm passierte, blieb er überrascht stehen. Er blickte zum Auto und kniff seine Augen zusammen.
Da, jetzt wieder. Eine Bewegung.
Ein Mann in feldgrauer Uniform saß hinter dem Steuer.
Hauser entsicherte seine Handfeuerwaffe und hastete zu seinem Fahrzeug. Auf den letzten paar Metern verlangsamte er seine Schritte. Er duckte sich, damit er im Rückspiegel nicht zu sehen war. Sachte stellte er sein Gepäck ab und schlich dann mit gezückter Waffe um die Karosserie herum.
Die Gestalt im Auto hatte ihn noch nicht entdeckt. Nach vorn gebeugt hantierte der Mann unter dem Armaturenbrett. Er keuchte bei dem Versuch, den Anlasser kurzzuschließen. Wahrscheinlich war er auf die gleiche Idee wie Hauser gekommen. Er wollte sich davonmachen.
Hauser öffnete die Fahrzeugtür und riss seine Waffe hoch.
»Ich befehle Ihnen, auszusteigen«, brüllte er.
Der Mann zuckte zusammen. Als er die Feuerwaffe sah, hob er die Hände. Dem Rangabzeichen zufolge handelte es sich um einen Untersturmführer der SS. Hauser hatte diesen Kerl noch nie gesehen, doch in einem großen Lagerkomplex wie Auschwitz war es nichts Besonderes, unbekannten Gesichtern zu begegnen. Unzählige Personen waren hier beschäftigt, wurden hierherversetzt oder wieder abkommandiert. Auch Hausers Arztkollegen arbeiteten häufig nur wenige Monate im Lager und verschwanden dann auf Nimmerwiedersehen.
»Na, machen Sie schon!«, rief Hauser, weil sich der Mann immer noch nicht bewegte. »Ich bin Lagerarzt und habe eine dringende Fahrt!«
Umständlich kletterte der Untersturmführer aus dem Fahrzeug. Hauser zeigte mit dem Lauf seiner Waffe in die Richtung des Lagers.
»Und nun verschwinden Sie!«
Der Mann setzte sich in Bewegung. Vorsichtig schaute er über seine Schulter zurück. Die ersten Schritte waren zögerlich, doch dann rannte er davon.
Hauser überlegte, ob er ihm in den Rücken schießen sollte. Wenn ihn der Kerl später wiedererkannte, konnte es gefährlich werden. Er blinzelte zum nächsten Wachturm empor. Der Wächter war schon längst auf ihn aufmerksam geworden und hielt sein Gewehr bereit.
Betont ruhig steckte Hauser seine Waffe in den Halfter. Obwohl im Lager alles drunter und drüber ging, hätte es zu großes Aufsehen erregt, hier jemanden einfach so abzuknallen. Vor allem, wenn es sich dabei um einen Angehörigen der SS handelte.
Vorsichtig legte Hauser seinen Koffer auf den Beifahrersitz, dann stieg er ein und startete den Motor.
Er nahm die südliche Route nach Auschwitz. Das war zwar ein Umweg, doch auf diese Weise musste er nicht an der Hauptwache vorbei. Er wollte jetzt nicht mehr riskieren, angehalten zu werden. Obwohl die Straße schlecht geräumt war, trat Hauser aufs Gaspedal.
Mit etwas Mühe fand er den Weg nach Tschenstochau. Das letzte Mal war Hauser Ende September in diese Richtung gefahren, als er von Hitlers Begleitarzt Hanskarl von Hasselbach die Einladung bekommen hatte, ihn auf der Wolfsschanze zu besuchen. Er war ein guter Bekannter aus seiner Zeit in Berlin. Hoffnungsfroh war Hauser damals zur Wolfsschanze gefahren, denn schließlich sollte er den Führer persönlich kennenlernen.
Die erste Enttäuschung folgte bereits bei der Ankunft. Trotz des klangvollen Namens war die Wolfsschanze nicht viel mehr als ein unansehnliches und feuchtkaltes Betongebäude, Teil eines Bunkersystems, im Schutze des dichten Waldes erbaut. Im Vergleich zu Hitlers repräsentativem Berghof am Obersalzberg wirkte der Befehlsstand ärmlich.
Es hieß, dass sich Hitler nach dem Attentatsversuch im Juli wieder gut erholt habe. Doch das Bild, das ihm der Diktator dann auf der Wolfsschanze bot, erschütterte Hauser. Zwar konnte man an Hitlers klarem Blick erkennen, dass sein Verstand nach wie vor auf Hochtouren arbeitete, aber der Körper des Führers befand sich in einer desolaten Verfassung. Er ging gebeugt, und das Gesicht war gelblich verfärbt. Doch was Hauser am meisten schockiert hatte, war das Zittern der Hände und des linken Beins. Statt dem Hitler, den er von Fotos her kannte, war ihm ein vorzeitig gealterter Mann begegnet.
Später hatte Hauser erfahren, dass er mitten in eine Palastrevolution geraten war. Hitlers Begleitärzte versuchten, den Leibarzt Dr. Morell abzusetzen, weil dieser dem Führer neben unzähligen, selbst zusammengebrauten Präparaten auch bedenkenlos Pillen gegen Blähungen verschrieben hatte, in denen sich Strychnin befand.
In Hitlers Entourage hatte sich Morell nicht nur durch seine Nähe zum Führer unbeliebt gemacht. Es spielte auch eine Rolle, dass er es mit der Körperhygiene nicht so genau nahm, die irritierende Angewohnheit besaß, beim Essen ungeniert zu rülpsen, und nach dem Mahl stets laut schnarchend schlief. Morells Fettleibigkeit und dunkle Hautfarbe waren ebenfalls eine Irritation, denn er ähnelte in auffälliger Weise dem gehässigen Zerrbild, das Hetzblätter wie Der Stürmer vom jüdischen Erzfeind zeichneten.
Damals auf der Wolfsschanze hatte von Hasselbach Hauser um eine Einschätzung von Hitlers Gelbsucht gebeten. Den Verdacht, dass so viel Strychnin in den Pillen enthalten war, um durch eine Schädigung der Leber eine Gelbsucht auszulösen, konnte Hauser anhand der vorliegenden Daten nicht von der Hand weisen. Doch es war merkwürdig, dass die sonst üblichen Vergiftungssymptome bislang nicht aufgetreten waren. Zudem erschien ihm auch Morells Hypothese plausibel, dass eine Behinderung des Gallenflusses dahinterstecken könnte.
Hauser hatte von Hasselbach abgeraten, den Verdacht an die große Glocke zu hängen, doch sein alter Bekannter hatte zusammen mit anderen Begleitärzten den Stein bereits ins Rollen gebracht – mit dem Resultat, dass sie von Hitler entlassen wurden und Morell seine Position festigen konnte.
Doch auch für Hauser war der Ärztestreit ein schicksalhafter Moment gewesen, weil der Titan aus seiner Vorstellung zu einem Menschen geschrumpft war, einem Wesen, zusammengesetzt aus Muskelzellen, Nervensträngen, Knochen und Fettgewebe wie alle anderen auch. Und wie jedes Lebewesen war der Führer verletzbar. Obwohl Hitler gerade einmal Mitte fünfzig war, ließen sich die Zeichen eines fortschreitenden Zerfalls nicht ignorieren. Hauser wusste, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis der Körper des Führers aufgrund der immensen Strapazen seine Dienste versagen würde. Früher oder später würde Hitler sterben und sein Reich unvollendet hinterlassen.
Und was dann? Nachdem der auserkorene Kronprinz Heß nach England geflogen war, hofften gleich mehrere Parteigrößen, Hitler zu beerben. Gerüchten zufolge waren darunter auch Reichsführer SS Heinrich Himmler und Parteikanzleileiter Martin Bormann. Eine andere Alternative war Joseph Goebbels, dessen Propagandaministerium in den letzten Jahren immer mehr an Kompetenzen zugesprochen bekam. Doch Hauser interessierte das nicht mehr. Für ihn gehörte das alles zu einer Vergangenheit, unter die er einen Schlussstrich ziehen wollte.
Auf der schneebedeckten Straße überholte er mehrere Menschenkolonnen. Zerlumpte Gestalten, die von ihren Bewachern, das Gewehr im Anschlag, zur Eile angetrieben wurden.
Als sich in der Winterlandschaft Gebäude abzeichneten, blickte Hauser kurz auf seinen Plan. Es war die Stadt Myslowitz. Dort musste er die Abzweigung nach Breslau finden. Hauser verlangsamte das Tempo und kurbelte auf der Beifahrerseite die vereiste Scheibe nach unten. Unangenehmer Frostwind blies ins Auto, als er wieder beschleunigte, doch er wollte sichergehen. Er brauchte klare Sicht, damit er den entscheidenden Wegweiser nicht übersah.
Nachdem er in Myslowitz die Hauptstraße in Richtung Westen gefunden hatte, fuhr er den Rest der Strecke im Windschatten eines Truppentransporters. Etwa dreißig Kilometer hinter Breslau erreichte er schließlich die Abzweigung nach Striegau, in dessen Nähe sich auch das Konzentrationslager Groß-Rosen befand.
Es war mittlerweile dunkel geworden. Hauser bremste ab und blieb mit laufendem Motor am Straßenrand stehen. Im Lichtschlitz der abgedeckten Scheinwerfer ragten die Wegweiser auf.
Er überlegte, denn plötzlich waren ihm Zweifel gekommen. Bislang war noch nicht viel geschehen. Es gab keinen Hinweis darauf, dass er desertieren wollte. Noch konnte er alles rückgängig machen.
Doch wenn er jetzt geradeaus weiter in Richtung Cottbus fuhr, würde er die Brücken endgültig hinter sich abbrechen. Dann war er vor den eigenen Leuten nicht mehr sicher. Sie würden ihn jagen, alles daransetzen, ihn zu finden.
Andererseits konnte sich Hauser auch vorstellen, was geschehen würde, wenn er den anderen Fahrzeugen folgte und nach links abbog. Wenn in einigen Wochen die Rote Armee anrückte, würde man das Lager in Groß-Rosen ebenfalls evakuieren. Meter für Meter würden ihn Stalins Truppen vor sich hertreiben.
Bis nach Berlin.
Hauser richtete den Lichtkegel seiner Taschenlampe auf die Straßenkarte. Bis zur Reichshauptstadt waren es etwa dreihundert Kilometer. Er hatte erst die Hälfte der Strecke hinter sich. Doch um sich selbst zu retten, musste er unbedingt zurück nach Berlin, wo sich die einzige Person befand, die ihm jetzt noch aus dieser Klemme helfen konnte.
Hildegard von Strachwitz.
Hauser ließ die Kupplung kommen. Schlitternd fuhr er geradeaus. In diesem Augenblick gab es keine Gewissheit mehr darüber, was die Zukunft für ihn bereithielt. Ihn überkam eine dunkle Ahnung, dass es letztendlich auf seinen Tod hinauslaufen würde. Doch bis dahin wollte er kämpfen, versuchen, sich dem Unabwendbaren zu entziehen.
Also ließ er Niederschlesien hinter sich zurück. Das Wichtigste war nun, Hilde zu finden.
2
Berlin, Samstag, 20. Januar 1945 – Sonntag, 21. Januar 1945
Herr Meier, nehme ich an?«
Oppenheimer erstarrte. Sein Herz pochte bis in den Hals. Jemand stand dicht hinter ihm. Jemand hatte ihn angesprochen.
Meier? Da war doch was. Ja, das war jetzt sein Name. Er hieß nicht mehr Richard Oppenheimer, sondern Herrmann Meier. Obwohl er den neuen Namen schon seit fast einem halben Jahr führte, hatte er sich noch immer nicht an ihn gewöhnt.
Er hielt die Henkel der beiden Eimer so fest umschlossen, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten. Hatte er sich verdächtig gemacht? Hatte er sich verraten? Er wusste, dass er aufgeschmissen war, wenn es sich um einen Beamten vom SD oder von der Gestapo handelte. Auf dem mit Glatteis überzogenen Gehweg konnte er nicht einmal fortlaufen.
Viel zu spät wandte sich Oppenheimer um, doch als er die gedrungene Gestalt des Fragestellers erkannte, atmete er auf.
»Herr Nowak? Was führt Sie denn hierher?«
»Entschuldigung, aber Sie müssen mir helfen«, sagte Nowak. Er zitterte am ganzen Leib, doch sein unruhiger Blick verriet, dass es nicht an der kühlen Temperatur lag. Irgendetwas hatte ihn aufgewühlt. Es musste schon sehr ernst sein, denn sonst hätte er nicht das Risiko auf sich genommen, ausgerechnet ihn zu kontaktieren, einen Juden, der unter falschem Namen untergetaucht war.
Oppenheimer führte Nowak in die Einfahrt eines zerstörten Gebäudes. In seiner zweiten Existenz hatte Oppenheimer gelernt, extrem vorsichtig zu sein. Er wusste, was geschehen würde, wenn ihn jemand entlarvte. Sie würden ihn ins KZ schicken, in den sicheren Tod. Immer wieder tauchten Gerüchte über Vernichtungslager im Osten auf. Und die Äußerungen von Soldaten auf Fronturlaub bestätigten die schauerlichen Vermutungen. Erst vor ein paar Wochen hatten zwei aus Auschwitz entkommene Tschechen im Schweizer Rundfunk von riesigen Waschräumen berichtet, in denen die Häftlinge systematisch vergast wurden. Für Oppenheimer gab es keinen Zweifel, dass diese Schilderungen der Wahrheit entsprachen.
Sowie sie um die Hausmauer gebogen waren und Nowak sich unbeobachtet fühlte, platzte es aus ihm heraus: »Bei mir daheim ist ein Toter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie müssen mir helfen. Zur Polizei kann ich ja nicht.«
Oppenheimer fragte sich, welche Komplikationen es da geben mochte. Selbst für Zivilisten war der Tod mittlerweile zur Routinesache geworden. Doch schließlich verstand er. »Sie meinen, die Leiche ist bei Ihnen … da oben in der Kammer?«
Nowak nickte beklommen. Der Tote befand sich also in dem für Untergetauchte reservierten Geheimversteck. Das war tatsächlich ein Notfall, bei dem man die Polizei nicht gut hinzuziehen konnte.
»Aber woher haben Sie meine Adresse?«, fragte Oppenheimer.
»Frau von Strachwitz hat sie mir gegeben.«
Das hieß, dass Hilde sicher bereits vor Ort war. Das war gut. Als Ärztin würde sie wissen, was zu tun war.
»Natürlich«, murmelte Oppenheimer, »natürlich helfe ich Ihnen. Leider kann ich Sie nicht zu mir hereinbitten. Es würde auffallen. Die Nachbarn, wissen Sie.«
Nowak nickte betreten. Oppenheimer wies auf seine beiden Eimer, die randvoll mit dem sogenannten Oberflöz waren, einem Heizmaterial, das im Gegensatz zu Kohle ohne Marken erhältlich war. Oppenheimer hatte heute früh das Glück gehabt, zufällig beim Kohlenhändler vorbeizuschlendern, als eine neue Ladung geliefert wurde. Die letzten zwei Tage über hatte zwar Tauwetter geherrscht, doch tagsüber waren die Temperaturen wieder rapide gefallen. Zweifellos kam eine neue Kältewelle auf Berlin zu, und Oppenheimer wollte Vorsorge treffen.
»Machen wir es so«, schlug Oppenheimer vor, »ich bringe meine Eimer hoch, dann bin ich wieder da. Am besten, wir treffen uns am Zeitungsstand an der S-Bahn. Wir werden schon einen Modus finden.«
Damit ließ Oppenheimer Nowak zurück. Ohne große Anstrengung drückte er mit seiner Schulter die Haustür auf. In dem Mietshaus, das zwischen der Ringbahnstraße und den Gleisen der S-Bahn lag, waren die Grundfesten durch die Bombardierungen mittlerweile so verschoben, dass man die Tür nicht mehr verschließen konnte. Doch als Schutz vor der Kälte und dem Staub der Straße besaß sie noch einen gewissen Nutzen. Auch sonst war das Gebäude sehr marode. Selbst die massiven Steinbalkone auf der Straßenseite begannen schon zu bröckeln.
Kaum hatte Oppenheimer seinen Fuß auf die knarzende Treppe gesetzt, um zu seiner Bude hinaufzusteigen, als im ersten Stock auch schon Beate Dargus aus ihrer Wohnung herausschaute.
»Ah, Herr Meier!«, flötete sie. »Müssen Sie dieses Wochenende nicht zur Arbeit?«
Oppenheimer bemühte sich, freundlich zu bleiben, obwohl er unter der Last der Brennvorräte schwer atmete. »Dieses Wochenende nicht. Ich bin erst am nächsten wieder eingeteilt.«
Frau Dargus trat auf den Treppenabsatz. Oppenheimer schätzte, dass sie etwas jünger als er selbst war. Vielleicht Anfang vierzig. Normalerweise hätte sie im Arbeitseinsatz stehen müssen, denn vor einigen Monaten hatte Propagandaminister Goebbels in seiner Funktion als Reichsbevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz eine Urlaubssperre verhängt, von der nur Frauen über fünfzig Jahren und Männer über fünfundsechzig Jahren ausgenommen waren. Zuvor hatte die Regierung die Wirtschaft vollständig umgekrempelt. Die meisten Unternehmen stellten jetzt nicht mehr ihre angestammten Waren her, sondern fertigten – von Gummistiefeln bis hin zu schwerer Kriegsmaschinerie – alles an, was an der Front benötigt wurde. Doch weil die Rohmaterialien immer knapper wurden, hatte die Belegschaft in den Betrieben auch immer weniger zu tun. Zwar war es ihre Pflicht, sich zu Schichtbeginn an ihrer Arbeitsstelle zu melden, doch dort warteten sie zumeist untätig an stillstehenden Bändern auf den Feierabend.
Nur Frau Dargus konnte bis auf weiteres zu Hause bleiben, weil auf das Gebäude der Firma, für die sie gearbeitet hatte, vor einigen Wochen Bomben gefallen waren und man sie noch nicht neu eingeteilt hatte. Seitdem verdiente sie sich nebenbei ein paar Mark mit Näharbeiten.
Als Oppenheimer vor ihr stand, kam er nicht umhin, ihre lockere Bekleidung zu bemerken. Wie üblich trug sie nur ihren hellbraunen Morgenmantel aus einem seidenartig schimmernden Material. Möglicherweise kleidete sich Frau Dargus so leger, weil sie meistens in ihrer Wohnung an der Nähmaschine saß, aber Oppenheimer ahnte aufgrund ihrer wiederholten Annäherungsversuche, dass sie ihr Dekolleté nur deshalb entblößte, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.
Und tatsächlich waren alle Voraussetzungen für eine schnelle Affäre gegeben. Oppenheimer hatte ein Zimmer gemietet, das bereits mit Mobiliar ausstaffiert war, und Möblierte Herren wie er galten in der Regel als alleinstehend. Zu seiner neuen Identität als Herr Meier gehörte leider auch, dass niemand im Haus von seiner Ehefrau wissen durfte. Seit er vor einigen Monaten offiziell für tot erklärt worden war, lebten sie gezwungenermaßen getrennt voneinander. Weil Lisa eine sogenannte Arierin war, hatte die Ehe mit ihr Oppenheimer lange Zeit vor dem Abtransport ins KZ geschützt. Trotz unzähliger Schikanen war Lisa nie der Gedanke gekommen, sich scheiden zu lassen. Selbst die letzten Jahre, als sie mit anderen Leidensgenossen in einem Judenhaus untergebracht waren, hatte sie stoisch ertragen. Oppenheimer hoffte, dass er irgendwann die Möglichkeit bekommen würde, all die Nachteile, die Lisa wegen ihm in Kauf nehmen musste, wiedergutzumachen.
Doch vermutlich hätte die Tatsache, dass er insgeheim ein verheirateter Mann war, für Frau Dargus keinen großen Unterschied gemacht, denn in Berlin waren die Sitten unter dem Eindruck der täglichen Bombardements deutlich lockerer geworden. In den letzten Monaten hatte man unzählige Ehefrauen mit ihren Kindern auf dem verhältnismäßig sicheren Land untergebracht. Gleichzeitig waren die meisten Ehemänner, wie auch der Gatte von Frau Dargus, als Soldaten an der Front eingesetzt. Viele der alleingelassenen Ehepartner spürten angesichts des täglichen Sterbens einen großen Lebenshunger und waren allzu gern dazu bereit, die ständige Unsicherheit und Gefahr in den Armen eines Partners auf Zeit zu vergessen.
»Machen Ihnen diese ewigen Nachtschichten denn nichts aus?«, wollte Frau Dargus wissen.
Weil Oppenheimer es eilig hatte, antwortete er kurz angebunden: »Man kann es sich leider nicht aussuchen. Aber entschuldigen Sie.«
Er versuchte, sich mit den beiden Eimern um Frau Dargus herumzuschlängeln, ohne dabei auf ihren wogenden Busen zu schauen.
Es gelang ihm nicht.
»Ja, ähm, vielen Dank, Frau Dargus.«
»Aber Sie können mich doch Beate nennen.«
Oppenheimer nickte nochmals und brummelte etwas vor sich hin. Doch als er die letzten Stufen zu seiner Wohnung emporstieg, beschäftigte ihn bereits wieder der Gedanke an den Toten.
Eines war ihm bewusst: Obwohl er heute zur Abwechslung keine Nachtschicht hatte, würde er vermutlich erst sehr spät ins Bett kommen.
Und das lag nicht an Frau Dargus.
»Eine schöne Scheiße hat er uns da eingebrockt!«
Hilde blickte auf den in Decken gewickelten Leichnam hinab. Oppenheimer stand ebenfalls vor der Matratze und versuchte erfolglos, Nowak gegenüber Zuversicht auszustrahlen. Es ließ sich nur schwer überspielen, dass beim Anblick des engen Zimmers wieder die alte Beklemmung von ihm Besitz ergriffen hatte. Oppenheimer kannte diese Kammer nur allzu gut. Er konnte kaum glauben, dass er es fast neun Wochen hier drinnen ausgehalten hatte.
Der fensterlose Raum maß zwei mal drei Meter und war ursprünglich als Speisekammer gedacht. Weil lediglich eine nackte Glühbirne den Raum erhellte, konnte man zwischen Tag und Nacht nicht unterscheiden. Nur anhand der Geräusche aus den anliegenden Wohnungen und der jaulenden Sirenen bei einem Luftangriff war erkennbar, dass die Zeit voranschritt. Wenn es jedoch still blieb, dehnten sich die Sekunden, bis sie wie Minuten erschienen. Als er auf den Toten blickte, konnte er sich gut vorstellen, was er hier oben durchgemacht hatte.
Im Sommer vergangenen Jahres hatte Oppenheimer der SS bei der Aufklärung einer Mordserie geholfen. Obwohl der mit der Aufklärung des Falles beauftragte Hauptsturmführer Vogler sich im Verlauf der Zusammenarbeit als kooperativ erwiesen hatte, war es Oppenheimer stets bewusst gewesen, dass sein Leben keinen Pfifferling wert war. Außerdem wurde der Fall, in dem Oppenheimer ermittelt hatte, als Geheime Reichssache eingestuft. Somit bestand die Gefahr, nach der Aufklärung als unerwünschter Mitwisser umgebracht zu werden.
Letztendlich war ihm nichts anderes übriggeblieben, als nach dem Abschluss der Ermittlungen unterzutauchen, bis Gras über die Sache gewachsen war. Zum Glück konnte er sich dabei auf die Hilfe seiner Unterstützerin Hilde verlassen. Sie hatte dafür gesorgt, dass er bei einem gewissen Herrn Nowak einen Unterschlupf fand. Ohne ihre zahlreichen Kontakte zu Regimegegnern hätte er wohl kaum überlebt.
Trotz allem hatte er sich bei seiner Ankunft bei Nowak nicht vorstellen können, wie qualvoll die Zeit in dessen Speisekammer werden sollte.
Zu der drückenden Enge kam erschwerend hinzu, dass schon nach drei Wochen sein ganzer Pervitin-Vorrat aufgebraucht war. Damals hatte er das Mittel gebraucht, damit er seine ständige Todesfurcht vergaß, und dass sich damit auch Müdigkeit und Hungergefühl bekämpfen ließen, war für Oppenheimer ein angenehmer Nebeneffekt gewesen. Hildes Warnung vor dem darin enthaltenen Methamphetamin schlug er gedankenlos in den Wind, schließlich nahmen viele seiner Bekannten diese Tabletten oder besaßen eine eiserne Reserve. Und das, obwohl die Tabletten wegen der erhöhten Suchtgefahr mittlerweile rezeptpflichtig waren.
Auch sonst war das Aufputschmittel weit verbreitet, denn es wurde mittlerweile in den Berliner Temmler-Werken in riesigen Mengen hergestellt, um die Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Immer mehr Soldaten bekamen Kaltblütigkeit in Tablettenform verabreicht. Oppenheimer hatte gehört, dass in den Flakstellungen um Berlin sogar den Knaben Pervitin gegeben wurde, damit sie hinter den Geschützen wach blieben.
Der Umgang mit dem Mittel war von einer großen Sorglosigkeit gekennzeichnet, weil fast jeder die Nebenwirkungen der chemischen Substanz geflissentlich ignorierte. Erst als Oppenheimers Körper in dieser Kammer von Entzugserscheinungen gequält wurde, hatte in ihm ein Umdenkprozess stattgefunden. Doch obgleich er erkannt hatte, wie richtig Hilde mit ihrer Warnung lag, war es schwierig, die alten Gewohnheiten abzulegen. Oppenheimer war seitdem abstinent und hatte sich geschworen, keine Pervitin-Tablette mehr anzurühren. Trotzdem sehnte er sich gelegentlich nach ihrer Fähigkeit, der Realität ihre Schrecken zu nehmen.
Um nicht weiter an Pervitin zu denken, konzentrierte er sich wieder auf die verzwickte Situation mit der Leiche. Er fand es recht kühl in der Kammer.
Oppenheimer versuchte, die positive Seite zu sehen, denn bei diesen niedrigen Temperaturen musste man nicht befürchten, dass die Nachbarn allzu bald einen verräterischen Verwesungsgeruch wahrnahmen.
Einige Volksgenossen waren geradezu erpicht darauf, verdächtige Leute bei der Polizei oder direkt bei der Gestapo zu denunzieren. Dass der negative Kriegsverlauf und die ständigen Bombardierungen die Moral an der Heimatfront untergraben hatten, änderte daran nichts. Im Gegenteil, obwohl selbst Hitler-Anhänger das Ende der nationalsozialistischen Diktatur mittlerweile in Erwägung ziehen mussten, waren oftmals noch viele Rechnungen offen. Und quasi mit dem Rücken zur Wand stehend, wurden die übrig gebliebenen Nazi-Anhänger oft doppelt gefährlich. Schon der geringste Zweifel am Endsieg wurde als Defätismus gebrandmarkt, auf den die Todesstrafe stand. Nach dem missglückten Attentat auf Hitler wurden sogar Personen verhaftet, die nichts weiter getan hatten, als vor Zeugen laut »schade« zu sagen.
Doch der Tote war davon nicht mehr betroffen.
»Was war die Todesursache?«, fragte Oppenheimer.
»Wahrscheinlich ein Infarkt«, antwortete Hilde. »Er hatte Nitroglycerin-Kapseln bei sich. Also besaß er ein schwaches Herz. Da haben wir noch mal Schwein gehabt.«
Oppenheimer murmelte zustimmend.
Bestürzt starrte Nowak sie an. »Wie können Sie denn da von Glück reden?«, ereiferte er sich, allerdings wegen der dünnen Wände mit gesenkter Stimme. »Man will seine Menschenpflicht tun, bringt hier jemanden unter, aber mit so was rechnet man doch nicht. Eine Rücksichtslosigkeit ist das.«
Hilde verzog den Mund. »Ich bin sicher, dass er sich auch einen anderen Abgang erhofft hat.«
Oppenheimer erkannte an der eingefrorenen Miene von Nowak, dass er Hildes Gedankengänge erklären musste.
»Hilde« – er verbesserte sich – »ich meine, Frau von Strachwitz will damit sagen, dass dieser Herr glücklicherweise nicht an einer Seuche gestorben ist.«
»Dann würden wir erst recht in der Scheiße stecken«, ergänzte Hilde. Nowak rang angesichts dieser Kraftausdrücke nach Luft, doch weil Oppenheimer schon mehrere Jahre mit Hilde befreundet war, versuchte er nicht mehr, sie zu einer gewählteren Ausdrucksweise zu ermahnen. Es war ohnehin zwecklos.
»Wenn das eine Seuche gewesen wäre,« fuhr Hilde fort, »dann hätte ich einen Kammerjäger auftreiben müssen. Und zwar einen, der heimlich die Bude ausräuchert und uns nicht bei der Gestapo verrät. Aber das Problem haben wir jetzt nicht. Wir müssen ihn nur hier wegschaffen.«
Als Nächstes erklang wieder Nowaks weinerliche Stimme. »Aber wo sollen wir nur mit ihm hin?«
»Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten ihn in einem ausgebombten Haus deponieren.«
Oppenheimer schüttelte den Kopf. Zwar hatte man ihn gleich nach Hitlers Machtergreifung mit Inkrafttreten des Arierparagraphen als Mordkommissar entlassen, doch er wusste, dass sich das Vorgehen bei der Strafverfolgung seitdem nicht wesentlich geändert hatte.
»Das würde ich nicht machen«, sagte er. »In diesem Fall wird die Polizei erst recht vermuten, dass unser Toter ein U-Boot war, und dann müssen sie die Gestapo oder den SD ranlassen.« Diesen Spitznamen für die Untergetauchten hatte er von Hilde übernommen. Oppenheimer fuhr fort: »Wenn die Gestapo-Leute das Melderegister des zerbombten Hauses durchsehen und er dort nicht aufgeführt ist, wird die Suche auf die umliegenden Wohnblöcke ausgeweitet. Und dann könnte Herr Nowak erst recht in Verdacht geraten.«
Hilde wiegte den Kopf hin und her. »Wir können ihn immer noch in die Spree schmeißen.«
»Und nach ein paar Tagen kommt er wieder an die Oberfläche. Auch dann werden sie glauben, dass etwas vertuscht wird.«
»Verdammt, wir können ihn hier ja nicht einfach verrotten lassen«, sagte Nowak unerwartet heftig. Offenbar färbte Hildes rüde Ausdrucksweise allmählich auf ihn ab.
»Sie haben recht, Herr Nowak.« Wie immer, wenn sich Oppenheimer konzentrieren wollte, steckte er seine Zigarettenspitze in den Mund und kaute darauf herum. Er richtete seinen Blick nach unten und schritt auf dem Boden unsichtbare Muster ab.
Nowak war alarmiert. »Sie wollen doch nicht etwa rauchen? Hier drin ist kein Abzug!«
Hilde hielt ihn zurück. »Am besten, Sie beachten Herrn Meier nicht, wenn er so ist.« Damit meinte sie natürlich Oppenheimer.
Schließlich kam ihm die Erleuchtung. »Warum wählen wir nicht die einfachste Lösung? Ein paar hundert Meter von hier ist doch ein Park. Wir setzen ihn einfach auf eine Bank und fertig. Gibt es etwas, anhand dessen man ihn identifizieren kann?«
Hilde kniete nieder, um die Taschen des Toten zu untersuchen. Dabei murmelte sie: »Ich glaube nicht. Ich hatte ihm eingeschärft, alle Papiere zu vernichten. Sicherheitshalber.«
»Ist er beschnitten?«
Hilde hatte sich inzwischen vergewissert, dass er keine verräterischen Dokumente bei sich hatte, und richtete sich wieder auf. »Nein, er war ein waschechter Arier. Er besitzt einen Bauernhof draußen in der Nähe von Gatow. Oder besser gesagt, er besaß einen Bauernhof. Auf seinem Gut waren Ostarbeiter eingesetzt. Als einer von denen den Löffel abgegeben hat, war er so blöd, zu der Beerdigung zu gehen. Das hat ausgereicht. Jemand hat ihn verpfiffen, und kurz darauf kamen auch schon Polizisten an und wollten ihn hopsnehmen. Wahrscheinlich sind sie der Auffassung, dass ein Arier auf der Beerdigung eines Untermenschen nichts zu suchen hat. Zum Glück hatte er noch rechtzeitig Wind davon bekommen und ist in die Stadt getürmt.«
Oppenheimer nickte. »Wenigstens das war klug von ihm. Hier können sie ihn nicht so einfach aufspüren wie auf dem Land. Es ist viel einfacher, die Spuren zu verwischen.«
»Tja, vorausgesetzt, man kennt dort jemanden. Bekannte von mir haben ihn vermittelt. Ich wusste, dass sie zuverlässig sind und uns keinen Spion unterjubeln. Na ja, das hat ihm auch nichts mehr genützt …«
»Dann sehe ich keine Gefahr«, meinte Oppenheimer. »Er hat keine Papiere bei sich, und er ist eines natürlichen Todes gestorben. Herzanfall, kein Anzeichen auf Fremdeinwirkung. Das ist gut. Ich glaube nicht, dass die Polizei unter diesen Umständen seine Identität ermitteln will. Bei den vielen Bombenopfern sind die Leichenidentifizierungskommandos sowieso hoffnungslos überlastet. Nur, wie bringen wir ihn am besten hier raus?«
Für Hilde stand das bereits fest. »Wir warten auf den nächsten Bombenalarm«, erklärte sie.
In den vergangenen Tagen hatte es abends fast immer zwei Alarme gegeben, weil britische Moskitos im Anflug waren. Es war jetzt fünf Uhr nachmittags, also mussten sie vielleicht noch drei bis vier Stunden bis zum nächsten Alarm warten.
Nowak räusperte sich. »Da gibt es aber ein Problem«, sagte er. »Ich bin für meinen Treppenaufgang der stellvertretende Luftschutzwart. Hier oben schlagen recht häufig Stabbrandbomben ein. Das wissen Sie ja noch, Herr Meier. Früher kam dann immer der Luftschutzwart rein und kontrollierte, ob alles in Ordnung ist. Aber das war mir zu unsicher, wenn ich« – er blickte kurz auf den Toten –, »nun ja, wenn ich Gäste bei mir habe. Jetzt darf niemand mehr in die Wohnung außer mir. Aber es wird auffallen, wenn Alarm ist und ich nicht da bin.«
»Hilft alles nichts«, sagte Oppenheimer mit einem Schulterzucken. »Dann müssen ich und Hilde das eben allein übernehmen. Wir werden die Leiche wegbringen, sobald es dunkel ist, die Sirene ertönt und alle im Bunker oder im Luftschutzkeller hocken. Fertig. Aber so lang es noch hell ist, sollten wir eine Entscheidung treffen, welchen Weg wir nehmen, und ihn uns genau einprägen.«
»Na, dann mal los«, sagte Hilde und schritt als Erste aus dem Raum.
Der Rhythmus der Stadt Berlin hatte sich unter dem Eindruck der ständigen Luftangriffe verändert. Die Bewohner hasteten morgens zur Arbeit und abends wieder zurück, damit sie noch rechtzeitig nach Hause kamen, ehe die üblichen Nachtangriffe einsetzten.
Größere Menschenansammlungen waren selten geworden. Nur vor den Wasserpumpen und Ladengeschäften sah man viele Leute und natürlich auch während der Mittagszeit in den Gaststätten, wenn der aktuelle Wehrmachtsbericht des OKW im Radio übertragen wurde. Eine Versammlung der anderen Art waren die sogenannten Bunkerkrähen, die kaum noch einen Schritt von den Großbunkern mit ihrer Betonpanzerung wichen und stundenlang mit ihren Klappstühlchen und Luftschutzkoffern vor den Eingängen saßen – auf diese Weise konnten sie im Alarmfall die sichersten Plätze ergattern. Und dass man während der Wartezeit nach Herzenslust miteinander reden und die neuesten Gerüchte austauschen konnte, war für die Bunkerkrähen ein angenehmer Nebeneffekt.
Doch kaum jemand verirrte sich am späten Nachmittag in den Treptower Park. An jenem Tag ging dort nur ein einziges Paar spazieren, was möglicherweise daran lag, dass der frostige Wind und der dunkel verhangene Himmel nicht gerade einladend wirkten. Der Mann hatte seinen Hut aufgesetzt, und die nicht mehr ganz so junge Frau trug einen nach Mottenkugeln riechenden Pelzmantel. Kaum jemand wäre auf die Idee gekommen, dass dieses unauffällige Paar im Park nach einem Platz für eine Leiche suchte.
Oppenheimer blickte sich um. Es war gerade niemand in ihrer Nähe, also konnten sie reden.
»Du verwickelst mich immer in Sachen«, sagte er und seufzte.
»Ging nicht anders«, erwiderte Hilde. »Du bist der Einzige, der uns aus dieser Klemme raushelfen kann.«
»Ja, aber normalerweise stehe ich auf der anderen Seite des Gesetzes.«
»Was die Nazi-Schweine hier machen, hat doch mit Recht und Gesetz nichts mehr zu tun!«
Oppenheimer verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Du weißt, was ich meine.«
Hilde hakte sich bei ihm unter und atmete die frische Luft ein. Als sie einige Schritte gegangen waren, zwinkerte sie ihm zu. »Oder befürchtest du etwa, dass es dir zu sehr gefällt?«
»Ich glaube, da besteht keine Gefahr. Am liebsten wäre ich jetzt in meiner Bude.«
»Das klingt so, als hättest du dich schon eingelebt. Zum Glück hat alles geklappt.«
Oppenheimer nickte. Für einen kurzen Augenblick dachte er daran, was mit ihm geschehen wäre, wenn Hilde nicht immer einen Weg gefunden hätte, ihm aus der Bredouille zu helfen. Oppenheimer konnte sich nur schwer erklären, woher sie den Mut nahm, dem nationalsozialistischen System die Stirn zu bieten, doch er hatte keinen Zweifel daran, dass Hildes stark ausgeprägter Eigensinn dabei eine gewisse Rolle spielte. Obwohl er nicht gerade abergläubisch war, kam es ihm manchmal so vor, als sei es eine Fügung des Schicksals gewesen, dass er ihr über den Weg gelaufen war. Während der sogenannten Reichskristallnacht, als die Synagogen in Flammen aufgingen, die Ladengeschäfte jüdischer Eigentümer zerstört wurden und in den Straßen ein organisierter Pöbel Jagd auf die jüdischen Mitbürger machte, war Hilde als Einzige bereit gewesen, ihm Schutz zu bieten. Obwohl er für sie zu diesem Zeitpunkt noch ein Fremder gewesen war, der sich zufällig auf das Grundstück ihrer herrschaftlichen Villa verirrt hatte, war aus dieser Begegnung mit der Zeit eine Freundschaft geworden, auf die er sogar in den gefährlichsten Situationen zählen konnte.
Als sich Oppenheimer im vergangenen Spätsommer wieder halbwegs sicher gefühlt hatte, nahm er ohne viel Wehmut von Nowaks enger Kammer Abschied. Nach einem besonders heftigen Tagesbombardement, bei dem etliche Häuser in Tempelhof in Schutt und Asche gelegt worden waren, war er auf Anraten von Hilde dort zum Bezirksamt gegangen, um sich bescheinigen zu lassen, dass er ausgebombt worden war und sämtliche Personalpapiere verbrannt waren.
Beim Amt hatte solch ein Durcheinander geherrscht, dass Oppenheimer an einen vorläufigen Ausweis gekommen war, obwohl er lediglich eine gefälschte Mitgliedskarte der Musikkammer vorweisen konnte. Es war Hildes Idee gewesen, ihn als Korrepetitor auszugeben, weil er sich ohnehin für klassische Musik interessierte. Doch zum Glück war niemand auf den Gedanken gekommen, Oppenheimers nicht existente Fähigkeiten als Klavierspieler zu testen. Nur bei dem eingetragenen Namen hatte der Beamte gestutzt.
»Wer ist eigentlich auf die blöde Idee gekommen, mich Herrmann Meier zu taufen?«, fragte Oppenheimer. Diese Frage lag ihm schon länger auf der Seele.
Hilde legte ihre Stirn in Falten. »Ich glaube, es war der Drucker. Ein richtiger Lahmarsch, aber trotzdem ein guter Mann. Wie kommst du darauf?«
»Einen merkwürdigen Humor hat euer Drucker. Bei Ausweiskontrollen falle ich ständig auf. Jeder denkt sofort, Herrmann Meier sei ein politischer Kommentar zu Göring.«
Einem Gerücht zufolge hatte Reichsmarschall Herrmann Göring zu Kriegsbeginn gesagt, dass er Meier heißen wolle, wenn auch nur ein einziges feindliches Flugzeug das Reichsgebiet überfliege. Die britische Propaganda hatte dieses nicht belegte Zitat dankbar aufgegriffen, um den Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe bei seinem eigenen Volk lächerlich zu machen. Und es hatte tatsächlich gewirkt. Vor dem Krieg war Göring mit seiner volkstümlichen Art einer der beliebtesten Politiker unter den Nationalsozialisten gewesen, doch nach dem Einsetzen der Bombardierungen hatte sich das Blatt gewendet. Seit einigen Monaten konnten die feindlichen Flugzeuge praktisch jederzeit ohne ernsthafte Gegenwehr ins Reich einfliegen. Die Bewohner der zerbombten Städte schrieben dies vor allem Görings Unfähigkeit zu, und gleichzeitig wunderte man sich darüber, dass sich Hitler davor scheute, den Reichsmarschall zum Rücktritt zu zwingen.
Doch die Wut in der Bevölkerung blieb. Und mit ihr kam der Spott. Wenn der Spitzname Herrmann Meier fiel, wusste mittlerweile jeder, wer damit gemeint war.
Hilde kommentierte Oppenheimers Vorwurf mit einem Schulterzucken. »Wahrscheinlich hat der Drucker nicht dran gedacht. Ich glaube, er geht einfach nur das Telefonbuch durch. Wenigstens ist Herrmann Meier ein Name, den sich kein U-Boot freiwillig zulegen würde. Und das macht dich wieder unverdächtig.« Sie fing an, in sich hineinzukichern.
»Schön, dass dich immer etwas freuen kann«, grummelte Oppenheimer.
Doch Hilde war bereits wieder ernst geworden. Als sie sich vergewissert hatte, dass niemand zuhörte, murmelte sie: »Du hast gerade noch rechtzeitig den Absprung geschafft. Am Montag wollten sie aus allen Mischehen die jüdischen Ehepartner abholen. Hatten sogar schon Lastwagen zum Abtransport parat. Sie sollten bei Nacht und Nebel nach Theresienstadt verschleppt werden, aber auf den letzten Drücker wurde die Aktion abgeblasen.«
Als Oppenheimer die Frage durch den Kopf ging, wie viele seiner ehemaligen Mitbewohner aus dem Judenhaus noch leben mochten, wurde er traurig.
Hilde hatte seinen Stimmungsumschwung bemerkt und schritt schweigend neben ihm her. Nach einer Weile fragte Oppenheimer: »Woher weißt du das überhaupt? Diese Planungsdetails stehen doch sicher unter Geheimhaltung.«
»Ein Diplomat hat es mir gesteckt«, sagte Hilde knapp.
Oppenheimer nickte nur. Er hatte aufgehört, sich darüber zu wundern, in welchen Kreisen Hilde ihre Bekannten hatte. Als Ärztin und Offizierstochter schien sie über Kontakte in allen möglichen und unmöglichen Gesellschaftsschichten zu verfügen.
»Die Alliierten haben irgendwie Wind davon bekommen«, ergänzte Hilde. »Jedenfalls haben sie so viel Stunk gemacht, dass sich letztendlich das Auswärtige Amt einmischte. Vielleicht haben wir Glück, und die jüdischen Eheleute werden als Faustpfand für die Kapitulationsverhandlungen benötigt.«
Trübsinnig blickte Oppenheimer vor sich hin. Diese Gedankenspiele waren nur ein schwacher Trost. »Nun ja«, sagte er, »wer weiß, wie lang es noch dauert. Also gut, hast du schon einen passenden Platz für unseren Bekannten gefunden?«
Auch Hilde erinnerte sich jetzt wieder an den Grund ihres Spaziergangs und blieb stehen. »Hm, ich denke, am besten ist es hier am See. Das wirkt doch schön harmlos.«
Sie waren am Karpfenteich angelangt. Oppenheimer blickte auf die zum Eispanzer erstarrte Oberfläche. »Wir gehen besser auf die andere Seite. Sonst wissen sie gleich, woher er kommt.«
»Meinst du nicht, dass uns jemand überraschen könnte?«, fragte Hilde.
Kopfschüttelnd antwortete Oppenheimer: »Abends wird kaum jemand im Park sein. Bei Alarm ist man hier aufgeschmissen, so ganz ohne Bunker.«
An der Weggabelung bogen sie ab und liefen am großen Spielplatz vorbei. In der Vergangenheit war er häufig das Zentrum für Turnfeste und politische Kundgebungen gewesen, doch zwischenzeitlich nutzten auch Wehrmacht und Polizei die elliptisch angelegte Fläche als Übungsplatz. Allerdings waren dort in den letzten Monaten nur noch Volkssturm-Bataillone zur Grundausbildung erschienen. Für die meisten war jedoch die Zeit zum Exerzieren vorbei, jetzt wurde an der Front gekämpft, und zwar nicht zum Schein.
Einige Meter weiter sagte Oppenheimer: »Ich glaube, das hier ist eine gute Stelle. Wenn wir es bis hierhin schaffen, dann …«
Plötzlich verstummte er. Hilde warf ihm einen fragenden Blick zu, doch er nahm sie kaum wahr. Unruhig beobachtete er die Umgebung.
Als Kommissar hatte er gelernt, auf seine Intuition zu hören, und jetzt hatte ihn ein ungutes Gefühl erfasst. Instinktiv wusste er, dass sie beobachtet wurden. Oppenheimer war hier nicht sicher. Sie alle waren hier nicht sicher. Es konnte nur eine Falle sein.
»Ich weiß nicht.« Oppenheimers Stimme war jetzt ein heiseres Raunen. »Mir gefällt das nicht. Irgendwie …«
Er kam nicht weiter.
Aus dem Gebüsch drang ein lautes Rascheln. Eine Kreatur schoss in den Himmel und flatterte mit rauhem Gekrächze davon.
Als Oppenheimer dem schwarzen Schemen hinterherblickte, erkannte er, dass es ein Rabe war.
Erleichtert atmete er auf.
»Hast du es?«
»Moment.«
»Verdammt noch mal, hast du es jetzt?«
»Gleich«, zischte Oppenheimer und packte mit beiden Händen das Seil.
Wieder erklang Hildes flüsternde Stimme. »Wir drücken schon wie verrückt!«
»Jetzt«, sagte Oppenheimer und begann zu ziehen. Auf dem gefrorenen Grund war es nicht einfach, das Gleichgewicht zu halten. Abgesehen von seinem Tastsinn, hatte er keinen Anhaltspunkt, denn wegen den Luftschutzbestimmungen waren die Straßen in vollständige Schwärze getaucht.
Doch dann spürte er, wie sich am anderen Ende des Seils etwas bewegte. In der Finsternis glitt ein dunkler Gegenstand auf ihn zu. Es war Nowaks alter Schlitten.
Der von ihnen erhoffte Alarm zum Abendangriff war nicht gekommen. Nach stundenlangem Warten hatten sie schließlich die Entscheidung getroffen, den Toten um halb vier Uhr morgens zum Park zu bringen. Um diese Uhrzeit war die Wahrscheinlichkeit am geringsten, einem Passanten zu begegnen.
In Nowaks Keller stand eine Schubkarre, doch weil die Straßen jetzt spiegelglatt gefroren waren, schien der ausgemusterte Kinderschlitten seines Sohnes für den Leichentransport besser geeignet zu sein. Zur Tarnung war der Tote in alte Decken und Mäntel eingeschnürt, für die Nowak keine Verwendung mehr hatte, denn er ließ sie lieber im Keller vergammeln, als sie bei der alljährlichen Kleidersammlung des Winterhilfswerks abzugeben. Diesmal wurde zu Jahresbeginn zum sogenannten Volksopfer aufgerufen, einer speziellen Spendenaktion für den Volkssturm und die Wehrmacht. Obwohl sich Goebbels’ Propagandamaschinerie selten durch Feinsinn auszeichnete, erschien Oppenheimer die martialische Parole »Ein Volk steht auf«, mit der die Sammlung in Zeitungen und auf Plakaten beworben wurde, besonders unsinnig.
Der Schlitten blieb stehen. Oppenheimer atmete durch und schüttelte den Kopf. Es war nichts zu machen. Es wollte ihnen nicht gelingen, dieses blöde Ding aus der Zufahrt hinaus auf den Bürgersteig zu ziehen.
Er trat zwei Schritte zurück und spannte erneut seine Armmuskeln an. Da, etwas begann sich zu bewegen. Oppenheimer biss die Zähne zusammen. Er musste jetzt durchhalten.
Schließlich hörte er das Schaben der Kufen auf eisigem Grund. Sie hatten es geschafft, sie waren auf dem Bürgersteig.
»Jetzt nicht nachlassen«, flüsterte Nowak. »Immer weiter.« Er hatte sich in letzter Minute bereit erklärt, mitzukommen, da der Alarm ausgeblieben war und das Fehlen des stellvertretenden Luftschutzwarts nicht auffallen würde.
Am Seil ziehend, drehte sich Oppenheimer um. Mittlerweile hatten seine Augen Zeit gehabt, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Die kleine Nebenstraße, die sie entlanggehen mussten, war tückisch. An den Stellen, wo Bombentreffer Lücken in die Häuserfront gerissen hatten, war der Gehweg eine wahre Rutschbahn. Aber fast noch gefährlicher waren die Stellen, an denen die Häuser noch standen. Der von den Dächern gerutschte Schnee war dort zu einer vereisten Kraterlandschaft erstarrt.
Um sie herum war alles still. Das nächtliche Rauschen der Großstadt war in den vergangenen Monaten fast gänzlich zum Verstummen gekommen, da die meisten Autos und Motorräder an der Front eingesetzt wurden, und so fand Oppenheimer das Kratzen der Schlittenkufen und das gedämpfte Keuchen von Hilde und Nowak unerträglich laut.
Als sie zur breiteren Querstraße gelangten, wurde es heller. Da jetzt schwacher Mondschein durch die Wolken drang, konnte Oppenheimer auf den Hauswänden die allgegenwärtigen Durchhalteparolen erkennen. Auf dem Gebäude direkt gegenüber stand: Unser Lebenswille ist stärker als der Vernichtungswille der Feinde! Zwei Häuser weiter war Nie wieder 1918! an die Mauer gepinselt, eine Erinnerung an die Novemberrevolution in der Endphase des Ersten Weltkriegs. Damals hatte die Belastung durch die jahrelangen Kämpfe für die Auslöschung der Monarchie gesorgt. Die nationalsozialistischen Machthaber sahen dies als warnendes Beispiel und wollten mit aller Macht verhindern, dass Reichsfeinde an der Heimatfront einen ähnlichen Umsturz anzettelten. Oppenheimer bog nach rechts ab. Nur wenige Meter, und sie würden auf die breite Straßenachse treffen, die entlang der Spree nach Südosten führte und sie vom Treptower Park trennte.
Das Ziel bereits vor Augen, ging Oppenheimer schneller. Sie erreichten die Litfaßsäule, hinter der die ersten schwarzen Baumwipfel des Parks zu erahnen waren. Selbst aus den bunten Plakaten war in der Dunkelheit die Farbe gewichen.
Als Oppenheimer die Straße überqueren wollte, blieb er abrupt stehen. Ein Lichtschein.
Hastig wich er zurück und presste sich gegen die Litfaßsäule.
»Was ist denn los?«, raunte Hilde.
Oppenheimer winkte ihr zu. Doch als er sich daran erinnerte, dass sie ihn wahrscheinlich nicht sehen konnte, zischte er: »Ruhig!«
Vorsichtig umrundete er die Litfaßsäule, bis er das Licht wieder sah. Es war zweifellos eine Blendlaterne. Dahinter kamen zwei Schatten auf ihn zu. Es musste sich um eine Streife auf Patrouillengang handeln, die Plünderungen im Schutze der Nacht zu vereiteln suchten.
Langsam schlich Oppenheimer zu Hilde und Nowak zurück. Auch sie standen jetzt mit dem Rücken zur Litfaßsäule. »Soldaten«, flüsterte Oppenheimer. Als Nowak dies hörte, wollte er zurück in seine Wohnung laufen.
Oppenheimer packte ihn am Arm. »Nicht bewegen«, zischte er.
Sie hatten keine andere Chance, als im Schutz der Litfaßsäule zu warten, bis die Männer vorbeigegangen waren. Mit dem Schlitten umzukehren hätte Lärm verursacht, und die Soldaten befanden sich bereits in Hörweite.
Hilde ergriff Nowaks anderen Arm. Mit vereinten Kräften zogen sie ihn zur Plakatwand zurück. Nowak wand sich wie ein Aal, ehe er sich seinem Schicksal ergab.
Jetzt konnten sie deutlich die Schritte der Männer hören, das knarzende Leder ihrer Stiefel, die klappernden Karabiner.
Die beiden Soldaten überquerten die Seitenstraße und erreichten die Litfaßsäule. Dann verstummten die Schritte plötzlich.
Oppenheimer hielt den Atem an. Das konnte nur bedeuten, dass sie genau auf der gegenüberliegenden Seite standen. Angestrengt horchte er in die Nacht.
Nach einigen Sekunden vernahm er, wie mit lautem Geraschel ein Zündholz aus einer Schachtel entnommen und angerissen wurde. Das ausgeblasene Hölzchen fiel fast vor Oppenheimers Füße.
Dann ertönte eine gedämpfte Stimme. »Auch eine?«
»Haste etwa noch Tabak?«, fragte der andere Soldat.
»Nee, bin auf Brombeertee umgestiegen.«
»Lass mal lieber. Verdammte Kälte, ich muss ewig pinkeln.«
Karabiner klapperten. Vermutlich öffnete der Soldat die Knopfleiste seiner Hose. Dann begann es zu plätschern, gefolgt von einem zufriedenen Seufzer.
»Fertig jetzt?«, fragte der erste Soldat nach einer Weile.
Oppenheimer schreckte zurück, als er den hellen Schein sah. Das Licht befand sich vor ihm. Als Nächstes gelangten die Schemen der beiden Soldaten in sein Blickfeld. Gemächlich schritten sie an ihm vorbei und steuerten auf die nächste Hausecke zu. Oppenheimer glaubte, die nach oben gerichteten Läufe der geschulterten Gewehre zu erkennen.
Als sie sich entfernten, löste sich Oppenheimers Anspannung. Doch obwohl das Schlimmste vorbei war, hatten sie es noch nicht geschafft. Erst wenn die Soldaten aus ihrem Blickfeld verschwunden waren, konnten sie es wagen, die Straßenachse zu überqueren. Oppenheimer registrierte, dass sich auch die verkrampfte Gestalt von Nowak wieder entspannte. Er sank nach vorn und gab einen Stoßseufzer von sich.
»Sag mal, war da was?« Einer der Soldaten war stehen geblieben und wandte sich um.
Oppenheimer fuhr zusammen. Bestimmt hatten sie Nowak gehört. Er war zu laut gewesen. Hastig drängte Oppenheimer seine Begleiter um die Säule herum.
Der Schein der Laterne wischte über den Gehweg und verharrte wenige Zentimeter von ihnen entfernt auf den angeklebten Plakaten.
Im Schatten kauerten sie sich zusammen. Den Schlitten mussten sie zurücklassen. Jetzt lag der eingehüllte Leichnam am Fuß der Litfaßsäule – direkt unterhalb des Lichtkegels. Wenn der Soldat die Lampe nach unten senkte, war alles aus.
»Was gibt es?« Auch der zweite Soldat hatte sich umgedreht und starrte den vereisten Gehweg entlang.
»Ich habe doch was gehört.«
»Du spinnst.«
Der Lichtkegel vibrierte und glitt dann zur nächstgelegenen Hauseinfahrt. Oppenheimer atmete kurz auf. Offenbar war der Soldat nicht sicher, aus welcher Richtung das Geräusch gekommen war.
»Warte, jetzt wieder.«
Oppenheimer spitzte seine Ohren. Konnte er es gewesen sein? Hatten sie ihn etwa atmen hören?
Dann nahm auch er einen Laut wahr, allerdings aus der Richtung des gegenüberliegenden Geröllhaufens. Mauersteine rieben aufeinander, als jemand versuchte, über den unebenen Grund zu laufen. Als der Fremde abrutschte, erklang ein leiser Fluch.
Die beiden Soldaten hatten sich mittlerweile von ihnen abgewandt und richteten den Lichtkegel auf das zerstörte Gebäude.
»Hallo? Ist da wer?«
Die einzige Antwort waren hastige Schritte. Oppenheimer sah einen Schatten über den Schuttberg huschen.
Die Soldaten entsicherten ihre Gewehre und legten an.
»Stehen bleiben, oder ich schieße!«
Zwei Schüsse krachten. Dann rannten sie dem Flüchtenden hinterher.
Oppenheimer wartete, bis sie verschwunden waren. Er konnte es nicht fassen, wie amateurhaft der Plünderer vorgegangen war. Die Soldaten hätten ihn niemals aufgespürt, wenn er nicht so verdammt laut gewesen wäre. Doch es war sinnlos, darüber nachzudenken. Ein weiterer Schuss ertönte. Diesmal klang er gedämpft, was ein Zeichen dafür war, dass sich die Soldaten jetzt wohl in einem Hinterhof befanden.
Nun mussten sie es riskieren.
»Los!«, rief Oppenheimer, ergriff das Seil und zerrte den Schlitten hinter sich her.
Als er auf der spiegelglatten Straße fast das Gleichgewicht verlor, fluchte er still in sich hinein. Irgendwo hinter ihm keuchten Hilde und Nowak, doch Oppenheimer drängte immer weiter, wagte nicht, zurückzublicken.
Die vereisten Straßenbahngleise in der Mitte der breiten Straße waren in der Dunkelheit eine regelrechte Stolperfalle, und so dauerte es eine ganze Weile, bis es ihnen gelungen war, sie zu überqueren. Aber zum Glück waren zu dieser frühen Stunde weder Fahrzeuge noch Passanten zu sehen. Selbst die Streife blieb verschwunden.
Mit trockenem Mund hastete Oppenheimer weiter und dachte nicht mehr an den Plan, den sie am Nachmittag geschmiedet hatten. Er lief die kürzeste Route, einfach querfeldein, bis die Bäume sie umfingen.
Als sie nach einigem Umherirren im Gestrüpp schließlich mit dem Schlitten auf eine verschneite Wiese hinaustraten, hinter der die vereiste Oberfläche des Karpfenteichs zu sehen war, wusste Oppenheimer, dass sie entkommen waren.
In dem fast leeren Zugabteil der S-Bahn ließen sich Oppenheimer und Hilde auf eine Bank fallen. Er rieb seine brennenden Augen, doch wegen der blaugetönten Beleuchtung ließ sich ohnehin kaum etwas erkennen. Die einzige scharf umrissene Kontur war die dösende Schaffnerin direkt neben der Eingangstür.
Bebend vor Furcht hatten sie vor wenigen Stunden die Leiche auf der Parkbank deponiert und sich eilig davongemacht. Danach blieb ihnen keine andere Wahl, als bei Nowak den Rest der Nacht zu verbringen, bis auf der Ringbahn wieder die ersten Züge fuhren. In ruhigeren Zeiten, wenn kaum jemand unterwegs war, hatten die Deutsche Reichsbahn und der BVG die Frequenz der S- und U-Bahn-Züge zuletzt drastisch reduziert.
»Wie geht es Lisa?«, fragte Hilde.
Zum ersten Mal an diesem Morgen dachte Oppenheimer an seine Frau, und es wurde ihm wieder bewusst, wie sehr es ihn schmerzte, von ihr getrennt zu sein. Nur der Gedanke, dass es bis zur Kapitulation nicht mehr lang dauern würde, bot ihm ein wenig Trost.
Doch leider konnte man beim besten Willen nicht abschätzen, wie viele Monate es sich noch hinzog. Erst gestern hatten die Redakteure des englischen Feindsenders wieder einmal das Kriegsende in Aussicht gestellt – diesmal für Ende März. Aber im Äther waren schon so viele Ankündigungen eines kurz bevorstehenden Sieges erfolgt, dass Oppenheimer sie kaum noch ernst nahm.
Die geläufigen Zeiteinteilungen besaßen ohnehin keine Gültigkeit mehr, weil alle Ereignisse seit Kriegsbeginn ineinander übergingen. Ob etwas im vergangenen Monat oder vor mehreren Jahren geschehen war, ließ sich kaum noch unterscheiden. Sie waren Gefangene der Gegenwart, balancierten unentwegt auf der hauchdünnen Trennlinie zwischen Gestern und Morgen. Und bis zur endgültigen Kapitulation musste er wohl oder übel sein Leben ohne Lisa fristen.
Oppenheimer verzog bei diesen Gedanken seine Mundwinkel.
»Es ist nicht einfach«, antwortete er. »Aber was will man machen? Uns bleibt wohl nichts anderes übrig.«
»Es wird schon wieder.« Hilde legte ihre Hand auf die seine. Wortlos saßen sie so da und starrten aus dem Zugfenster. Allmählich zeichneten sich im Morgengrauen erste Konturen ab, doch die vorbeiziehenden Gebäude ließen sich noch nicht von den allgegenwärtigen Trümmerhaufen unterscheiden. Über einen wolkenfreien Himmel wie heute freuten sich die Bewohner der Geisterstadt namens Berlin schon lang nicht mehr, weil dies eine ideale Voraussetzung für Bombenangriffe war.
Schließlich kam der Perron der Station Tempelhof in Sicht. Oppenheimer erhob sich und machte sich zum Aussteigen bereit.
»Nächste Woche?«, fragte er.
»Wie üblich«, sagte Hilde und grinste müde. Sie war sitzen geblieben, weil sie noch eine Station weiterfahren musste. Oppenheimer nickte. Er besuchte sie an jedem letzten Sonntag im Monat. Früher hatten sie sich sogar wöchentlich getroffen, doch weil er nun untergetaucht war, versuchte Oppenheimer, seine alten Kontakte nicht so häufig wie sonst in Anspruch zu nehmen. So war es sicherer für sie alle.
Fast hätte Oppenheimer das Aussteigen verpasst. Obwohl er sich wie die meisten Leute mittlerweile jegliches Pathos abgewöhnt hatte, war ein Abschied etwas, das man hinauszögerte.
Doch als er hastig aus dem Zug sprang, machte er eine Entdeckung.
Aus der nächsten Zugtür war ebenso flink ein anderer Fahrgast ausgestiegen. Oppenheimer war überrascht, denn vorhin im Zug war er ihm nicht aufgefallen. Der Mann sah mit seinem Kurzhaarschnitt und dem schmuddeligen Wollmantel ganz gewöhnlich aus.
Nur sein Verhalten wirkte verdächtig.
Er blickte in Oppenheimers Richtung und bemerkte dann, dass er einen Fehler gemacht hatte. Anscheinend war er zu früh ausgestiegen. Sofort machte er kehrt und sprang in letzter Sekunde wieder in den Zug.
Als sich die Türen schlossen und der Zug wieder Fahrt aufnahm, verlangsamte Oppenheimer seinen Schritt und blickte den Wagen hinterher. Durch die Fenster konnte er für einen kurzen Augenblick das Gesicht des Mannes sehen. Als sich ihre Blicke kreuzten, stellte er an dem Gesichtsausdruck des Fremden fest, dass er ihn erkannt hatte.
Abrupt blieb Oppenheimer stehen.
Ein Schauer ging durch seinen Körper. War er aufgeflogen? Er kramte in seinem Gedächtnis, welchen Personen er in den letzten Jahren begegnet war, doch niemand ähnelte diesem Mann.
Er beruhigte sich mit dem Gedanken, dass er übertrieben vorsichtig war, weil er zu lang im Verborgenen gelebt hatte. Sicher sah er Gespenster, genauso wie gestern Nachmittag im Treptower Park. Der Fremde war wieder eingestiegen, also konnte er kein Interesse an Oppenheimer haben.
Oder verfolgte der Mann etwa ein anderes Ziel?
Ratlos machte sich Oppenheimer auf den Weg. Nein, er war nichts weiter als müde. Müde und überreizt.
3
Sonntag, 21. Januar 1945 – Dienstag, 23. Januar 1945
Hilde blickte aus dem Fenster. Zwei Stockwerke unter ihr spielten Kinder auf der Straße. In Berlin gab es etliche Familien, die sich erfolgreich gegen die Evakuierung ihrer Sprösslinge aufs Land wehrten. Die Bomben hatten den Kindern einen abenteuerlichen Spielplatz zurückgelassen. In den Ruinen und Kratern ahmten sie nach, was die Erwachsenen taten.
Mit ihren kleinen Schaufeln bauten sie Bunker.
Aber Hilde sagte sich, dass es immer noch besser war, als in den Trümmerbergen nach den Splittern von Granaten zu suchen und sich über die verschiedenen Bombenkaliber zu unterhalten.
Hilde beneidete sie um ihre Sorglosigkeit, als das Lachen durch das Fenster drang.
Obwohl von der Gestapo weit und breit nichts zu sehen war, blieb sie auf ihrem Posten am Fenster und starrte hinaus. Aus einem unerfindlichen Grund ahnte sie, dass die nächtliche Episode im Treptower Park noch ein Nachspiel haben würde.
Hilde befand sich in der kleinen Wohnung von Otto Seibold. Durch die Schlieren, die Ruß und Qualm auf den Fenstern hinterlassen hatten, konnte man bestenfalls erahnen, dass draußen ein strahlender Frosttag war. Hilde zog die vergilbten Gardinen wieder zu. Obwohl Seibold verheiratet und bereits in den Fünfzigern war, wirkte die Wohnung auf sie wie das Musterbeispiel für eine Junggesellenbude.
Im Gegensatz zu anderen hatte Seibold nichts dagegen unternommen, dass seine Familie aufs Land in Sicherheit gebracht wurde. Obwohl er danach dem Lotterleben anheimgefallen war, nutzten Hilde und ihre Gesinnungsgenossen seine Wohnung gern, weil man sich hier relativ unkompliziert treffen konnte.
»Sehen wir es doch realistisch«, sagte ihr Mitverschwörer Franz Schmude. »Gibt es für uns wirklich die Möglichkeit, noch weitere U-Boote zu ernähren?«
Nach dieser Frage riss sich Hilde vom Fenster los. Weil ihre Gesprächspartner wussten, dass eine unangenehme Entscheidung zu treffen war, vermieden sie den Augenkontakt mit ihr.
Wortlos setzte sie sich wieder auf ihren Platz und griff nach ihrer Blechtasse. Natürlich war nur Muckefuck darin, aber wenigstens war er heiß. Obwohl Seibold lediglich zwei Tassen und einen Kaffeelöffel zur Verfügung stellen konnte, hatte Hilde ihren eigenen Becher bekommen. Sollte damit demonstriert werden, dass man ihre Führungsrolle in der Runde nicht anzweifelte? Kopfschüttelnd ergriff Hilde das Wort.
»Ich kann einfach niemanden abweisen, wenn er tauchen will. Außer wenn ich denke, dass es ein Spitzel ist.«
»Aber es werden zu viele für uns«, sagte Seibold und runzelte die Stirn. Mit der Brille auf seiner Nase und dem Schnauzbart wirkte er wie ein Büroangestellter, doch in Wirklichkeit war er Apotheker. Das war ein Glück, denn auf diese Weise konnten sie die Untergetauchten zumindest mit den wichtigsten Medikamenten versorgen. Natürlich half es auch, dass Hilde keinerlei Skrupel besaß, Rezepte auf Phantasienamen auszustellen, wenn es der Sache dienlich war. »Wir können die Versorgung nicht mehr gewährleisten«, fuhr Seibold fort. »Es wächst uns über den Kopf. Schon so ist es schwer genug, genügend Lebensmittel zu bekommen. Die neuen Marken werden jetzt in immer größeren Zeitabständen ausgegeben. Ich habe Gerüchte gehört, dass die Lebensmitteltransporte wegen der russischen Offensive ausfallen könnten. Dann sind wir abgeschnitten. Unter diesen Voraussetzungen können wir unsere U-Boote wohl kaum durchfüttern. Und immer bei Bekannten zu schnorren ist auch keine Lösung. Was haben wir in der letzten Woche schon bekommen? Zwei neue Milchkarten, drei Fettmarken und fünf Marken für Brot. Das ist einfach zu wenig.«