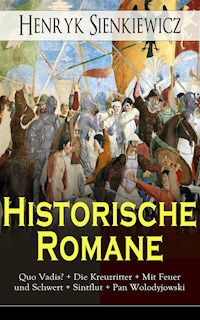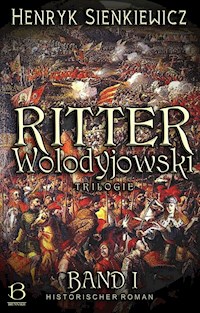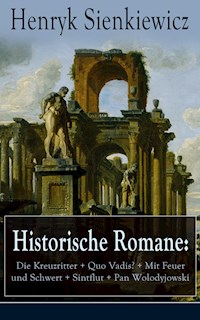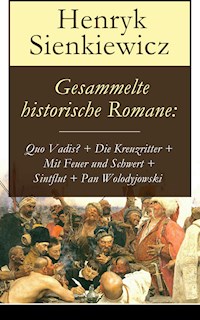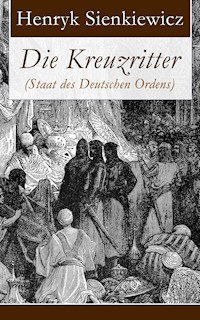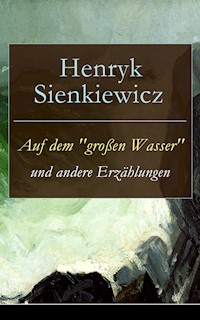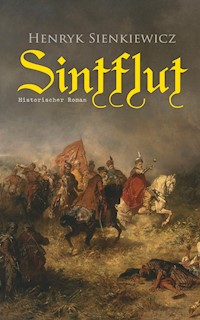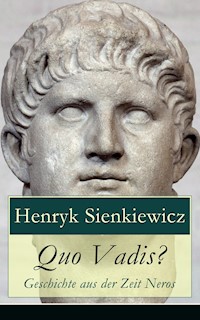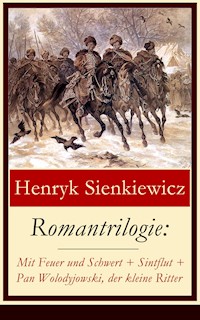Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman "Ohne Dogma" gehört zu der Gattung der psychologischen Romane: und sein Dichter tritt hier in Rivalität mit den bedeutendsten Meistern dieser Gattung aus der französischen Literatur: Daudet, Zola, Bourget und Balzac. "Unsre Dichter," so bemerkt der Held des in Tagebuchform gehaltenen Romanes über die Frau, die er liebt, von der er geliebt zu werden glaubt und die ihm widersteht, "geben ein ganz falsches Bild von den Frauen; sie sehen in jedem Weibe ein Rätsel, eine lebende Sphinx; aber tausendmal rätselhafter, tausendmal sphinxartiger sind die Männer; eine gesunde - nicht hysterische - Frau, ob sie nun gut oder schlecht, stark oder schwach sein mag, besitzt einen weit einfacheren, schlichteren Geist als der Mann; in allen Lebenslagen, zu jeder Zeit genügen ihr die zehn Gebote und werden von ihr hochgehalten, ohne Rücksicht darauf, ob sie sich diesen Geboten fügt, oder ob sie, ihrer schwachen Natur wegen, deren Vorschriften außer acht läßt."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ohne Dogma
Henryk Sienkiewicz
Inhalt:
Henryk Sienkiewicz – Biografie und Bibliografie
Ohne Dogma
Einleitung.
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Ohne Dogma, Henryk Sienkiewicz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN:9783849618599
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Henryk Sienkiewicz – Biografie und Bibliografie
Der bedeutendste poln. Romanschriftsteller der Gegenwart, geb. 1846 in Wola Okrzejska (Kreis Lukow, Gouv. Sedlez), verstorben am 15. November 1916 in Vevey (Schweiz). Studierte in Warschau Philosophie, trat schon 1872 mit seiner ersten humoristischen Novelle: »Niemand ist Prophet in seinem Vaterland«, hervor, reiste 1876 nach Amerika und wurde dann durch seine unter dem Pseudonym Litwos in der Warschauer »Gazeta Polska« veröffentlichten, ungemein interessanten amerikanischen Reisebriefe in den weitesten Kreisen bekannt. Er veröffentlichte sodann eine Reihe von Novellen, die ein ungewöhnliches Talent in realistischer Auffassung und Darstellung bekundeten und allgemeines Aufsehen erregten. Am bemerkenswertesten darunter sind: »Stary sługa« (»Der alte Diener«), »Hania« (»Hanna «), »Szkice węglem« (»Kohlenskizzen«), »Janko muzykant« (»Janko der Musikant«), »Przez stepy« (»Durch die Steppen«), »Orso«, »Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela« (»Aus dem Tagebuch eines Posener Lehrers«), »Czyja wina« (»Wer ist schuld«), »Za chlebem« (»Ums liebe Brot«), »Latarnik« (»Der Laternenmann«), »Jamioł«, »Niewola tatarska« (»Die Tatarenknechtschaft«), »Na jednę kartę« (»Auf eine Karte«), »Bartek zwycięzca« (»Bartel der Sieger«). Alsdann errang er einen ganz außerordentlichen Erfolg auf dem Gebiete des historischen Romans mit der großen Romantrilogie »Ogniem i mieczem« (»Mit Feuer und Schwert«, Warsch. 1884, 4 Bde.), »Potop« (»Die Sintflut«, Berl. 1886, 6 Bde.) und »Pau Wołodyjowski« (das. 1887–88, 3 Bde.). Alle drei Romane spielen im 17. Jahrh. auf dem blutigen Hintergrunde der Kriege mit den Kosaken, Schweden und Türken und übertreffen an Kraft, Erfindungsgabe und glänzendem Stil alles, was bisher auf diesem Gebiet in der polnischen Literatur geleistet wurde. Nach Herausgabe einer Reihe von Novellen (»Ta trzecia«, »Sachem«, »Sielanka« etc. 1889) veröffentlichte er dann 1890 das zweibändige Werk »Bez dogmatu« (»Ohne Dogma«), den bedeutendsten psychologischen Roman, den die polnische Literatur aufzuweisen hat. Seine letzten Publikationen sind die Romane »Rodzina Połanieckich« (1894), das weltberühmt gewordene »Quo vadis« (1895, aus der Zeit Neros), das in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurde, und »Krzyżacy« (»Die Kreuzritter«, 1901). S. hatte dann seinen Wohnsitz abwechselnd in Warschau und Krakau und hat in den letzten Jahren weite Reisen nach England, Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, dem Orient etc. unternommen. Eine Reise nach Afrika schildern seine »Briefe aus Afrika«. Eine Zeitlang war er Redakteur des Warschauer »Slowo«. Jetzt lebt er meist auf dem Gute Olęgoret (Gouv. Kjelzy), das ihm 1900 zu seinem 25jährigen Schriftstellerjubiläum von den Polen als Nationalgeschenk verehrt wurde. 1905 wurde ihm der Nobel-Preis für Literatur zuerkannt. Eine Sammlung seiner Werke erscheint seit 1880 in Warschau. S.' Schriften sind fast sämtlich mehrfach übersetzt worden, seine Romane deutsch Leipzig 1901–02 in 10 Bänden, eine andre deutsche Ausgabe seiner »Gesammelten Werke« erscheint seit 1906 in Graz. Seine Biographie schrieben P. Chmielowski (poln., Lemberg 1901) und J. Nowiński (poln., Warsch. 1901).
Ohne Dogma
Einleitung.
An diesem Werke lernen wir den gefeierten Dichter Polens von der allgemein menschlichen Seite kennen. Die in der Weichert'schen »Kollektion klassischer Romane« erschienenen zwei andern Werke aus seiner Feder zeigten ihn auf historischem Boden: »Quo vadis?« führte uns in das kaiserliche Rom des Altertums zur Zeit des keimenden Christentums, »Die Kreuzritter« in die Zeit der Kämpfe zwischen dem Deutschritter-Orden und dem Königreiche Polen als der äußersten Vormacht des Slaventums. In den diesen beiden Werken vorausgesandten Einleitungen findet der Käufer der vorliegenden Ausgabe der Sienkiewicz-Romane, was ihm zur Orientierung über den Dichter und seinen Lebenslauf, wie über das Milieu, in welchem die Handlungen spielen, und über die Zeit derselben, zu wissen von nöten ist, um einen richtigen Genuß von der Lektüre dieser hervorragendsten Werke der gegenwärtigen schöngeistigen Literatur zu haben.
Der Roman »Ohne Dogma« gehört zu der Gattung der psychologischen Romane: und sein Dichter tritt hier in Rivalität mit den bedeutendsten Meistern dieser Gattung aus der französischen Literatur: Daudet, Zola, Bourget, Balzac ... Gleichwie ich den hochbegabten Polen für den ersten aller lebenden Meister des historischen Romans halten möchte, dem ein Platz unmittelbar neben Walter Scott und Willibald Alexis gebührt, der in der großartigen Wucht seiner Massenbilder Alexandre Dumas den Vater übertrifft, so stehe ich nicht an, ihn in seinen psychologischen Romanen auch über die genannten Franzosen zu stellen; denn Sienkiewicz analysiert wohl das Frauengemüt, seziert es aber nicht, er wird als Analytiker nicht zum Verächter, sondern bleibt Verehrer des Ewigweiblichen; er ist wohl ein slavischer Schopenhauer, aber unendlich verfeinerter, sensitiver als sein – nun, man darf es sagen – sein deutsches Vorbild; und so gibt er uns wohl »eine feine, trefflich durchgeführte psychologische Studie eines weltmännischen, an sich selbst und allem zweifelnden Skeptikers« und »einer absolut reinen und edlen Frauennatur,« hält sich aber »weit, weit fern von dem widrigen Schauspiel der vergnügt in den schmutzigen Wässern der Ehebruchstragödien plätschernden französischen und italienischen Romandichter.«
»Ohne Dogma« ist nicht das einzige Werk dieser Richtung aus der Feder des polnischen Dichters, sondern es sind ihm verschiedene Novellen vorausgegangen, die fast durchweg als Kleinode der Erzählungskunst gelten dürfen; es steht ihm ein nicht minder bedeutender Roman zur Seite, der das in »Ohne Dogma« in der Adelswelt skizzierte Thema in die bürgerlichen Verhältnisse hinüberträgt: »Die Familie Polaniecki« ... Was ich in einem buchhändlerischen Fachblatte vom Jahre 1901 lese: »Von all den Vorzügen, die den Sienkiewicz'schen Roman »Die Familie Polaniecki« zu einem der schönsten machen, die die neuere Literatur gezeitigt hat, ist der höchste, der echt christliche Sinn, der es durchweht, der religiöse Kern, der in ihm steckt; denn sein Dichten wurzelt tief im Glauben, und wie kein zweites Buch so eindringlich und überzeugend, predigt dieses, daß erst dann hohes Glück in das Herz des Menschen einziehen könne, wenn der Glaube an eine Vorsehung, die schon hienieden dem Menschen das Gute lohne und das Böse ihn sühnen lasse, sich gefestigt habe,« – das läßt sich auch unterschreiben für das hier zur Ausgabe gebrachte Werk »Ohne Dogma« ... die tiefe Psychologie, die seine Charakteristik und die hohe Anmut, die über allem schwebt, sichern ihm einen hervorragenden Platz in der Literatur und einen großen Leserkreis ... »Unsre Dichter,« so bemerkt der Held des in Tagebuchform gehaltenen Romanes über die Frau, die er liebt, von der er geliebt zu werden glaubt und die ihm widersteht, »geben ein ganz falsches Bild von den Frauen; sie sehen in jedem Weibe ein Rätsel, eine lebende Sphinx; aber tausendmal rätselhafter, tausendmal sphinxartiger sind die Männer; eine gesunde – nicht hysterische – Frau, ob sie nun gut oder schlecht, stark oder schwach sein mag, besitzt einen weit einfacheren, schlichteren Geist als der Mann; in allen Lebenslagen, zu jeder Zeit genügen ihr die zehn Gebote und werden von ihr hochgehalten, ohne Rücksicht darauf, ob sie sich diesen Geboten fügt, oder ob sie, ihrer schwachen Natur wegen, deren Vorschriften außer acht läßt.«
Der Roman »Ohne Dogma« ist, wie bereits bemerkt, allgemeinmenschlicher Natur; die Träger seiner Handlung sind nicht Slaven, sondern nur Menschen mit slavischen Namen, die unter allen Rassen leben und – leiden: darum dürfen sich Deutsche gerade dieses Werkes des nichts weniger als deutschfreundlichen Dichters wohl mit am meisten erfreuen.
Adam Kotulski.
Erster Teil
Rom, am 9. Januar.
Es ist noch nicht lange her, da habe ich mich mit meinem Freunde Sniatynski, der sich nach Beendigung seiner Studien der Schriftstellerei zuwandte und bereits einen recht guten Namen besitzt, über Literatur unterhalten. Er schwärmte für das Tagebuch und meinte, ein solches gebe, sofern es die Wahrheit enthalte, nicht bloß ein getreues Zeitbild, sondern auch ein unbedingt verläßliches Zeugnis menschlichen Lebens; wer ein Tagebuch schreibe, erwerbe sich, behauptete er, ein unmittelbares Verdienst um die Menschheit, und nur eine Erzählungsform habe Anwartschaft auf wirkliche Unvergänglichkeit, nämlich die Denkwürdigkeiten. Ich bin nun 35 Jahre alt und habe für meine Mitmenschen noch nicht das geringste geleistet, will es drum einmal probieren, ob ich in dieser Weise etwas für sie vollbringen kann. Den Grund dafür, daß ich noch solche Null darstelle, erblicke ich mit in dem Umstande, daß ich nach Vollendung meiner Universitätsstudien mich immer im Auslande herumgetrieben habe. Man nehme diese Worte nicht als Humor, höchstens als eine Art Galgenhumor, und betrachte auch in solchem Lichte meinen Entschluß, ein Tagebuch zu schreiben, ungeachtet der skeptischen Lebensauffassung, mit der ich mich vollgesogen habe wie ein Schwamm mit Wasser ... Jedes Wort, das ich schreibe, soll wahr sein, und wenn sich meines Freundes Ansicht, der Mensch finde, wenn er sich erst einmal daran gewöhnt habe, seine Gedanken in solcher Form niederzuschreiben, seine Freude daran, bei mir nicht bewahrheiten sollte, dann Gnade der Himmel meinem Tagebuche! es möchte reißen wie eine zu straff gespannte Saite, denn wenn ich schließlich auch ganz gern bereit bin, für die Menschheit etwas zu vollbringen, so wird es mir nun und nimmer einfallen, mich für sie zu »ennuyieren«. Anderseits sollen mich Schwierigkeiten nicht abschrecken; ich denke vielmehr, daß es mir gelingen wird, mich an die Arbeit zu gewöhnen und auch Gefallen an ihr zu finden ... Mein Freund schärfte mir ein, ja nicht zu schreiben nach Literatenweise... er mag ja recht haben, wenn er sagt, man schreibe um so besser, je ungesuchter man schreibe; aber ich bin ja doch nur Dilettant, und wenn es mir wirklich an allen Eigenschaften zur Erfüllung der gestellten Aufgabe fehlen sollte, so doch vielleicht nicht an einer gewissen Dosis Geschmack ... drum denke ich, ich trete ohne weitere Erwägungen an sie heran und erzähle zunächst einiges über meine Vergangenheit.
Mein Name ist Leon Ploshowski, mein Alter, wie schon bemerkt, 35 Jahre; ich bin der Sohn reicher Eltern und im Besitz eines recht stattlichen Familiengutes. Mein Sinn steht nicht danach, es zu mehren; es wird mir aber auch nicht einfallen, es zu verwirtschaften. Ich bin nicht darauf angewiesen, mir eine Stellung im Leben zu erringen, ich weiß nichts von kostspieligen Liebhabereien, sondern stehe dem Leben und seinen Genüssen und Freuden mit arger Skepsis gegenüber, halte nicht viel von seinem Werte, sondern bilde mir ein, daß es überhaupt nicht viel wert ist ...
Acht Tage nach meiner Geburt hat meine Mutter das Zeitliche gesegnet, während mein Vater, der sie über alles in der Welt geliebt hat, in Trübsinn verfallen ist ... Wiener Aerzten gelang es, ihn zu heilen, aber die Heimat war ihm verleidet, er überließ der einzigen Schwester die Bewirtschaftung seines Gutes Ploshow und zog nach Rom. Dorthin ließ er auch die Asche meiner Mutter bringen, und 30 Jahre lang hat er aus der ewigen Stadt den Fuß nicht gesetzt. Auf der Via Babuino ließ er sich ein Landhaus bauen, das er nach unserem Geschlechtswappen Casa Osoria taufte, und dessen Inneres er zu einer Art Museum gestaltete von allerhand Kunstwerken aus der Zeit des Urchristentums und dessen weiteren Ausbau ich mir zur Lebensaufgabe gemacht habe. Mein Vater war in seinen jüngeren Jahren das Muster männlicher Schönheit, ragte auch hervor durch glänzende Gaben des Geistes, und da ihm Name und Vermögen alle Pforten erschlossen, wurde ihm von aller Welt eine große Zukunft geweissagt. In Berlin hatte er Philosophie studiert, und die dortigen gelehrten Kreise erwarteten viel von ihm; aber der außerordentliche Erfolg, den er in der Damenwelt hatte, lenkte ihn von dem Studium ab; in den Salons hieß er nicht anders als »der Unbezwingliche«, und wenn er auch der Wissenschaft darüber nicht völlig untreu wurde, so sollten sich doch auch die Hoffnungen, die man an seine Fähigkeiten knüpfte, nicht erfüllen. Aber er war auch in seinen späteren Jahren noch immer ein so schöner Mann, daß mehr als ein berühmter Maler gesagt hat, sein Kopf sei einer der edelsten Patriziertypen, die man sehen könne. In wissenschaftlicher Richtung war und blieb er Dilettant, und Dilettantismus scheint mir in unserer Familie erblich zu sein.
Als er von seinem Trübsinn geheilt war, warf er sich der Religion in die Arme und lebte eine Zeitlang im Zustande richtiger Ekstase, verbrachte Tag und Nacht im Gebet, kniete vor allen Kirchen, stand bei den einen im Ruf eines Heiligen, bei anderen im Ruf eines geistig Gestörten. Allmählich jedoch fand er die Ruhe wieder und kehrte zu seiner früheren Lebensweise zurück. All seine Liebe wandte er nun auf mich, während er Beschäftigung für seinen Geist in seinem Museum, in der Sammlung von Altertümern aus der Urchristenzeit suchte. Ein Pater Calvi, der mir den ersten Unterricht gab, war ein tüchtiger Archäologe und in jedem Winkel des alten Rom zu Hause.
Er und der berühmte de Rossi weckten in meinem Vater die Liebe zu der ewigen Stadt und waren tagelang mit ihm unterwegs, in den Katakomben u. s. w. Mein Vater setzte die beiden gelehrten Herren oft durch sein Wissen in Verwunderung. Hin und wieder versuchte mein Vater wohl auch, etwas zu Papier zu bringen, es blieb aber immer bei den Anfängen, wahrscheinlich weil er seine Studien über ein zu großes Gebiet ausdehnte. Es währte nämlich nicht lange, so ging er von der Zeit des Urchristentums zum Mittelalter über, beschäftigte sich mit den Geschlechtern der Colonna und Orsini, wandte sich vom Mittelalter zum Zeitalter der Renaissance; Bildhauerei, Malerei und die anderen Künste gewannen ihm die gleiche Begeisterung ab, und wenn auch sein ausgedehntes Studium seinen Sammlungen vorzüglich zu statten kam, so nahm es ihm doch soviel Zeit, daß die Abfassung eines großen Werkes über die drei römischen Epochen in polnischer Sprache immer nur Idee blieb und niemals Wirklichkeit wurde.
Mein Vater trägt sich mit dem Gedanken, seine Sammlungen als ein »Museum Osoryjow-Ploshowskich« bei seinem Ableben der Stadt Rom zu vermachen mit dem einzigen Vorbehalt, daß die ewige Stadt sich verpflichtet, einen besonderen Saal hierfür herzugeben. Das wird die Stadt natürlich tun; ich aber vermag nicht einzusehen, wie seine Schätze der Menschheit besser zu gute kommen sollen, wenn er sie statt dem Vaterlande der ewigen Stadt vermacht. Ich kann mich seiner Meinung nicht anschließen, daß sie in Polen vermodern würden, während sie in Rom Aussicht hätten, durch die vielen Fremden, die dorthin strömten, zum Gemeingut aller Völker zu werden. Ich vermute, es wohnt dem lieben Vater ein bißchen völkische Eitelkeit inne, ein gewisser Kitzel, unseren polnischen Namen in Marmor gegraben in der ewigen Stadt verewigt zu sehen; will den Fall indessen nicht weiter untersuchen, da es mir im Grunde genommen völlig gleichgültig ist, wo die Sammlungen schließlich einmal bleiben. Meine Tante in Warschau dagegen, die ich übrigens in nächster Zeit einmal heimsuchen muß, kann sich mit solcher Absicht ihres Bruders ganz und gar nicht befreunden und gibt ihrem Verdrusse über solche Vaterlandslosigkeit in jedem Briefe unverhohlenen Ausdruck; als sie vor einigen Jahren einmal eine Zeitlang in Rom bei meinem Vater zu Besuch war, brachte sie dieses Thema tagtäglich aufs Tapet, und wenig fehlte, so wäre es darüber zwischen Bruder und Schwester zum Bruche gekommen.
Meine Tante ist ein absonderliches Frauenzimmer, und es ist notwendig, mich eine Weile mit ihr zu befassen. Sie ist ein paar Jahre älter als mein Vater, hat nach dem Tode meiner Mutter das Familiengut übernommen, meinen Vater mit Geld abgefunden und verwaltet nun seit 30 Jahren das Gut aufs musterhafteste; als sie zwanzig Jahre alt war, trug sie sich mit Heiratsgedanken; ihr Bräutigam starb jedoch im Auslande, und die Todesnachricht erreichte sie in dem Augenblicke, als sie zur Reise zu ihm alle Vorbereitungen traf. Da faßte sie den Entschluß, ledig zu bleiben, und hat sich auch durch keinen Bewerber, an denen es ihr nicht fehlte, davon abbringen lassen.
Nach dem Ableben meiner Mutter begleitete sie den Vater nach Wien und dann nach Rom, widmete ihm die zärtlichste Fürsorge und schloß später mich mit gleicher Liebe in ihr Herz. Sie ist die vornehme Dame im eigentlichen Sinne, herrisch und hochfahrend, rücksichtslos und derb: Eigenschaften, die sich gern bei Leuten einfinden, die sich im Besitz eines großen Vermögens wissen und in der Gesellschaft eine erste Rolle spielen; dabei ist meine Tante aber eine kreuzbrave Person und von höchster Respektabilität. Unter der Schale sitzt ein goldener Kern: sie beschränkt ihre Liebe und Anhänglichkeit auf ihren Bruder und Neffen, und erstreckt sie, wenn nicht auf die ganze Menschheit, so doch auf alle, die zum Hause Ploshaw gehören. Ihre Wohltätigkeit ist in aller Munde, und während sie die Bettler grob anläßt wie ein Polizist, versorgt und pflegt sie sie wie ein zweiter Vincenz von Paula. Sie ist wahrhaft fromm, lebt nach strengen Grundsätzen und ist infolgedessen nie im Zweifel, wie sie ihr Verhalten einzurichten, was sie zu tun und zu lassen hat, und wird in ihrem Seelenfrieden niemals gestört. In der Gesellschaft genießt sie außerordentliche Beliebtheit; bloß in der Damenwelt macht sich hie und da eine gewisse Abneigung gegen sie geltend ...
Ploshow liegt in der Nähe von Warschau. In Warschau besitzt die Tante ein eigenes Haus und verlebt dort in der Regel den Winter. Sie stellt alljährlich alles mögliche auf, mich dorthin zu ziehen, in der stillen Absicht nämlich, mich in das Ehejoch zu spannen. So habe ich erst vor ein paar Wochen wieder eine solche Einladung von ihr bekommen und werde, wie wohl schon bemerkt, in nächster Zeit doch einmal nach Warschau reisen müssen, zumal ich nun schon geraume Zeit nicht mehr auf heimatlicher Scholle war und die Tante in ihrem letzten Schreiben betont, sie sei nun auch schon alt geworden und möchte mich doch vor ihrem Tode noch gern einmal sehen und sprechen. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, so folge ich ihrer Einladung nicht gern, weil es nun einmal ihr Steckenpferd ist, mich zu verehelichen, und weil sie jedesmal, wenn ich wieder unverrichteter Sache den Fuß in die Fremde setze, bitter enttäuscht ist. Ich kann es nun einmal nicht ändern, daß ich vor diesem Schritte, der einen neuen Lebensabschnitt bedeutet, einen gewissen Horror empfinde. Ich habe im Grunde genommen mein bisheriges Leben schon recht satt. Obendrein kann ich mich in meinem Verhältnis zu der Tante einer gewissen peinlichen Empfindung nicht erwehren. Sie bildet sich nämlich ein, wie es einst den Freunden meines Vaters mit diesem erging, an mir besondere Fähigkeiten entdeckt zu haben, die mir eine bedeutende Zukunft eröffnen sollen. Ich mag sie aber nicht in diesem Glauben lassen; es kommt mir vor, als beginge ich Mißbrauch mit ihrem guten Glauben: es drängt mich im Gegenteil, ihr zu sagen, daß von meinen Fähigkeiten gar nichts im Leben zu erwarten sei, und das möchte ich auch nicht gern, weil ich der guten alten Frau nicht auf ihre letzten Tage noch ein Leid antun möchte, das ihr ja, unbeschadet meiner Wenigkeit, ganz gut erspart bleiben könnte.
Es ist nun aber zu meinem Leidwesen nicht unmöglich, daß die Tante mit ihrer Ansicht über mich nicht allein dasteht, daß vielmehr auch andere Personen meiner Bekanntschaft oder Verwandtschaft sie teilen; und darum wird es gut sein, nun ein paar Worte über mich selbst zu sagen. Das wird mir aber insofern nicht leicht fallen, als ich eine von jenen Naturen besitze, die man als »komplizierte« zu bezeichnen liebt. Ich muß Wohl annehmen, daß ich schon mit der Veranlagung zur Nervosität auf die Welt gekommen bin. Kinder aus Familien, die schon durch Generationen hindurch sich höherer Kultur erfreuen, mögen wohl einen höchst verfeinerten Nervenapparat schon mit auf die Welt bringen. Meine Tante war die Hüterin meiner Kindheit, und als sie, um unser Erbgut zu übernehmen, von meinem Vater schied, traten in ihr Hüteramt, wie es in der vornehmen polnischen Welt Brauch und Sitte ist, verschiedene Gouvernanten oder »Bonnen«. Da mein Vater in Rom lebte, mußte natürlich, um mich meiner Muttersprache nicht allzu sehr zu entfremden, eine dieser Damen aus Polen stammen. Der Vater plauderte frühzeitig mit mir über allerhand Fragen und Dinge in seinem Zimmer, und diesen oft ein wenig lang ausgesponnenen Unterhaltungen mag ich Wohl eine schnellere, vielleicht auch etwas frühzeitige Entwickelung verdanken. Später mögen ihn Studien und Sammlungen zu sehr in Anspruch genommen haben; denn der schon erwähnte Pater Calvi wurde für mich als Lehrer genommen. Es war schon ein älterer Herr, von wahrer Frömmigkeit und doch fröhlichen Sinnes. Die Kunst liebte er schwärmerisch, und ich möchte fast sagen, die Kunst durch ihre Schönheit wurde ihm zur Mittlerin der Religion. Wenn ich ihn in Museen, vor Madonnen- und Heiligenbildern stehen, oder in der sixtinischen Kapelle einer Motette oder geistlichem Konzerte lauschen sah, ist er mir immer vorgekommen wie der Erde entrückt. Ich kann mir nicht helfen, aber mir kommt es immer so vor, als riefe mir die Greisenfigur auf dem raphaelischen Gemälde, die neben der heiligen Cäcilia steht und den Sphärenklängen lauscht, den Pater Calvi in Erinnerung. Mit meinem Vater war der fromme Herr bis zum Tode in freundschaftlichen Beziehungen; und ihre Liebe zu mir und Fürsorge für mich festigte dieselben noch. Sie erblickten beide in mir einen talentvollen Knaben, dem eine schöne Zukunft winke, und in gewissem Sinne wohl eine Art Ergänzungsstück der an Schönheiten so überreichen Umgebung, in der sie lebten ... und die auch auf mich und meine Erziehung von besonderem Einflusse sein mußte. Ich war in den Galerien und Museen sozusagen Stammgast, denn sowohl Vater wie Lehrer besuchten sie niemals ohne mich, und ehe ich noch fest in den vier Grundrechnungen war, habe ich ein paar Engländer, die Caracci mit Caravaggio verwechselten, über diesen Irrtum aufklären können. Im Alter von elf Jahren hatte ich mir bereits eigene Ansichten gebildet über die italienischen und fremden Meister, und wenn sie auch noch harmloser Natur sein mochten, so merkte ich doch an den Blicken, die sich Vater und Lehrer zuwarfen, daß sie nicht wenig darüber erstaunt waren. Ribera zum Beispiel mit seinen grellen Schwarzweiss-Effekten war mir zuwider, dagegen schwärmte ich für Carlo Dolci. Aber Pater Calvi war ein ebenso großer Freund der Natur wie der Kunst, und auf den Spaziergängen, die wir in die Umgebung der ewigen Stadt unternahmen, schulte er mein Auge an den Edelformen der Pinien, an den Bogen und Linien der in Ruinen liegenden Thermen, impfte er meinem Gemüte die wundersam poetische Melancholie der römischen Campagna ein. Ueber der Natur und Kunst wurde aber auch die Philologie nicht vernachlässigt, und sehr früh war ich des Lateinischen mächtig; ich erinnere mich des großen Vergnügens, das mir das zufolge meiner Kenntnis des Italienischen mühelose Studium dieser Sprache immer bereitete, noch heute mit Liebe ... Kurzum, ich kann nicht anders als wiederholt bemerken, daß ich in den Augen meines Vaters und meines Lehrers als eine Art Wunderkind galt, und daß auch meines Vaters Bekannte sich dieser Anschauung anschlossen: kein Wunder, daß das häufige Lob, das mir gespendet wurde, Eitelkeit in mein Gemüt pflanzte, und daß ich unter solchem, wie dem allgemeinen Einflusse der Umgebung, in der ich lebte, in einen Zustand krankhafter Empfindsamkeit geriet, den ich zeitlebens nicht los werden sollte. Daß diese Einflüsse anderseits nicht im stande waren, aus mir selbst einen Künstler zu machen, wird seinen Grund wohl in einem Mangel an eigentlichem Talent haben; mein Zeichen- und mein Musiklehrer waren in dieser Hinsicht freilich anderer Meinung, und daß ich mich eigentlich darüber wundere, daß es weder meinem Vater noch dem Pater Calvi möglich gewesen, die ihnen innewohnende heiße Liebe zur Kunst auf mich zu übertragen, bekenne ich unverhohlen. Während sie beide ihr angehörten mit Herz und Seele, bin ich bloß Nachempfinder; und wenn auch mir die Kunst ein notwendiges Bedingnis zum Leben ist, so doch nur als Vervollständigerin der übrigen seiner Genüsse und Freuden; ich schätze und liebe sie, doch nur als Dilettant; sie ist mir Annehmlichkeit, nicht aber Passion oder Leidenschaft: es wäre mir vielleicht nicht möglich, ohne sie zu leben, aber mit meinem ganzen Leben in ihr aufzugehen, wäre ich ebensowenig im stande ...
Da mein Vater mit den Schulen Italiens nicht zufrieden war, gab er mich nach Metz ins Kolleg, das ich »summa cum laude« absolvierte, trotzdem ich im letzten Jahre »abschwenkte« zu den Don Carlosschen Truppen und mich acht Wochen lang mit den Freischärlern unter Tristan in den Pyrenäen umhertrieb. Mein Vater ließ mich durch das französische Konsulat in Burgos dingfest machen; ich wurde zur Strafe wieder nach Metz gebracht, kam aber mit glimpflicher Buße weg, da sowohl der Vater, wie auch die Lehrer im stillen über mein Abenteuer nicht ungehalten, sondern vielleicht eher stolz darauf waren. Meine Mitschüler sahen mich mit großen Augen an, etwa wie einen Helden aus der Ritterzeit, und keinem einzigen von ihnen wäre es eingefallen, mir die bevorzugte Stellung streitig zu machen, die ich nun als der beste Examinandus der Anstalt errang. Auch der Vater verzieh mir den Don Carlos-Abstecher schnell über dem vorzüglichen Zeugnis, das ich »in litteris« wie auch »in moribus« von Metz mitbrachte, und sowohl Lehrer wie Mitschüler waren sich einig darüber, daß ich die Vorzugsstellung, die mich jetzt auszeichnete, auch im Leben weiter inne behalten werde. Hierin täuschten sie sich aber ebenso, wie ich mich; denn während manch einer von ihnen, der sich im Kolleg niemals herausgenommen, mir den allgemein zugesprochenen Vorrang streitig zu machen, in Frankreich in Literatur, Wissenschaft oder Politik, eine hervorragende Stellung bekleidet, stehe ich heute noch als »Wilder« da, der sich keiner einzigen Wissenschaft zugewandt hat, und der, wenn er es jetzt noch tun sollte, in arge Verlegenheit bezüglich der Wahl käme.
Meine Stellung in der Gesellschaft ist vorzüglich. Ich bin schon von mütterlicher Seite im Besitz eines Vermögens, das sich, wenn einmal mein Vater die Augen zutut, noch erheblich vermehren wird ... ich denke auch, unser Erbgut später einmal selbst zu bewirtschaften, und schon dieser Umstand muß mich ja hindern, im Leben eine wissenschaftliche oder soziale Rolle zu spielen. Freilich werde ich ja keinen sonderlichen Helden in der Landwirtschaft und Verwaltung darstellen, und vollständig fern liegt es mir, für den Ehrgeiz, der mich erfüllt, auf solchem Boden ein schickliches Betätigungsfeld zu erblicken. Dem Wunsche von Vater und Tante gemäß habe ich die Universität in Warschau besucht, und zwar zusammen mit Sniatynski. Wir fühlten beide Neigung zur Schriftstellerei. Ob ich der Befähigtere von uns beiden war, darüber will ich keine Untersuchung anstellen; aber das darf ich sagen, daß meine ersten Versuche besser ausfielen als die seinen und Besseres für die Zukunft versprachen ... nichtsdestoweniger hat er heut schon Bedeutendes erreicht, und ich bin noch immer Ploshowski »der Vielversprechende«, über den vielleicht dieser oder jener den Kopf schüttelt und bei sich denkt: »wenn der Mensch bloß mal was machen würde!«
Ja, wenn solche Leute doch bloß bedenken möchten, daß zum Können das Wollen gehört ... mir ist ja schon oft eingefallen, daß es besser für mich sein möchte, kein Vermögen zu besitzen; denn dann zwänge mich die Not, einen Beruf zu ergreifen, aber auch dann gehörte ich, wie ich bestimmt weiß, nicht zu denjenigen Leuten, die ihre Fähigkeiten voll auszunützen lieben. In anderen Stunden sage ich mir dann aber wieder, daß nicht für alle Menschen Reichtum Behinderungsursache sei zur Kraftbetätigung: Darwin, Buckle, Sir John Lubbock (der reiche Bankier) sind Beweise hierfür genug; und von Frankreichs berühmten Männern lebten und leben viele in den glänzendsten Verhältnissen. Eher ließe sich vielleicht an der Hand solcher Zeugen der Beweis liefern, daß Reichtum den Aufstieg erleichtere. Von mir persönlich kann ich wohl sagen, daß mich Reichtum vor mancher Klippe bewahrte, an der ich als armer Teufel sicher gescheitert wäre. Damit will ich ja nicht sagen, daß ich einen schwachen Charakter besäße, der Kampf ums Dasein hätte wohl auch ihn gestählt; immerhin wird aber wahr bleiben, daß die Gefahr zu stolpern auf ebenem Wege geringer ist als auf unebenem. Wäre ich ein Strohkopf, so ließe sich meine Arbeitsunlust daraus erklären; ich bin jedoch nicht bloß wißbegierig, lese viel und behalte auch viel, sondern es fällt mir auch nicht im geringsten schwer, mir Kenntnisse anzueignen. Es mag wohl sein, daß es mir an der zu einer großzügigen Arbeitskraft unerläßlichen Ausdauer fehlt; man sollte aber meinen, sie müsse zum Teil Ersatz finden durch die mir eigene leichte Auffassungsgabe. Solche dickleibigen Wörterbücher abzufassen wie Littré, bin so wenig wie andere ja auch ich nicht gezwungen; es kann aber doch, wer nicht dauernd strahlen kann wie die Sonne, recht wohl einmal aufleuchten wie ein Meteor ... fürwahr! diese Zuversicht, Null im Leben zu bleiben, ist ein herber Gedanke: so herb, daß mir das Schreiben für heute verleidet wird.
Rom, 10. Januar.
Gestern war Abendgesellschaft bei dem Grafen Malatesta. Da fiel das geflügelte Wort: »L'improductivité slave!« Als ich es hörte, kam ich mir vor wie ein Nervenkranker, dem der Arzt zu seinem Troste sagt, die Krankheit, an der er leide, sei ein bekanntes und weitverbreitetes Uebel. Es stimmt, an Leidensgefährten fehlt es mir nicht, wenn ich auch nicht weiß, ob sie nur dem polnischen Volke, oder den slavischen Völkern im allgemeinen angehören. Um Bestimmtes darüber zu sagen, kenne ich die Slaven im allgemeinen zu wenig. Aber dieses geflügelte Wort hat mir die ganze Nacht im Schädel rumort, und ich muß sagen, daß es wahrlich kein Esel war, der es auf den Flug gebracht hat. Wir sind wirklich mit solchem Gebreste behaftet: es gebricht uns an der Fähigkeit, die Fähigkeiten umzusetzen, die in uns stecken: ich möchte dieses Gebreste »Lebensuntauglichkeit« nennen. Müßte ich nicht fürchten, eine wunde Stelle zu berühren, so redete ich Wohl einmal mit dem Vater über den Fall: er liebt ja solche Debatten ... ich will aber darauf verzichten, und werde dem Falle statt dessen in meinem Tagebuche einen breiten Raum geben, und das ist schließlich besser, denn es sichert ihm vielleicht wenigstens nach dieser Seite hin einen Wert ... Es ist übrigens wohl auch erklärlich, daß ich in meinem Tagebuche zumeist von Dingen sprechen werde, die mich persönlich angehen. Gleichwie in jedes Menschen Innern sich eine bestimmte Tragik birgt, so in dem meinigen die »Unproduktivität« des Geschlechtes der Ploshowski ... Zur Zeit der Romantik brüstete man sich mit solchen tragischen Mängeln in der Öffentlichkeit, drapierte sich damit wie mit einem Mantel, heute ist das nicht mehr Mode, heute trägt man sie unter der anderen Garderobe, wie das Hemd ... anders in einem Tagebuche: da darf man, ja da soll man die Aufrichtigkeit wahren ...
Rom, 11. Januar.
Ich halte mich noch ein paar Tage hier auf ... ich will sie zur Niederschrift dessen benützen, was ich noch über meine Vergangenheit zu sagen habe; daraus wird sich zeigen, wer ich bin; und was ich bin, das erspart mir die eigentliche Biographie, die mir schon darum zuwider wäre, weil sie mir wie die langweiligste aller vier Grundrechnungsweisen, die Addierung, vorkommt. Will ich aber von mir selbst die richtige Summe ziehen, so muß ich meiner Skizze wohl oder übel noch ein paar Striche beifügen.
Von der Universität Warschau begab ich mich auf eine landwirtschaftliche Lehranstalt Frankreichs; wiewohl ich den Kursus dort durchmachte in dem Bewußtsein, daß ich es tue, um das, was ich dabei lerne, im Leben einmal praktisch zu verwerten, so konnte ich doch der Empfindung nie Herr werden, daß ich mich mit etwas befaßte, das ich unter meiner Würde hielt, das weder meinen Fähigkeiten entsprach, noch meinen Ehrgeiz befriedigte. Meine Gesundheit wurde aber durch die Arbeit im Freien außerordentlich gekräftigt, und insofern war der Aufenthalt in dieser Ackerbauschule nicht unvorteilhaft für mich. Ich lernte auch genug, daß mir der klügste Oekonom kein X mehr für ein U machen kann ... In den nächsten Jahren war ich bald in Paris, bald in Rom, hin und wieder auch, aber immer nur kurze Zeit, in Warschau. In Paris weilte ich immer gern, spielte aber, trotzdem es mir damals doch an Sicherheit wahrlich nicht fehlte, und auch meine Einkünfte reich genug waren, mir nach allen Seiten hin Unabhängigkeit zu sichern, in dieser seltsamen Welt eine ziemlich harmlose Rolle. Ich verliebte mich dort in eine Dame vom Schauspiel, Mademoiselle Richemberg, und wollte sie vom Flecke weg heiraten.
Was sich daraus alles an Verwickelungen für mich ergeben hat, bleibt besser verschwiegen. Mir kommt dies alles heute entsetzlich albern vor. Die Französin hat, wie übrigens auch die Polin, Aehnlichkeit mit einem Fechtmeister: so wie dieser, muß sie sich in täglicher Uebung erhalten: der Fechtmeister, um nicht die Gewandtheit des Armes einzubüßen, die Französin und Polin, um nicht die Herzensgewandtheit einrosten zu lassen. Da ich kein übler junger Kerl war und zu der besten Gesellschaft gehörte, bin ich oft zu solchen Fechtmeisterstückchen herangezogen worden, und wenn ich auch bei keinem auf den Tod verwundet worden bin, so ist es doch hin und wieder nicht ohne empfindlichen Schmerz dabei abgegangen. Lehrgeld bleibt eben in dieser Pariser Welt keinem erspart, und ich kann wenigstens noch von mir sagen, daß ich keine lange Lehrzeit durchzumachen gehabt habe. Dann kam für mich die Zeit, in der ich heimzahlen konnte, was mir »ausgewischt« worden war: und ich darf wohl sagen, daß ich niemand was schuldig geblieben bin ...
Ich lernte in Paris alle Kreise kennen, denn ich hatte überall Zutritt: die Legitimisten »ennuyierten« mich; in der durch die Bourbonen und Orleans neu geschaffenen Adelswelt, die, wenn nicht in Paris, doch in Plätzen wie Nizza, die erste Geige spielt, aus der sich der jüngere Dumas, Sardou und auch andere noch ihre Heldengrafen und -Herzöge nehmen, die alte Traditionen nicht kennt, aber Geld und Titel, und Titel und Geld in Hülle und Fülle hat, die außer Lebensgenuß keine Ausgabe, kein Ziel kennt, amüsierte ich mich »um der Damenwelt willen«, um jener zarten, nervösen Wesenheit willen, die nach Erregung dürstet, ewig auf der Jagd nach Erlebnissen ist, aber ledig aller Ideale ist, statt dessen meist ebenso verderbt, wie die nach ihnen kopierten Heldinnen ihrer Lieblingslektüre; ich will nicht in die Geschmacklosigkeit verfallen, von »meinen Erfolgen« zu faseln, indessen eines bemerken: daß ich mich ehrlich bemüht habe, wenn auch die Erfolge meines Vaters nicht zu übertreffen, so doch ihnen keine Schande zu machen ... Wer sich in diesem Pariser Leben eine Zeitlang hat herumschleudern lassen, geht unfehlbar mehr oder weniger marode daraus hervor, und lernt erst später erkennen, welche verhängnisvolle Verwandtschaft die darin errungenen »Triumphe« mit Pyrrhus-Siegen haben; so sind denn auch meine Nerven, trotzdem ich über keine von Haus aus unbedingt schwächliche Natur verfügte, von dieser Pariser Lebensführung stark irritiert worden. Indessen haben doch Boudoir, Klub und Salon nicht meine ganze Zeit ausgefüllt, sondern wie ich in meiner Knaben- und Studienzeit der Kunst nicht entraten konnte, und wie ich auch heute noch in ihr lebe und webe, so auch in dieser Pariser Zeit: ich ließ mich auch von der geistigen Strömung tragen, las viel und sorgte, daß ich mit dem geistigen Leben meiner Zeit gleichen Schritt hielt.
Von meinem Vater habe ich Wohl die Vorliebe für das »Denken in der Synthese« geerbt und damit den Hang zur Philosophie; ich halte mich indessen für keinen Philosophen von Fach, denn ich habe, wie schon wiederholt bemerkt, keinen eigentlichen Beruf; aber vom Standpunkte des mit der Fähigkeit zu denken ausgestatteten Menschen, der die neueren philosophischen Richtungen kennt und sich ihrem Einflusse nicht entzogen hat, darf ich mir in dem Tagebuche, das ich hier niederschreibe, wohl herausnehmen zu schildern, was bei der Gestaltung meiner geistigen und moralischen Persönlichkeit auf das Konto der Philosophie gesetzt werden muß.
In erster Linie muß ich da sagen, daß mein Glaube, den ich aus dem Metzer Kollegium rein und lauter in die Welt mit hinaus nahm, der Lektüre naturphilosophischer Bücher nicht standzuhalten vermocht hat. Darum bin ich aber noch lange kein Atheist. Ueber die Zeit, wo jeder, der den Geist nicht anerkannte, an seine Stelle das Wort »Materie« setzte, sind wir hinweg; heute urteilen wir nicht ohne weiteres ab, sondern sind bescheidener geworden und geben die Antwort: »Ich weiß nicht« ... und wenn auch die Psychologie alle psychischen Erscheinungen analysiert, so bekennt sie doch, wenn es sich um die Unsterblichkeit der Seele handelt, daß »sie nichts weiß«, und anders verhält es sich nun einmal damit nicht: sie weiß nichts hierüber und kann auch hierüber nichts wissen ...
Mit diesem »Ich weiß nicht« läßt sich nun der Zustand meines Geistes leicht und bequem definieren. In solch eingestandenem Unvermögen menschlichen Verstandes liegt unbedingt etwas Tragisches. Unser Geist wird nicht allein unaufhörlich nach Lösung dieser Rätsel dürsten, sondern wir stehen hier vor Fragen, die von höchst realer Bedeutung sind und für uns die höchste Wichtigkeit haben. Gibt es ein Jenseits und etwas Ewiges im Jenseits, dann schwinden alle Leiden und Einbußen des Diesseits zu nichts. »Mag sich der Teufel in Schwarz kleiden,« könnte man sich versucht fühlen, mit Hamlet zu sprechen, »ich will in einen Zobelpelz fahren.«
»Gegen den Tud,« erklärt Renan, »hätte ich im Grunde gar nichts, bloß wissen möchte ich, daß ich dabei profitierte.« Die Philosophie aber spricht: »Ich weiß nicht.« Solche Unwissenheit ist eine Qual für den Menschen. Wäre es ihm möglich, sich für das eine oder das andere zu entscheiden, so wäre er glücklicher daran und wäre ruhiger.
Rom, Babuina, 13. Januar.
In vier Tagen will ich reisen. Ich will zusehen, mit meiner Persönlichkeit zu Ende zu kommen. In sozialpolitischer Hinsicht darf ich mich konservativ nennen, bin es indessen nur soweit, wie es durch meine Stellung in der Gesellschaft bedingt wird und wie es mir im allgemeinen behagt. Um vom Scheitel bis zur Sohle Aristokrat oder Demokrat zu sein, dazu bin ich zu zivilisiert, und überlasse es Individuen altmodischer Art in Landstrichen, wo sich die Füchse gute Nacht sagen, wo etwas für neumodisch gilt, was man bei uns schon seit zehn Jahren in die Rumpelkammer geworfen hat, sich mit solchen Grillen zu befassen.
Ich kann mir nun einmal nicht helfen: ich liebe nur Menschen mit verfeinertem Sinn und mit empfindsamen Nerven. Ich liebe sie wie ein Kunstwerk, wie eine Naturschönheit, wie eine schöne Frau. Mir bereitet ästhetische Empfindsamkeit nicht nur Genuß, sondern auch Schmerz, aber sie hat mir einen Dienst erwiesen, den ich nicht genug schätzen kann: sie hat mich vor gänzlicher Verderbtheit bewahrt und mir in gewissem Sinne Ersatz für moralische Grundsätze geleistet. Im allgemeinen glaube ich sagen zu dürfen, daß ich ein anständiger Mensch bin, wenn auch nicht unverdorben: ein Geschöpf, genauer gesagt, das in sittlicher Hinsicht insofern in der Luft steht, als es sich weder auf religiöse noch auf gesellschaftliche Dogmen stützt. Ich wüßte übrigens auch keinen Lebenszweck, dem ich mein Leben aus wirklicher Ueberzeugung weihen könnte. Und was hülfe es mir, bei dieser »improductivité« im Besitze genialer Fähigkeiten zu sein? ich bliebe doch, wie es Minister ohne Portefeuille gibt, ein »Genie ohne Portefeuille« ... mir scheint, auf diese Charakteristik sollte ich ein Patent nehmen, so zutreffend erscheint sie! Aber ich bin nicht der einzige, auf den solcher Titel paßt ... nicht wahr? der alte, land- und menschenläufige Trost! nein, ihrer sind Legion! Die »improductivité slave« ist ein Ding für sich, und daneben besitzen wir an der Weichsel noch als eigenstes Produkt unseres Landes das »Genie ohne Portefeuille« ... und ihrer sind, ich betone es nochmals, Legion! in keinem anderen Erdwinkel geht soviel glänzende Begabung so nutzlos und unproduktiv zu Grunde, wie bei uns an der Weichsel...
Schon wieder ein Brief von der Tante! nun ja doch, ich komme ja schon, bin ia schon unterwegs! aber, Tantchen, weit, weit lieber bliebe ich hier, das darfst Du mir glauben, und müßte ich es nicht Dir zuliebe tun, so käme ich nicht; denn mein Vater ist seit einiger Zeit gar nicht mehr wohlauf; es befällt ihn von Zeit zu Zeit etwas wie Lähmung, und zwar auf der ganzen linken Körperhälfte ... er hat ja auf meine dringlichen Vorstellungen einen Arzt zu Rate gezogen; aber ich möchte mich hängen lassen, wenn er nicht, wie es immer seine Art war, die Arznei, die ihm der Arzt verschreibt, in den Wandschrank praktizierte, wo schon an die Hunderte von Fläschchen mit Mixturen stehen, die er hat schlucken sollen, und nie geschluckt hat...
Was mir die Reise in zweiter Linie verleidet, das sind die Pläne, die Tantchen doch wieder schmiedet! denn ich möchte Gift darauf nehmen, sie will mich verehelichen! ob sie schon eine bestimmte Person für mich in petto hat? ich will's nicht hoffen; aber mit der Absicht hält sie ganz und gar nicht hinterm Berge ... Ich bin aber nicht 35 Jahre alt geworden, ohne allerhand sentimentale Episoden hinter mir zu haben. Bei wem wäre das nicht der Fall, der viel gelebt hat? ... Natürlicherweise haben hierbei auch Polinnen ihren Anteil gehabt, und eben aus diesen mancherlei Episoden hat sich in meinem Gemüte die Meinung gebildet, daß von allen weiblichen Geschöpfen unter Gottes Sonne die Polin das schwierigste und unbequemste ist. Eine Polin zieht das Drama der Liebe im allgemeinen mehr an als die Liebe selbst; in jeder Polin steckt eine Königin und darin unterscheidet sie sich hauptsächlich von den Frauen aller übrigen Völker; die Polin glaubt dem Manne schon damit eine Gnade zu erweisen, daß sie ihm gestattet, sie zu lieben; es genügt keiner einzigen Polin, im Leben des Mannes, das doch noch andere Aufgaben zu erfüllen hat, als Füllsel, als Zugabe zu gelten; sondern sie verlangt, der Mann solle für sie existieren, und für den umgekehrten Begriff hat sie kein Verständnis und sucht nach keinem Verständnis. Zudem liebt jede Polin mehr ihre Kinder als ihren Mann, und erblickt im Manne einzig und allein einen Trabanten ... Ich meine nun aber, daß es für einen Mann wenig Reiz haben kann, alles Streben und jegliches Ideal bloß darum aufzugeben, um tagtäglich auf dem Altare des Weibes – obendrein des eigenen Eheweibes – zu brennen ... und wenn ich mich schließlich in meiner Selbsterkenntnis frage, was ich wohl eigentlich Besseres zu tun hätte, welches mein Streben sei und nach welchen Zielen ich ringe, wenn ich mir in weiterer Selbsterkenntnis zuletzt auch sage, daß, wenn irgend ein Mann hierzu tauge, so ich dieser Mann sei ... so sage ich mir doch wieder mit einer Verwünschung, daß ich dazu nicht die geringste Lust verspüre ... Daß man in der Ehe sein ganzes Leben umwandeln, daß man alle alten lieb gewordenen Gewohnheiten an den Nagel hängen, daß man auf alle Eigentümlichkeiten verzichten müsse ... und daß hierfür doch eben nur eine wahre, eine große Leidenschaft schadlos halten könne! ... nein! mir soll das nicht passieren! ich will mich nicht verheiraten! ich will keinem Weibe ein Vertrauensvotum solch unerhörter Natur aussprechen, und auch nicht meiner Willenskraft!
Warschau, 21. Januar.
So! seit heute morgen bin ich in Warschau. Die Reise hat mich nicht weiter angestrengt, da ich in Wien Station gemacht habe. Es ist schon spät; aber ich bin zu nervös, um schlafen zu können, und so will ich wieder mich an mein Tagebuch setzen. Das Ding wird mir wirklich zur lieben Gewohnheit.
Ei! war das eine Freude heute! und Tantchen ist doch wirklich eine gute Seele! Ich glaube, sie hat sich so gefreut und freut sich wohl auch noch so sehr, daß es ihr gehen mag, wie mir: daß sie nicht einschlafen kann. Zu Mittag wenigstens hat sie keinen Bissen gegessen. Wenn sie in Ploshow ist, hat sie immer ihren Aerger mit Chwastowski, dem Gutsverwalter, denn der ist einer von der alten Schlachta und steckt als solcher kein Wort ein, sondern »vermauliert« sich gehörig. Ist's so weit, daß sie sich gegenseitig den Stuhl vor die Tür gesetzt haben, dann hält die Tante den Mund und läßt sich das Essen schmecken; es scheint, als wenn sie allen Aerger mit hinunterschlinge. Heute bekamen die Dienstboten »ihr Fett«, aber das schien ihr nicht so recht zu genügen. Immerhin war sie bei trefflicher Laune ... Mein Spitzname im Tantenkreise ist »Fetisch«, darüber kann sich Tantchen ganz gehörig »fuchsen« ... Daß sich meine Befürchtungen, die mir die Reise fast verleidet hätten, bewahrheiteten, wird nicht verwundern. Tantchen hat die Angewohnheit, nach dem Essen mit großen Schritten in dem Zimmer auf und ab zu gehen und laut dabei zu denken ... und in solchem Momente von Selbstvergeßlichkeit schlugen die folgenden Selbstgespräche an mein Ohr: »Der Junge ist doch jung und eine stattliche Erscheinung, er ist reich und kein Dummkopf: da müßte sie doch eine Närrin sein, wenn sie nicht zugreifen wollte.« Morgen geben die Herren unserer Gesellschaft ihren Damen ein Picknick. Da fahren wir mit. Es verspricht sehr nett zu werden.
Warschau, 25. Januar.
Bälle sind mir zuwider: als »homo sapiens« komme ich bei solchem »Vergnügen« um vor Langeweile; als Heiratskandidat sind sie mir geradezu ein Greuel; nur als Künstler – natürlich solcher »ohne Portefeuille« – bereiten sie mir hin und wieder ein gewisses Amüsement.
Eine breite Treppe, wenn sie hellerleuchtet und mit Blumen geschmückt ist, und wenn Damen in Balltoiletten, mit nackten Schultern und Armen, die Stufen hinauf steigen, kann schön, kann prächtig sein; die Figuren gewinnen an Größe, wenn man sie von oben sieht, und erinnern in ihren Schleppkleidern an die Engel der Jakobsleiter ... Auch mein Geruchssinn labt sich, denn Parfüm ist mir ein Hochgenuß ...
Das Picknick verlief großartig. Dieser Stashewski ist wirklich ein Hauptkerl: auf so etwas versteht er sich ganz ausgezeichnet; kaum kam ich mit der Tante in Sicht, so legte er sie auch schon mit Beschlag und führte sie die Treppe hinauf. Tantchen trägt bei größeren Festlichkeiten immer einen Hermelinkragen von recht großer Länge: sie hat ihn nun einmal und will ihn doch sehen lassen. Davon führt sie nun in der Gesellschaft den Spottnamen »lange Pelerine« ...
Am Eingang verweilte ich eine Zeitlang, um unsere Gesellschaft zu mustern: man hat immer solch merkwürdigen Eindruck, wenn man bekannte Gesichter nach jahrelanger Abwesenheit einmal wiedersieht ... es kommt uns dann immer so vor, als seien es Wesen, die uns näher stünden als die, die wir draußen trafen, und doch beobachtet man sie, studiert man sie, als seien es Fremde. Vor allen Dingen interessierte mich die Damenwelt. Kein Zweifel, ich befinde mich in einer erlesenen Gesellschaft: alle Gesichter, gleichviel ob schön oder häßlich, tragen den Stempel alter, verfeinerter Zivilisation: Nacken und Schultern der Damen erinnern mich, trotz ihrer jugendlichen Rundung, an Sevres-Porzellan-Kunst: dieselbe abgeklärte Eleganz, die gleiche tadellose Vollkommenheit! Fürwahr! keine nachgeäffte Kultur, sondern echt europäische Kultur ...
Ich mochte ein Viertelstündchen dagestanden und sinniert haben, was für ein Köpfchen, was für ein Schulternpaar, was für einen Busen die Tante wohl für mich ausgesucht haben mochte, als die Sniatynskis zu mir herantraten. Vor ein paar Monaten traf ich ihn in Rom; die Frau hab' ich schon früher kennen gelernt; ich kann sie gut leiden, ihr Gesicht mutet an, und sie ist eine von jenen seltenen Polinnen, die ihr Leben dem Manne weihen und nicht das des Mannes im ihrigen aufsaugen wollen. Nach einem Weilchen glitt ein junges Ding zwischen Sniatynskis und mich, begrüßte Frau Sniatynska, hielt mir ein zierliches Händchen in schneeweißem Handschuh entgegen und rief: »Ei, Leo, kennst Du mich denn gar nicht mehr?« Mich setzte die plötzliche Frage in Verlegenheit: ich wußte wirklich im ersten Augenblick nicht, wohin ich das junge Ding tun sollte. Als ich ihr aber, wie es sich für einen höflichen Mann gehört, die Hand gab und unter Nicken und Lächeln erwiderte: »Gewiß! gewiß! wie könnte ich nicht?« da mochte ich doch ein recht einfältiges Gesicht geschnitten haben, denn Madame Sniatynska rief unter Lachen: »Nein, so was! Sie erkennen sie ja doch nicht: es ist ja Anielka P.!« Cousine Anielka! na, daß ich die nicht erkannte, war doch nicht so verwunderlich, denn zum letztenmal hab' ich sie wohl noch im kurzen Röckchen gesehen ... richtig! jetzt fällt's mir ein: es war in Ploshow, im Garten; sie trug kurze Strümpfe von Fleischfarbe, und weil sie die Mücken jämmerlich stachen, trampelte sie herum wie ein wildes Füllen. Wie sollte ich ahnen, daß diese ausgewachsene junge Dame mit dem vollen Busen, den weißen Schultern und den dunklen Augen eins war mit dem dünnbeinigen Bachstelzchen von damals? Das war ja wirklich ein ganz reizender Schmetterling, der aus dieser Puppe gekrochen war! Es versteht sich wohl von selbst, daß ich sie noch einmal bekomplimentierte, und zwar aufs allerherzlichste ... ja, als sie mir, wie Sniatynskis gegangen waren, sagte, ihre Mama und die Tante hätten sie zu mir geschickt, da gab ich ihr den Arm, und wir schritten weiter hinein in den Saal ... Und da schoß es mir mit einem Male zu Sinne: Anielka war die »faiblesse« meiner Tante! an dies junge Ding sollte ich anbeißen! Tantens Liebling war sie ja immer gewesen, und um die zerfahrenen Geldverhältnisse ihrer Mama hatte sich Tantchen ja immer schon Kopfschmerzen gemacht! Erklärlich, daß sie mich jetzt in ganz anderer Weise interessierte als der sonstige Damenflor ... Während wir durch den Saal promenierten, konnte ich mit ihr plaudern, konnte ich sie mustern: halblange Handschuhe, kaum bis zum Ellbogen hinauf, waren Mode ... ich konnte mithin sehen, daß der Arm, der sich auf den meinigen stützte, um eine Nuance dunkler war als der Flaum weicher Härchen, der ihn ziemlich dicht bedeckte. Auf den ersten Blick meint man, sie sei eine Brünette, ist es jedoch nicht. Während ihr Haar wie Bronze schillert, sind die Augen hellfarbig, erscheinen aber durch den Schatten der langen Wimpern schwarz, wie die Brauen, die tatsächlich schwarz und herrlich geschwungen sind. Ueber der schmalen Stirn übervolles Haar; auch die Brauen und Wimpern sind übervoll, und auf den Wangen wird der Flaum, den ich schon auf ihren Armen sah, zart und weich wie Flockseide ... Ich leugne nicht: dieses warme, lebensprühende, reizvolle Wesen repräsentiert mein Genre, und wenn auch Tantchen von jenem abscheulichen Menschen mit Namen Darwin wahrscheinlich keine Kunde hat und, wenn sie ihn kennen sollte, ganz sicher nichts von ihm hören und sehen will, so ist sie doch, ohne es zu ahnen, seiner Theorie von der natürlichen Zuchtwahl gefolgt ... Entschieden: Anielka ist mein Genre ... Tantchen hat diesmal wirklich einen ganz verflixten Köder an ihre Angel gesteckt! Uebrigens merke ich auch, daß ich ihr nicht mißfalle, und solche Wahrnehmung regt einen Mann ja immer an. Auch die Prüfung vom künstlerischen Standpunkte aus bestand sie mit der Zensur »Vorzüglich«. Es gibt tatsächlich Gesichter, die einen anmuten, wie eine auf menschliche Züge übertragene Melodie oder Poesie: und Anielka hat ein solches Gesicht: in ihrem Gesicht liegt wirklich keine Spur von etwas Gewöhnlichem!
Mir kommt es so vor, als sei Anielka bei aller Harmlosigkeit nicht frei von Koketterie: ich glaube bestimmt, sie weiß, daß sie eine Schönheit ist. So senkt sie die herrlichen Wimpern weit öfter als nötig wäre; warum? weil sie weiß, daß sie entzückend wirken! und warum hebt sie, um einen freundlich anzusehen, immer das Köpfchen mit solch anmutiger Bewegung hoch? ...
Das muß ich sagen: die Tante mit ihrer Zerstreutheit ist einzig! Kaum hatte ich Anielka zu den Damen geführt, kaum hatte ich ein paar artige Worte mit ihrer Mama gesprochen, so wandte sich Tantchen, der meine animierte Stimmung nicht entging, mit leichtem Achselzucken zu der Frau P.: »Ach, die Veilchen am Busen machen sich wirklich ausgezeichnet! ich glaube doch, daß es ein ganz vortrefflicher Einfall war, das Paar einander auf dem Balle zum ersten Male vorzuführen!« Frau P. geriet in Verlegenheit, Anielka auch, und nun wurde mir auf einmal klar, warum die beiden Damen nicht wie sonst bei meiner Tante abgestiegen waren. Frau P. und die Tante hatten ja sicher schon des langen und breiten über ihre Absicht, aus uns beiden ein Paar zu machen, verhandelt! und Frau P. mochte es nicht merken lassen. Um der verdrießlichen Situation, die sich hieraus für alle Beteiligten ergab, die Spitze abzubrechen, wandte ich mich mit den Worten an Anielka: »Ich will nicht unterlassen zu bemerken, daß ich ein herzlich schlechter Tänzer bin. Du kannst mir aber jeden Augenblick weggeholt werden, und deshalb möchte ich Dich bitten, mir diesen ersten Walzer zu vergönnen.« Anielka gab mir ihre Tanzkarte. »Schreib' ein, was Dir beliebt!« sagte sie resolut ... Ich bin nun aber durchaus kein Freund davon, mich zu etwas drängen zu lassen, und um mir bei dem politischen Spiel der beiden älteren Damen nicht alles Heft aus den Händen nehmen zu lassen, schrieb ich in Anielkas Tanzkarte: »Hast Du durchschaut, daß sie sich an uns einen Kuppelpelz verdienen wollen?« Sie las die Frage und wurde blaß. Der Ausdruck ihres Gesichts wechselte. Sie zog die seidenen Wimpern hoch, sah mir gerade in die Augen und antwortete, im gleichen resoluten Tone, wie sie mich zur Einzeichnung aufgefordert hatte: »Ja.« Dann war es mir, als wenn sie etwas fragen möchte, nicht mit Worten, sondern mit Blicken ... ich habe wohl schon bemerkt, daß ich keinen unbedingt schlechten Eindruck auf sie gemacht hatte, und ihre Gedanken mußten sich ja, seit sie erraten hatte, was meine Tante und ihre Mama vorhatten, in einem fort mit mir befaßt haben ... und nun sagten ihre Augen mir mit nicht mißzuverstehender Deutlichkeit: »Daß Mama und Tante den Wunsch haben, daß wir uns kennen lernen und einander nähern sollen, weiß ich ... was aber folgt daraus?« ... Statt ihr mündliche Antwort zu geben, legte ich den Arm um sie, zog sie leicht an mich und führte sie zum Walzer ... Anielka tanzt ausgezeichnet, selbstvergessen und hingebungsvoll, also ganz, wie es Pflicht der Dame ist zu tanzen. Es entging mir nicht, daß sich die Veilchen an ihrem Busen etwas unruhiger zu bewegen anfingen – diese Unruhe konnte nicht nur vom Tanzen herrühren ... Keine Frage: es begann in ihrem Herzen etwas zu sprießen!
Warschau, 30. Januar.