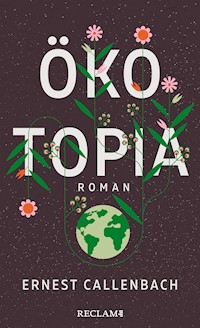
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman »Ökotopia«, 1975 verfasst, verblüfft durch seine Aktualität: Elektrotaxis, Biogemüse, Smartphones, mächtige Politikerinnen, Solarenergie – beim Lesen glaubt man sich immer wieder in eine parallele Gegenwart versetzt. Doch der kleine Staat Ökotopia an der US-amerikanischen Südwestküste, der sich in Callenbachs Zukunftsszenario von den Vereinigten Staaten abgespalten hat, ist einfach nur seiner Zeit weit voraus. Entsprechend staunt auch der New Yorker Journalist William Weston, der über die skurrile Hippie-Republik mit der guten Luft berichten soll, und wirft seine Vorurteile bald über Bord. Spätestens als er sich in eine Ökotopianerin verliebt, will er gar nicht mehr zurück. Doch um bleiben zu können, muss er nicht nur die Wahrheit über einen von der US-Regierung vertuschten Krieg herausfinden, sondern auch beweisen, dass er eine gleichberechtigte Beziehung führen kann ... »Callenbach zeichnete 1975 eine Gesellschaft, die durch ihre ökologische Nachhaltigkeit heute mehr denn je inspirierend wirkt.« DEUTSCHLANDFUNK KULTUR
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ernest Callenbach
Ökotopia
Roman
Reclam
Englischer Originaltitel: Ecotopia
Eine englische Ausgabe mit englisch-deutschem Glossar liegt unter Nr. 14144 in Reclams Universal-Bibliothek vor.
2022 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
© All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Bantam Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Umschlaggestaltung: Favoritbüro
Umschlagabbildung: shutterstock.com/Molibdenis
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962079-4
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011417-9
www.reclam.de
Inhalt
Westons nächster Auftrag: Ökotopia
William Weston auf seiner Reise nach Ökotopia
Über die ökotopische Grenze
Die Straßen von Ökotopias Hauptstadt
Lebensmittel, Abwasser und »stabiles Gleichgewicht«
Das autofreie Leben in den neuen Städten Ökotopias
Das unsportliche Leben in Ökotopia
Das ökotopische Fernsehen und seine Sendungen
Die ökotopische Wirtschaft: Ein Produkt der Krise
In den großen Wäldern Ökotopias
Sinkflug ohne Absturz? Das Problem der ökotopischen Einwohnerzahl
Rückfall in die Barbarei: Die dunkle Seite Ökotopias
Ihr und unser Plastik
Frauen an der Macht: Politiker, Geschlechterfragen und Recht in Ökotopia
Mitspracherecht der Arbeiter, Besteuerung und Jobs in Ökotopia
Die Rassenfrage in Ökotopia: Apartheid oder Gleichberechtigung?
Energie aus Sonne und Meer
Kommunikation in Ökotopia: Presse, Fernsehen und Verlagswesen
Überraschendes aus dem ökotopischen Bildungswesen
Leben in Plastikröhren
Trennung der Funktionen: Forschung und Lehre in Ökotopia
Musik, Tanz und andere Kunstformen in Ökotopia
Krankenhäuser und Gesundheitswesen: Der ökotopische Weg
Ökotopia: Herausforderung oder Illusion?
Arbeit und Freizeit bei den Ökotopiern
Nachwort der Herausgeber
Über den Autor
ÖKO-
vom griechischen oikos (›Haushalt‹ oder ›Zuhause‹)
-TOPIA
vom griechischen topos (›Ort‹)
In der Natur wird keine organische Substanz aufgebaut, sofern sie nicht wieder abgebaut werden kann; das Recycling wird mit Nachdruck betrieben.
BARRY COMMONER
Westons nächster Auftrag: Ökotopia
Endlich kann die Times-Post mitteilen, dass William Weston, unser bester Reporter für internationale Beziehungen, von kommender Woche an sechs Wochen in Ökotopia verbringen wird. Dieses bislang beispiellose journalistische Projekt wurde durch Vereinbarungen auf höchster diplomatischer Ebene ermöglicht. Es wird der erste offiziell arrangierte Besuch eines Amerikaners seit der Sezession Ökotopias sein, als die normalen Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten unterbunden wurden.
Die Times-Post schickt Weston auf diese einzigartige und heikle investigative Mission in der Überzeugung, dass eine offene, an Ort und Stelle durchgeführte Einschätzung Ökotopias unerlässlich ist – zwanzig Jahre nach der Abspaltung. Zu lange schon haben alte Antagonismen eine genaue Untersuchung all dessen verhindert, was bislang in Ökotopia geschehen ist – in einem Teil der Welt, der uns einst nahestand, der uns teuer und vertraut gewesen ist, aber seit der Unabhängigkeit jahrzehntelang abgeriegelt war und zunehmend geheimnisvoller wurde.
Das Problem ist heutzutage nicht in erster Linie, Ökotopia zu bekämpfen, sondern es zu begreifen – was sich positiv auf die guten internationalen Beziehungen auswirken dürfte. Die Times-Post steht wie immer bereit, diese Angelegenheit zu unterstützen.
(3. Mai) Da wären wir also wieder, liebes Tagebuch. Ein neues Notizbuch mit leeren Seiten, die nur darauf warten, vollgeschrieben zu werden. Schön, endlich unterwegs zu sein. Die Alleghenies verschwinden bereits hinter uns, wie blassgrüne Wellen auf einem mit Algen bedeckten Teich. Wenn ich darüber nachdenke, wie diese Reise überhaupt angefangen hat – ist das wirklich schon ein Jahr her? Diese sorgsam gestreuten Andeutungen im Weißen Haus, wie Krumen für das Präsidentenhirn, das alles wie ein Staubsauger in sich aufnimmt. Bis sie sich schließlich zu einer Art Gebilde formten und dann wie seine eigene wagemutige Idee daherkamen: Okay, schickt jemand Inoffizielles dorthin, absolut informell – einen Reporter, der nicht sofort mit Regierungskreisen in Verbindung gebracht wird, der ein bisschen herumschnüffeln und ein paar nette Testballons steigen lassen könnte – kann ja nicht schaden! Ein prickelnder Augenblick, als er das Thema schließlich anschnitt, unmittelbar nach einer großen Lagebesprechung zu Brasilien. Das berühmte vertrauliche Lächeln! Und als er dann meinte, er habe ein kleines Abenteuer im Sinn, das er mit mir unter vier Augen besprechen wolle …
War seine zögerliche Haltung nur auf seine gewohnte Vorsicht zurückzuführen, oder war das bereits ein Hinweis darauf, dass der Besuch (und der Besucher), falls etwas schieflief, politisch entbehrlich war?
Dennoch, ein wichtiger erster Schritt für unsere Außenpolitik – genügend gewichtige Argumente, die dafür sprechen. Heilt den brudermörderischen Bruch, der die Nation auseinanderriss – damit der Kontinent vereint zusammenstehen kann gegen sich zuspitzende Hungersnöte und Revolutionen. Die Falken, die »die verlorenen Territorien im Westen« mit Gewalt zurückerobern wollen, scheinen im Aufwind zu sein – sie müssen kaltgestellt werden. Ökotopische Ideen schwappen in bedrohlicherem Maße über die Grenzen – können nicht länger ignoriert werden, könnten aber an Wucht verlieren, indem man sie entlarvt usw.
Vielleicht finden wir ein offenes Ohr für den Vorschlag, die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen; vielleicht auch Angebote für Handelsbeziehungen. Mit dem Hoffnungsschimmer der Wiedervereinigung. Sogar ein publizierbares Gespräch mit Vera Allwen wäre brauchbar – das könnte der Präsident mit seiner ihm eigenen Flexibilität dafür nutzen, sowohl die Falken als auch die Umstürzler abzuwehren. Außerdem, wie ich schon zu Francine sagte – die mich selbst nach drei Gläsern Brandy natürlich noch verhöhnte –, will ich Ökotopia kennenlernen, einfach weil es existiert. Sind die Dinge dort wirklich so seltsam, wie man immer hört? Das frage ich mich.
Habe mir die Tabus durch den Kopf gehen lassen. Muss mich aus der Sache der Sezession heraushalten: Das könnte immer noch zu viel Verbitterung wachrufen. Aber dort warten vermutlich faszinierende Stories auf mich – wie die Abtrünnigen für die nuklearen Minen, die sie angeblich in New York und Washington platziert haben, Kernbrennstoff aus den Kraftwerken geklaut haben. Wie es ihrer politischen Organisation unter Führung dieser verfluchten Frauen gelungen ist, die etablierte politische Struktur erst lahmzulegen und dann zu ersetzen, und wie sie die Kontrolle erlangten über die Waffenvorräte und die Nationalgarde. Wie sie mithilfe von Täuschungen eine Pattsituation herausgeholt haben – natürlich spielte ihnen die schwere Wirtschaftskrise des Landes in die Karten, die aus ihrer Sicht gerade zur rechten Zeit kam. Jede Menge Geschichte wartet nur darauf, eines Tages niedergeschrieben zu werden – aber noch ist dafür nicht die Zeit gekommen …
Es fällt mir immer schwerer, mich von den Kindern zu verabschieden, wenn ich eine längere Reise antrete. Nicht, dass es eine so große Sache wäre, weil ich mich manchmal ein paar Wochenenden nicht blicken lasse, obwohl ich in der Gegend bin. Aber allmählich scheint es die Kinder doch zu stören, dass ich so oft weg bin. Wahrscheinlich setzt Pat ihnen den Floh ins Ohr; werde mit ihr reden müssen. Wie käme Fay sonst darauf, mich zu fragen, ob sie mitkommen kann? Meine Güte – mit Schreibmaschine und achtjähriger Tochter tief ins dunkelste Ökotopia …
Sechs Wochen ohne Francine. Es ist immer erfrischend, eine Weile weg sein zu können, und sie wird da sein, wenn ich zurückkomme, vollkommen begeistert von irgendeinem neuen Abenteuer. Irgendwie aufregend, wenn ich daran denke, gar keinen Kontakt mehr mit ihr zu haben, auch nicht mit dem Redaktionsbüro, ja, im Grunde mit dem ganzen Land. Keine Telefonverbindung, nur indirekt Kontakt zu Nachrichtenagenturen: diese unheimliche Isolation, auf der die Ökotopier seit zwanzig Jahren beharren! Selbst in Peking, Bantustan oder Brasilien hatte ich immer einen amerikanischen Dolmetscher dabei, der nicht anders konnte, als mich an die Verbindungen nach Hause zu erinnern. Diesmal wird es aber niemanden geben, mit dem man kleine amerikanische Befindlichkeiten austauschen könnte.
Und es ist gut möglich, dass es ziemlich gefährlich wird. Diese Ökotopier sind bestimmt Heißsporne, und deshalb könnte ich schnell ernsthaft in Schwierigkeiten geraten. Verglichen mit uns scheint die Regierung nur ansatzweise Kontrolle über die Bevölkerung zu haben. Man hasst die Amerikaner abgrundtief. Wenn man in der Klemme sitzt, ist die ökotopische Polizei wahrscheinlich keine große Hilfe – wie es aussieht, ist sie gar nicht bewaffnet.
Nun, ich sollte den ersten Zeitungsartikel schreiben. In luftiger Höhe ist vielleicht nicht der schlechteste Ort, damit anzufangen.
William Weston auf seiner Reise nach Ökotopia
An Bord des Flugs TWA 38, von New York nach Reno, 3. Mai. Während ich mit diesem Sonderbericht beginne, ist mein Flieger in westlicher Richtung unterwegs nach Reno – zur letzten amerikanischen Stadt vor den zerklüfteten Bergketten der Sierra Nevada, die die geschlossenen Grenzen von Ökotopia bewachen.
Im Laufe der Jahre hat sich der Schock angesichts der Abspaltung Ökotopias von den Vereinigten Staaten etwas gelegt. Heute wissen wir, dass Ökotopias Beispiel gar nicht so neuartig war, wie es damals den Anschein hatte. Biafra hatte den Versuch unternommen, sich von Nigeria loszusagen, und war gescheitert. Bangladesch hatte sich erfolgreich von Pakistan getrennt. Belgien hatte sich in drei Länder aufgespalten. Sogar die Sowjetunion hat immer wieder »kleinere« separatistische Unruhen erlebt. Bei der Abspaltung Ökotopias orientierte man sich teilweise daran, wie sich Quebec damals von Kanada lossagte. Eine derartige »Devolution« ist zu einem weltweiten Trend geworden. Die einzig bedeutsame Gegenentwicklung, auf die wir verweisen können, ist der Zusammenschluss der skandinavischen Länder – vermutlich eine Ausnahme, die nur die Regel bestätigt, da die Skandinavier ohnehin immer schon kulturell ein Volk waren.
Trotzdem erinnern sich viele Amerikaner heute noch an den furchtbaren Mangel an Obst, Salat, Wein, Baumwolle, Papier, Bauholz und anderen Produkten aus dem Westen der USA – eine unmittelbare Folge der Abspaltung eines ganzen Territoriums, das einst Washington, Oregon und den Norden Kaliforniens umfasst hatte. Diese Probleme verschärften die allgemeine amerikanische Wirtschaftskrise jener Tage; die chronische Inflation stieg rasant an, was eine große Unzufriedenheit mit der Politik der Regierung hervorrief. Außerdem ist Ökotopia immer noch der Stachel im Fleisch der grundlegenden nationalen Philosophie Amerikas mit ihren Glaubenssätzen: stetiger Fortschritt, alle profitieren von der Industrialisierung, wachsendes Bruttosozialprodukt.
Während der zurückliegenden zwei Jahrzehnte haben wir als Nation meistens zu ignorieren versucht, was sich in Ökotopia ereignet hat – in der Hoffnung, all das werde sich als bloße Dummheit entpuppen und sich wieder legen. Inzwischen ist jedoch klar geworden, dass Ökotopia nicht zusammenbrechen wird, wie es viele amerikanische Analysten zunächst prophezeiten. Es ist an der Zeit, dass wir uns ein klareres Bild von Ökotopia verschaffen.
Sollten sich die sozialen Experimente Ökotopias letzten Endes als absurd und unverantwortlich herausstellen, werden sie keine Verlockungen mehr für leicht zu beeindruckende, junge Amerikaner darstellen. Sollten sich Ökotopias seltsame Sitten und Gebräuche tatsächlich als so barbarisch erweisen, wie die Gerüchte vermuten lassen, wird Ökotopia einen hohen Preis zahlen, indem es die Welt gegen sich aufbringt. Sollten die Behauptungen der Ökotopier falsch sein, können die amerikanischen Politiker von diesem Wissen nur profitieren. So müssen wir zum Beispiel die Behauptung überprüfen, ob Ökotopia tatsächlich keine Todesfälle mehr durch Luftverschmutzung und chemische Verunreinigungen verzeichnet. Unsere eigene Sterberate ist von einem Höchststand von 75 000 pro Jahr auf 30 000 gesunken – nach wie vor ein tragischer Verlust, aber die Zahlen legen nahe, dass die drastischen Maßnahmen, die Ökotopia ergriffen hat, kaum erforderlich sind. Kurzum, wir sollten der Herausforderung, die Ökotopia für uns darstellt, auf der Grundlage fundierten Wissens begegnen statt mit Unwissenheit und Informationen aus dritter Hand.
Mein Auftrag für die kommenden sechs Wochen wird also darin bestehen, das ökotopische Leben vom Scheitel bis zur Sohle zu erforschen – ich werde herausfinden, wie viel Wahrheit in den Gerüchten steckt, werde detailliert beschreiben, wie die ökotopische Gesellschaft tatsächlich funktioniert, werde die Probleme dokumentieren und, sofern es angemessen ist, die Leistungen würdigen. Wenn wir aus erster Hand wissen, in welcher Situation sich unsere ehemaligen Mitbürger jetzt befinden, dann werden wir vielleicht wieder an die alten Beziehungen anknüpfen können, die sie einst mit die Vereinigten Staaten unterhielten und die sie so überstürzt abgebrochen haben.
(3. Mai) Das einst florierende Reno ist nur noch ein trauriger Schatten seiner selbst. Da das lukrative Geschäft mit dem Glücksspiel Kaliforniens durch die Abspaltung unterbrochen wurde, verfiel die Stadt zusehends. Die einstmals schicken Spielkasino-Hotels sind nur noch bessere Absteigen – die Betreiber sind schon lange nach Las Vegas ausgewichen. Ich flanierte in der Nähe des Flughafen-Terminals durch die Straßen und fragte die Leute, was sie hier von Ökotopia hielten. Die meisten Antworten sind unverbindlich, aber manchmal meinte ich, einen Anflug von Verbitterung herauszuhören. »Leben und leben lassen«, sagte ein grauhaariger alter Mann, »wenn man das überhaupt ›leben‹ nennen kann, was die da hinten so treiben.« Ein junger Mann, der sich selbst als Cowboy bezeichnete, lächelte bei meiner Frage. »Jaaa«, meinte er, »ich kenne Typen, die sagen, sie wären extra rübergefahren, um Mädels aufzureißen. Ist nicht wirklich gefährlich, wenn man die Gebirgspässe kennt. Die Leute sind ganz in Ordnung, solange du nichts im Schilde führst. Aber weißt du was, Mann? Die Mädels dort tragen alle Waffen! So wird’s jedenfalls erzählt. Das haut dich glatt um, was?«
War schwer, einen Taxifahrer zu finden, der bereit war, mich über die Grenze zu fahren. Letzten Endes überredete ich einen, der aussah, als hätte er zwanzig Jahre im Knast gesessen. Musste ihm nicht nur den doppelten Preis versprechen, sondern auch noch fünfundzwanzig Prozent Trinkgeld. Dafür erntete ich böse Blicke und jede Menge Mut machender Bemerkungen wie: »Was wollen Se da denn überhaupt, sind Se nicht ganz dicht? ’n Haufen verfluchter Kannibalen ist das! Da kommen Se nicht mehr lebend raus – ich hoffe nur, ich schaff’s.«
Über die ökotopische Grenze
Im Sierra Express, Tahoe-San Francisco, 4. Mai. Ich bin jetzt in Ökotopia – soweit bekannt, der erste Amerikaner, der den neuen Staat seit seiner Unabhängigkeit vor neunzehn Jahren besucht.
Mein Flieger landete in Reno. Auch wenn es nicht viele wissen, die ökotopische Regierung gestattet nicht einmal internationale Flüge über ihrem Staatsgebiet – wegen der Luftverschmutzung und Lärmbelästigung. Flüge von San Francisco nach Asien oder über die Arktis nach Europa müssen nicht nur einen vierzig Meilen außerhalb der Stadt liegenden Flughafen nutzen, sie sind darüber hinaus gezwungen, Flugrouten über Wasser einzuhalten; und amerikanische Maschinen mit Ziel Hawaii müssen über Los Angeles fliegen. Um also nach San Francisco zu gelangen, musste ich in Reno zwischenlanden und dann eine teure Taxifahrt in Kauf nehmen, um den Bahnhof am nördlichen Ufer von Lake Tahoe zu erreichen. Von Tahoe aus gibt es schnelle und regelmäßige Verkehrsverbindungen.
Die tatsächliche Grenze markiert ein pittoresker, verwitterter Holzzaun mit einem breiten Tor, das offensichtlich wenig in Gebrauch ist. Als mein Taxi dort hielt, war niemand zu sehen. Der Fahrer musste aussteigen, zu einem kleinen, aus Stein erbauten Wachhaus gehen und die ökotopischen Soldaten dazu bewegen, ihr Kartenspiel zu unterbrechen. Letzten Endes waren es zwei junge Männer in ziemlich knittrigen Uniformen. Aber sie wussten von meinem Besuch, überprüften meine Papiere mit einer Miene wissender Autorität und ließen das Taxi dann das Tor passieren – allerdings nicht ohne darauf hinzuweisen, dass es einer speziellen Erlaubnis bedurft hatte, damit ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor die heiligen Pforten passieren könne. Ich erwiderte, das Taxi müsse mich ja nur ungefähr zwanzig Meilen bis zum Bahnhof bringen. »Sie haben Glück, dass der Wind heute aus West kommt«, meinte einer der Soldaten. »Würde er aus Ost kommen, hätten wir Sie eine Weile hier festhalten müssen.«
Sie überprüften mein Gepäck mit einer gewissen Neugier und schenkten vor allem meinen Schlaftabletten besondere Aufmerksamkeit. Aber ich durfte alles behalten, nur nicht meinen verlässlichen Colt.45 samt Halfter. Das sei womöglich Standardausrüstung in New York, wie man mir sagte, aber in Ökotopia seien keine versteckten Waffen erlaubt. Weil er womöglich mein leichtes Unbehagen bemerkte, sagte einer der beiden Soldaten, dass ökotopische Straßen recht sicher seien, bei Tag wie bei Nacht. Dann reichte er mir eine kleine Broschüre mit dem Titel Ökotopia erklärt. Das Buch war hübsch gedruckt, hatte dafür aber ziemlich kuriose Illustrationen. Die Broschüre war offensichtlich in erster Linie für Touristen aus Europa und Asien hergestellt worden. »Vielleicht fällt es Ihnen damit leichter, sich an die Dinge zu gewöhnen«, meinte der andere Soldat in einem leisen, fast schmeichlerisch-freundlichen Ton, den ich inzwischen als nationale Eigenart wahrnehme. »Entspannen Sie sich, das ist ein freies Land.«
»Mein Freund«, entgegnete ich, »ich war schon an verdammt vielen Orten, die sehr viel seltsamer waren als dieses Land, und ich entspanne mich, wenn es mir passt. Wenn Sie dann mit meinen Papieren fertig sind, würde ich gern weiterreisen.«
Er klappte meinen Pass zu, hielt ihn aber noch in der Hand. »Weston«, sagte er und sah mir in die Augen, »Sie sind Autor. Wir verlassen uns darauf, dass Sie Ihre Worte mit Bedacht wählen, solange Sie hier sind. Falls Sie auf dem Rückweg wieder hier vorbeikommen, werden Sie das Wort ›Freund‹ vielleicht ohne Hintergedanken verwenden. Das würde uns gefallen.« Dann schenkte er mir ein freundliches Lächeln und streckte mir die Hand entgegen. Zu meinem eigenen Erstaunen ergriff ich seine Hand und merkte, dass auch ich unwillkürlich lächelte.
Wir fuhren weiter zum Tahoer Bahnhof des ökotopischen Schienennetzes. Das Bahnhofsgebäude erwies sich als recht rustikal und bestand aus mächtigen Bohlen. In Amerika hätte es als überdimensionale Skihütte durchgehen können. In den Wartebereichen gab es sogar offene Kamine – und gleich mehrere Bereiche, in denen man sich aufhalten konnte: eine Art Restaurant, einen großen verlassenen Raum mit einer Bühne, in dem offenbar Tanzveranstaltungen stattfinden, und eine kleinere, ruhige Lounge mit Ledersitzen und einer Auswahl an Büchern. Die Züge, die für gewöhnlich nur zwei oder drei Waggons haben, dafür aber stündlich verkehren, fahren unterirdisch in den Bahnhof ein, und bei kalter Witterung schließen sich große Tore hinter ihnen, um Schnee und Wind fernzuhalten.
Besondere Vorrichtungen für Wintersportler sah man auf den ersten Blick – Regale und Spinde –, aber zu dieser Jahreszeit ist der Schnee weitestgehend geschmolzen, und die Skisaison ist quasi zu Ende. Die elektrischen Minibusse, die den Bahnhof mit den Skigebieten und den Städten in unmittelbarer Umgebung verbinden, sind fast alle leer.
Ich ging nach unten zu meinem Zug. Er sah kaum wie ein Zug aus, sondern eher wie ein Flugzeug ohne Tragflächen. Zuerst dachte ich, ich wäre in ein nicht zu Ende gebautes Fahrzeug eingestiegen – es gab keine Sitze! Der Boden war mit einem dicken, nachgiebigen Teppich ausgelegt und durch kniehohe Trennwände in verschiedene Abteile untergliedert; ein paar Passagiere hatten es sich auf großen, sackartigen Lederkissen bequem gemacht, die verstreut herumlagen. Ein älterer Herr hatte sich am Ende des Waggons eine Decke von einem Stapel geholt und legte sich für ein Nickerchen hin. Ein paar Leute, die mir an meiner Verwirrung anmerkten, dass ich ein Fremder war, zeigten mir, wo ich meine Tasche verstauen konnte, und erklärten mir, wie man bei dem Steward im nächsten Waggon Erfrischungen bestellte. Ich nahm auf einem der Kissen Platz und merkte, dass ich durch die großen Fenster, die bis auf sechs Zoll über dem Boden hinuntergezogen waren, eine tolle Aussicht haben würde. Meine Mitreisenden zündeten sich Zigaretten an, am Geruch merkte ich, dass es Marihuana war, und ließen sie herumgehen. Als erste Geste des internationalen guten Willens nahm ich ein paar Züge, und kurz darauf plauderten wir recht ungezwungen.
Ihre sentimentale Naturverbundenheit hat die Ökotopier sogar dazu veranlasst, Grünpflanzen in ihren Zügen unterzubringen, die voller hängender Farne und kleiner Pflanzen sind, die ich nicht kannte. (Meine Mitreisenden konnten die botanischen Namen jedoch wie selbstverständlich herunterbeten.) Am Ende des Waggons standen Behälter, die wie Abfalleimer aussahen, versehen mit Großbuchstaben – M, G und P. Das, so erklärte man mir, seien »Recycling-Behälter«. Es mag Amerikanern unrealistisch vorkommen, aber mir fiel auf, dass meine Mitreisenden während der Fahrt ausnahmslos sämtliche Abfälle aus Metall, Glas, Papier oder Plastik auf die jeweiligen Behälter verteilten. Sie taten das, ohne dass es ihnen peinlich war – jedem Amerikaner wäre das peinlich gewesen –, und auf diese Weise kam ich zum ersten Mal mit der streng befolgten Praxis des Recyclings und der Wiederverwertung in Berührung, auf die die Ökotopier angeblich so verbissen stolz sind.
Falls man es überhaupt bemerkt, dass man mit einem ökotopischen Zug unterwegs ist, so nimmt man die Bewegung so gut wie gar nicht wahr. Da die Züge mittels Magnetschwebetechnik angetrieben werden, gibt es keine ratternden Räder, keine Motorengeräusche und auch keine Erschütterungen. Die Leute unterhalten sich, man hört das leise Klirren von Gläsern und Teetassen, einige Passagiere winken Freunden auf dem Bahnsteig zu. Kurz darauf scheint der Zug buchstäblich über den Boden zu fliegen, obwohl er nur wenige Zoll über einer muldenförmigen Führungsschiene schwebt.
Meine Mitreisenden erzählten mir etwas zu der Entstehung dieser Züge. Boeing in Seattle hatte bis zur Unabhängigkeit offenbar nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, die Produktpalette abseits der Flugzeuge weiter zu diversifizieren, um andere Transportarten zu ermöglichen. Der Weltmarkt war beim Flugzeugbau jedoch von starkem Wettbewerb geprägt, und glücklicherweise konnte die ökotopische Regierung vorübergehend die Boeing-Produktionsstätten nutzen, um das neue nationale Bahnnetz auf die Beine zu stellen, obwohl die Wirtschaftspolitik Ökotopias auf lange Sicht in jeder Stadt und jeder Region nach Diversifizierung und Dezentralisierung der Produktion verlangt. Zwar hatten die Deutschen und die Japaner bei Magnetschwebebahnen mit Linearmotoren Pionierarbeit geleistet, aber bei Boeing ging dieses System nur ein Jahr nach der Unabhängigkeit in Produktion. Auf meine Frage, wie das enorm kostspielige System finanziert worden sei, lachten meine Mitreisenden nur. Einer von ihnen bemerkte, dass sich die Kosten für die gesamte Bahntrasse von San Francisco nach Seattle auf etwa das Gleiche beliefen wie zehn Überschalltransportflugzeuge (SST), und er erklärte, die Sozialkosten pro Person und Meile seien bei ihrem Bahnnetz im Ganzen geringer als beim Luftverkehr auf einer beliebigen Distanz unter tausend Meilen.
Aus meiner Broschüre erfuhr ich, dass die Züge für gewöhnlich auf ebener Strecke 360 Kilometer in der Stunde fahren. (In Ökotopia wird das metrische System verwendet.) Bei dieser Geschwindigkeit, umgerechnet 225 Meilen pro Stunde, sieht man noch genug von der Landschaft. Allerdings erreichten wir diese Geschwindigkeit erst zwanzig Minuten später, nachdem wir den östlichen Steilhang der Sierra Nevada hinaufgekrochen waren, bei einer Geschwindigkeit von weniger als neunzig Meilen. Der Donnerpass wirkte fast so trist, wie er den Siedlern der Donner Party vorgekommen sein muss, die dort ums Leben kamen. Wir machten Halt in Norden und nahmen ein paar Wintersportler der Nachsaison an Bord – wie auch die Wintersportler bei uns war das eine fröhliche Gruppe, aber in ziemlich abgerissener Kleidung, darunter pelzgefütterte Jacken, die sehr abgetragen aussahen. Sie trugen selbstgefertigte Rucksäcke und primitive Skier – lange, schmale Bretter mit lockeren, altmodischen Bindungen. Dann stieß der Zug hinab in die langen Canyons der Sierra-Wälder und flog gelegentlich an einem Fluss vorbei, dessen Wasser blauschwarz und eisig zwischen den Felsen gurgelte. Nur wenige Minuten später glitten wir nach Auburn hinein. Der Fahrplan, der anschaulich die Strecken und die ungefähren Abfahrtszeiten eines komplexen Netzes von Anschlusszügen und -bussen zeigt, nannte noch drei weitere Stationen vor San Francisco. Ich war froh, als ich merkte, dass wir weniger als eine Minute hielten, obwohl die Leute mit der typischen ökotopischen Lockerheit ein- und ausstiegen.
Als wir die Ebene unten im Tal erreichten, gab es kaum etwas, das mein Interesse geweckt hätte, aber meine Reisegefährten schienen immer noch fasziniert zu sein. Sie wiesen auf den Wechsel von Feldern und Wäldern hin, an denen wir vorüberfuhren; in einem bewaldeten Abschnitt entdeckte jemand eine Ricke mit zwei Kitzen, und später sorgte ein Eselhase für Erheiterung. Schon bald erreichten wir die hügelige Landschaft um die San Francisco Bay und schossen durch eine Reihe von Tunneln in den grasbewachsenen, wie Brüste gerundeten grünen Hügeln. Man sah jetzt mehr Häuser, die allerdings recht verstreut lagen – viele davon schienen kleinere Höfe zu sein. Die Obstgärten, Felder und Zäune sahen gut und erstaunlich gepflegt aus, fast so wie in Westeuropa. Doch wie schäbig und ärmlich dagegen die Bauernhäuser wirkten, verglichen mit den weiß getünchten Farmhäusern in Iowa oder Neu England! Die Ökotopier müssen wirklich allergisch gegen Farbe sein. Sie bauen mit Steinen, Lehmziegeln und verblichenen Brettern – offenbar mit fast allem, was sich gerade anbietet, und es mangelt ihnen an einem Sinn für Ästhetik, der sie dazu veranlassen würde, diese Materialien unter einer Farbschicht zu verbergen. Anscheinend würden sie ein Haus lieber mit Kletterpflanzen oder Sträuchern versehen, als es anzustreichen.
Die Trostlosigkeit der Landschaft wurde noch durch ihre offenkundige Abgeschiedenheit verstärkt. Die Straßen waren schmal und gewunden, die Bäume wuchsen gefährlich dicht an der Fahrbahn. Es schien überhaupt keinen Straßenverkehr zu geben. Nirgends war eine Plakatwand zu sehen, nicht einmal eine Tankstelle oder eine Telefonzelle. Wäre wenig beruhigend, in einer solchen Gegend nach Einbruch der Dunkelheit festzusitzen.
Eineinviertel Stunden, nachdem wir Tahoe verlassen hatten, verschwand der Zug in einem röhrenförmigen Tunnel in der Nähe des Ufers der Bucht und kam kurz darauf im Hauptbahnhof von San Francisco wieder zum Vorschein. In meinem nächsten Artikel werde ich meine ersten Eindrücke von der Stadt am Golden Gate beschreiben – wo früher so viele Amerikaner an Land gingen, um ihr Glück auf den Goldfeldern zu machen.
(4. Mai) Allgemeiner Eindruck: Viele Ökotopier sehen aus wie Westmänner der alten Zeit, wie Figuren aus dem Goldrausch, die zu neuem Leben erwacht sind. Wir haben ja, weiß Gott, jede Menge freakige Leute in New York, aber deren verrücktes Aussehen ist bewusst gewählt, affektiert und theatralisch – eine Art Angeberei. Die Ökotopier sind fast wie Charaktere bei Dickens: oft ziemlich sonderbar, aber nicht übergeschnappt oder schmuddelig wie die Hippies der Sechziger. Abgefahrene Hüte und Frisuren, Jacken, Westen, Leggings, Strumpfhosen; Himmel hilf, ich glaube, ich habe sogar eine Schamkapsel gesehen – entweder das oder der Typ war übernatürlich gut bestückt. Es gibt viele Stickereien und Verzierungen aus kleinen Muscheln oder Federn und viel Patchwork – Stoffe müssen unglaublich rar sein, daher bemühen sie sich so sehr, sie wiederzuverwenden.
Und ihr Verhalten ist sogar noch verwirrender. Auf der Straße knistert es regelrecht, wenn Frauen mir direkt in die Augen sehen; bisher habe ich weggeschaut, aber was würde wohl passieren, wenn ich den Blicken standhielte? Die Leute scheinen einen lockeren, fast spielerischen Umgang miteinander zu pflegen, als hätten sie alle Zeit der Welt, um herauszufinden, welche Möglichkeiten sich auftun. Es gibt keine implizite Bedrohung durch die offen kriminelle Gewalt, die auf unseren öffentlichen Plätzen vorherrscht, aber dafür jede Menge starke Emotionen, die ganz bewusst zum Ausdruck gebracht werden! Die friedliche Ruhe der Zugfahrt wurde mehrmals durch laute Wortwechsel oder Beleidigungen unterbrochen; die Leute legen eine unverschämte Neugier an den Tag, die oftmals zu Meinungsverschiedenheiten führt. Fast so, als hätten sie das Gespür für Anonymität verloren, das es uns erst ermöglicht, in größerer Zahl zusammenzuleben. Daher kann man einen ökotopischen Beamten auch nicht so behandeln, wie wir es üblicherweise tun. Der Ökotopier am Fahrkartenschalter wollte es schlicht und einfach nicht dulden, dass ich ihn auf meine gewohnte Art ansprach – er fragte mich, was er meiner Ansicht nach sei, ein Fahrkartenautomat? Tatsächlich gibt er dir das Ticket erst dann, wenn du ihn wie einen normalen Menschen behandelst, und er besteht darauf, dich genauso zu behandeln – er stellt also Fragen, macht Bemerkungen, auf die er eine ernstzunehmende Reaktion erwartet, und wird laut, wenn er sie nicht erhält. Aber all der Schall und die Raserei scheinen im Grunde nichts zu bedeuten. Mag sein, dass es unter den harmlosen Verrückten auch gefährliche Irre gibt, aber noch sind mir keine begegnet. Hoffe nur, dass ich meine eigene geistige Gesundheit bewahren kann.
Die Straßen von Ökotopias Hauptstadt
San Francisco, 5. Mai. Als ich den Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt verließ, hatte ich so gut wie keine Ahnung, was ich von dieser Stadt zu erwarten hatte – die einst damit geprahlt hatte, nach einem schrecklichen Erdbeben samt Feuersbrunst wie ein Phönix aus der Asche erstanden zu sein. San Francisco galt einst als »Amerikas beliebteste Stadt« und besaß eine enorme Anziehungskraft auf Touristen. Die effektvollen Hügel und Brücken, die pittoresken Kabelbahnen und die weltmännischen, aber angenehm entspannten Leute hatten Besucher angelockt, die danach immer wiederkamen. Würde ich feststellen, dass San Francisco immer noch den Ruf verdient, ein eleganter und kultivierter Ort zu sein?
Ich gab mein Gepäck auf und machte mich auf den Weg, mich ein bisschen umzusehen. Der erste Schock stellte sich in dem Moment ein, als ich die Straße betrat. Eine seltsame Stille lag über allem. Ich rechnete damit, zumindest etwas von dem aufgeregten Gewühl unserer Städte zu erleben – hupende Autos, vorbeizischende Taxis, Menschenmengen, die in der Hektik des städtischen Alltags vorwärtsdrängen. Nachdem ich mein Erstaunen angesichts der Stille einmal überwunden hatte, stellte ich stattdessen fest, dass sich die Market Street, einst ein breiter Boulevard, der einmal quer durch die Stadt bis zum Meer verlief, in eine Promenade mit tausenden Bäumen verwandelt hat. Die »Straße« an sich, über die elektrische Taxis, Minibusse und Lieferwagen schnurren, ist zu einer zweispurigen Angelegenheit geschrumpft. Der verbleibende Platz, der beträchtlich ist, wird vereinnahmt von Radwegen, Springbrunnen, Skulpturen, Kiosken und absurden kleinen Gärten, umgeben von Sitzbänken. Über allem schwebt die fast düstere Stille, nur hier und da unterbrochen von dem Surren der Fahrräder und dem Geschrei der Kinder. Gelegentlich hört man Vogelgezwitscher, so unglaublich einem das auch auf der vollen Hauptstraße einer Großstadt erscheinen mag.
Vereinzelt stehen dort große Pavillons mit konisch zulaufenden Dächern, in deren Mitte ein Kiosk Zeitungen, Comics, Zeitschriften, Fruchtsäfte und Snacks verkauft. (Auch Zigaretten – den Ökotopiern ist es nicht gelungen, das Rauchen auszumerzen!) Die Pavillons erweisen sich als Haltestellen des Minibussystems, und die Leute warten darin geschützt vor dem Regen. Bei diesen Bussen handelt es sich um komische batteriebetriebene Apparate, die den alten Kabelbahnen nachempfunden sind, die den Bewohnern von San Francisco einst so ans Herz gewachsen waren. Es gibt keine Fahrer, gesteuert und zum Halten gebracht werden die Bahnen von einer elektrischen Vorrichtung, die unter der Straße verlegten Leitungen folgt. (Ein Sicherheitspuffer hält sie an, falls es jemand nicht rechtzeitig schafft, dem Bus Platz zu machen.) Damit die Leute während des fünfzehn Sekunden währenden Halts rasch ein- und aussteigen können, befindet sich der Einstieg nur wenige Zoll über dem Bordstein; die Räder befinden sich an den äußersten Ecken des Fahrzeugs. Die Sitzreihen zeigen zur Fahrbahn, so dass man sich auf einer Kurzstrecke sofort setzen kann oder stehen bleibt und an einem der Griffe Halt findet. Bei schlechtem Wetter können mit Fransen gesäumte Stoffbahnen ausgefahren werden, die zusätzlich Schutz bieten.
Diese Busse kriechen mit einer Geschwindigkeit von zehn Meilen pro Stunde dahin, aber sie verkehren etwa alle fünf Minuten. Es wird kein Fahrgeld verlangt. Als ich eine Probefahrt in einem der Busse machte, sprach ich einen Passagier darauf an, und er meinte, die Minibusse würden in derselben Weise finanziert wie die Straßen – aus den allgemeinen Steuereinnahmen. Lächelnd fügte er hinzu, ein Fahrer an Bord, der das Fahrgeld kassiert, würde mehr kosten, als man mit dem Fahrgeld einnähme. Wie viele Ökotopier neigte auch er zur Schwatzhaftigkeit und erklärte mir genauestens das gesamte ökonomische Grundprinzip des Minibussystems, ganz so, als wolle er es mir verkaufen. Ich bedankte mich bei ihm und stieg nach einigen Blocks aus.
Die idyllische Atmosphäre des neuen San Francisco lässt sich vielleicht am besten an dem Umstand ablesen, dass entlang der Market Street und einiger anderer Straßen Bäche verlaufen. Dieses Wasser hatte man früher unter hohem Kostenaufwand über große unterirdische Kanalleitungen abgeleitet, wie es in Städten üblich ist. Die Ökotopier investierten noch mehr Geld, um das Wasser wieder an die Oberfläche zu bringen. Deshalb sieht man heutzutage auf diesen größeren Boulevards eine entzückende Ansammlung kleiner gurgelnder und sprudelnder Wasserfälle und Kanäle, gesäumt von Steinen, Bäumen, Bambus und Farnen. Es scheinen sich auch Elritzen im Wasser zu tummeln – aber wie man die Fische vor stibitzenden Kindern und räuberischen Katzen schützt, ist mir schleierhaft.
Trotz der Stille sind die Straßen voller Menschen, aber es sind nicht die Massen wie in Manhattan. (Etwas von dem Fußgängerverkehr ist auf gitterförmig verzierte Brücken umgeleitet worden, die einen Wolkenkratzer mit dem anderen verbinden, manchmal in einer Höhe von fünfzehn oder zwanzig Stockwerken.) Da fast die gesamte Straße »Gehweg« ist, braucht sich keiner über Hindernisse zu ärgern – oder über Schlaglöcher, die mit Blumen bepflanzt werden, sobald sie sich im Gehweg auftun. Ich kam an einer Gruppe Straßenmusiker vorbei, die Bach spielten, auf einem Cembalo und einem halben Dutzend anderer Instrumente. Straßenhändler schieben buntbemalte Karren vor sich her und bieten heiße Snacks, Esskastanien und Eis an. Einmal sah ich sogar einen Jongleur und einen Zauberkünstler, die vor einer Schar Kinder auftraten – das erinnerte mich an Filme, die im Mittelalter spielen. Es gibt jede Menge Leute, die flanieren, gaffen und faulenzen – Leute, die keiner bestimmten Beschäftigung nachgehen und die die Straße wie eine selbstverständliche Erweiterung ihrer Wohnzimmer betrachten. Obwohl es so viele Leute gibt, die nichts zu tun haben, ist es komisch, dass man auf den ökotopischen Straßen vergebens nach Sicherheitstüren, Türstehern, Wachpersonal oder anderen Vorkehrungen gegen Kriminalität sucht. Und niemand scheint unser Verlangen nach Autos zu verspüren, um geschützt von einem Ort zum anderen zu kommen.
Bereits auf der Zugfahrt war mir aufgefallen, dass die ökotopische Kleidung ziemlich locker fällt und leuchtende Farben aufweist, mit denen der Mangel an Stil und Schnitt kaschiert werden soll. Dieser Eindruck bestätigt sich nun, nachdem ich Tausende Einwohner von San Francisco gesehen habe. Der typische ökotopische Mann trägt unauffällige Hosen (sogar Jeansstoff sieht man häufig – vielleicht aus nostalgischen Gefühlen für die amerikanische Mode der Zeit vor der Abspaltung?), dazu oftmals scheußliche Hemden, Pullover, Ponchos oder Jacken. Trotz der für gewöhnlich kühlen Witterung sind Sandalen bei beiden Geschlechtern häufig. Auch die Frauen tragen oft lange Hosen, aber noch häufiger sieht man locker fallende, folkloristische Röcke. Ein paar Leute tragen sonderbare, hauteng anliegende Kleidungsstücke, die wie Taucheranzüge aussehen, aber aus einem mir unbekannten Gewebe bestehen. Mag sein, dass diese Leute Mitglieder einer speziellen Gruppe sind, weil ihre Kleidung so ungewöhnlich ist. Leder und Pelze scheinen bevorzugte Materialien zu sein – sie finden Verwendung bei Handtaschen, Beuteln, Hosen und Jacken. Kinder tragen Miniaturversionen der Erwachsenenkleidung; es scheint keine spezielle Kinderbekleidung zu geben.
Möchten die Ökotopier weiter als einen Häuserblock oder zwei fahren, dann benutzen sie meistens eines der stabilen weißen Fahrräder, die zu Hunderten neben den Straßen zur Verfügung stehen und für alle kostenlos sind. Da die Fahrräder tagsüber oder abends von den Bürgern in Anspruch genommen und über die Stadt verstreut werden, bringen entsprechende Teams sie nachts wieder an die Stellen zurück, an denen sie am nächsten Tag benötigt werden. Als ich einem freundlichen Fußgänger gegenüber bemerkte, dieses System müsse ja ein Fest für Diebe und Vandalen sein, widersprach er hitzig. Dann legte er seinen Standpunkt dar, und vielleicht ist das auch gar nicht weit hergeholt: dass es nämlich immer noch weniger Kosten verursacht, ein paar Fahrräder einzubüßen, als mehr Taxis oder Minibusse bereitzustellen.
Wie ich feststelle, tragen die Ökotopier bei Fragen dieser Art Statistiken mit unbekümmerter Hingabe vor. Sie haben eine Art, den Faktor »soziale Kosten« in ihre Berechnungen einzubinden, was unvermeidlich mit einem gewissen Maß an optimistischer Spekulation einhergeht. Es wäre interessant, solche Informanten mit einem der nüchtern kalkulierenden Experten unserer Autoindustrie oder Straßenbauindustrie zu konfrontieren – der natürlich entsetzt wäre angesichts der Abschaffung der Autos in Ökotopia.
Als ich spazieren ging, fiel mir auf, dass es in Downtown San Francisco merkwürdigerweise nur so von Kindern und deren Eltern wimmelte, abgesehen von den Leuten, die offensichtlich in den Büros und Geschäften arbeiteten. Meine Fragen an Passanten (die mit erstaunlicher Geduld beantwortet wurden) ergaben die vermutlich verblüffendste Tatsache, die mir bislang in Ökotopia untergekommen ist: Die großen Wolkenkratzer in der Innenstadt, die einst Firmenzentralen weitverzweigter Unternehmen waren, sind in Wohnhäuser verwandelt worden! Es bedarf noch weiterer Nachforschungen, um sich ein klares Bild von dieser Entwicklung zu verschaffen, aber ich hörte auf der Straße heute wiederholt, dass die ehemaligen, außerhalb gelegenen Wohnviertel weitestgehend verlassen sind. Viele dreigeschossige Gebäude waren ohnehin vor neun Jahren von einem Erdbeben stark beschädigt worden. Tausende billig hochgezogene Häuser in neueren Bezirken (meine Gewährsmänner bezeichneten sie spöttisch als »öde Schuhkartons«) wurden ausgeschlachtet und nach Entfernung der elektrischen Leitungen und der Glas- und Metallbestandteile von Bulldozern planiert. Jetzt leben die Bewohner im Zentrum, und zwar in Gebäuden, in denen es nicht nur Wohnungen gibt, sondern auch Kindertagesstätten, Lebensmittelläden und Restaurants, darüber hinaus im Erdgeschoss Geschäfte und Büros.
Obwohl die Straßenzüge immer noch amerikanisch aussehen, ist es leider schwierig, Einzelheiten in Ökotopia zu erkennen, um sich zurechtzufinden. Denn auf den Häuserfassaden sind nur sehr kleine Hinweisschilder erlaubt; Straßenschilder sind rar und schwer auszumachen, meistens sind sie an Gebäuden an Straßenecken angebracht. Schließlich fand ich aber den Weg zurück zum Bahnhof, holte meinen Koffer ab und suchte ein nahegelegenes Hotel auf, das man mir als angemessen für einen Amerikaner empfohlen hatte – gleichzeitig sollte es mir einen Eindruck davon vermitteln, »wie die Ökotopier leben«. Dieses ehrenwerte Etablissement wurde seinem Ruf gerecht, da es kaum zu finden war. Aber es bietet ausreichend Komfort und wird mir als meine Basisstation dienen.
Wie alles andere in Ökotopia ist auch mein Zimmer voller Widersprüchlichkeiten. Es ist gemütlich, wenn auch gemessen an unseren Standards ein bisschen altmodisch. Das Bett ist grauenhaft – es hat keine Sprungfedern, sondern bloß eine Kaltschaummatratze auf einem Brett –, aber dafür ist es mit einer luxuriösen Daunendecke versehen. Es gibt einen großen Schreibtisch, ausgestattet mit einer Kochplatte und einem Teekessel. Die Tischoberfläche ist aus schlichtem, unbearbeitetem Holz, das viele rätselhafte Flecken aufweist – aber dafür steht auf dem Tisch ein kleines, schickes Bildtelefon. (Auch wenn die Ökotopier vielen modernen Errungenschaften ablehnend gegenüberstehen, so besitzen sie doch ein paar Apparate, die sogar noch besser als unsere sind. Ihre Bildtelefone zum Beispiel lassen sich weitaus besser bedienen als unsere, müssen dafür aber mit einem Fernsehbildschirm verbunden sein. Die Bildqualität ist ebenfalls sehr viel besser.) Hoch über meiner Toilette hängt ein Spülkasten eines Modells, das schon um 1945 in den Vereinigten Staaten nicht mehr gebaut wurde und mit einem Kettenzug mit sonderbar geschnitztem Griff bedient wird; beim Toilettenpapier muss es sich um irgendeine ökologische Scheußlichkeit handeln – es ist rau und schlicht. Aber die Badewanne ist ungewöhnlich groß und tief ausgelegt. Wie die Wannen, die immer noch in hochpreisigen japanischen Hotels in Gebrauch sind, besteht auch diese aus einer wohlriechenden Holzart.
Ich benutzte das Bildtelefon, um vorab die Vereinbarung für ein Treffen morgen mit der Ministerin für Ernährung zu bestätigen, bei dem ich damit beginnen werde, die ökotopischen Behauptungen näher unter die Lupe zu nehmen, es gebe ökologische Systeme im »stabilen Gleichgewicht«, ein Thema, das so viele Debatten ausgelöst hat.
(5. Mai.) Vielleicht sind sie doch in die Steinzeit zurückgekehrt. Am frühen Abend sah ich, wie eine Gruppe Jäger mit edlen Bogen und Pfeilen aus einem Minibus sprang, in dem sie ein kürzlich erlegtes Reh transportiert hatten. Zwei der Jäger hievten sich das an einem langen Ast herabhängende Tier auf die Schultern und gingen die Straße hinunter. (Ein großer Jagdhund trottete hinterdrein – das erste Haustier überhaupt, das ich in Ökotopia gesehen habe. Offensichtlich belässt man Tiere in der freien Natur, und die Menschen scheinen kein Bedürfnis zu verspüren, sie als Begleiter um sich zu haben.) Menschen liefen zusammen und verfolgten, was die Jäger taten, kleine Jungen drückten sich ganz aufgeregt bei den Erwachsenen herum. Die Jäger machten ganz in meiner Nähe Halt, um etwas auszuruhen – auch deshalb, so vermute ich, damit die Leute die Beute bewundern konnten. Einer von ihnen bemerkte meinen Blick und muss offenbar Abscheu in meinen Augen entdeckt haben. Er fuhr mit der Hand über die Wunde des Rehs, die noch feucht vom Blut war, ehe er mir mit den Fingern über die Wange strich, als wollte er mich in die Jagd mit einbeziehen. Ich wich erschrocken zurück, und die kleine Zuschauermenge lachte ziemlich gehässig, wie ich fand.
Als ich mich später mit ein paar Leuten dort unterhielt, erfuhr ich, dass die Gruppe unmittelbar am Stadtrand gejagt hatte – wo es offensichtlich viel Rehwild gibt. Die Jäger sahen hartgesotten aus (lange Messer, Bärte, grobe Kleidung), aber es handelte sich offensichtlich um ganz normale Bürger, die auf die Jagd gehen. Das Reh würde zerlegt, das Fleisch aufgeteilt werden: Wild deckt, wie ich höre, einen wesentlichen Bestandteil des Fleischbedarfs in der ökotopischen Ernährung; es wird für seine »spirituellen« Eigenschaften gepriesen!
Ob Lebensmittelknappheit die Ökotopier zu diesen Praktiken zwingt oder die Jagd die Folge einer absichtlich rückwärtsgewandten Politik ist, vermag ich noch nicht zu sagen. Doch die Szene war in der zunehmenden Dämmerung unheimlich genug. (Die meisten ökotopischen Straßen sind stockdunkel bei Nacht – offenkundig hat ihre Energiepolitik sie dazu veranlasst, die Straßenbeleuchtung nachts auf ein Minimum zu reduzieren. Kann nicht erklären, warum das nicht zu der Panik vor Verbrechen führt, die bei uns ausbrechen würde. Habe Leute gefragt, ob sie sich nachts sicher fühlen, und sie antworten ohne zu zögern mit Ja – behaupten, sie könnten immer noch genug sehen, und lenken das Gespräch dann auf irgendetwas Irrelevantes: wie Fahrradlampen aussehen, die sich wie Glühwürmchen hin und her durch die Nacht bewegen, oder wie schön es doch ist, sogar in der Stadt die Sterne sehen zu können. Gut, dass sie keine Autos haben, denn dann wäre die Unfallrate enorm.)
Gestern Abend etwas Ärger mit dem Zimmermädchen, weil sie meinte, ich nähme mir zu viele Freiheiten heraus. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass ich ein paar Blumen auf der Straße gepflückt und mit auf mein Zimmer genommen hatte. Offenbar pflücken Ökotopier keine Blumen, sondern erfreuen sich lieber dort an ihnen, wo sie wachsen, und das Zimmermädchen klärte mich auf eine eher neckische Weise darüber auf. Vielleicht wollte sie nur freundlich sein, schien mir aber schöne Augen zu machen, ohne sich dann wirklich auf das Spielchen einzulassen. Tja, macht die Sublimierung den Griffel stärker? (Nein, sie weckt in mir den Wunsch, Francine für ein oder zwei Tage zu mir zu holen.)
Ich ziehe mich gern gut an, aber mit meiner New Yorker Kleidung falle ich hier nur auf; deshalb habe ich mir eine neue Garderobe zugelegt. Einen dunkelgrünen Poncho mit Kapuze; der Stoff ist weich und so dicht gewebt, dass er, wie man mir erklärt, sogar den Regen abhält (und ich wahrscheinlich wie ein nasses Schaf riechen werde). Dazu ein paar weite Hemden in angemessen schreienden Farben, eine Weste, eine ausgebeulte Wildlederjacke, zwei Jeanshosen. Auch ein Paar robuste Schuhe – meine eleganten italienischen Straßenschuhe gehen hier gar nicht! Ich betrachte mich im Spiegel und muss lachen – würde ich in diesem Aufzug bei Francine an der Tür klingeln, würde sie die Polizei rufen. (Ein Spiel, das wir noch nie gespielt haben: Die Vergewaltigung durch einen ökotopischen Agenten, der sich heimlich nach New York schleicht und die Frau eines prominenten Journalisten verführt, um an geheime Informationen zu kommen.)
Soweit ich das auf meinen kurzen Shopping-Touren einschätzen konnte, enthält die Kleidung hier kein Nylon, Orlon, Dacron oder andere synthetische Bestandteile. (»Ich brauche ein paar Oberhemden, bügelfrei.« Ungläubiger Verkäufer: »Sie meinen ein Hemd mit synthetischen Fasern? Die haben wir zuletzt vor zwanzig Jahren verkauft.« Es folgte ein Vortrag: Bei der Herstellung von synthetischen Fasern werde zu viel Strom und Wasser verbraucht – außerdem könne man das nicht recyceln.) Mir fielen ein paar Kleidungsstücke auf, die auf ihren Etiketten voller Stolz verkünden, sie seien aus »wiederverwerteter Wolle«. Beides, Gewebe und Kleider, stammt aus heimischer Produktion – und die Preise erscheinen mir übertrieben hoch.
Mir gefällt die fetischistische Ablehnung von Kunstfasern nicht, aber ich hatte schon vergessen, wie angenehm sich ein gutes Baumwollhemd auf der Haut anfühlt. Diese Qualität wird noch von den Herstellern unterstrichen – sie weisen nämlich darauf hin, dass die Gewebe mehrmals gewaschen werden, ehe die Kleidung zum Verkauf angeboten wird …
Lebensmittel, Abwasser und »stabiles Gleichgewicht«
San Francisco, 6. Mai. Als ich im Ministerium für Ernährung zu meinem Interview mit der Ministerin ankam, musste ich zu meiner Enttäuschung feststellen, dass sie zu beschäftigt war, um mich zu empfangen. Stattdessen wurde ich einem Staatssekretär vorgestellt, einem Mann Anfang dreißig, der mich in einem Arbeitsoverall empfing. Für eine bedeutende Person wie ihn war auch sein Büro erstaunlich unscheinbar. Es gab keinen Schreibtisch, keinen Konferenztisch, keine bequemen Stühle. Entlang einer Wand standen einige überladene Aktenschränke und Bücherregale aus Holz, daneben Tische, auf denen sich in völliger Unordnung allerhand Papiere stapelten. Vor einer anderen Wand befand sich eine Art Laboreinrichtung mit den unterschiedlichsten Analyseapparaturen.
Auch der Staatssekretär ist, wie viele Ökotopier, aufreizend gelassen und spricht eher langsam mit tiefer Stimme. In einem sonnendurchfluteten Winkel des Büros räkelte er sich auf gewebten Kissen auf dem Boden, und zwar genau unter einem Oberlicht, von dem eine Art Efeu herabhing. Sein Laborassistent erhitzte derweil Teewasser auf einem Bunsenbrenner. Ich kauerte mich etwas umständlich nieder





























