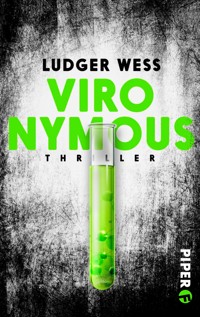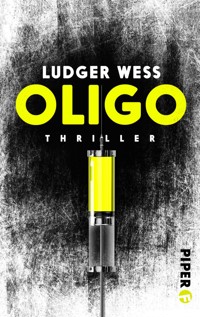
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bei seiner Recherche für eine Titelstory stößt Journalist Tom Berner auf eine große Geschichte: Kaufen islamistische Terroristen online Zutaten, aus denen sie Erreger der tödlichen Ebola-Seuche herstellen können? Die Indizien sprechen dafür: In Istanbul stößt Berner auf ein Biotech-Unternehmen, das den Terrorismus zu unterstützen scheint. Doch als mitten in Rom ein Mordanschlag auf den Journalisten verübt wird, wird ihm klar, dass sich mehr hinter dem Fall verbirgt, als anfänglich gedacht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-98292-4
Überarbeitete Neuausgabe Januar 2017
© der Originalausgabe: tredition, Hamburg 2012
© für diese Ausgabe: Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: © Yanchous, dencg/shutterstock.com
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
oli|go-, Oli|go-, (vor Vokalen:) olig-, Olig- [griech. olígos]: Best. in Zus. mit der Bed.: wenig, klein, gering
Oli|go (Molekularbiol.): Abk. f. Oligo|nukleotid: kurze Nukleinsäure, meist Bez. für ein synthetisches DNA-Fragment mit definierter Sequenz, das als Gensonde oder zur Herstellung größerer Einheiten (Gene, Genome) verwendet wird.
PROLOG
Die Erde ist entweiht durch ihre Bewohner; denn sie haben die Weisungen übertreten,
die Gesetze verletzt, den ewigen Bund gebrochen.
Darum wird ein Fluch die Erde zerfressen; ihre Bewohner haben sich schuldig gemacht.
Darum schwinden die Bewohner der Erde dahin, nur wenige Menschen werden übrig gelassen.
Jesaja 24
Kapitel I
Mai 2018
Tom fand nie heraus, wie es begonnen hatte.
Tatsächlich hatte alles, was folgen sollte, seinen Ursprung in den Bergen. Die meisten Pläne zur Beseitigung von Menschen, die als schädlich und minderwertig erachtet wurden, wurden im Gebirge beschlossen, auf dem Obersalzberg, im Kaukasus oder im Hindukusch. Berge lassen Menschen unbedeutend erscheinen.
Die zwei Männer waren schon seit dem Morgengrauen unterwegs. Am Anfang ihrer Wanderung hatte noch Raureif die Halme bedeckt und der Atem hatte Wölkchen gebildet. Inzwischen brannte die Maisonne. Sie erreichten einen Hang, der nach Süden lag. Das Gras war noch kurz, aber dazwischen blühte es schon weiß und violett. In Mulden und an schattigen Plätzen lagen Reste von harschigem Schnee. Es war windstill, und außer ihren Schritten und den kurzen Rufen von ein paar Dohlen war nichts zu hören. Rundherum waren nur Berge, kahl, karstig und schneebedeckt. Konzentriert und schweigsam setzten die zwei ihre Schritte.
Sie waren Freunde, schon seit Jahrzehnten, und beide hatten sie die sechzig weit überschritten. Der Kleinere, der bereits ein wenig kurzatmig war, blieb stehen, um tief Luft zu holen. Immer häufiger spürte er sein Alter, und in letzter Zeit dachte er öfter an den Tod. Er würde nur noch wenige Jahre Gelegenheit haben, etwas zu bewirken; es wurde Zeit, sich zu entscheiden. Er sah seinem Freund hinterher, der zügig weiter den Berg hinauf stieg – immer voller Energie, das sagten sogar seine Feinde vor laufenden Kameras.
Schon der Gedanke, dass im Fernsehen über ihn geredet würde, ließ ihn schaudern. Er stand nicht gern im Mittelpunkt. Es war ihm recht, dass ihn nur Spezialisten kannten, die sich mit den Geld- und Warenströmen rund um das Mittelmeer beschäftigten. Doch selbst diese Fachleute wussten nicht, dass sein Vermögen ausgereicht hätte, ihm einen Platz auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt zu bescheren. Aber was nutzte Geld, wenn Werte und Überzeugungen zerfielen?
Mit seinem Taschentuch wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Das Klettern strengte ihn an. Früher, in den Dörfern seiner Kindheit, als ein Auto noch eine Sensation gewesen war, hatten lange Fußmärsche durch steiles, unwegsames Gelände zum Alltag gehört. Aber das war lange her. Wer heute auf dem Land noch zu Fuß ging, wurde bemitleidet oder verspottet. Rasend schnell hatte sich alles verändert, die Menschen waren träge und bequem geworden. Alte Werte und Tugenden galten immer weniger, und niemand war da, der sich darüber empörte und »Halt!« schrie, um ihren Verfall aufzuhalten. Er rammte seinen Wanderstock in den Boden und stapfte weiter den Hang hoch.
Sein Freund verlangsamte seinen Schritt und drehte sich um. »Lass uns eine Rast einlegen! Der Blick von hier ist schön. Da am Fels ist ein guter Platz.«
Dankbar stimmte er zu.
Kaum hatte er den Stein erreicht, lehnte er seinen Stock dagegen, nestelte den Rucksack vom Rücken und ließ sich auf den Boden fallen. Von unten, sein Tuch noch in der Hand, um sich auch den Nacken auszuwischen, sah er den Freund fragend an. »Du bist viel besser in Form als ich, du brauchst keine Brille, und deine Haare hast du auch noch. Wie machst du das?«
»Eine Gottesgabe, nehme ich an.« Sein Gefährte hatte schon seinen Rucksack geöffnet und breitete Äpfel, Datteln und Nüsse auf einem Tuch aus. »Vielleicht ist es aber auch der Zorn, der mich jung hält.«
»Zornig war ich auch, aber ich habe resigniert – du nicht!« Er legte das Tuch beiseite und griff nach seinem Wasserbeutel. »Ich bin vor vielen Jahren hierhergekommen, um Frieden zu finden. Ich hätte es besser wissen müssen. Die Kultur der Unruhestifter breitet sich aus wie ein Krebsgeschwür!« Er lachte bitter. »Sie fallen hier ein, ungefragt und ungebeten, mischen sich in alles ein, stellen täglich neue Forderungen. Nur ihre Sitten und ihre Gebräuche zählen. Respekt vor unserem Glauben, unserer Kultur, unseren Heiligtümern kennen sie nicht.« Er beschattete seine Augen mit der Linken und starrte in die Ferne. Weit unten im Tal glitzerte ein Fluss. »Und was habe ich getan? Ich habe Augen und Ohren verschlossen, damit die schlechten Nachrichten mich nicht mehr erreichen.«
»Zu welchem Entschluss bist du gekommen?«
»Dein Vorschlag war ein Weckruf.« Er tat einen tiefen Zug aus seinem Wasserbeutel. »Ich bin alt, und gerade deswegen muss ich mich empören. Was habe ich zu verlieren? Alles muss anders werden! Es geht nicht nur um die Fremden. Du hast vollkommen recht! Die ganze Menschheit ist ungläubig und unmoralisch geworden. Sie braucht ein Zeichen, eine Warnung zur Umkehr, und dann muss jeder Einzelne sich entscheiden.«
»Ich kann also auf dich zählen?«
»Auf mich, auf mein Geld und meine Verbindungen. Ich bin dabei!«
Sein Freund legt ihm den Arm auf die Schulter. »Gott ist groß, und Sein Wille geschehe.« Der andere erwiderte die Geste.
In diesem Moment erschien mit einem schrillen Schrei direkt über ihnen ein großer Greifvogel. »Ein Milan«, sagte der Größere. »Sieh dir seinen Gabelschwanz an.«
Sie schauten zu, wie er sich in der aufsteigenden warmen Luft immer höher schraubte.
»In der Sprache meiner Mutter heißt er ›Der mit Macht und Anmut fliegt‹. Man erzählt von ihm, dass er nach einem Buschfeuer glimmende Äste packt und sie über trockenem Gras fallen lässt, um damit ein neues Feuer zu legen. So kann er sich die flüchtenden Mäuse und Schlangen greifen.«
Sie sahen dem Raubvogel nach, bis er nur noch ein Punkt am Himmel war. Sekunden später sagten beide gleichzeitig: »Milan-Projekt!« Sie lachten.
»Abgemacht«, sagte der Große. »So nennen wir es.« Er drückte die Schulter seines Freundes. »Du sorgst für Geld und Kontakte, und ich lasse den Milan fliegen. Ich schicke dir jemanden, schon in einer Woche. Er wird alle Einzelheiten mit dir besprechen.«
Dann beteten sie, aßen und sprachen erneut ein Gebet. Schweigend machten sie sich bereit, weiter zu wandern.
Kapitel II
Juli 2018
»Dieses marmorne Grab umschließt Ferdinand von Aragón und Isabella von Kastilien, Gemahl und Gemahlin, allerseits die Katholischen geheißen, die Vernichter der Mohammedanischen Sekte und Auslöscher der ketzerischen Falschheit.«
Vor dem Grabmal des Königspaars in Granadas Capilla Real drängten sich die Menschen: indische Familien, japanische Austauschschüler und Gruppen von bleichen nordeuropäischen Touristen, die sich um Fremdenführerinnen mit hoch erhobenen Schirmen scharten. Ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen schob ihren noch kleineren Bruder in seiner Kinderkarre zwischen den Bänken umher, und vorn, direkt am Gitter vor den imposanten Marmorschreinen, beugte sich ein älterer Mann mit einer Baskenmütze auf dem Kopf nach vorn, um die in klaren Lettern gemeißelte lateinische Inschrift durch die Gitterstäbe hindurch zu fotografieren.
Er kam nicht mehr dazu, auf den Auslöser zu drücken. Als er den Bildausschnitt gewählt hatte, flammte in der Menge hinter ihm grelles Licht auf, und es gab einen gewaltigen Stoß, der ihn mit dem Kopf voran in die Gitterstäbe katapultierte. Den ohrenbetäubenden Knall, der folgte, hörte er schon nicht mehr.
Überlebende berichteten später entsetzt, wie vor ihren Augen Menschen gegen Wände und Säulen flogen und ihre zerschmetterten Körper dann wie in Zeitlupe zu Boden rutschten. Die erste Explosion am Morgen des 16. Juli 2018 forderte 29 Todesopfer, unter ihnen zwei Kinder, die mit seltsam verrenkten Gliedern auf den Königsgräbern gefunden wurden, als hätte jemand achtlos zwei Puppen dorthin geworfen.
Anderthalb Minuten später – der Staub und der stechend scharfe Geruch von Sprengstoff wälzten sich noch durch die Kathedrale – zündete eine zweite Bombe, direkt neben einer Säule nahe des Ausgangs, zu dem sich in wilder Panik die Überlebenden drängten. Fast einhundert Menschen wurden zerfetzt oder von den Trümmern der Säule und der teilweise einstürzenden Decke erschlagen.
Zehn Minuten danach, inmitten des Chaos in den engen Gassen um die Kathedrale von Granada, während Sanitäter und Sicherheitskräfte sich bemühten, zu den Verletzten vorzudringen, folgte die dritte Explosion. In der an dieser Stelle kaum fünf Meter breiten Calle de la Cárcel Baja, direkt vor der Euroarabischen Stiftung für Höhere Studien, explodierte eine Autobombe, versteckt in einem Lieferwagen. Fenster zerbarsten, Menschen standen in Flammen. An den Hauswänden klebten Blut und Fleischfetzen, und es roch nach verbrannter Haut.
Flüchtende stolperten über Tote und Verletzte, brennende Menschen irrten schreiend von einer Straßenseite zur anderen, zu Boden gerissen von einigen wenigen beherzten Helfern, die die Flammen zu löschen versuchten. Dutzende andere saßen blutüberströmt und wie betäubt auf dem Pflaster. Wieder andere rannten und rannten, schreiend und mit weit aufgerissenen Augen, Kinder und Freunde hinter sich herziehend. Hysterie erfasste die Stadt, die das öffentliche Leben für Tage zum Erliegen bringen sollte.
Am Abend belief sich die Zahl der Toten auf 183. In den folgenden Tagen stieg sie weiter und kletterte in der Woche nach den Anschlägen auf 218.
Die Bergungsarbeiten waren wegen akuter Einsturzgefahr der Kathedrale äußerst schwierig. Tage nach der Explosion fanden die Bergungsmannschaften noch immer Leichen und Körperteile, darunter den abgetrennten, bärtigen Kopf eines der Attentäter, der später als Schüler des als Hassprediger bekannten italienischen Imams Hafid El Korchi identifiziert wurde.
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Organisation Saif al-Islam bereits zu dem Anschlag bekannt. Al Jazeera verbreitete ein Video, in dem aber nur Standfotos zu sehen waren. Die üblichen Bilder von bis an die Zähne bewaffneten Kriegern wechselten mit Fotos von jungen Männern in Labors, umgeben von technischen Geräten, ab. Ein Sprecher erklärte mit erhaben klingender Stimme, dass die Siege der Ungläubigen über die Führer Saif al-Islams ebenso wie die Siege des Christentums über den Islam nur vorübergehend gewesen seien. »Wird einer getötet, erheben sich hundert. Stärker als zuvor holen wir uns zurück, was uns schon gehörte, und, so Allah (Friede sei mit ihm) es will, werden wir seine Mission vollenden. Wir haben euch gewarnt, oh, ihr Ungläubigen – euer Blut wird sich mit euren Tränen mischen, und dies ist erst der Anfang. Der Tod wird euch finden, auch wenn ihr euch in euren Häusern versteckt.«
Den pathetischen Worten folgten die Stellungnahmen westlicher Politiker, die von verabscheuungswürdigen Taten sprachen, deren Hintermänner zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Der Papst verurteilte den Anschlag als unmenschlich und grausam, nahm aber den Islam ausdrücklich in Schutz. Es werde einer Handvoll irregeleiteter Fanatiker nicht gelingen, einen Keil zwischen Christen und Muslime zu treiben: »Wir betrachten den Islam mit Hochachtung und werden uns weiterhin aufrichtig um gegenseitiges Verstehen bemühen, damit wir gemeinsam für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen eintreten.« Er rief die Regierungen dazu auf, sich nicht vom Geist der Rache und der Vergeltung leiten zu lassen und nicht abermals Hass und Tod zu säen, sondern mit »Werken des Friedens Licht in das Dunkel« zu bringen.
Kardinal Julio Aznar hingegen, der aus Rom in seine Heimat geeilt war, um den Trauergottesdienst für die Opfer zu halten und Angehörigen und Verletzten Trost zu spenden, ließ in seiner Predigt und in zahlreichen Interviews keinen Zweifel daran, dass er die Gemeinschaft der Muslime für mitschuldig hielt. Er beklagte bitter, dass kein hoher islamischer Würdenträger den Terrorismus verdammt habe und dass es in keinem muslimischen Land Demonstrationen gegen den Terror gebe. »Empörung gibt es dort nur dann, wenn Moslems durch Andersgläubige ums Leben kommen. Das Leben von Christen ist in den Augen der Anhänger des Islams nichts wert. Dieses Attentat ist eine Kriegserklärung an die Christenheit, und es wird Zeit, die menschenverachtenden Expansionsgelüste des Islams in die Schranken zu weisen.«
Kapitel III
Tom Berner, Reporter bei Epoca, bekam von alledem nichts mit. Er hatte Urlaub genommen, aber er war nicht in den Ferien, sondern auf der Flucht, versteckt hinter Pinien und Zypressen in einem abgelegenen Häuschen in der Toskana, umgeben von dicht bewaldeten Hügeln. Es gab weder Fernsehen noch Radio noch Handyempfang, und die alten Epoca-Hefte, die in der Ferienwohnung neben abgegriffenen Krimis und Tourenvorschlägen des Fremdenverkehrsbüros im Bücherregal lagen, hatte er sofort in die Mülltüte gestopft.
Doch es ist unmöglich, seinen Träumen zu entkommen. Auch in dieser Nacht hatten sie ihn wieder gefunden und ihn mitgerissen in eine Wüste, auf den Rücksitz eines Geländewagens. Es ist stickig und heiß, die Zunge klebt am Gaumen, zwischen den Zähnen knirscht Sandstaub, und die Lippen sind rissig. Ein Schlagloch erschüttert den Wagen, und für einen kurzen Moment tauchen die vom Qat-Genuss rot geränderten Augen des Fahrers im Rückspiegel auf. Sie passieren ein von Kugeln durchlöchertes Straßenschild. Noch 200 Kilometer bis Kabul. Hinter einer Kurve liegen ein paar Felsbrocken auf der Straße. Der Fahrer flucht, während er auf die Bremse tritt. Dann gibt es einen Schlag wie von einer Riesenfaust, der Jeep bäumt sich auf, die Motorhaube fliegt davon und für einen Moment scheint es, als ob der Wagen in der Luft stehen bliebe. Sekunden später trifft er so hart auf der Piste auf, dass die Zähne aufeinander schlagen und der Atem wegbleibt. Ein Stakkato von Schüssen ist zu hören, Schreie, Schüsse, und noch mehr Schreie.
Es war sein eigener Schrei, der ihn weckte. Benommen und schweißgebadet tastete er neben sich. Wo war Franca? Gerade hatte sie noch neben ihm gesessen, dann war das Maschinengewehrfeuer zu hören gewesen, und sie war zusammengesackt.
Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Er keuchte, als hätte ihm jemand die Kehle abgedrückt. Dann fand er den Lichtschalter.
Er war nicht bei Franca gewesen, als es passiert war. Er hatte in einer Bar am Strand von Ostia über Horden von Strandurlaubern hinweg aufs Meer gestarrt und sich mit viel zu süßen Cocktails betrunken. Irgendwann an diesem Nachmittag hatte es viertausend Kilometer östlich einen Blitz und einen Knall gegeben. Die Explosion hatte den Jeep, in dem Franca mit einem Fahrer und einem italienischen UN-Mitarbeiter saß, in zwei Teile zerrissen. Keiner der drei hatte überlebt.
Und er, Tom, war schuld daran.
Heute, genau heute vor zwölf Monaten war es passiert. Er hatte Franca nicht begraben können, er hatte nicht einmal den Ort besuchen können, an dem sie umgekommen war. Die Taliban hatten das Gebiet fest in der Hand, nicht einmal die US-Armee wagte sich dorthin. Wieder und wieder hatte er stattdessen die Straße, auf der es passiert war, auf den Satellitenfotos im Internet abgesucht, aber dort war nichts zu sehen als Sand und Felsen.
Die Attentäter hatten sich mit Francas sterblichen Überresten fotografiert; lachend hatten sie davor posiert wie Jäger vor ihrer Beute. Zwei Monate später hatte das italienische Außenministerium die Reste von Francas Ausrüstung in die Redaktion geschickt: zwei demolierte Kameras und ein nahezu unversehrtes Weitwinkelobjektiv. Sonst war ihm nichts von ihr geblieben – abgesehen von ihrem Namen auf dem Türschild des Reportageteams von Epoca.
»So lange hier noch irgendjemand arbeitet, der Franca gekannt hat, bleibt der Name da dran, verstanden?«, hatte der kleine Ugo, Fotograf genau wie Franca, den Hausmeister angebrüllt, als der zwei Wochen nach ihrem Tod mit dem Schraubenzieher anrückte, um ihr Namensschild zu entfernen. Als der nicht gleich parierte, war Ugo mit einem schweren Teleobjektiv auf ihn losgegangen.
Kapitel IV
Kaffee, er brauchte jetzt einen starken Kaffee. Während er auf die blubbernde Caffettiera starrte und versuchte, den Traum zu vergessen, dachte er an die Bemerkung seines Chefs, der ihn in Urlaub geschickt hatte: »Sieh zu, dass du wieder in Ordnung kommst! Du hast deinen Biss verloren, das sagt sogar der Außenminister – seine Pressestelle fürchtet sich nicht mehr vor deinen Anrufen.«
Als der Kaffee fertig war, trat Tom auf die Terrasse. Die kühle Luft tat gut. Er betrachtete die Sterne, folgte mit den Augen dem Verlauf der Milchstraße und sog den Duft der Bäume ein, der vom Tal her aufstieg.
Ein paar Augenblicke später kam eine getigerte Katze aus der Dunkelheut angelaufen, sprang mit einem kurzen Maunzen über die niedrige Umfassungsmauer und strich um seine Beine. Sie folgte ihm bis zu dem weißen Gartenstuhl, der in der Dunkelheit schimmerte, und als Tom sich setzte, sprang sie auf seinen Schoß und putzte sich. Manchmal hielt sie inne, hob den Kopf und starrte mit nach vorn gestellten Ohren in die Ferne. Tom hörte nichts als das Rauschen des Bachs im Tal hinter dem Häuschen und streichelte die Katze, bis sie zu schnurren begann. So saßen sie, bis es im Osten zu dämmern begann und die Sterne verblassten. Ein Käuzchen rief in der Ferne, und zwei Fledermäuse drehten gaukelnd ihre letzten Runden um das Haus.
Tom wusste jetzt, was zu tun war.
Als er anderthalb Stunden auf dem Weg nach Rom eine Autobahnraststätte ansteuerte und die Titelseite des neuesten Epoca-Hefts sah, mit einem Foto der halb eingestürzten Kathedrale von Granada und dem Kopf des Attentäters, wusste er, dass seine Entscheidung richtig war. Er schaltete sein Handy ein: 25 Anrufe in Abwesenheit, 18 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Er ging die Anrufliste durch und wählte den Menüpunkt »Alle löschen«.
Kapitel V
Oktober 2018
Tamar Ciller fluchte und sprang aus seinem Schreibtischsessel auf. Er hatte sich am Teeglas verbrannt und dabei vor Schreck das starke, süße Gebräu über die Finanzübersicht des letzten Quartals geschüttet. Er griff nach einer Serviette und wischte den Tisch trocken. Zum Glück war nichts über seinen Anzug gelaufen. Aber die Tabellen waren hinüber, die Zahlen verwischt und unleserlich.
Er hatte schon das Telefon in der Hand, um seine Sekretärin um einen neuen Ausdruck zu bitten, aber dann legte er es zurück. Aishe war schon gegangen und er wusste auch ohne diese Tabellen, dass es seiner Firma schlecht ging, hundsmiserabel, um genau zu sein.
So hatte er sich das nicht vorgestellt, als er seinen lukrativen Job in Deutschland aufgegeben, seine Aktienpakete zu Geld gemacht und alles in TurkBio investiert hatte, sein Unternehmen, von dem er noch immer hoffte, dass es eines Tages das führende Biotechnologie-Unternehmen im Nahen Osten, mindestens aber in der Türkei sein würde. Aber davon war er weiter entfernt als je zuvor.
Es gab keine Aufträge, abgesehen von den staatlichen Impfstoff-Bestellungen, aber mit denen war nichts anzufangen, denn die Verwaltung zahlte nicht. Mit der Privatisierung der Impfstoffproduktion war das Institut aus dem Blick der Beamten verschwunden. Dass Gehälter und Lieferanten zu zahlen waren, interessierte niemanden. Die Amtschefs, die man früher hatte schmieren können, waren jetzt für andere Geschäftsbereiche zuständig und außerdem verärgert, dass sie die Privatisierung nicht hatten verhindern können. Beschwerden verliefen im Sand.
Entnervt warf er die Serviette in den Papierkorb und trat ans Fenster. In der Ferne glänzte der Bosporus in der Sonne, ein Frachter nach dem anderen glitt langsam durch die Meerenge, und von der großen Brücke blitzten die Scheiben der Autos hinüber, die sich in endlosen Schlangen zwischen Europa und Asien hin und her schoben. Er hatte immer davon geträumt, wieder nach Hause zurückzukehren, als gemachter Mann, weg aus Deutschland mit seinen nasskalten, endlosen Wintern, seinen Vorschriften für alles und jeden, der schlechten Stimmung und den Vorurteilen.
Am Anfang hatte alles rosig ausgesehen. TurkBio zog in ein nagelneues Gebäude, die Mitarbeiter waren noch aus Institutszeiten ein eingespieltes Team, es gab Startkapital vom Staat, Steuervorteile und eine boomende Börse, nachdem die EU im Dauerstreit mit der Türkei eingelenkt hatte. Gute Leute waren auch zu kriegen, denn viele türkischstämmige Akademiker, die in Deutschland ausgebildet worden waren, zog es zurück in die Heimat, weil der Staat gerade kräftig in Forschung und Bildung investierte und es in Deutschland wirtschaftlich bergab ging. Die Zeitungen verglichen die Lage mit den dreißiger Jahren, als deutsche Emigranten in der Türkei für ein Aufblühen der Wissenschaft gesorgt hatten. Aber dann hatte sich gezeigt, wie zerbrechlich das Verhältnis zwischen Türkei und EU war: Es gab erneut Streitereien, Drohungen und Gegendrohungen, und seit dem Putsch, genauer gesagt, den Säuberungswellen, die darauf folgten, herrschte Eiszeit. Der Boom war vorbei, auch wenn die Zentralbank das Land mit billigem Geld überschwemmte. Zudem war allen schönen Worten über das Hightech-Land Türkei zum Trotz der Beamtenapparat noch nicht einmal im 20. Jahrhundert angekommen. Die Verwaltung lebte noch in Byzanz.
Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, betrachtete Tamar die lange Reihe der Schiffe, die durch die Meerenge zogen. So schlecht konnte es der Wirtschaft doch nicht gehen! Andererseits – was dort unten schwamm, waren Produkte der alten Industrien: Textilien, Motoren, Fahrzeugteile, Haushaltsgeräte. Biotechnologie aus der Türkei war Neuland, nichts für Investoren, die sowieso schon zögerten, wenn es um die Türkei ging. Sie warteten ab, wie sich die politische Situation entwickelte. Bis dahin fanden sie genügend Investitionsmöglichkeiten im restlichen Europa.
Zwar hatte Pierre Hadrout angebissen, ein libanesischer Investor, der rund um das Mittelmeer in Biotechnologiefirmen investierte, aber auch der hatte ihn nicht gerade mit Geld überhäuft. Zu allem Überfluss hatte er ihm einen Finanzchef vor die Nase gesetzt, aus dem er nicht schlau wurde.
Erst war er von dem neuen Mann begeistert gewesen. Toros Aldemir stammte aus der Türkei und hatte in den USA studiert. Seine Kompetenz und sein Netzwerk waren beeindruckend, aber ihm fehlte jeglicher Teamgeist: Er war verschlossen und wortkarg bis zur Schroffheit und schien nicht einmal zu bemerken, wie sehr er dadurch alle Mitarbeiter gegen sich aufbrachte.
Aishe, die junge Firmensekretärin, die sonst keine Probleme hatte, sich durchzusetzen, war eine Woche nach Aldemirs erstem Arbeitstag ins Chefzimmer gestürzt und hatte wutentbrannt ihre Kündigung auf den Tisch geknallt: »Dieser Mann ist kalt wie ein Fisch, und er verachtet mich! Das lasse ich mir nicht gefallen! Ich gehe, und zwar sofort.« Es hatte ihn Mühe gekostet, sie zum Bleiben zu bewegen: »Das gibt sich bestimmt«, hatte er gesagt. »Er war lange in den USA, da muss man so kühl sein.«
Dann hatte jemand herausbekommen, dass Aldemir Marathonläufer war, und die fünf Mitarbeiter, die jedes Jahr am Eurasia-Marathon von Üsküdar nach Beyoglu teilnahmen, hatten ihn hoch erfreut zum gemeinsamen Training eingeladen. Aldemir hatte sie bedenkenlos brüskiert: »Ich trainiere grundsätzlich allein.«
Auf Cillers Bitten, ein wenig mehr Teamgeist zu zeigen, hatte Aldemir nicht reagiert, und nach wie vor beteiligte er sich nicht an Geselligkeiten, Festen oder gemeinsamen Mittagessen. Verheiratet war er nicht, eine Freundin schien er auch nicht zu haben und über seine Familie wusste man nichts – kurzum, die Mitarbeiter hatten begonnen, ihn zu hassen. Es verging keine Woche, ohne dass Aishe ihm voller Empörung neue Zusammenstöße berichtete, die sie oder andere Mitarbeiter mit Aldemir gehabt hatten. »Wenn das so weitergeht«, hatte Aishe gesagt, »werden wir etwas unternehmen!«
Tamar hatte erstaunt die Augenbrauen gehoben: »Was zum Beispiel?«
»Wir … ich«, hatte sie gestottert und einen roten Kopf bekommen, »wir … wir werden alle kündigen!«
Er strich sich mit beiden Händen über die Schläfen. Was sollte er machen? Ohne Aldemir hätte es kein Geld gegeben, und was noch wichtiger war, der Neue kannte sich in der Branche aus und hatte gute Verbindungen zur EU-Bürokratie. Diese Kontakte spielten die größte Rolle für TurkBio, denn Fördermittel aus den EU-Töpfen standen mittlerweile auch türkischen Unternehmen zu. Ausgezahlt hatte sich das bislang jedoch nicht. Aldemir hatte Zusagen erreicht, aber dann bewegte sich nichts mehr, weil es politische Reibereien zwischen der EU-Kommission, den Mitgliedsländern und der türkischen Regierung gab. Immer wieder wurden die Anträge auf Eis gelegt, Zahlungen verzögert und neue Unterlagen angefordert. Das ging nun schon seit Monaten so.
Bevor Hadrout eingestiegen war, hatte Tamar einige Lieferanten um Zahlungsaufschub bitten müssen, aber selbst mit der Finanzspritze von Hadrout war absehbar, dass es in spätestens einem halben Jahr wieder eng werden würde, falls nicht endlich Fördermittel kamen. Im schlimmsten Fall müsste er den Libanesen erneut um Geld bitten. Aber je mehr der investierte, desto größer wurde auch sein Besitzanteil an TurkBio, und Tamars eigener Anteil wurde kleiner. Schon der Gedanke daran ließ seinen Blutdruck steigen. Er war es doch, der das Unternehmen aufgebaut hatte, es waren seine Ideen, seine Patente, seine Initiative, die dieser Firma Leben eingehaucht hatten! Er würde das nicht preisgeben, auch wenn dieser Libanese ihn vor dem Bankrott gerettet hatte.
Missmutig wandte er sich vom Fenster ab, kehrte zum Schreibtisch zurück und stopfte die nassen Blätter der Finanzübersicht in den Reißwolf unter seinem Schreibtisch. Die Maschine sprang kraftvoll an, doch Sekunden später fraß sich der Mechanismus fest. Mit einem tiefer werdenden Knurren erstarb der Motor. Ein wütendes Summen noch, dann flogen die Sicherungen heraus. Der Computer zischte und der Bildschirm wurde schwarz.
Mit einem Wutschrei trat Ciller den Reißwolf um. Kunststoff splitterte. Ciller setzte nach und gab auch dem metallenen Papierkorb unter seinem Schreibtisch einen Tritt, sodass er quer durch das Zimmer schoss und auf der polierten Platte des kleinen Tisches in der Besprechungsecke landete. Dort hinterließ er einen tiefen Kratzer. Ciller war jetzt so in Rage, dass er einen der Sessel umstürzte und wie von Sinnen am Regal mit den Aktenordnern rüttelte, bereit, alles aus dem Fenster zu werfen, weit weg, am liebsten in den Bosporus.
Erst als ihm ein dicker Ordner auf den Kopf fiel, kam er wieder zu sich. Noch schnaufend stellte er den Sessel wieder auf und trug den verbeulten Papierkorb an seinen Platz zurück. Nur gut, dass Aishe nicht da war, sie wäre bestimmt hereingekommen.
Erschöpft ließ er sich in den Schreibtischsessel fallen und starrte aus dem Fenster. Der Himmel war jetzt vollkommen blau, nur ganz in der Ferne, in der oberen Ecke des Fensterausschnitts, zog eine kleine Wolke vorbei.
Er sah ihr nach, bis sie verschwunden war. Dann richtete er sich auf. Es hatte keinen Sinn, zu jammern oder sich aufzuregen. Er musste handeln. Er rückte mit dem Stuhl näher an den Schreibtisch und zog die mittlere Schublade auf, die für persönliche Dinge und Krimskrams reserviert war. Irgendwo darin musste sie liegen. Er holte einen Stapel Papier heraus – Autoprospekte, Angebote für Villen in Bahçeşehir, für Wochenendhäuser an der Ägäis, mit eigenem Strand und Anleger – und blätterte ihn durch.
Wenn mit den Impfstoffen nichts zu verdienen war, ließ sich doch auch etwas anderes mit den Geräten machen, zweckgebundene Zuschüsse hin oder her. Die Bürokraten blickten ohnehin nicht durch. Wo konnte sie sein? Dann hatte er sie gefunden, mitten zwischen den Yachtprospekten von der letzten Bootsmesse in Hamburg: die Visitenkarte von Ahmed el-Dschabir. Vorn prangte ein Wappen mit einem Greifvogel und zwei gekrümmten Schwertern. Er klappte sie auf. Edles Papier, der Name in Goldschrift geprägt, links in arabischer, rechts in lateinischer Schrift. Die Karte roch förmlich nach Reichtum, feinsinnigem Geschmack und vornehmer Zurückhaltung. So hatte auch ihr Besitzer gewirkt, ein älterer Herr aus Dubai, der ihn neulich bei der Eröffnung des neuen Klinikum-Gebäudes der Universität angesprochen hatte.
Warum hatte er bislang gezögert? Weil der türkische Traum Europa war und nicht die arabische Welt? Europa klang verlockend, Arabien rückwärtsgewandt. Aber im Nahen Osten war Geld zu holen, viel Geld, und es gab keinen Grund, diese Quellen nicht anzuzapfen.
Noch einmal ging er ans Fenster und schaute auf die Stadt und das Meer. Nein, er würde hier nicht scheitern, um keinen Preis. Er steckte die Karte in die Innentasche seines Jacketts. Es war besser, el-Dschabir von zu Hause aus anrufen und keine Spuren im Telefonsystem der Firma zu hinterlassen.
Kapitel VI
Oktober 2018
Für einen Einbruch gibt es in Reykjavik keinen besseren Zeitpunkt als die ersten Morgenstunden des Samstags. Die gesetztere Hälfte der 120.000 Einwohner des Städtchens liegt satt und mehr oder weniger betrunken in den Betten, während alle, die jünger sind als 40, noch die Restaurants und Bars des Hafenviertels bevölkern, feiern, tanzen und vor allem sehr viel trinken.
So stand es in jedem Reiseführer, aber er hatte sich vorsichtshalber mit eigenen Augen überzeugt. Am Wochenende um Mitternacht gab es im Vergnügungsviertel der isländischen Hauptstadt den größten Stau der Woche und einen Menschenauflauf, den man andernorts nur bei Großveranstaltungen finden würde.
Er parkte den Leihwagen abseits des Universitätsgeländes und schlenderte mit hochgeschlagenem Jackenkragen auf das flache, helle Gebäude zu, das am Rand des Campus gelegen war. Es hatte zu schneien begonnen.
Der Schnee war ein Glücksfall. Die dicken, weißen Flocken versteckten ihn hinter einem Vorhang und dämpften alle Geräusche, und sie ließen sehr zuverlässig sämtliche Fußspuren verschwinden.
Er hatte das Gebäude am Morgen mit einer Gruppe Studenten betreten und sich umgesehen. Im Erdgeschoss befanden sich Seminarräume und ein Hörsaal mit Blick auf den Atlantik. Außentüren und Fenster waren alarmgesichert, aber im ersten Stock, wo das Zimmer lag, das er suchte, hatte man schon gespart. Die Fenster der Toiletten waren einfach und ungesichert.
Dorthin zu gelangen war ein Kinderspiel, denn der Architekt hatte die Fassade mit Lavasteinen dekoriert. Er kletterte von einem Mauervorsprung zum nächsten, schwang sich auf das leicht abschüssige Vordach, kroch dann, um nicht abzurutschen, auf allen Vieren an das Fenster heran, und während er sich mit einer Hand am Fensterbrett festhielt, holte er mit der anderen einen Geißfuß aus der Tasche und hebelte es auf. Dann war er drinnen.
Die Türen zum Labortrakt waren alle abgeschlossen, aber auch sie waren leicht zu öffnen. Er gab sich keine Mühe, Spuren zu vermeiden. Nur der Zweck des Einbruchs musste verborgen bleiben. Er durchschritt die Labors und kam am Ende an eine Tür, die nach seiner Berechnung zum Arbeitszimmer des Professors führen würde. Sie war nicht verschlossen.
Er ließ die Blenden vor den Fenstern herunter, schaltete seine Taschenlampe ein und begann mit der Suche. In den Regalen und im Schreibtisch war nichts Interessantes. Was er suchte, musste in dem großen, metallenen Aktenschrank sein, dessen Türen abgeschlossen waren. Aber er hatte lange genug in verschiedenen Firmen gearbeitet, um zu wissen, dass die Schlüssel zu Büroschränken meist unter einem Gegenstand auf dem Schreibtisch lagen, oder oben auf den Schränken – so wie hier.
Er öffnete die Türen und blickte auf zwei Reihen von Ordnern mit Verträgen, Patentanträgen und Manuskripten, alle fein säuberlich beschriftet. Er zog den ersten heraus, legte ihn auf den Boden, nahm seine Kamera aus der Tasche und begann, Blatt für Blatt abzufotografieren.
Drei Stunden später war die Arbeit getan. Er überprüfte, ob sich alles wieder an Ort und Stelle befand, schloss den Schrank ab, deponierte den Schlüssel wieder an seinem Platz und zog die Blenden hoch.
Jetzt begann der nächste Teil seiner Arbeit. Er durchwühlte alle Schubladen und machte sich nicht die Mühe, sie wieder zu verschließen. Im Labor nahm er wahllos Flaschen aus den Regalen, öffnete die Schranktüren und füllte seinen Rucksack schließlich mit einer Flasche 96%igem Alkohol, einem Kunststoffbehälter mit Bernsteinsäure und einem Liter P2P, der Grundstoff für viele Drogen war. Zum Schluss steckte er einen GPS-Empfänger ein, den jemand auf einem der Labortische liegen gelassen hatte. Es würde alles so aussehen, als ob ein Junkie auf der Suche nach Chemikalien und Wertgegenständen gewesen war.
Kapitel VII
»Er hat angebissen. Der Bruder hatte Recht. Er ist geldgierig.«
»Es war nicht schwer, das herauszufinden. Er hat wirklich keine Zweifel?«
»Er hat mich angerufen, und ich habe ihn zappeln lassen. Den letzten Termin habe ich kurzfristig abgesagt. Das ist das beste Rezept: Du winkst mit Millionen, machst dich rar, ziehst die Verhandlungen in die Länge und feilschst um Details. Dann hast du sie am Haken. Die Aussicht auf viel Geld lässt die meisten unvorsichtig werden.«
»Ich sehe, die Sache ist bei dir in guten Händen. Aber bleib vorsichtig. Du musst immer darauf gefasst sein, dass man dich beobachtet.«
»Das ist mir bewusst.«
»Wann trefft ihr euch?«
»Nächste Woche Mittwoch. Ich habe mich in einem Halal-Hotel einquartiert, kein Alkohol, keine gottlosen Filme und Trennung der Geschlechter.«
»Hat Bruder 2 dich instruiert?«
»Ich bin die Listen Punkt für Punkt mit ihm durchgegangen. Er hat mir alles erklärt.«
»Wenn du noch Fragen hast, ruf uns an, mich oder den Bruder. Den Vertragsentwurf bekommst du von uns, zusammen mit den neuen Instruktionen.«
»Das werde ich. Ich schicke euch einen genauen Bericht, sobald ich ihn getroffen habe.«
Kapitel VIII
Es war so einfach. Jeder Biologiestudent konnte das machen. Die Arbeit war primitiv – Viren allerdings nicht.
Entschlossen öffnete er die Tür zum Eisschrank, in dem die Proben lagen. Vorsichtig nahm er die kleinen Kunststoffnäpfe heraus und legte sie in eine Plastikschale mit Eisbröckchen.
Er hatte großen Respekt vor den Fähigkeiten von Viren. Rein äußerlich betrachtet, waren sie totes Material, bloßer Kristallstaub, feiner als Puderzucker. Keine Organe, kein Stoffwechsel, nichts dergleichen, nur eine winzige, harte Hülle mit Widerhaken und Nadeln und im Inneren ein eingetrockneter, kleiner Bauplan aus Nukleinsäure. Ein Nichts, weniger als ein Krümel, weniger als Staub und Dreck, aber etwas, das in der Lage war, Städte zu entvölkern, Panik zu säen, die Wirtschaft zu ruinieren und Regierungen zu stürzen.
Jetzt nur keinen Fehler machen, keine Röhrchen verwechseln. Sorgfältig kontrollierte er die Beschriftungen, glich sie mit seiner Tabelle ab und markierte die Deckel zur Sicherheit noch einmal mit frischer Farbe.
Denn wenn dieser Kristallstaub auf den richtigen Organismus traf, wenn die Häkchen und Spitzen sich auf einer Zelle festsetzten, bekam die Hülle einen Sprung und die messerscharfen Kanten rissen die Zelloberfläche auf. Sobald der Nukleinsäure-Kassiber aus dem Innern des Stäubchens durch die Wunde hindurch war, brach die Hölle los.
Er öffnete den Kühlschrank, nahm die am Vortag angemischten Lösungen heraus, mit denen sich die Einzelteile zusammensetzen ließen und stellte sie ins Eisbad.
Die aus den Viruskristallen eingeschmuggelte Information brachte die wichtigsten Schaltstellen der befallenen Zelle unter Kontrolle. Ab sofort würde sie nichts anders mehr tun als Viren zu produzieren. In der kurzen Zeitspanne, in der ein nichtsahnender Mensch seinen Kaffee austrank oder seine Zigarette zu Ende rauchte, war die erste Zelle schon zum Bersten voll mit neuen Viren.
Als Letztes holte er ein braunes Gläschen mit der Aufschrift »Transkriptase« aus dem Kühlschrank. Die glitzernden Eiweißkristalle darin würden dafür sorgen, dass sich die einzelnen Bausteine in ein funktionierendes Virus verwandeln würden.
Während der infizierte Mensch vom Kaffeetisch aufstand, war die mit neuen Viren gefüllte Zelle bereits geplatzt, und die frisch erzeugten Erreger hatten sich über weitere Zellen hergemacht. Vielleicht überkam den Menschen jetzt ein leichter Schauder, er spürte ein kleines Ziehen, einen winzigen Stich. »Kalt hier«, würde er denken, oder »Es zieht«. Er würde sich nicht vorstellen, dass er schon 24 Stunden später mit dem Tod ringen würde.
Nein, Viren waren nicht primitiv, sie waren ausgeklügelte, effiziente Parasiten. Was primitiv war, war ihre Herstellung.
Die Baupläne waren leicht zu bekommen. Im Internet gab es viele Datenbanken und Veröffentlichungen, die die Reihenfolge der Virusbausteine und alle bekannten Varianten auflisteten und ihre Eigenschaften beschrieben.
Das ließ sich alles in ein Textverarbeitungsprogramm kopieren und aufteilen in kleinere Päckchen. Die brauchte man nur in die Bestellformulare einschlägiger Firmen zu kopieren, die auf Knopfdruck aus den genetischen Blaupausen das gewünschte Genmaterial herstellten. Geschickt aufgeteilt, konnte niemand Verdacht schöpfen.
Solche Genstückchen, Oligos genannt, brauchte fast jedes biologische Labor jeden Tag, und bei den Oligo-Lieferanten liefen die Automaten, die sie herstellten, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Binnen weniger Tage kamen die Oligo-Bausteine ins Haus.
Die Oligos für das Ebola-Virus, Variante Phi-X0, die aggressivste bekannte Virusversion, waren jetzt alle da, sie steckten im Eis in den kleinen Töpfchen vor ihm. Jetzt brauchte er sie nur noch zusammenzusetzen. Ein Kinderspiel, wenn man die Technik beherrschte und die Arbeitsanweisung vor sich hatte.
Die Kosten waren lächerlich. Ein paar tausend Euro, alles zusammen, und ein paar Stunden Arbeit. Leicht am Wochenende zu erledigen, oder nach Feierabend, wenn sonst niemand da war.
Bevor er mit dem Zusammensetzen begann, setzte er sich auf den Laborhocker, um eine Zigarette zu rauchen. Sein Blick fiel auf den Kühlschrank, in dem schon in ein paar Stunden der Tod schlafen würde.
Müsste ich etwas fühlen?, dachte er. War das ein historischer Moment? Ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit? Wohl kaum. Vermutlich würde erst der Tag, an dem das Virus seine ersten Opfer fand, in die Geschichtsbücher eingehen, so wie 9–11, der 11. September 2001.
Er blies den Rauch seiner Zigarette zur Decke. Was fühlten die Techniker, die eine Atombombe zusammenbauten? Oder einen Sprengstoffgürtel?
Er wusste es nicht. Er wusste nur, dass das Virus die Ungläubigen treffen würde, diejenigen, die es abgelehnt hatten, die Botschaft des Einen und Wahren Gottes anzunehmen, und dass das Virus nicht losgelassen würde, bevor nicht jeder seine Chance gehabt hätte, sich zu entscheiden. Diejenigen, die sich bekennen würden, würden verschont werden.
Er nahm sich noch einmal den Arbeitsplan vor. Die Titelzeile hatte er mit einem Filzschreiber geschwärzt, aber wenn man genau hinsah, waren die Worte »Universität Tübingen« immer noch lesbar. Das störte ihn, daran wurde er nicht gern erinnert. Er holte seine Laborschere aus der Kitteltasche und schnitt die Zeile ab. Konzentration war jetzt wichtig, denn es ging darum, einen guten Job zu machen. Wenn er nur zwei Bausteine vertauschte, wäre das Virus ein Blindgänger, der nicht eine einzige Zelle infizieren könnte. Er stand auf, drückte die Zigarette aus und verwirbelte den Rauch mit seiner Rechten. Er sollte hier besser nicht rauchen. Es wäre besser, auch die Gedanken zu verscheuchen.
Vier Stunden später, als alles getan war, schickte er die verabredete SMS und zündete sich erneut eine Zigarette an. Diesmal ließ er dem Rauch die Freiheit, sich auszubreiten, wohin er wollte.
Kapitel IX
Dezember 2018
Wieder fegte eine Böe heran und warf einen Schwall Regen gegen die Windschutzscheibe, dass es klatschte und die Scheibenwischer stockten. Tom schauderte es. Die Heizung seines betagten Alfas war voll aufgedreht, aber sie kam gegen das Winterwetter nicht an. Die Scheiben blieben beschlagen, und zu allem Überfluss machte auch der Motor wieder einmal Zicken, stotterte und bockte. Tom sah auf die Uhr. Es ging schon seit fünf Minuten nur zentimeterweise voran. Wahrscheinlich war weiter vorne wie üblich die Straße überflutet. Bei Regenwetter geriet Rom immer gleich an den Rand des Ausnahmezustands. In solchen Momenten vermisste er Neapel, nicht nur wegen der milderen Winter. Den Römern fehlte der Gleichmut der Neapolitaner, Dinge hinzunehmen, die sie nicht ändern konnten.
Neapel kam ihm öfter in den Sinn, seit er bei Epoca ins Wissenschaftsressort gewechselt war. Er war wieder empfindlich geworden für die Hektik in Rom, wahrscheinlich, weil der Stress des Kriegsreporterdaseins von ihm abgefallen war. Zum ersten Mal seit Jahren stand sein Koffer geleert im Kellerverschlag und nicht mehr gepackt neben dem Bett. Niemand klingelte ihn mehr aus dem Schlaf, um ihn auf der Stelle in einen Winkel der Welt aufbrechen zu lassen, wo Granaten und Sprengstoffgürtel Menschen zerfetzten. Niemand zwang ihn mehr dazu, sich zu verstellen; es gab keine konspirativen Treffen mehr mit Interviewpartnern, die sich vor Geheimdiensten und Folterknechten fürchteten, und er musste auch keine kugelsichere Weste mehr tragen. Stattdessen hatte er fast geregelte Arbeitszeiten und ein Einzelbüro, in dem das einzige Geräusch die Lüftung des Computers war. Vor allem aber erinnerten ihn die neuen Kollegen nicht mehr tagtäglich an Franca.
Franca – sein Herz schlug immer noch schneller, wenn er an sie dachte, und noch immer erschien sie in seinen Träumen. »Schließ endlich damit ab«, hatte Wilson, sein Freund und Nachbar, erst neulich wieder gesagt. »Nicht du hast sie umgebracht – es waren die Taliban. Was glaubst du, wie oft ich Kollegen in einen Einsatz geschickt habe, in dem sie verletzt wurden? Aber als Polizisten kennen sie das Risiko – genau wie Franca!«
Er hatte sich oft gefragt, ob das Wilsons ehrliche Meinung war. Oder war es Fatalismus, um damit fertig zu werden, dass er selbst nach einer Schießerei querschnittsgelähmt und frühpensioniert im Rollstuhl saß?
Trotz des Regens kurbelte er die Seitenscheibe herunter. Eine regenfeuchte Böe klatschte ihm ins Gesicht wie ein nasses Handtuch und brachte ihn in die Gegenwart zurück. Rasch schloss er das Fenster wieder. Er hatte einen Interviewtermin, und er hatte ein solides Thema – kein Krieg, kein Terror, keine Intrigen. Manchmal kam ihm das schon wieder seltsam vor. War Ende dreißig nicht zu früh, sich in die heile Welt der Gelehrten, des Schönen, Wahren und Guten zurückzuziehen?
Kapitel X
Nur ein lautes Surren war zu hören. In dem karg möblierten Zimmer saßen zwei Männer stumm über ihre Arbeit gebeugt. Mit ihren blassen Gesichtern, den kurzgeschorenen, schwarzen Haaren und den fast blauen Bartschatten sahen sie ausgemergelt und abgekämpft aus. Aber ihre Augen waren wach und ihre Blicke konzentriert. Der Kleinere hatte seinen Arm entblößt und auf einen abgeschabten kleinen Tisch gelegt, der schon ein langes Leben in einem Restaurant oder Café hinter sich haben mochte. Ein schlichter Kleiderschrank aus hellem Holz und ein Bett komplettierten die Einrichtung. An der Wand hing ein Kruzifix.
Der andere Mann, auch er etwa Anfang 40, hatte mit der Linken den Bizeps seines Freundes umfasst, mit der Rechten hielt er ein Tätowiergerät. Er zeichnete konzentriert zwei Fische auf den Oberarm. Danach herrschte Stille.
»Die Zeit?«, fragte er, während er das Gerät zur Seite legte.
»Sechs Minuten.«
»Schmerzen?«
»Ein bisschen so wie im Winter, wenn die kalt gefrorenen Hände warm werden. Es kribbelt und brennt.«
»Schmerzen machen Eindruck.«
Der andere nickte. »Das Problem werden die Kinder sein.«
»Da sprühen wir vorher etwas auf.« Er lehnte sich zurück und betrachtete die Stelle. »Sieht gut aus.« Er wischte das Blut ab und wickelte etwas Klarsichtfolie um den Arm.
»Heute Abend waschen und eincremen«, sagte er. »Jetzt bist du ein Fischer – der Erste.«
»Ich bin mir der Ehre bewusst, und ich werde das Zeichen mit Dankbarkeit tragen.«
Er betrachtete die Stelle noch einen Moment und zog dann den Ärmel seines Hemds hinunter. Der andere räumte die Geräte weg.
»Wann machen wir weiter?«
»In drei Tagen ist es so weit. Dann werden wir sehen.«
»Zweifelst du?«
»Nein, mein Bruder. Der Herr wird mit uns sein.«
Kapitel XI
Tom hastete durch den Regen. Die Parkplatzsuche hatte weitere Zeit verschlungen. Neapolitanische Gelassenheit war gut, aber Unpünktlichkeit fand er unverzeihlich. Das sind deine deutschen Gene, spotteten seine Freunde, wenn er wieder einmal als Einziger zur angegebenen Zeit zu einem Essen erschienen war und die Gastgeber noch nicht einmal mit dem Kochen begonnen hatten.
Er war so damit beschäftigt, den Pfützen auszuweichen, dass er das Institut für Mathematische Genetik beinahe verpasst hätte. Das unscheinbare Schild hing an der Wand eines Palazzo in Trionfale, dem Viertel hinter der Vatikanischen Mauer. Der Regen hatte die graue Fassade des alten Gebäudes noch dunkler gemacht. Der Putz war abgebröckelt, die Schnitzereien des einst imposanten Holztors stark verwittert, und irgendein Barbar hatte dessen linken Flügel ausgesägt, um eine gewöhnliche Tür einzubauen.
Dahinter begann eine andere Welt. Der kleine Hof bestand aus einer Grünfläche, die als klassischer italienischer Garten streng geometrisch mit sorgfältig beschnittenen kleinen Hecken angelegt war. In der Mitte plätscherte ein Brunnen. Rechts und links führten zwei Laubengänge zum hinteren Teil, wo sich das Treppenhaus zum ersten Stock befand. Dort sollte er Professor Oshino treffen, den Leiter des Instituts.
Entlang der Treppen hingen Drucke von klassischer Architektur, daneben Erläuterungen zu den jeweiligen Zahlenverhältnissen der einzelnen Elemente, ganz offenbar das Hobby eines Zahlenverrückten.
Tom hob die Hand, um an Oshinos Tür zu klopfen, als sein Blick auf die Radierung fiel, die neben dem Türrahmen hing. Sie zeigte die »ideale Stadt«, so der Titel des Blatts. Häuser und Paläste umsäumten einen Platz, an dessen Ende ein Schiff im Hafenbecken lag. Seine geblähten Segel bildeten das einzige Element, das nicht aus Geraden bestand. Die Perspektive zog den Betrachter hinein in die Stadt und auf das Schiff zu. Tom suchte den Namen des Künstlers, fand aber nur eine Jahreszahl: 1480. Er trat einen Schritt zurück. Das Bild zeigte Architektur, aber auch die Essenz der Renaissance – klassische Strenge, mathematisch-wissenschaftliche Klarheit und weite Räume. Alles sah nach Aufbruch aus, nach der Lust, neue Kontinente zu erobern. Wie konnte es sein, dass eine mehr als 500 Jahre alte Architekturzeichnung imstande war, gute Laune zu verbreiten? Tom kniff die Augen zusammen, riss sich von dem Bild los, klopfte an die Tür und öffnete sie, ohne eine Antwort abzuwarten.
Das Zimmer war verwaist, aber es waren Stimmen und Gelächter zu hören, die durch eine angelehnte Tür aus dem Nebenraum drangen. Kurz entschlossen durchquerte er den Raum und stand in der Institutsbibliothek, wo sich etwa zwei Dutzend Menschen bei Kuchen und Getränken versammelt hatten. Die meisten waren noch sehr jung – vermutlich Studenten – und unterhielten sich angeregt.
Hiroki Oshino, ein trotz seines Alters sehr lebhaft wirkender kleiner Mann mit einer Hornbrille, die an Aristoteles Onassis erinnerte, stand inmitten einer größeren Gruppe und hielt eine Figur in der Hand. »Wie kann eine Skulptur, die das Böse darstellt, den klassischen Proportionen der Schönheit entsprechen?«
»Das ist leicht zu erklären«, entgegnete eine junge Frau, »das Böse ist nun einmal sehr anziehend, genau wie das Schöne. Wenn es nur hässlich und abstoßend wirkte, würde sich doch niemand darauf einlassen.«
»Messen Sie doch mal nach, ob es sich wirklich um die klassischen Proportionen handelt«, schlug Oshino vor, »und lesen Sie nach, was die Zeitgenossen über den Goldenen Schnitt und die Abweichungen davon geschrieben haben. Dann können wir nächste Woche weiter diskutieren.«
Er wandte sich um. »Sie sind also der Reporter von Epoca. Dann kommen Sie mit in mein Büro – oder wollen Sie lieber ein wenig mit uns diskutieren?«
Tom schüttelte den Kopf. Er fürchtete, unter den jungen Leuten eine schlechte Figur zu machen. Mathematik war immer sein Angstfach gewesen.
Im Arbeitszimmer ließ Oshino Tom in einer Sitzecke Platz nehmen. »Möchten Sie etwas trinken? Ich habe Tee, Wasser und Apfelsaft anzubieten.«
Tom entschied sich für Wasser, Oshino griff nach dem Apfelsaft. »Ich liebe Äpfel. Ich habe immer welche auf dem Schreibtisch. Wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann rieche ich daran und schon geht es wieder.«
Tom machte sich in Gedanken eine Notiz. Er war noch damit beschäftigt, Notizblock und Mini-Rekorder auszupacken, als Oshino das Wort ergriff.
»Sie interessieren sich also für die Mathematik der Gene«, eröffnete er das Gespräch. Es klang nicht wie eine Frage. »Das freut mich. Bisher hat niemand etwas darüber schreiben wollen oder können. Ich habe daher etwas für Sie vorbereitet.«
Er griff zu einem CD-Player neben seinem Sessel und startete ihn. Geigenmusik erklang. »Was hören Sie?«
Tom hörte dem Geigensolo eine Weile schweigend zu. Dass sein Gegenüber die Interviewfragen stellte, kam gewöhnlich nur bei Politikern vor. Und was hatte das alles mit Genforschung zu tun? Aber alles an diesem Institut schien so seltsam, dass er beschloss, sich darauf einzulassen. »Ich höre eine Violinsonate, Bach vielleicht?«
»Gar nicht so schlecht, junger Mann. Keine Girlanden, alles schlank und auf einem klaren, einfachen Motiv aufgebaut. Die Schönheit kommt durch die Variationen und Wiederholungen.«
»Habe ich richtig getippt?«
Oshino wiegte den Kopf. »Der Komponist ist unbekannt, aber sicher nicht Bach.«
»Also auch kein Zeitgenosse von ihm?«
»Viel, viel älter.« Oshino drückte die Stopp-Taste. »Das ist Musik, die aus den Genen kommt. Das war das Gen für Zytochrom C, eines der ältesten Gene, das wir kennen, entstanden vor 2 Milliarden Jahren. Fast alle Lebewesen, Bakterien genauso wie der Mensch, benutzen es, und es ist sehr streng durchkomponiert. Alles Überflüssige ist weg – keine Arabesken. Bach hätte es nicht besser machen können.«
Tom griff nach seinem Notizblock. »Wie kann man Gene in Musik verwandeln?«
»Ganz einfach. Schon in der Schule lernen wir, dass die Abfolge von Genbausteinen in der DNA einen Code bildet – immer drei Bausteine bilden einen Buchstaben. Die Zelle liest diese Buchstabenabfolge und benutzt sie, um damit ein Protein herzustellen. Jeder Buchstabe entspricht einer bestimmten Aminosäure, und so wird Stück für Stück ein Protein zusammengesetzt, dessen Aufbau exakt der Abfolge der Buchstaben entspricht. Ich lese den genetischen Code genauso ab – nur ordne ich jedem Buchstaben eine Note zu. Fertig ist die Genmusik.« Er lachte und sah dabei aus wie ein Kind, das sich über ein gewonnenes Spiel freut.
»Was kann man daraus lernen?«
»Bei Genen geht es genauso wie in der Musik um Variation und Wiederholung. Gene, die sich in der Evolution als nützlich erwiesen haben, bilden das Ausgangsmaterial für Weiterentwicklungen. Sie werden abgewandelt, es kommt etwas Neues hinzu, das wird wieder variiert und so weiter. Komponisten machen es ganz genau so.«
»Ist das nun Ihr Hobby oder Ihre Forschungsarbeit?«
»Beides. Genetische Muster und Variationen helfen mir, zu verstehen, welche Gene voneinander abstammen, wo Veränderungen entstanden sind und warum Fehler im Erbgut zu Krankheiten führen. Man kann die Bausteinreihen mit dem Computer analysieren und beschreiben, aber für mich ist das nicht anschaulich genug.« Oshino lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hinter seinem Kopf. »Ich bin ein sehr musikalischer Mensch, und ich begreife viel mehr, wenn ich diese Muster höre. Also habe ich Musik daraus gemacht, und manche Stücke sind einfach sehr schön.«
»Sie spielen sie auch selbst?«
»Ich habe ein paar Semester Geige studiert. Zum Virtuosen hat es leider nicht gereicht. Da bin ich dann Mathematiker geworden.«
»Wie hat es Sie hierher verschlagen?«
»Das ist eine lange Geschichte. Meine Eltern stammen aus Japan und kamen nach dem Krieg in die USA. Ich bin dort nie heimisch geworden, aber nach Japan wollte ich auch nicht, das war noch fremder für mich. Europa gefiel mir, und so habe ich mich entschieden, hierher zu ziehen.«
»Warum sind Sie nach Italien gekommen?«
»Zum Beispiel wegen meines Interesses an Zahlensymbolik. Die ist in Italien sehr präsent. Seit dem Mittelalter beruht die italienische Architektur auf Proportionen und Zahlensymbolik. Noch dazu gibt es hier intensive Beziehungen zwischen Architektur und Musik. Zum Beispiel hat der Komponist Guillaume Dufay im 15. Jahrhundert zur Einweihung des Doms in Florenz ein Stück komponiert, das exakt den mathematischen Proportionen der Kuppel entspricht.«
Tom rückte das Mikrofon seines Rekorders zurecht. Die Geschichte würde sich ohne Weiteres an den Rundfunk verkaufen lassen. Nach ein paar weiteren Beispielen hatte er jedoch genug Material und brachte das Gespräch auf einen anderen Punkt. »Hat das alles – verzeihen Sie das ›nur‹, das jetzt folgt – hat es nur Bedeutung für die Grundlagenforschung oder auch für konkrete Anwendungen, sagen wir, in der Medizin?«
»Ich bin nicht begeistert von denjenigen, die aus der Biologie eine Ingenieursdisziplin machen wollen, in der alles gleich auf seine technische Anwendbarkeit hin überprüft wird. Das verändert die Forschung fundamental und wird langfristig wirklich neue Durchbrüche verhindern. Aber zurück zu Ihrer Frage: Ja, es kann der Medizin nutzen, aber ich selbst beschäftige mich nicht mit angewandter Forschung.«
Oshino besaß ein fast enzyklopädisches Wissen, und nach einer Stunde hatte Tom weitere Einsichten über italienische Musikgeschichte, die Abstammung des Menschen und die Entstehung von Krebs notiert. Zum Abschluss bat er darum, noch ein paar Stücke hören zu dürfen. Oshino startete den CD-Player erneut. »Das hier ist das Gen für einen Stoff, der nur bei Säugetieren vorkommt, also relativ neu ist. Da habe ich mich aber am Klavier versucht.«
Tom hört ein paar Takte lang zu und verzog das Gesicht. »Hört sich an wie Strawinsky – nicht mein Fall.«
Oshino lächelte. »Auch nicht unbedingt meine Lieblingsmusik. Aber was halten sie hiervon?«
Wieder erklang Klaviermusik. Sehr expressionistisch gespielt, mit leisen und kräftigen Passagen. »Klingt wie ein Jazzpianist, Keith Jarrett zum Beispiel. Könnte fast ein Hit werden.«
»Sie sagen es. Das ist das Ebola-Virus, vielleicht ein paar hunderttausend Jahre alt, und wer weiß, was daraus werden kann. Vor 40 Jahren hat es den Sprung auf den Menschen geschafft, nach einer kleinen Variation der Melodie. Ein paar Variationen mehr, und es breitet sich aus wie die Pocken, oder, wer weiß, es wird in unser Erbgut eingebaut und etwas Nützliches wird daraus. Die Zukunft wird es zeigen.«
Es klopfte und gleich darauf steckte eine junge Frau ihren Kopf zur Tür herein. »Dr. Oshino, ich mache gleich Feierabend und will Sie nur noch rasch an Ihre Verabredung mit Dr. Aznar erinnern.«
Oshino nickte: »Danke, ich habe es nicht vergessen.«
Tom stand auf. »Dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange aufgehalten.«
Oshino lächelte. »Nein, nein, im Gegenteil. Es hat mich gefreut. Sie waren ein guter Zuhörer. Ich bin gespannt auf Ihre Geschichte. Rufen Sie mich an, wenn Sie noch Fragen haben. Die CD können Sie mitnehmen, und ich habe auch noch ein Programm darauf gebrannt, mit dem Sie eine Gensequenz selbst hörbar machen können.«
Kapitel XXII
»Patient, männlich, ca. 1,75 groß, etwa 40 Jahre alt, nicht ansprechbar, keine äußeren Verletzungen, keine Blutungen; Reflexe normal, Puls 120, Blutdruck 100 zu 70, Körpertemperatur 40,9. Augen und Rachen deutlich gerötet, Konjunktivitis. Makulopapulöses Exanthem am Stamm und den Extremitäten; Handinnenflächen und Fußsohlen frei. Keine Hinweise auf Knochenbrüche.« Dr. Mateotti stoppte das Diktiergerät, schob die Untersuchungslampe beiseite und wartete darauf, dass seine Augen sich wieder an die normale Klinikbeleuchtung gewöhnten.
»Wo und wie, sagten Sie, wurde der Mann gefunden?« Eine Stunde nach Mitternacht und nach mittlerweile mehr als 25 Stunden Klinikdienst war seine Aufmerksamkeit für nicht-medizinische Details nur noch sehr wenig ausgeprägt.
»Auf der Tiberbrücke, nahe dem Vatikan, Dottore.« Schwester Annunziata war noch immer aufgelöst. »Ein Taxifahrer hat ihn gebracht. Er sagte, der Pater war dabei, über die Brüstung zu klettern, als ob er sich in den Tiber stürzen wollte.«
»Und der Taxifahrer hat ihn davon abgehalten?«
»Nein, er sagte, er brach vorher zusammen.« Sie schlug ein Kreuzzeichen. »Stellen Sie sich vor, ein Ordensmann, der sich umbringen will! Eine Todsünde!«
»Nun beruhigen Sie sich, Schwester«, brummte der Doktor. »Erstens lebt er noch, und zweitens hat er sehr hohes Fieber. Da weiß man oft nicht, was man tut. Vielleicht wollte er sich abkühlen.«
»Ach, Dottore, meinen Sie? Ich werde für ihn beten. Was fehlt ihm denn?«
»Ich weiß es noch nicht. Das Fieber ist sehr hoch, aber er scheint ganz gut beieinander. Im Augenblick ist sein Zustand noch nicht bedrohlich, aber wir müssen ihn im Auge behalten. Was mir nicht gefällt, sind diese merkwürdigen Pusteln. Sieht fast aus wie Masern, aber blasser, und die Augen sind auch in Mitleidenschaft gezogen.« Er zog die Stirn in Falten. »Vielleicht ist er Missionar und kommt gerade aus Afrika zurück? Wir legen ihn vorsichtshalber auf die Isolierstation. Hatte er irgendwelche Papiere bei sich oder vielleicht einen Abschiedsbrief?«
»Madonna mia!« Schwester Annunziata bekreuzigte sich erneut. »Möge der Herr Ihnen vergeben! Nein, Dottore, nein, gar nichts.«
»Woher wissen Sie eigentlich, dass er ein Pater ist?«
»Er hatte so eine Art Kutte an.«
»Das bedeutet gar nichts«, gab der Doktor zurück. »Kutte, Burnus, wer kann das schon so genau unterscheiden? Er könnte genauso gut ein Araber sein.«
Schwester Annunziata zeigte auf die Fischtätowierung am Oberarm des Mannes. »Das ist aber ein christliches Symbol.«
»Das bedeutet auch nichts. Vorne Madonna, hinten Koransure – alles schon gesehen.« Er hielt das Röntgenbild gegen das Licht und musterte die Details. »Hatte er sonst noch irgendetwas bei sich, damit wir Angehörige finden können?«
Die Schwester schüttelte den Kopf. »Nur ein Medaillon«, sagte sie. »Das haben wir ihm aber abgenommen, fürs Röntgen.«
»Und?«
»Es war ein Raubvogel eingraviert.«
»Ein Raubvogel? Welcher Verein trägt denn so etwas?«
»Ich weiß nicht. Ich kann versuchen, über meine Schwester Oberin …«
Doktor Mateotti wedelte mit dem Röntgenbild. »Das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Darum soll sich die Verwaltung kümmern. Ab mit ihm auf die Isolierstation. Ich brauche ein Blutbild, und zwar sofort! Und dann das Tropenkrankenhaus ans Telefon, Spallanzani oder Sacro Cuore, wer gerade erreichbar ist!«, rief er der Schwester nach, die schon mit dem Patienten im Aufzug verschwand.
»Ein Seuchenausbruch, das hätte uns gerade noch gefehlt!« Aber das sprach der Doktor schon nur noch zu sich selbst.
Kapitel XIII
Er schlug die Augen auf. Dunkelheit. Nicht ganz. Neben ihm blinkte etwas. Er wollte den Kopf zur Seite drehen, aber seine Muskeln gehorchten nicht. Er versuchte, den Arm zu heben. Auch das scheiterte. Seine Glieder waren entsetzlich starr, als wenn er in einer Rüstung steckte. Noch ein Versuch. Er legte all seine Kraft in die Bewegung seiner Arme und schaffte es, den Oberkörper anzuheben.
Schlagartig setzten Kopfschmerzen ein, als wenn sein Kopf in eine riesige Falle geraten wäre, die seinen Schädel zusammendrückte, bis er zu bersten drohte. Seine Nackenmuskulatur zog sich zusammen und wurde augenblicklich hart wie Stein. Er ließ sich zurück auf das Kissen fallen. Vielleicht konnte er eine Position finden, die seinen Nacken entspannen und die Schmerzen lindern würde. Es gelang nicht. Ihm wurde übel.
Er zwang sich, tief durchzuatmen, und überprüfte seine Glieder, erst Arme, Hände und Finger, dann Beine, Füße, Zehen. Er konnte sie spüren und kontrollieren. Noch einmal versuchte er, sich aufzurichten. Der Schmerz pochte in seinem Kopf wie ein Glockenschlägel, aber es gelang ihm, dagegen anzukämpfen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht starrte er an sich hinunter. Was war das an seinen Armen? Schläuche? Drähte? Was waren das für Lämpchen? Wo war er? Das letzte, woran er sich erinnern konnte, war eine Mauer, alte Steine mit Pockennarben und Furchen, eine breite Fuge und eine Stimme.
Sobald er den Kopf drehte, geriet alles in Bewegung, die Lichter tanzten, die Konturen der Apparate verschwammen und das Bett verwandelte sich in ein taumelndes Karussell. Er war schweißnass und fror. Seine Zähne klapperten. Fieber, bestimmt hatte er Fieber, das zeigten ihm die Schmerzen in den Gelenken und sein rasender Puls.
Wieder rebellierte sein Magen. Erneut überstand er eine Welle der Übelkeit, aber die Hammerschläge unter seiner Schädeldecke wurden stärker und vor seinen Augen tanzte bunter Schnee.
Als er für einen Moment wieder klar sehen konnte, wurde ihm schlagartig bewusst, dass er in ein Krankenhaus geraten war. Das war schlecht, sehr schlecht. Er musste von hier verschwinden, so schnell wie möglich. Sie durften nicht entdecken, wer er war und was er da mit sich herumschleppte. Vor allem durften sie nicht begreifen, warum er es überlebte. Denn dass er es überleben würde, daran hatte er keine Zweifel, schließlich war er wieder aufgewacht, konnte sich bewegen, denken, Pläne machen, trotz der wilden Schmerzen, die durch seinen Körper jagten. Das Experiment war gelungen.
Wieder setzte der Schwindel ein. Wild entschlossen richtete er sich auf, um sich auf die Bettkante zu setzen. Das Scheuern der Bettdecke schmerzte, als ob Flammen seine Beine verbrannten. Stöhnend sank er in sich zusammen. Es war unmöglich, zu fliehen. Er konnte ja nicht einmal aufstehen. War es nicht doch besser, hier zu bleiben, sich zu ergeben und um Linderung zu bitten?
Er krümmte sich noch weiter zusammen, wie ein Embryo, und presste die Hände gegen seine Schläfen. Eine Prüfung, dachte er, Gott will mich prüfen. Die Kopfschmerzen trieben ihm Tränen in die Augen. Sprich zu mir, Gott, flehte er in Gedanken, ich bitte Dich, sprich!
Für einen Moment ließen die Schmerzen nach, aber schon Sekundenbruchteile später begann die Krankheit in seinem Körper wieder zu rasen, verbiss sich in seine Nerven, versuchte, seine Adern zu zerreißen und das Blut zum Kochen zu bringen. Noch einmal rief er Gott an, so inbrünstig, wie er es in seinem Leben noch nie getan hatte. »Was soll ich tun? Was ist Dein Wille? Ich flehe Dich an! Hilf mir! Hilfe!«
Wieder zogen sich die Schmerzen zurück, in einen kleinen Winkel seines Schädels, hinter seinen Augenlidern erschienen Blitze und Sterne. Dann verschwanden auch sie. Alles war leer. Aus der Leere kam ein Ton herüber, eine Melodie, eine Stimme mit einer Botschaft. Für eine Sekunde breitete sich ein Glücksgefühl aus, bis in die Zehenspitzen. Das also war Gottes Botschaft! Als wenn ein Stein ihn am Hinterkopf getroffen hätte, kehrten die Schmerzen zurück. Aber was bedeutete das schon? Er war erleuchtet worden! Gott hatte zu ihm gesprochen. Er musste nach draußen. Zurück in sein Versteck, ins Labor, seinen Auftrag zu Ende bringen. Gott würde ihm helfen.
Er schaffte es, die Schmerzen zu ignorieren. Gott würde ihm helfen! Die Gewissheit gab ihm die Kraft, aufzustehen. Vorsichtig tastete er herum, bis er das Nachtlicht fand, mit dem er das Zimmer beleuchten konnte. Seine Augen funktionierten nicht richtig, sie zeigten die Farben falsch und die Formen verzerrt, aber er konnte trotzdem erkennen, dass auf einem Stuhl nahe der Wand ein transparenter Plastikbeutel mit seinen Sachen lag.
Er setzte sich wieder auf die Bettkante und angelte den Stuhl mit dem rechten Fuß heran. Er würde sich jetzt so weit wie möglich ankleiden, ohne die Kabel und die Kanüle zu entfernen, denn das würde bestimmt Alarm auslösen. Das durfte erst zuletzt geschehen, und dann musste es schnell gehen.
Wieder wurde ihm schwindelig.