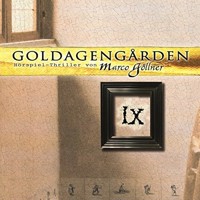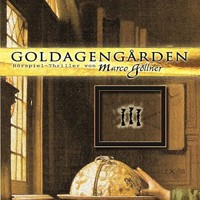9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Oma Martha roch immer gleich (4711), ließ ihre Zähne nachts im Becher schlafen und puderte alles, was nach Ausschlag aussah: zum Beispiel Kinderhintern und jahrelang das Gesicht meines Bruders, bis Oma feststellte: ‹Das soll woh so sein.›» Marco Göllner wuchs bei Oma Martha auf, einem echten Original der Generation Kittelschürze, in einem Haushalt, in dem sich auf eines verlassen werden konnte: Omma hatte alle im Griff. Sein Buch ist eine zauberhaft geschriebene Liebeserklärung an die Frau, die ihm alles mitgab, was fürs Leben wichtig ist. (Und was sie ihm nicht mitgab, war auch nicht wichtig.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Marco Göllner
Oma Martha und ich
Über dieses Buch
Eine besondere alte Dame, ein besonderer Erzähler – Podcast-Star Marco Göllner über seine Kindheit in den Siebzigern bei «Omma Martha».
«Oma Martha roch immer gleich (4711), ließ ihre Zähne nachts im Becher schlafen und puderte alles, was nach Ausschlag aussah: ihr offenes Bein, Kinderhintern und jahrelang das Gesicht meines Bruders, bis Oma feststellte: ‹Das soll woh so sein.›» Marco Göllner wuchs bei Oma Martha auf, einem echten Original der Generation Kittelschürze, in einem Haushalt, in dem sich auf eines verlassen werden konnte: Omma hatte alle im Griff. Sein Buch ist eine zauberhaft geschriebene Liebeserklärung an die Frau, die ihm alles mitgab, was fürs Leben wichtig ist. (Und was sie ihm nicht mitgab, war auch nicht wichtig.)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Media GmbH, München
Umschlagabbildung privat
ISBN 978-3-644-40447-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
In Erinnerung an
Martha Emma Auguste Kaufmann
kurzzeitige Krüger
geborene Säger
17/12/1913–29/07/2002
Ich vermisse dich, Oma!
Anmerkung
Ich habe dieses Buch laut gesprochen und aufgeschrieben, insofern halte ich Sie, liebe über das Buch geneigte Leser, dazu an, es ebenfalls laut zu lesen. Laut im Kopf drin gilt auch.
Es kann (ganz sicher) Spuren von lippischer Grammatik enthalten.
Zum Zwecke des Verständnisses sei an dieser Stelle auf den Buchstaben «G» besonders hingewiesen. Er wird auch mal wie ein stinknormales «G» gesprochen, aber eher selten. Eigentlich wird er wie ein «CH» gesprochen, häufig allerdings auch wie ein «J». Das kommt ein bisschen darauf an, wo er sich im Satz befindet, beziehungsweise welches Wort ihm voransteht. – Jefühlssache is das.
Das «G» als «CH» spricht der Lipper am Anfang eines Wortes immer wie im Wort «ich» und am Ende eines Wortes immer wie im Wort «ach».
(Es sei denn, das Wort endet auf «ig».)
Beispiel: Chuten Tach!
Wenn Sie ein «J» lesen (wo eigentlich ein «G» stehen müsste, wenn man nicht aus Lippe kommt), geben Sie ruhig immer eine kleine Portion «CH» hinzu (wie in «ich»), dann sind Sie auf der «janz» sicheren Seite.
Ebenso kommen Ausdrücke zum Ausdruck, welche vielleicht in den Ohren einiger weniger, die sie kennen, falsch geschrieben sind. Ich entschuldige mich bereits im Vorab dafür, aber ich konnte zu jener Zeit, in welcher die Geschichten passierten, noch nicht schreiben und gebe diese Begriffe somit lautmalerisch wieder.
So, wie ich sie als Kind verstanden habe.
Verstanden?
Chut.
Fangwa an!
So ’n Quatsch!
«So ’n Quatsch!», sagte Oma.
«Och, bütte!», sagte ich und sah sie ungeheuer lieb an.
Wir standen gemeinsam vor der Garderobe im Flur.
«Was wisste mit mein Hut?», fragte sie.
Ich erklärte ihr, dass ich am Ende des Sommers beim Seifenkistenrennen mitmachen wollte. Und ich bräuchte noch einen Helm.
«Mit mein Hut??» Oma schien entsetzt.
Na ja, sagte ich, er sähe doch so ähnlich aus wie ein Helm, und sie selbst hätte doch gesagt, der würde ganz wunderbar auf ihren Dickkopp passen und die Dauerwelle beschützen, selbst gegen Dellen und Beulen, und da sie immer sagen würde, ich hätte ebenfalls einen Dickkopp, müsste er ja dann auch da draufpassen und könnte mich somit vor eventuellen Dellen und Beulen beim Seifenkistenrennen beschützen.
«Der is füa chut!», sagte Oma.
Ja, wenn der doch «für gut» sei, erwiderte ich, dann würde der doch ganz hervorragend zum Seifenkistenrennen passen, denn das sei ja auch gut.
«So ’n Quatsch!», sagte Oma.
Das ganze Haus würde mitmachen, erklärte ich ihr. Alle hätten schon zugesagt. Mama und Papa würden beim Bau des Chassis helfen, Großcousine und Großcousin wollten sich um die Lackierung kümmern, Didi wollte sich der Kugellager annehmen, auf dass die etwas schneller drehten, und selbst Tante Creme und Onkel Friedlich hätten bereits zugesagt, mit entsprechenden Fähnchen am Straßenrand zu stehen und dem Fahrer Mut zuzurufen.
«Und was macht Üttchen?», fragte Oma.
Die hätte sich bereit erklärt, das alles gut im Auge zu behalten, erklärte ich. Von ihrem Stuhl aus.
Das seien ja wohl Fiesematenten, ließ Oma wissen.
Nein, sagte ich, aber der fiese Hennes hätte letztes Jahr gewonnen und das Jahr davor auch, und ich hätte entschieden, dass sich dieser Umstand in diesem Jahr ändern sollte.
«Mit mein chuten Hut?» Omas Augen waren sehr groß geworden.
Ich versuchte erneut, ungeheuer lieb zu gucken, neigte etwas den Kopf und machte ebenfalls große Augen. «Nich?»
«Nee!» Oma schüttelte den Kopf.
Das sei aber ganz sicher eine herbe Enttäuschung für den Rest vom Haus, wenn ich diese traurige Nachricht überbringen müsste, merkte ich an. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder die andere sogar weinen würde müssen bei der Vorstellung, dass wir dieses Jahr nicht wie geplant den Sieg einfahren würden, bloß weil Oma sich weigern würde, ihre Kopfbedeckung mal auszuleihen. Und dann fügte ich hinzu, dass wir die ganze Sache doch vielleicht durch eine Abstimmung basisdemokratisch auf sichere Füße stellen könnten.
«Abstimmung», wiederholte Oma leicht lächelnd, wurde aber sofort wieder ernst und etwas lauter: «Abstimmung, Abstimmung – BE-stimmung!!»
Abstimmung würde ganz flott gehen, sagte ich. Wir würden uns alle gemeinsam treffen, und ich würde die entsprechende Frage in den Raum werfen, und dann würde jeder, der dafür ist, den Arm heben.
«Das wär ja noch schöner!», sagte Oma. «Das machen wa überhaupt nich! Cha nich!» Dass Leute gemeinsam den Arm heben würden, sei seit einigen Jahren – ein Glück – sowieso nicht mehr «in», und Abstimmung oder ähnlichen Quatsch hätte es in diesem Haus ja noch nie gegeben.
«Das hat’s ja noch nie jejeben!», sagte Oma laut. «Das wär ja noch schöner!»
Ich wandte ein, dass, wenn es doch noch schöner wäre, wir es doch vielleicht einmal ausprobieren sollten.
«Das wär ja noch schöner!», sagte Oma laut. «Das hat’s ja noch nie jejeben!»
Ja, aber wir könnten doch mal was Neues ausprobieren, wollte ich sie locken.
«Was Neues?», sagte Oma immer noch laut. «Das wär ja noch schöner!»
Ich hatte irgendwie das Gefühl, die Konversation verfahre sich im Kreisverkehr, und schlug vor, die Entscheidung darüber zu vertagen.
Sie könne dann ja noch mal tief in sich reinhören.
Oma sagte, sie hätte schon mal tief in sich reingehört. Und nicht nur das, sie hätte sogar schon mal in sich reingerufen!
Tief sogar! Da hätte aber keiner geantwortet.
Also sei da nix.
Ach so.
Und wenn ich jetzt nicht mit den Sperenzchen aufhören würde, müsse sie wohl doch noch ihr Nachthemd zurückfordern, das ich seit nunmehr vier Tagen trug, weil ich doch ein Gespenst war. (Mit Ambitionen, Rennfahrer zu werden.)
«Aber das is meins!», sagte ich sehr bestimmt.
«Meins, meins!», sagt Oma vorwurfsvoll. «Mach ma die Augen zu! Wasde dann siehst, das is deins!» Und mit diesen Worten verschwand sie in der Küche.
Ich stand allein auf dem Flur unter Omas Garderobe und schloss meine Augen.
Und ich sah … eine ganze Welt!
Halt ’n Mund und stoppa was rin!
Ich verbrachte meine ersten Lebensjahre bei Oma.
Und Oma hieß mit Vornamen Martha.
Genau genommen war meine Oma gar nicht meine Oma, sondern meine Urgroßoma, also die Oma meiner Mutter. In Anbetracht der Tatsache allerdings, dass die Mutter meiner Mutter zu diesem Zeitpunkt grad verstorben war, war Uroma für mich Oma.
Genauer geschrieben war sie «Omma». Und ihr Vorname: «Machta».
Denn so spricht man hier.
In Lippe.
Mama war noch in der Ausbildung zur Friseuse und Papa beim Bund. Sie hatten frühzeitig rumgemacht, wie es in unserer Familie üblich war.
Oma lebte ihr ganzes Leben in Bad Salzuflen.
Geboren wurde sie kurz vor dem Ersten Weltkrieg irgendwo zwischen Kühen, Schweinen und sechs Geschwistern im Ortsteil Lockhausen. Später zog sie in den Ortsteil Aspe. Was ungefähr drei Kilometer straßabwärts liegt. Das war auch schon fast ihre weiteste Reise, außer ein paar Tagen am Wolfgangsee, damals, als sie bei einem Preisausschreiben gewonnen hatte. Aber das hatte ihr nicht gefallen. Sie hatte Heimweh bekommen. Und da Heimweh bekanntlich schlimmer ist als Hunger und Hunger ziemlich schlimm ist, wie Oma nicht müde wurde, bei jeder Mahlzeit zu betonen, fuhr sie fortan nie mehr fort.
Oma sagte immer, sie hätte schon dann Heimweh, wenn sie den Kirchturm nicht mehr sehen könne. Worauf ich sie fragte, ob sie denn jetzt in diesem Moment auch gerade Heimweh habe, da sie den Kirchturm ja hier in ihrer Küche gerade nicht sehen könne.
«Halt ’n Mund und stoppa was rin!», sagte Oma.
Als Kind dachte ich immer, Haltnmundundstoppawasrin sei ein einziges Wort, denn Oma sagte es ohne Pause, und meist stellte sie zur Bekräftigung ihrer Aussage, gleichzeitig mit Haltnmundundstoppawasrin, einen Topf oder eine Schüssel sehr laut auf den Küchentisch. War dergleichen nicht zur Hand, nahm sie die Hand und schlug flach auf denselbigen. Diese Kombination aus dem Geräusch eines energisch hingestellten Gegenstands, gepaart mit dem Satz aus dem Mund meiner Oma, ging mir so in Fleisch und Blut über, dass ich noch Jahre später, immer wenn irgendetwas lauter auf irgendeinen Tisch gestellt wurde, sofort und ohne zu überlegen und reflexartig sagte: «Halt ’n Mund und stoppa was rin!»
Den unrühmlichen Höhepunkt fand diese Eigenart in dem Moment, als ich Jahre später mit einer meiner ersten Eroberungen, die ich erst tags zuvor kennengelernt hatte, des Nachts auf ihrem Sofa saß und sie gerade nach einem sehr langen Monolog die Weinflasche wieder zurück auf den Couchtisch stellte.
Ich sah sie nie wieder.
Üttchen
Oma hatte im Laufe der Jahre zwei Ehemänner verschlissen.
Der erste sei in Südfrankreich im Krieg geblieben, sagte sie immer.
In Südfrankreich (wo immer das war) war also noch Krieg, folgerte ich.
Und der zweite sei ihr weggestorben, habe aber seinen Namen dagelassen. Und seine Schwester. Denn Oma wohnte nicht allein. Üttchen wohnte bei ihr.
Üttchen war sehr dick und genauso hoch wie breit und nicht größer als wir Kinder, aber sie hatte immer einen Taler in der Tasche. Das machte sie sehr beliebt. Denn sie gab den Taler auch gerne mal weiter und sagte dann: «Stecka man chut wech!»
Und das taten wir immer. Wir steckten den Taler immer gut in den Süßigkeitenautomaten in Omas Straße und drehten an dem Dreher und klappten an der Klappe und nahmen dann unten die Süßigkeiten heraus, und die steckten wir gut in den Mund.
Wenn Üttchen lachte, hörte man nichts.
Sie wackelte dann bloß. Überall. Und das Möbelstück, auf dem sie saß (und sie saß meist), dann ebenfalls. Ihr Körper bebte, das Gesicht war stark verzogen, die Augen nicht zu sehen und der Mund zu und zittrig. Dann lief sie blau an, und immer in dem Moment, in dem alle dachten, spätestens jetzt müsse man aber den Notarzt rufen – atmete sie ein.
Ein langes, lautes, gieriges Einatmen. In dieser Art und Lautstärke ansonsten lediglich bekannt von Blauwalen nach einem Tauchgang.
Sah auch so ähnlich aus.
Üttchen trug Perücke. Denn sie habe all ihre Haare im Krieg gelassen, sagte Oma. Ich überlegte, was wohl noch alles im Krieg geblieben war. Und was Omas erster Mann mit Üttchens Haaren wollte?
Üttchen hieß eigentlich Auguste. Wurde aber immer Jutte gerufen. Aber wir Kinder konnten das J nicht so gut sprechen, also riefen wir sie Ütte. Ich glaube, mein Vater war es, der dann die Verniedlichungsform anhängte und sie zu Üttchen machte.
Sie hatte ihr ganzes Leben bei «Hoffmann’s Stärke» gearbeitet und dort wohl so viel zu tun gehabt, dass sie nie die Zeit gefunden hatte, einen Mann kennenzulernen.
Mein Onkel äußerte einmal leise die Vermutung, sie würde wohl «unjeöffnet zurückchehn».
Tante Creme und Onkel Friedlich
Über Oma und Üttchen wohnte Onkel Friedlich, Omas Sohn, mit seiner Familie. Über Onkel Friedlich selbst gibt es hier nichts weiter zu sagen, denn er selbst sagte auch meist nichts. Er war sozusagen nichtssagend. Genau genommen kann ich mich nicht erinnern, ihn jemals sprechen gehört zu haben. Ganz im Gegensatz zu seiner Frau. Die redete gern und viel und wusste alles und alles besser. Sie gab vordergründig vor, gute Laune zu haben, und grinste viel.
Selbst wenn ihr Mund geschlossen war.
Denn sie verfügte über einen äußerst bemerkenswerten Oberkiefer, gespickt mit hundert daumendicken Zähnen, alle ungefähr gleich groß und alle flächig nebeneinander, was von vorne so aussah wie eine Wand mit gelben Tapeten, auf der die einzelnen Bahnen nicht ganz auf Naht geklebt worden waren.
Lud Oma des Sonntags zum Kaffee, war nicht nur ihr Sohn eingeladen, sondern leidlicherweise wegen des Umstandes der Heirat auch seine Frau. Und da sie die Prinzessin des Hauses war und die kürzeste Anreise hatte, nämlich nur eine Treppe bergab, kam sie natürlich immer als Letzte.
Und bevor sie dies tat, rieb sie sich ihre Hände mit Handcreme ein!
Über die Menge, die sie dafür benutzte, lassen sich bloß Vermutungen anstellen. Dass es allerdings so war, daran besteht kein Zweifel. Denn immer wenn sie den Raum betrat, war sie noch dabei, ihre Hände ineinanderzureiben.
Aufgrund des opulenten Repertoires an Creme und der Tatsache, dass diese noch nicht vollständig eingezogen war, entfleuchten dabei immer wieder kleine, flatulenzartige Geräusche aus ihren Handinnenflächen. Ich fragte mich, was wohl passieren würde, würde die Creme tatsächlich einmal vollständig in ihre Hände einziehen. Sie hätte ganz bestimmt Pfoten so groß wie Schaufelbagger.
Auf jeden Fall begrüßte sie dann mit diesen fett eingefetteten Griffeln jeden einzelnen Gast mit Handschlag. Mit der Rechten. Besonders wohlgesonnenen Menschen legte sie außerdem die tätschelnde Linke obendrauf. Und wir Kinder bekamen einen Streichler über die Wange. Wahlweise rechts oder links. Obwohl ich nicht wusste, was was war. Eine Eigenschaft, die mir bis heute zu eigen ist.
Einmal habe ich mit dem Fett von meiner Wange die Kufen meines Schlittens eingerieben und ihn so um ganze 20 km/h schneller gemacht. Dafür war es also ganz gut.
Beim Kaffeetrinken jedoch war es eine Katastrophe.
Tante Cremes Handschlag führte regelmäßig dazu, dass mehreren Gästen die Kaffeetassen entglitten, was stets zu einer Riesensauerei führte.
Einmal musste Onkel Friedlich sogar ins Krankenhaus gebracht werden, da eine Kuchengabel in seinem linken Tränensack steckte. Sie war Üttchen aus der Hand geflutscht, als die auf einen der Stühle gedeutet und zu mir gesagt hatte: «Geh du ma da sitzen!»
Tante Creme heuchelte bei jedem dieser Missgeschicke Entsetzen, aber egal, was der Rest ihres Gesichts auch versuchte: Die gelbe, schlecht verklebte Tapete grinste und grinste.
Haare
Nachdem Mama ausgelernt hatte und richtige Friseuse war, schnitt sie uns allen die Haare. Meinem Vater, meinem Bruder, unserer Großcousine und unserem Großcousin und natürlich auch mir.
Mama hatte das Haareschneiden sehr gut gelernt. Sie konnte die erlernte Frisur exakt kopieren. Was zur Folge hatte, dass man schon von weitem sah, dass wir wohl alle miteinander verwandt sein mussten. Es war eine gute Frisur. Sie erwies sich als sehr moderesistent und wurde über viele Jahre beibehalten. Mein Vater trägt sie noch heute. Meine Mutter sagt, er trage sie auf.
Bei uns Kindern und meinem Vater wurden die Haare geschnitten, bei Oma und den anderen wurden die Haare gemacht. Das war ein Unterschied. Der Unterschied bestand hauptsächlich darin, dass Oma sich die Haare vorher waschen musste, und erst dann wurden sie geschnitten. Mama kippte Flüssigkeit aus einer kleinen Plastikflasche über Omas Kopf und knetete diese in die Haare hinein. Oma hatte dann einen Waschlappen vor dem Gesicht und atmete schwer. Danach wurden die Haare auf Lockenwickler gedreht und mit kleinen gebogenen Drähten am Kopf festgemacht. So fest, dass Oma immer die Augen zukniff, wenn Mama den Stachel durch die Wickler trieb.
Waren alle Haare fein aufgedreht, stülpte Mama Oma die Haube über. Die Haube war so etwas wie eine Luftmatratze für um den Kopf herum. Erst war sie ganz schlapp und sah aus wie eine weiße Sturmmütze, die unten nicht zugebunden worden war, doch wenn Mama das Gebläse bediente, plusterte sie sich auf und wurde groß und dick und fett und heiß am Kopf. Das Gebläse war dann so laut, dass Oma kein einziges Wort verstehen konnte. Was uns Kinder dazu veranlasste, sie nach Strich und Faden zu beleidigen. Aber eigentlich taten wir nur so, als würden wir böse Dinge sagen, und bewegten bloß die Lippen. Oma lachte meist, hob drohend den Zeigefinger und sagte: «Freundchen!»
Frisurentag war immer der Samstagnachmittag. Mama machte dann auch Üttchen die Haare, und immer wenn das passierte, mussten wir Kinder die Küche verlassen, denn keiner sollte Üttchen ohne Perücke sehen. Manchmal aber, wenn einer in die Küche hineinging oder sie verließ, sahen wir durch den Schlitz den kahlen Kopf. Und als ich Jahre später den zweiten Teil von Krieg der Sterne sah, als der Admiral zu Darth Vader ins Stübchen kommt und er durch den Spalt gerade noch so sieht, wie Darth Vader den Helm aufgesetzt bekommt – dachte ich an Üttchen!
Eines Tages hatten wir Kinder uns die «Wir-stülpen-eine-Decke-über-jeden-der-durch-die-Tür-kommt»-Beschäftigung ausgedacht und schon an verschiedenen Hausbewohnern erfolgreich getestet, als Üttchen hereinkam. Beim Überstülpen war es noch recht lustig, aber beim Abziehen der Decke nahmen wir ungewollterweise auch Üttchens Perücke mit. Keiner lachte mehr, und wir verließen auf dem Absatz den Raum, so wie wir es gelernt hatten, wenn sie oben ohne war. Üttchen selbst sagte an jenem Nachmittag nur noch einen einzigen Satz zu uns: «Na, das machta ja woh nicht noch ma, ne?!»
Und nachdem wir kopfschüttelnd verneint hatten, wurde nie wieder ein einziges Wort über diesen Vorfall verloren.
Biggi und Banda
Ich war ein sehr einfaches Kind. Bis auf den Vorfall mit Üttchens Perücke verhielt ich mich eher unauffällig. Von einem frühen gesundheitlichen Problem einmal abgesehen: Dieses eine Mal setzte alles bei mir aus, und ich wurde in Omas Arm ins Krankenhaus gefahren. Ich, fast noch ein Baby und ohnmächtig. Keiner fand je heraus, was es wirklich war, aber Oma machte sich seither mehr Gedanken um mich als um die anderen Kinder und beäugte und betrachtete mich stets mit einer Mischung aus Misstrauen und Mitleid.
Ansonsten war die Pflege, Fütterung und Beaufsichtigung meiner Person eine einfache. Man brauchte mich lediglich irgendwo abzusetzen, und schon beschäftigte ich mich mit mir selbst.
In Ermangelung irgendwelcher Spielsachen erfand ich Biggi und Banda. Meine eine und meine andere Hand, die sich miteinander unterhielten. Selbstverständlich mit unterschiedlichen Stimmen. Sonst hätte ich sie ja kaum auseinanderhalten können, denn ich wusste ja nicht, wo rechts und wo links ist.
Eine Eigenschaft, die mir bis heute zu eigen ist.
Allerdings brachten gerade solche und ähnliche Dinge Oma dazu, mich immer argwöhnisch zu beobachten und manchmal leise zu Mama zu sagen: «Der Junge hat doch nichts davongetragen, oder?» Woraufhin Mama aber nichts antwortete, sondern mich lediglich sorgenvoll ansah.
Ich versuchte, so zu tun, als hätte ich nichts gehört, fragte mich aber die ganze Zeit, was Oma wohl meinte. Ich saß doch nun schon so lange still hier in der Ecke und hörte zu, wie sich Biggi und Banda unterhielten. Und hatte mich nicht fortbewegt. Wie sollte ich da irgendetwas davongetragen haben? Und wenn Oma etwas suchte, warum fragte sie mich dann nicht selbst? Eine Eigenschaft, die ich bei Erwachsenen im Laufe der Jahre immer wieder feststellte: Sie unterhielten sich miteinander über eine dritte Person, als wäre diese nicht mit im Raum.
War sie aber.
So ein Blödsinn.
Selbst Biggi und Banda erwischte ich einmal, wie sie über mich redeten.
Marotte
Immer wenn ich mich mit etwas Neuem beschäftigte und dieses dementsprechend lang durchzog, weil mir noch nichts noch Neueres eingefallen war – ich zum Beispiel jemanden im Fernsehen gesehen hatte, den ich dann in Haltung und Sprache nachmachte –, fragte Oma: «Was is’ das denn wieda fünne Marotte?»
Ich blickte mich suchend um, sah aber keine. Ich wusste ja nicht mal, wie eine Marotte aussah.
Da Oma nichts Näheres dazu erläutern wollte, musste ich meine eigenen Schlüsse ziehen. Eine Marotte war bestimmt so etwas Ähnliches wie eine Karotte. Wahrscheinlich also rot und zum Essen und sicherlich dicker, denn «Ma» hörte sich dicker an als «Ka». Also war eine Marotte ganz bestimmt die dicke Schwester von Karotte. Und da Karotte auch Möhre hieß, musste Marotte wohl auch Köhre heißen. Sosehr ich mich aber umsah, immer wenn Oma das fragte, sowenig sah ich irgendetwas rotes Dickes.
Außer Üttchen.
Oma sah also Dinge, die gar nicht da waren. Mama sagte später einmal, das sei so bei alten Leuten, also ging ich im Folgenden nicht mehr darauf ein.
Lediglich einmal, als Oma und Mama mich dabei beobachteten, wie ich mit Onkel Friedlichs Strohhut und Omas erster Mann «sein Bambusspazierstock» und Üttchens Brille (die sie schon den ganzen Morgen suchte) so tat, als würde ich an der Küchenuhr hängen, weil ich Harold Lloyd in «Ausgerechnet Wolkenkratzer» imitierte und Oma wieder fragte: «Was is’ das denn wieda fünne Marotte?», antwortete ich trotzig, laut und leicht genervt: «Oma, hier is’ keine Köhre!»
Den Blick, mit dem sie mich daraufhin ansah, sah ich in den gemeinsamen Jahren danach noch des Öfteren im Gesicht meiner Oma.
Kurz darauf beugte sie sich zu Mama herüber und fragte ganz leise: «Der Junge hat doch nichts davongetragen, oder?»
Appes Bein
Irgendwann lief dieses Lied immer im Radio: «Schmidtschen Schleischer mit den elaschtische Beine». Und ich fragte mich, was der Mann da singen tut. Und warum man im Radio was singen darf, wenn man eine so schleschte Aussprache hat. Oma erklärte mir, der Mann käme aus einem anderen Land. Sei also Ausländer. Aus Holland. Also Holländer. Und die würden halt so reden.
Ach so.
Ich fragte mich, wie die Ausländerholländer einander verstehen würden, wo sie doch eine so schleschte Aussprache hatten.
Aber irgendwie klang es auch sehr, sehr niedlich.
Und es klang auch fast wie Deutsch.
War ohrenscheinlich nicht so schwierig, das Holländische.
Also entschied ich, Holländisch zu lernen. Entlang dieses Liedes.
Ich verbrachte viele Stunden vor dem Volksempfänger mit Warten darauf, dass das grüne Lämpchen vollständig leuchtete und er somit anging, und dann damit, dass das Lied wieder gespielt wurde.
Und dann, eines Abends, trat der Mann außerdem im Fernsehen auf. Verrückt! Der sah aus wie Harold Lloyd in «Ausgerechnet Wolkenkratzer»! Nur ohne die Brille. Dafür mit gewaltigem Schnurrbart. Das halbe Kostüm hatte ich also schon!