
One True Queen, Band 1: Von Sternen gekrönt (Epische Romantasy von SPIEGEL-Bestsellerautorin Jennifer Benkau) E-Book
Jennifer Benkau
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: One True Queen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
In dieser Welt sterben Königinnen jung. Dunkelheit. Das Gefühl, zu fallen. Und dann: nichts. Eben noch stand Mailin in ihrer Heimatstadt, plötzlich wacht sie in einer anderen Welt auf. Im Königreich Lyaskye trachtet ihr alles und jeder nach dem Leben – nur nicht der mysteriöse Fremde, der Mailin aus einer Falle rettet. Der so gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt. Erst als er sie zum Königshof bringt, erkennt Mailin, dass sie nicht ohne Grund in Lyaskye ist: Sie soll Königin werden. Und das ist in dieser Welt ein Todesurteil. Jand 1 der High-Romantasy-Reihe von SPIEGEL-Bestsellerautorin Jennifer Benkau Herzzerreißend. Episch. Atemberaubend. Jennifer Benkaus Romantasy-Reihen "One True Queen", "Das Reich der Schatten" und "The Lost Crown" spielen in derselben Fantasy-Welt, können aber unabhängig voneinander gelesen werden. Sie sind in dieser Reihenfolge erschienen: One True Queen, Band 1: Von Sternen gekrönt One True Queen, Band 2: Aus Schatten geschmiedet Das Reich der Schatten, Band 1: Her Wish So Dark Das Reich der Schatten, Band 2: His Curse So Wild The Lost Crown, Band 1: Wer die Nacht malt The Lost Crown, Band 2: Wer das Schicksal zeichnet New-Adult-Romance von Jennifer Benkau: A Reason To Stay (Liverpool-Reihe 1) A Reason To Hope (Liverpool-Reihe 2)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 633
Sammlungen
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2019
Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag GmbH
© 2019 Ravensburger Verlag GmbH
Copyright 2019 © Jennifer Benkau
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Lektorat: Kathrin Becker
Umschlaggestaltung und Vorsatzkarte: Carolin Liepins, München
Verwendetes Bildmaterial von © Andrekart Photography, © iiiphevgeniy, © Romola Tavani, © ollen, © Azamat-Fisun, © Chinawooth Sakaew, © Katerina Era, © Alexander_P, © Bodor Tivadar und © Aleshyn_Andrei, alle von Shutterstock
Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.
ISBN 978-3-473-47973-3
www.ravensburger.de
So viele Bücher. Und du nimmst ausgerechnet dieses.
KAPITEL1
Wie viel Mut es kosten kann, ein Buch aufzuschlagen.
Alice im Wunderland. Heute lege ich es darauf an, eine Regel nach der anderen zu brechen, aber mir steht ohnehin der Ärger meines Lebens bevor. Ich hätte das Dach über unseren Köpfen anzünden können, die Tat würde blass und unscheinbar aussehen neben dem, was ich eben getan habe. Ich zittere immer noch vor Wut.
An Vickys Oberlippe klebt ein kleiner Kakaobart – ein Beweis meiner letzten, harmlosen Verfehlung. Kakao bekommt sie normalerweise nur am Wochenende. Aber heute wird Mum sicher nichts dazu sagen, kein: »Sie verbrennt kaum Kalorien, von Süßem wird sie dick und krank.« Wir werden andere Probleme haben, sobald sie nach Hause kommt.
»Bist du bereit?«
Meine Schwester lächelt. Ihr Blick ist müde, als hätte sie tagelang nicht geschlafen, dabei tut sie kaum etwas anderes. Doch sie lächelt.
Ich lese langsam, mache Pausen und sehe sie immer wieder an. Achte auf ihr Blinzeln, auf jede Bewegung ihrer Lippen, auf die kleinste Regung. Bleiben ihre Hände offen und entspannt? Hebt und senkt sich ihre Brust im selben Rhythmus? Ihre vielen Teddys und Kuscheltiere beobachten mich trotz ihrer freundlichen Gesichter skeptisch bis anklagend.
Doch ich glaube, Vicky mag das Gedicht, mit dem Lewis Carroll seinen Roman beginnt; sie liebt es immer, wenn ich ihr Lyrik vorlese. Und ich meine zu spüren, dass ihr auch das erste Kapitel gut gefällt; von den beiden Schwestern, die gemeinsam ein Buch lesen.
Trotzdem gehe ich ein Risiko ein. Die Ärzte sagen, wir dürften Vicky weder fernsehen lassen noch unbedacht das Radio einschalten, wenn sie im Zimmer ist. Und wenn wir ihr etwas vorlesen, soll es harmlos sein, ohne Konflikt und Spannung. Es darf sie keinesfalls verwirren. Niemand weiß, was sie bewusst mitbekommt, was nur zur Hälfte und was ihr Angst einjagt, irgendwo weit hinter ihrem ewigen, müden Kinderlächeln, weil sie Realität und Geschichten vermutlich nicht auseinanderhalten kann.
Alice im Wunderland ist alles andere als harmlos. Doch mein Gefühl sagt mir, dass sie die Raupe Nimmersatt und Peter Rabbit leid ist, und dieses Gefühl – meine Verbundenheit zu ihr – ist das Einzige, was mich noch zu ihr durchlässt. Ich darf nicht zulassen, dass sie durch meine Unsicherheit abreißt. Sobald das geschieht, sehe ich vielleicht nur noch das in ihr, was Catherine Pakert mit ihren widerlichen Worten vorhin behauptet hat.
Seit sieben Jahren liegt Victoria im Wachkoma. Sieben Jahre, in denen ich jede Stunde darauf gehofft habe, dass sie aufwacht. Ebenso spontan, grundlos und unerklärlich, wie sie in diesen Zustand verfallen ist. Damals dachte ich, sie hätte irgendetwas Wichtiges von mir in ihre Welt mitgenommen. Alles war plötzlich so still um Mum und mich herum. Mein Leben, wie ich es kannte, liebte und leben wollte, verbrannte und Vicky sah schweigend lächelnd zu, wie die Reste meiner Kindheit in einem Ascheregen auf uns niedersanken. Ich war eine ganze Weile wütend, auch wenn ich natürlich wusste, dass sie nichts für ihren Zustand konnte. Erst viel später habe ich zu kämpfen begonnen und das Schwert in meiner Hand hat mir geholfen anzunehmen, was nicht zu ändern ist.
Inzwischen ist meine Schwester neunzehn. Doch hier in ihrem Zimmer sieht fast alles noch genauso aus, wie sie es mit zwölf Jahren dekoriert hat. Zwischen Pferde- und Katzenpostern hängt ein einziges von Justin Bieber. Selbst der war damals niedlich. Auf den Regalböden stapeln sich Comics, Pferdebücher und Kuscheltiere über Kuscheltiere, weil man ihr sonst nichts schenken kann, wenn ihr Geburtstag oder Weihnachten ansteht. In ihrem Schrank hängen immer noch ein paar ihrer geblümten Kinderkleider. Wir haben es nicht über uns gebracht, sie auszusortieren, als würden sie Vicky wie von Zauberhand wieder passen, wenn sie gesund wird und zu sich kommt.
Bei mir hingegen hat sich alles verändert, mehrmals sogar. Die Tierkinder haben zunächst Postern von Sängern, Bands und Fußballstars Platz geschaffen, bis ich diese dann auch wieder abgenommen und weggeworfen habe. Inzwischen hängen ein paar Landschaftsaufnahmen an meinen Wänden – phänomenale Bilder von den atemberaubendsten Orten der Erde, allesamt nahezu am anderen Ende der Welt. Souvenirs aus den USA, Australien und Japan, die ich über eBay erstanden habe, weil meine Reiseerfahrung sich auf Bildbände und Youtube-Videos beschränkt. Dazu ein London-Metallschild sowie ein leerer Bilderrahmen. Früher war ein Foto von Fynn und mir darin, aber nachdem wir Schluss gemacht hatten, schuf ich Kunst daraus. Ich nannte das Werk: Nichts, nur ein hübscher Rahmen. Die Worte stehen auf dem kleinen Schild, das darunter hängt.
Doch vollkommen egal, wie verschieden wir uns entwickelt haben: Zwischen Vicky und mir gibt es immer noch ein besonderes Band. Dieses Band, das schwöre ich, wird niemals reißen. Ich kenne sie besser als eine Pflegerin mit dreißig Jahren Erfahrung mit anderen Menschen; besser als ein Arzt, der sie alle paar Wochen für eine Untersuchung an seine Gerätschaften anschließt. Ihr ewiges Lächeln, das die Leute nichtssagend nennen – mir sagt es noch immer genug.
Und so lese ich, beobachte ihre Reaktionen, koche uns beiden zwischendurch eine zweite Tasse Kakao und lasse zu, dass mich ihr Lächeln langsam entspannt.
Als ich den Schlüssel im Haustürschloss höre, schlage ich das Buch zu und schiebe es in die Ritze zwischen Polster und Armlehne des Sessels. Jetzt bin ich fällig.
»Mum ist da«, sage ich und hauche Vicky einen Kuss auf die Wange. »Wir lesen morgen weiter, okay?«
Vicky lächelt und ich verlasse ihr Zimmer, damit sie den Streit, der nun unausweichlich folgen wird, nicht mit anhören muss.
»Sag mir, dass alles ein Missverständnis ist!«, fährt Mum mich an, noch während sie ihre Jacke an die Garderobe hängt. Der Haken bricht ab, sie zischt die erste Silbe eines Fluchs durch die Zähne und lässt die Jacke auf den Boden fallen.
Ich schließe Vickys Zimmertür. »Hi, Mum.«
»Mailin!« Sie ist sauer.
Das ist sie selten. Gestresst, ja. Das darf man einer alleinerziehenden, berufstätigen Mutter zweier Teenagertöchter nicht vorwerfen. Erst recht nicht, wenn eine der Töchter so selbstständig ist wie ein Säugling. »Mit Mrs Walsh will man nicht tauschen!«, sagen die Leute über meine Mutter. Und damit meinen sie nicht die Tatsache, dass ihr einst rotblondes Haar längst grau wird und immer noch so schnell wächst, dass sie mit dem Ansatzfärben nie hinterherkommt.
Aber Mum lässt den Stress nie an mir aus, im Gegenteil. Normalerweise macht sie sich zusätzlichen, um vor mir zu verbergen, wie anstrengend ihr Alltag ist. Sie jetzt nur mühsam beherrscht zu sehen, lässt mich kleinlaut werden und alle Argumente, die ich mir sorgsam zurechtgelegt habe, wirken plötzlich verstreut und durcheinander.
Mit zusammengepressten Lippen tritt sie an mir vorbei und verschwindet im Zimmer meiner Schwester, um sie zu begrüßen.
Ich gehe in unsere kleine Wohnküche, wo nur noch zwei Stühle am Esstisch stehen, um Platz für den Rollstuhl zu schaffen. Das Geschirr vom Frühstück wartet noch in der Spüle. Verdammt, das habe ich schon wieder vergessen.
Mum kommt in die Küche, nimmt schwerfällig am Tisch Platz, stützt die Ellbogen auf und lehnt die Stirn auf die Fingerspitzen. »Was hast du dir nur dabei gedacht, Catherine so zu beleidigen?«
Ich habe inzwischen Spülwasser eingelassen und versenke das erste Glas im Schaum. »Du warst nicht da, Mum, sonst wüsstest du es.«
»Du musst sie anrufen und dich entschuldigen. Sie ist wütend, aber ich glaube, dass sie sich auf eine ehrliche Entschuldigung ein…«
»Mum! Ich werde sie nicht anrufen. Du hast doch gar keine Ahnung, was passiert ist!«
»Was passiert ist?« Ihr Kopf fährt hoch und ihr Blick wird scharf. »Ich sage dir, was passiert ist, Mailin. Unsere Pflegerin hat wegen deiner Unverschämtheit fristlos gekündigt und ich stehe vor dem Problem, meiner Chefin erklären zu müssen, dass ich morgen nicht zur Arbeit kommen kann. Und übermorgen auch nicht. Sondern erst, wenn ich eine neue Pflegekraft für Vicky habe. Du weißt selbst, wie schwer es war, Catherine zu finden.« Ihre Stimme ist leise geworden, was mich unruhiger macht, als würde sie schreien. »Dein Verhalten könnte mich den Job kosten. Das ist passiert, Jesus Christ!«
Mechanisch wische ich an einem Teller herum, der längst sauber ist. »Es ging nicht anders.«
»Hör auf, Mailin!«
»Aber es ist wahr.« Ich lasse den Teller ins Wasser gleiten und wende mich zu ihr um. »Du hast nicht gehört, was sie über Vicky gesagt hat.« Allein daran zu denken, macht mich so wütend, dass mir die Brust zu eng für meinen Herzschlag wird. »Sie hat gesagt, dass sie nur noch eine Hülle ohne Sinn und Verstand sei.« Mir schießen Tränen in die Augen. »Eine Leiche, die das Sterben vergessen hat! Und Vicky war dabei, Mum! Sie hat das alles gehört!«
Mum senkt den Blick. »Das hat sie nicht so gemeint. Ihr Job ist hart, Mailin. Da wird man … pragmatisch.« Sie seufzt, es liegt fast ein Schluchzen darin. »Sie darf so etwas nicht sagen. Ich hätte mit ihr geredet. Aber du kannst so was nicht selbst in die Hand nehmen und sie vergraulen. Catherine sagte, du hättest sie eine böse Hexe genannt.«
»Das stimmt gar nicht.«
»Was hast du denn gesagt?«
Ich muss bitter grinsen. »Ich habe sie ›Dolores Umbrigde für Arme‹ genannt«, antworte ich und Mum entgleisen die Gesichtszüge. »Woher hätte ich wissen sollen, dass eine wie die Harry Potter kennt?«
Meine Mutter antwortet nicht, stattdessen bekommt sie ihre hektischen Flecken. Ich sollte es dabei belassen, aber die Worte wollen raus.
»Sie ist kein Verlust, Mum. Sie war die ganze Zeit respektlos. Sobald du aus dem Haus warst, ging sie mit Vicky um, als wäre sie etwas Lästiges. Das heute, das war nur die Spitze des Eisbergs und …«
»Halt den Mund!«, schreit Mum mich an. »Verdammt, Mailin, wenn ich mir eine Pflegekraft hätte aussuchen können, wäre es sicher nicht Catherine Pakert gewesen! Aber ich hatte keine Wahl, verstehst du es nicht? Ich habe wochenlang gesucht. Monate! Im Moment ist sie die Einzige, die qualifiziert, zuverlässig und bezahlbar ist.«
Ich balle die Fäuste so fest, dass sich meine kurzen Nägel in die Handflächen bohren. »Du machst es dir leicht! Catherine verachtet Vicky. Und du willst es nicht wahrhaben, weil es ungelegen kommt.«
»Schluss jetzt!«, zischt Mum. »Du übertreibst maßlos. Und solange wir alle – wir alle drei, auch du, Mailin! – davon abhängig sind, dass ich zur Arbeit gehe und unser Geld verdiene, werden wir mit ihr zurechtkommen müssen.«
Das Spülwasser tropft von meinen Händen auf den Linoleumboden und hinterlässt kleine Kreise auf der gefakten Holzmaserung.
»Du wirst dich bei ihr entschuldigen.«
»Nein, Mum. Bitte. Wir finden jemanden. Wenn es am Geld liegt, dann kann ich einen Job annehmen. Ich habe doch auch gespart, für Australien. Ich muss noch gar nicht nach Australien, das kann warten! Und bis wir jemanden finden, kann ich mich um Vicky kümmern.«
»Nein, Mailin.«
»Doc Madely schreibt mich eine Weile krank, wenn wir es ihm erklären. Ich arbeite den Schulkram zu Hause nach.«
»Mailin. Nein.« Meine Mutter spricht zu mir wie zu einem Kleinkind. »Die Schule ist wichtig. Das kommt überhaupt nicht infrage.«
»Dann …«
»Es reicht jetzt! Du musst dich bei Catherine entschuldigen.«
»Den Teufel werde ich tun!« Aufgebracht stürme ich aus der Küche, bleibe jedoch auf halbem Weg noch einmal stehen. »Du kannst ja gern den Mist glauben, den Catherine dir immer erzählt. Dass Vicky ohnehin nichts mehr mitkriegt und wir sie in ein Heim geben sollen. Ja, schau mich nicht so an – ich habe das mitbekommen. Ich bin nicht blind und taub, Mum. Aber Catherine irrt sich, ich weiß es. Und du weißt es auch. Du willst es nur nicht wahrhaben. Du redest dir ein, sie wäre eine leere Hülle ohne Gefühle, weil du sie sonst nie ohne schlechtes Gewissen dieser Hexe überlassen könntest!«
»Mailin, hör sofort auf damit!« Mums Stimme zittert vor Entsetzen. So habe ich noch nie mit ihr gesprochen. Mir rauscht das Blut in den Ohren. Ihr Mund bewegt sich weiter, aber ich verstehe nicht mehr, was sie sagt.
Ich greife nach meiner Tasche, renne nach draußen und knalle die Tür hinter mir zu. Mit brennenden Augen umrunde ich unser kleines Haus, öffne das Gartentor mit einem Fußtritt und schwinge mich auf mein altes Männerrennrad, das neben der Wäschespinne im Hof an der Wand lehnt.
Nichts wie weg hier.
KAPITEL2
Wind.
Es gibt nichts auf der Welt, das mich mehr tröstet, als Fahrtwind im Gesicht. Wenn das Tempo leichtsinnig hoch ist, der Wind wie mit Händen durch meine Haare fährt und mir Tränen aus den Augenwinkeln treibt, wenn das Atmen schwerfällt und das Herz davonrast, dann fühle ich mich frei und für einen Moment, als wäre ich … richtig. In diesen Augenblicken weht mir um die Ohren, dass mein Leben mehr ist als bloße Existenz. Im Rauschen und Sausen verbirgt sich ein Flüstern, das leise aber klar irgendetwas von Bedeutung verspricht. Etwas, was ich noch nicht gefunden habe und wonach ich nie zu suchen aufhören darf.
Vielleicht bedeutet das alles aber auch nur, dass ich mich lebendig fühle. Unanständig, provokant und regelrecht vulgär lebendig, verglichen mit meiner Schwester.
Ich kenne jeden Stein auf dieser Straße, jedes Schlagloch und alle Risse im Asphalt, den seit Jahrzehnten niemand mehr erneuert hat. Warum auch? Die Straße führt bloß zwischen sattgrünen Talsenken und saftig bewachsenen Hügeln von Killarney zu der Siedlung hoch, wo wir wohnen, und wird selten befahren. Man fühlt sich mit dem Blick auf Berge, Seen und Ross Castle unten in der Stadt wie im kitschigsten Postkartenidyll und nur die Kühe schauen einem nachsichtig hinterher. Wenn man von hier aus zurückblickt, sehen die Häuser auf der Anhöhe wie ein eigenes Dorf aus, aber der Schein trügt. Außer ein paar Wohnhäusern liegen dort lediglich eine verwaiste Lagerhalle von John Deere, ein Bed & Breakfast für die ganz Sparsamen sowie ein Spielcasino.
Aus der abgefahrenen Niemandslandstraße wird die Mainstreet von Killarney, zu deren Seiten sich bunt gestrichene Wohnhäuser mit hohen Fenstern und Blumenrabatten dicht aneinanderschmiegen, unterbrochen von Geschäften und einem Hotel nach dem anderen. Pro Einheimischen trift man hier im Sommer meist auf vier bis fünf Touristen.
Ich biege ab, bevor die hübschesten Restaurants und Cafés kommen, und flitze an Bäckerei, Bauernladen und dem Haus vorbei, in dem mein bester Freund Ravi mit seiner Zwillingsschwester Reena und ihren Eltern im oberen Stockwerk wohnt. Im Erdgeschoss liegt – ganz dem Klischee entsprechend – der indische Imbiss der Familie. Mr und Mrs Sharma träumen davon, dass die Kinder diesen eines Tages übernehmen, aber Ravi und Reena würden es allenfalls zum Katzen-Café oder Horror-Fan-Shop umbauen und ihren Eltern damit das Herz brechen. Ich fahre mitten durch die Duftwolke aus exotischen Gewürzen und frischem Brot. Etwas später passiere ich Tesco und bremse ab, denn gleich hinter dem Parkplatz, da, wo man denkt, dass nur noch Lagerräume kommen, liegt mein Ziel. Ich schließe mein Fahrrad an eine Laterne an. Das alte Rostteil ist ein Erbstück meines Dads; eines der wenigen Teile, die er Vicky und mir hinterlassen hat, als er ging. Mum nennt das Fahrrad Altmetall und meint, Dad wäre bloß zu bequem gewesen, es zum Schrotthändler zu bringen, dabei ist nur die Gangschaltung kaputt und ansonsten fast nichts.
Ich tätschle den Sattel und atme tief durch. Versuche, den Rest Ärger und Frustration loszulassen, aber es gelingt mir nicht.
Wie kann sie Vicky nur dieser Frau anvertrauen?
Wie kann sie von mir verlangen, es zu akzeptieren?
Wie konnte ich nur so gemein zu ihr sein? Sie hat ja recht, wenn sie sagt, dass sie keine Wahl hat.
Und so betrete ich die Kampfsportschule mit vor Grübelei schwerem Kopf. Da ich etwas außerhalb von Killarney wohne, gebührt mir die Annehmlichkeit eines eigenen Spinds, in dem mein Shinai, das Trainingsschwert aus Bambus, mein weiter, indigoblauer Gi und die Bōgu, die Rüstung, auf mich warten. Bōgu und Gesichtsmaske sind Leihgaben des Vereins, ein weiterer Vorteil, den mir meine Trainerin Lucinda verschafft hat, da wir uns die Ausrüstung nicht leisten konnten. Beides lasse ich heute hängen und greife nur zu Gi und Schwert. Ich möchte an meiner Kata feilen, nicht kämpfen, da brauche ich keine Rüstung.
Während ich mich umziehe, höre ich Kampfschreie aus dem Dōjō. Ich schlüpfe in den Gi, binde mir die windzerzausten Locken zusammen und drücke aus alter Gewohnheit gegen den linken Nasenflügel. Seit einem Bruch ist meine Nase ein wenig schief und Ravi hat mir eingeredet, man könnte das mit regelmäßigem Gegendruck verbessern. Bevor ich aus dem nüchternen Korridor in die Trainingshalle gehe, in der Holzdielen, Bambusraumtrenner sowie japanisch anmutende Fenster und Lampen eine fernöstliche Atmosphäre versprühen, versuche ich noch einmal, meinen vor Gedanken sirrenden Kopf zur Ruhe zu bringen. Das Übungsschwert hilft mir, mich nicht mehr machtlos zu fühlen.
Im hinteren Bereich des Dōjōs trainieren zwei erfahrene Kendōka anspruchsvolle Techniken. Lucinda erkenne ich trotz Rüstung und Maske sofort. Ihr Gegner ist mir auf den ersten Blick unbekannt. Er ist groß und breitschultrig – und unglaublich gut. Ein harter Treffer nach dem anderen geht auf Lucindas Rüstung nieder. Trotz ihrer Erfahrung und Schnelligkeit hat sie nicht den Hauch einer Chance, denn er ist atemberaubend wendig und vollkommen unvorhersehbar in seinen Bewegungen.
Es dauert eine Weile, bis mir auffällt, dass ich die beiden Kämpfer anstarre. Rasch wende ich mich ab, verbeuge mich vor der Ehrenseite der Halle und setze mich zu einer kurzen Meditation auf die Fersen. Dann beginne ich meine Kata, um endlich, endlich die trüben Wolken aus meinem Kopf zu vertreiben.
Ich habe etwa eine halbe Stunde lang geübt, da kommt Lucinda auf mich zu. Ich hatte ihre Anwesenheit und die des anderen Kämpfers trotz ihrer Kampfschreie vollkommen ausgeblendet und zucke zusammen, als sie mich begrüßt und ihre Gesichtsmaske abnimmt.
»Ich hatte heute gar nicht mit dir gerechnet«, sagt sie und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Der andere hat es ihr mächtig gegeben. Ob er ein neuer Trainer ist? Unauffällig linse ich zu ihm hinüber. Er übt eine komplizierte Abfolge von Schritten und Angriffen, als hätte ihn der Kampf zuvor nicht im Geringsten angestrengt.
»Ich konnte ein Training gebrauchen«, antworte ich und Lucinda kneift die Augen leicht zusammen.
»Aber genutzt hat es dir nicht. Du bist nicht gut. Nicht«, sie klopft mir mit zwei Fingern an die Stirn, »frei. Solche Übungseinheiten sollte man sich sparen. Man wird dadurch nur schlechter.«
Viele Schüler können mit ihrer direkten Art nicht gut umgehen. Die meisten behaupten, Ehrlichkeit und Offenheit zu schätzen – aber nur solange, bis jemand ehrlich und offen mit ihnen spricht. Auch mein Gehirn sucht bereits eine Ausflucht. Doch dann nicke ich. Sie hat leider recht.
»Kummer?«, fragt sie schlicht, setzt sich auf die Bodendielen und deutet neben sich. Ich sinke in den Schneidersitz, will schweigen und lasse mich von ihrem wortlosen Warten dann doch überzeugen, ihr zu erzählen, was passiert ist.
Mit Lucinda zu reden, fiel mir schon immer leicht, auch wenn die meisten Menschen, einschließlich Mum und meiner Freunde, behaupten, ich wäre wortkarg und verschlossen. Bei Lucinda ist es anders. Vielleicht, weil sie selbst viel schweigt und sogar die scheusten meiner Worte sich in ihrer Stille nach draußen wagen. Als ich vor sechs Jahren hier anfing, war ich eine verstörte Elfjährige, die nicht das geringste Interesse an Kendō hatte, aber lernen sollte, sich zu wehren. Lucinda war eine sechzehnjährige Ehrenamtlerin mit einem Faible für schwierige Fälle. Inzwischen ist sie nicht nur meine Trainerin, sondern vor allem eine Freundin.
Als ich zu Ende erzählt habe, zeichnet sich ein Grinsen auf ihrem Gesicht ab, das mir beinah stolz erscheint. »Ich bin froh, dass du etwas gesagt hast.«
»Es war nicht besonders fair.«
Lucinda wiegt den Kopf. »Es war überfällig. Wenn man den Mund erst aufmacht, sobald man zu platzen droht, passiert es schnell, dass man an der Fairness vorbeistürmt. Aber gar nichts zu sagen, ist doch auch keine Option. So, wie du diese Pflegerin beschreibst«, sie zwinkert, »hätte ich sie auch zum Teufel gejagt.«
»Leider hat Mum recht, wenn sie sagt, dass wir keine Wahl haben.«
»Ich glaube, es gibt immer eine Wahl.«
»Aber es wird schwer.«
»Ja.« Lucinda lächelt mitfühlend. »Aber das ist deine Schwester doch wert, oder?«
»Natürlich.«
Sie legt mir die Hand aufs Knie. »Als du hier angefangen hast, da war deine erste Aufgabe, dich nicht von Dingen fertigmachen zu lassen, die du nicht ändern kannst. Die Idioten aus deiner Schule, die dich geärgert oder über deine Schwester hergezogen haben, oder die Abwesenheit deines Vaters. Weißt du noch?«
Ich nicke stumm. Da gab es einiges.
»Und das hast du geschafft. Aber mit den Jahren hab ich mir mehr und mehr Sorgen um dich gemacht, weil du angefangen hast, alles hinzunehmen, und dabei immer stiller wurdest. Heute warst du nicht still, sondern hast die Kämpferin rausgelassen. Das ist ein großer Schritt. Du solltest stolz sein.«
Ich bemühe mich, ihr Lächeln zu erwidern, aber meines gerät unsicher. »Ich komme vermutlich trotzdem nicht darum herum, mich bei Mum zu entschuldigen, oder?«
Lucinda grinst. »Ich fürchte nicht. Aber vorher machst du die Kata noch einmal. Und fühlst dabei den angebrachten Stolz, weil du für deine Schwester gekämpft hast.«
Ich springe auf die Füße, verneige mich vor ihr und der Ehrenseite des Dōjōs und beginne die Kata erneut.
»Besser?«, frage ich danach.
Lucinda lächelt. »Nicht genug. Noch mal. Und dann noch einmal. Und sobald du mich nicht mehr fragen willst, ob du gut genug warst, weil dir dein eigenes Urteil wertvoll erscheint, kannst du für heute Schluss machen.«
Als ich nach einem langen, harten Training zu den Duschen gehe, höre ich das Ratschen eines Reißverschlusses aus der Männerumkleide. Ob das dieser supergute Typ von vorhin ist? Ich gehe langsamer, nestle noch am weiten Hosenbein meines Anzugs herum, aber die angelehnte Tür öffnet sich nicht, also gehe ich erst mal duschen. Etwas später komme ich in meiner üblichen Montur aus schwarzer Jeans und anthrazitfarbenem Tanktop heraus – ein gern kritisiertes Outfit, weil es depri wirkt, aber in Wahrheit passt zu meinen roten Haaren leider nichts anderes als die breite Palette zwischen Dunkelgrau und Schwarz. Ein geblümter Handtuchturban auf dem Kopf und Badelatschen an den Füßen vervollständigen mein Outfit – hoffentlich begegnet der Neue mir nicht ausgerechnet auf dem Rückweg zur Frauenumkleide. Doch die Tür zur Männerkabine steht offen und der Raum ist leer.
Es ist still in der Kampfsportschule, man hört das Ticken der Uhr und das leise Sirren des Getränkeautomaten im Eingangsbereich. Lange wird das nicht so bleiben, in einer halben Stunde startet der erste Kurs, und ein Haufen Leute wird sich gleichzeitig in die engen Umkleiden pressen. Besser, ich beeile mich. Auch, weil ich es nicht länger aufschieben will, mit Mum zu reden. Vielleicht schreibe ich ihr eine Nachricht, überlege ich, während ich meine Füße abtrockne und Socken und Sneakers anziehe. Immerhin brauche ich noch eine Dreiviertelstunde, um ohne Gangschaltung den Berg wieder hochzustrampeln.
Ich greife zum Handy, sehe eine eingegangene Nachricht von Ravi, muss aber vor dem Lesen kurz aufblicken, weil die Tür geöffnet wird.
Da ist jemand, ich sehe einen Schemen, höre einen Laut.
»Sch!«
Im nächsten Moment löst sich mein Sichtfeld auf. Es verschwindet einfach – alles um mich herum zerfällt zu nichts. Ich will schreien und kann es nicht. Fühle mich stürzen, doch schlage nicht auf. Es geht sehr schnell und ist gleichzeitig endlos.
Meine Gedanken erscheinen mir zunächst absurd aufgeräumt und logisch: Du fällst in Ohnmacht – das kommt vor, ist sicher nur der Kreislauf.
Doch im Grunde weiß ich es längst besser.
Ich fühle mich, als wäre ich aus Sand. Und von einem Moment auf den anderen zerfalle ich in Milliarden Körnchen und ein wirbelnder Sturm erfasst mich und löst mich auf.
KAPITEL3
Nein.
Nein!
Was immer hier geschieht – ich lasse es nicht zu.
Ich lasse. Es. Nicht zu!
Ich fühle mich zerrissen.
Windzerrissen. Und dieser Wind hat nichts an sich, was mich tröstet oder frei macht.
Er schleift mich mit sich und zerfetzt mich in tausend Bestandteile, die allesamt nur einem Instinkt folgen wollen:
Ich lasse das nicht zu!
Gib mich frei, Wind, oder was immer du auch bist.
Lass. Mich. Los!
Der Wind ist so stark, so stürmisch, so vollkommen unnachgiebig.
Aber ich – ich bin es auch.
KAPITEL4
Taufeuchtes Gras klebt an meiner Wange. Sonnenstrahlen und Schatten spielen über mich hinweg, als hätten sie Freude daran. Während ich mich aufrapple, reibe ich mir übers Gesicht und sehe mich um. Wo bin ich und was zum Teufel ist passiert?
Ich befinde mich auf einer Lichtung im Wald und in meinem Kopf hallt ein seltsames Dröhnen nach, als wäre unter meiner Hirnschale eine gewaltige Glocke geschlagen worden. Habe ich getrunken? So viel? Ich kann mich nicht erinnern. Alles, was ich noch weiß, ist, dass ich im Dōjō war, geduscht und mich wieder angezogen habe. Meine Kleidung passt haargenau zu dieser Erinnerung – ich trage Jeans, Tanktop und die Sneakers sind noch offen. Sogar meine Locken sind noch feucht und dunkel. Vielleicht bin ich über die Schnürsenkel gefallen und habe mir den Kopf angehauen? Aber was mache ich dann im Wald?
Im Gras finde ich mein Handy, doch das Display bleibt schwarz, egal wie oft ich auf den Knopf drücke. Eiskalt erwischt mich der Gedanke, jemand könnte mir K.-o.-Tropfen oder andere Drogen untergejubelt haben. Doch hier ist niemand und nichts weist darauf hin, dass mir etwas angetan wurde.
Mein Hirn fühlt sich eigenartig klar an. Fast scheinen mir meine Sinne schärfer zu sein als gewöhnlich. Die Blätter der Bäume und das Gras sind von einem intensiveren Grün und tragen einen seltsamen Schimmer. Ganz sicher doch Drogen!
Ich erkenne diese Lichtung nicht. Was bedeutet, dass ich mich nicht mehr in der Nähe von Killarney befinden kann, denn dort kenne ich jedes der wenigen Wäldchen in- und auswendig. Es kann nur eine Erklärung geben: Jemand muss mich hergebracht haben – wo immer hier auch sein mag. Mich fröstelt trotz der Wärme. Ich sollte verschwinden, bevor derjenige zurückkommt und mit mir anstellt, was er sich ausmalt. Mein erster Impuls sagt: Renn! Mühsam ringe ich ihn nieder. Erst mal muss ich mich orientieren. Der hohe Stand der Sonne deutet auf Mittag hin, was mich fast verzweifeln lässt. Im Dōjō war ich am frühen Abend. Ich kann doch unmöglich eine Nacht und den halben Tag hier im Gras gelegen haben?
Egal. Es wird sich alles aufklären, ich darf nur nicht die Nerven verlieren. Einatmen, ausatmen. Und dann los, immer geradeaus, früher oder später werde ich aus dem Wald kommen und auf eine Straße oder eine Ortschaft treffen. Ich habe oft bedauert, dass es in Irland kaum mehr richtige Wälder gibt, jetzt kommt mir das entgegen.
Als ich nach etwa einer Stunde noch immer nichts und niemanden gesehen habe – nicht einmal eine steinige Bergkuppe zwischen den Bäumen, einen der vielen Zuflüsse unserer Seen oder eine einfache Wanderwegmarkierung, die es in Kerry an jedem zweiten Stein und dritten Baum gibt, mutiert meine Unruhe zu nackter Angst.
Die Pflanzen hier sehen anders aus. Ich komme an blau schillernden Pilzen vorbei, groß wie Couchtische. Die langen, schmalen Blätter eines Baums, an dem ich entlangstreife, scheinen sich nach mir auszustrecken. Farne in Rot- und Orangetönen schwanken im Wind wie lodernde Flammen und gerade beobachtet mich ein Vogel, dessen Gefieder zwischen Schwarz und einem tiefen Blaugrün changiert. Nichts davon gehört in die irische Flora und Fauna. Das wüsste ich doch.
»Hallo?« Ich flüstere das Wort zunächst, drehe mich im Kreis und versuche krampfhaft, die aufkommenden Ängste zu verdrängen. Was soll Vicky nur denken, wenn ich nicht zurückkomme? »Hallo!« Und Mum? Ob sie sich Sorgen macht, mich schon überall sucht?
»Hallooo?«, rufe ich in den Wald. Mehrere Vögel flattern auf, doch eine Antwort bleibt aus. Es ist düster, dabei kann es allenfalls früher Nachmittag sein. Doch die dichten Zweige über mir verflechten sich zu einem Dach, das kaum Tageslicht hindurchlässt. »Haaal-looo! Hiiil-feee!«
Schließlich bricht ein Schluchzen aus mir hervor. Ich will nicht heulen wie ein Kind – das bringt mich nicht weiter. Ein paar Tränen laufen mir dennoch übers Gesicht, bevor ich sie mit dem Handrücken wegwische. Zu meiner Verzweiflung kommt Durst. Nach dem schweißtreibenden Training habe ich nichts getrunken und sollte das tatsächlich schon einen Tag her sein, wird es langsam kritisch. So fühle ich mich allerdings nicht. Durstig, ja. Aber nicht dehydriert.
Mutlos lasse ich mich auf eine von Moos bewachsene Baumwurzel sinken, stütze die Stirn in die Handflächen und versuche nachzudenken. Doch in meinem Kopf kreiselt bloß die Vorstellung, wie Mum zu Hause nervös auf mich wartet, erst all meine Schulkameraden anruft und schließlich die Garda verständigt. Die durchkämmen kaum die Wälder nach mir. Siebzehnjährige Mädchen, die nach einem Streit verschwinden, vermutet die Polizei erst in Galway, dann in Dublin und schließlich in London. Man wird ein paar Plakate von mir aufhängen und meine Familie bedauern. Das war’s.
Zusammenreißen!, befehle ich mir, als die Verzweiflung aufzuwallen droht. Ich kann nicht darauf setzen, hier gesucht zu werden, also muss ich selbst einen Weg finden.
Ich will mich gerade aufrichten, da sehe ich in wenigen Metern Entfernung ein seltsames kleines Tier aus dem Farn lugen. Zuerst lässt mich der runde Kopf mit den winzigen Ohren und den großen Augen an ein Äffchen denken. Aber als sich das Tier noch einen Schritt weiter aus der Deckung wagt, erkenne ich den Körper und die Bewegungen eines Kaninchens.
Ich muss schlucken und kann es nicht. Ein Kaninchen mit einem Äffchengesicht … Fuck! Wo bin ich hier?
»Drogen«, flüstere ich. Ich muss irgendetwas eingeschmissen haben – der Teufel weiß, warum oder wann und was danach passiert ist. Ich bin auf einem ganz miesen Trip.
Das kleine Tier hoppelt zögernd auf mich zu. Lange Barthaare zittern, während es schnuppert.
Vorsichtig strecke ich meine Hand aus. »Was bist du denn für ein Monster?«
Es hält kurz vor mir inne, legt den Kopf schief und gibt ein gurrendes »Frrr« von sich.
»Ja, ich habe auch einen verdammt üblen Tag.«
Langsam, ganz langsam wagt es sich noch näher an meine ausgestreckte Hand. Die Schnurrhaare berühren meine Fingerknöchel. Es kitzelt und ich muss trotz allem lächeln.
Und da schießt das Biest vor, ich sehe spitze Zähne blitzen und schon stecken sie tief in meinem Daumen. Entsetzt schreie ich auf, springe auf, doch das kleine Tier hat sich in meinem Daumen festgebissen. Ich muss ihm mit der anderen Hand mehrmals auf den Kopf schlagen, bis es endlich loslässt und zu Boden fällt, wo es sich schüttelt. Erschrocken betrachte ich meine Hand. Das Blut läuft in einem gleichmäßigen dünnen Strom aus zwei Wunden.
»Du böses, kleines Mistvieh!«, flüstere ich. »Warum beißt du mich?«
»Frr«, macht das Tier, diesmal lauter als vorhin. »Frr. Frr. Frrrrrrrrrrr!«
Im Farn raschelt es und im nächsten Augenblick hoppeln weitere dieser seltsamen Affenkaninchen auf mich zu; drei, vier, ein halbes Dutzend – ach was, ein ganzes Dutzend.
Und dann gehen sie zum Angriff über.
Eines der Tiere springt mir ans Bein und schnappt mir in den Oberschenkel. Eines gelangt höher, verfängt sich mit dem Maul im Stoff meines Tops und reißt ihn ein. Das dritte Tier erwischt mich am Arm, ich schlage es im hohen Bogen weg und seine scharfen Krallen hinterlassen Kratzer auf meiner Haut. Sie sind so schnell. Und es werden immer mehr! Sie jagen im Rudel, diese teuflischen kleinen Biester – und mich haben sie zu ihrer Beute erkoren!
Ich werfe mich herum und renne los. Nach wenigen Hundert Metern versperren mir rotorange glühende Farne den Weg. Instinktiv vermeide ich es, sie zu berühren, biege ab und muss mich durch dorniges Gestrüpp kämpfen. Die kleinen Tiere hetzen hinter mir her und sobald die Vegetation mich ausbremst, springen sie mich an und schnappen mir in die Beine. Ich schlage nach ihnen, reiße sie von meiner Hose ab wie böse, lebendige Kletten und werfe sie von mir.
»Das gibt es nicht! Das – gibt es – nicht!«, keuche ich. So eine Verschwendung meines Atems! Ich sehe doch, dass es das gibt. Aber die einzige Chance, den Verstand nicht zu verlieren, ist, an meinem Sinn für die Realität festzuhalten. »Gibt! Es! Nicht!«
Die dornigen Büsche, durch die ich mich mit bloßen Händen kämpfe, reichen mir inzwischen bis zur Hüfte. Meine Beine verheddern sich in den verflochtenen Gewächsen, immer mehr Tiere erreichen mich und fallen mich an. Meine Kraft lässt nach, mein Herz bollert so stark in der Brust, dass der Lunge kaum Raum zum Atemschöpfen bleibt. Ich muss hier weg.
Die Killerkaninchen werden mehr, ich sehe sie überall, in allen Richtungen, und immer noch rufen sie mit ihrem »Frr, frrr!« weitere Jagdgenossen heran.
Zur Linken wird das Unterholz lichter. Ich schlage mich hindurch, ein kleines Biest beißt sich in meiner Wade fest, doch ich renne einfach weiter, presse die Zähne zusammen und atme in abgehackten Stößen. Meine Beine brennen von den Wunden, als würde ich durch Feuer laufen. Ich trample über Efeu und durch Farne, boxe mit den Fäusten nach den Viechern. Zum Schreien habe ich keine Luft mehr und jeder Atemzug schmerzt mir in der Kehle, als wäre mein Hals wund gescheuert. Schon jetzt stolpere ich mehr, als dass ich laufe.
Hinter mir müssen es inzwischen an die hundert Killerkarnickel sein. Die werden mich zu Tode hetzen und mir das Fleisch von den Knochen fressen, wenn ich nicht sofort …
Vor mir taucht ein breiter gräulicher Baumstamm auf. Armdicke Äste schlingen sich um ihn herum wie Taue. Ich halte auf ihn zu, klettere daran hoch – und hoffe inständig, dass die Biester mir nicht folgen. Die Äste fühlen sich merkwürdig an. Rau von außen, aber im Inneren knautschig. Ein paarmal rutschen mir die Füße weg, doch meine Kraft reicht noch, um mich festzuhalten. Stück für Stück klettere ich höher, streife dicke weiche Blätter und Aststücke, die aussehen wie blanke Knochen. Was für ein scheußlicher Baum. Aber er rettet mir das Leben, denn – ich hatte es kaum zu hoffen gewagt – die Biester bleiben auf dem Waldboden und knurren mir ihr empörtes »Frr, frrr!« hinterher.
In drei Metern Höhe setze ich mich in eine Astgabel und atme durch. Absurderweise muss ich an Mum denken, die immer Angst um mich hatte, wenn ich als Kind auf Bäume geklettert bin. »Du fällst und brichst dir was!«, hat sie gesagt. Und nun rettet mir die jahrelange Übung das Leben. Die Biester werden irgendwann verschwinden und dann …
Es zieht mir den Magen zusammen, nicht zu wissen, was ich dann machen soll. Ich betrachte die Wunden an meinen Beinen, der Hüfte und den Händen. Meine Jeans ist von zahllosen Löchern und Rissen durchzogen und von Blut getränkt. Die Bisse sind nicht tief, doch es sind viele, sie brennen höllisch und jeder Kratzer hat das Potenzial, sich übel zu entzünden.
Mit einem Mal werden die kleinen Biester ganz still, glotzen ohne einen Laut in dieselbe Richtung, um dann wie auf ein geheimes Zeichen im Wald zu verschwinden. In Sekunden ist keines mehr zu sehen.
Was hat sie vertrieben?
Ich kneife die Augen zusammen und versuche, etwas in dem Dickicht zu erkennen. Und dann bleibt mir fast das Herz stehen. In wenigen Metern Entfernung verbirgt sich ein Schatten hinter einem Baumstamm. Ein sehr großer Schatten.
Es herrscht plötzlich Stille in diesem Wald; eine tiefere Stille, als in irgendeinem Wald richtig sein kann. Und ich habe die unheilvolle Ahnung, dass das, was ich da gesehen habe, gefährlicher ist als ein Rudel blutrünstiger Killerkarnickel.
Jäh spüre ich etwas an meiner Schulter. Ich schreie auf, werfe mich herum und falle dabei fast vom Baum. Es war nur ein Ast. Verdammt, ich sehe schon Gespenster. Jetzt, da das Adrenalin nachlässt, zittern die Muskeln in meinen Armen und meine Beine werden bleiern. Mühsam steige ich am Stamm weiter hoch, möglichst weit weg von dem Schatten da unten. Doch als ich gerade nach oben schaue, um eine Stelle zu finden, die ich sicher greifen kann, sehe ich ihn aus dem Augenwinkel näher kommen! Als ich mich umdrehe, ist er verschwunden.
Atemlos greife ich nach einem dieser weißen Zweige, die aussehen wie Knochen, und als er sich löst und ich ihn plötzlich in der Hand halte, wird mir bewusst, dass ich mich geirrt habe.
Diese Äste sehen nicht aus wie Knochen.
Es sind Knochen.
Erneut regt sich dort unten etwas und ich höre Schritte im Laub.
Ich will nur noch weg hier, ich muss höher steigen, aber mein Fuß steckt zwischen den Blättern fest. Nein, er steckt nicht fest. Die Blätter … quetschen ihn ein. Unruhig versuche ich, meinen Fuß frei zu bekommen, da sehe ich direkt neben mir eine Bewegung. Mein Kopf zuckt herum – und ich traue meinen Augen nicht.
Ein paar dicht bewachsene Zweige nähern sich meiner Schulter.
Sie nähern sich meiner Schulter?
Dieser Baum … bewegt sich.
Schon liegen seine dicken Blätter wie große Hände auf mir. Ich zerre an dem Ast, muss das Grün regelrecht von meiner Haut kratzen, denn die Blätter kleben daran. Dünne, aber zähe Zweige greifen nach meinem Handgelenk und Ellbogen und pressen mir den Arm unnachgiebig vor die Brust, während ich verzweifelt – und erfolglos – versuche, mich zu befreien. Ein anderes Astende umfasst meine Hand, quetscht mir die Finger zusammen. Aus dem fleischigen Inneren der Blätter kommt eine klebrige Flüssigkeit, die auf meiner Haut brennt.
Dieser Baum ist eine gottverfluchte fleischfressende Pflanze!
Die Schreie bleiben mir im Hals stecken. Ich versuche erneut, mich loszureißen und die Arme frei zu bekommen, aber der Baum ist unglaublich stark, die Zweige und Blätter sind überall. Er wird mich festhalten und früher oder später werden auch von mir nur noch Knochen übrig sein.
Unten vor dem Baum, tritt der Schatten aus seiner Deckung und starrt zu mir hoch. Es ist eine menschliche Gestalt, ich erkenne bloß den Umriss breiter Schultern und einer Kapuze über dem Kopf.
Der Tod ist es, der da steht.
Die Panik kocht in mir hoch. Ich wimmere bloß noch, aus meinen Befreiungsversuchen ist ein sinnloses Gezappel geworden. Es muss ein Traum sein. »Aufwachen!« Ich will mich anschreien, aber es kommt bloß ein Keuchen. »Wach auf, wach auf, du träumst nur, du träumst!«
»Tust du nicht.« Die Stimme ist dunkel. Es ist ein Mann, der da unten steht und zusieht. »Du träumst nicht.«
»Hilfe«, flehe ich ihn an. »Bitte! Bitte hilf mir!«
Doch er blickt bloß in Seelenruhe zu mir hoch. Und immer mehr Zweige greifen nach mir und nehmen mich in den festen Griff ihrer klebrigen Blätter. Ich sehe blanke Knochen zwischen den Ästen: den Schädel eines Hirsches und etwas, was nur die Wirbelsäule eines großen Tieres sein kann – vielleicht die eines Pferdes.
Hier zu sterben würde bedeuten, Mum und Vicky alleinzulassen. Und das kommt überhaupt nicht infrage!
Ich atme durch, konzentriere mich wie in einem Kendō-Kampf, suche einen Fokus. Nehme meinen Gegner ernst und beschließe, ihn zu schlagen. Noch einmal sammle ich alle verbliebene Kraft und rucke kurz und so hart ich kann an meinem Arm, um ihn loszubekommen. Immer wieder und wieder. Zuerst wirkt es aussichtslos, aber ich verspreche dem verdammten Baum stumm, nicht aufzugeben, bevor ich entweder frei oder tot bin. Und plötzlich löst sich mein linker Arm aus dem Klammergriff. Die Blätter packen sofort erneut zu, doch dabei bewegen sich die Zweige und einer der Tierknochen, die darin hängen, gerät in meine Reichweite. Er bricht ab, als ich mit aller Kraft daran ziehe. Nun habe ich eine Waffe – eine dünne, poröse Waffe, nicht einmal so lang wie ein Brotmesser, doch mit einem spitzen Ende. Zitternd ramme ich es in alle Blätter, die ich erreichen kann. Mit jedem Stich wird der Baum nachgiebiger und ich kann mich aus seiner Umklammerung lösen und ein wenig höher klettern. Von unten recken sich jedoch bereits frische, unversehrte Äste nach mir. Die von oben kommenden sind kleiner, ihre Blätter schmaler, aber auch diese strecken sich hungrig nach mir aus. Ich schätze die Entfernung zum Boden ab. Sicher fünf Meter. Selbst wenn ich mich geschickt abrolle, könnte ich mir alle Knochen brechen.
Ich kann nicht mehr kämpfen. Meine Haut brennt nicht mehr, sondern wird langsam taub. Vor meinen Augen tanzen schwarze Punkte und verbinden sich zu Schlieren. Vielleicht hat der Baum mich vergiftet. Ich muss hier weg – besser, ich springe, bevor ich falle.
»Warte!«, ruft der Tod. Wie durch einen schwarzen Nebel sehe ich, dass er noch immer zu mir hochschaut, aber nun hält er ein Messer in der Hand. Er hockt sich nieder und berührt mit den Fingerspitzen eine Baumwurzel, die aus dem Boden herausragt. Tief senkt er den Kopf. Dann stößt er mit einer kraftvollen Bewegung das Messer hinein – es versinkt bis zum Heft im Holz. Ein Beben geht durch den Baum, ich verliere fast den Halt. Dann sinken plötzlich die Äste herab, alle Blätter hängen schlaff nach unten und einige fallen sogar auf den Boden und platzen dort wie überreife Früchte.
Ich wage es nur langsam, hinabzuklettern. Inzwischen zittere ich wie Espenlaub und kann kaum noch richtig zufassen. Die letzten zwei Meter springe ich, weil ich zum Klettern keine Kraft mehr habe.
Und dabei falle ich dem Typen fast in die Arme. Reflexartig will ich nach seiner Jacke greifen, um mich festzuhalten, doch er atmet scharf ein, macht einen Schritt zurück und ich klatsche wie ein nasser Sack auf Hände und Knie.
Mein Schädel brummt, mein ganzer Körper zittert und die schwarzen Punkte vor meinen Augen werden immer mehr. Mit großer Anstrengung schaffe ich es, den Kopf zu heben.
Der Kerl steht groß und bedrohlich über mir und ich will nichts mehr, als Abstand zu ihm gewinnen. Mühsam rapple ich mich auf, doch auch im Stehen überragt er mich fast um einen Kopf. Unter der Kapuze erkenne ich nicht viel mehr als ein kantiges, unrasiertes Kinn. Jetzt sieht er nicht mehr aus wie der Tod – aber leider auch nicht viel ungefährlicher. Obwohl ich seine Augen nicht sehe, spüre ich seinen Blick auf mir und fühle mich nackt in meinem halb zerfetzten Tanktop.
»Du bist nicht von hier«, stellt der Kerl fest und verschränkt die Arme vor der Brust, als hätte ich irgendeine Regel gebrochen, von der ich keine Ahnung habe.
»Nein. Ist der Baum … tot?« Ich hoffe es inbrünstig und versuche, meine Atmung unter Kontrolle zu bekommen – vergeblich.
Er nickt. »Leider.«
»Warum hast du mir nicht früher geholfen?«, krächze ich.
Er kippt den Kopf leicht zu Seite, und ohne es sehen zu können, höre ich das herablassende Grinsen in seiner Stimme. »War gespannt, ob du’s schaffst.«
KAPITEL5
Ich bin nicht gewalttätig. Leider. Denn für den Spruch würde ich ihm schrecklich gern eine reinhauen. Doch aus dem Zittern meiner Arme wird ein krampfartiges Zucken. Meine Beine fühlen sich wacklig und viel zu weich an. Meine Sicht verschwimmt immer mehr. Etwas stimmt nicht. Schwerfällig sacke ich auf den Boden. Also doch Drogen?
»Der Baum ist ziemlich giftig«, sagt der Typ, löst etwas Lederumbundenes von seinem Gürtel und wirft es mir zu. »Hier.«
Was auch immer es ist, es ist schwerer als gedacht und rutscht mir beim Versuch, es aufzufangen, durch die Hände. Mein nächster Griff nach dem Ding geht ins Leere. Alles dreht sich. Dann finden meine Finger es doch. Unter dem Leder verbirgt sich eine Flasche. Nur mit äußerster Mühe kann ich den Verschluss aufdrehen. Hastig setze ich sie an den Mund und trinke, da steht der Typ plötzlich neben mir und reißt sie mir weg.
»Du sollst es nicht trinken, sondern das Gift abwaschen.« Er sagt es, als wüsste das jeder, kippt mir das Wasser über die Arme und den Oberkörper, verteilt die letzten Tropfen in meinem Gesicht und zeigt mir dann mit wortlosen Gesten, dass ich die inzwischen geröteten Stellen, wo sich die Blätter festgesaugt haben, mit den Handflächen abreiben soll. Dabei gibt er sich äußerste Mühe, mich nicht zu berühren.
Das Wasser auf der Haut zu spüren, peitscht den Durst auf, mein Mund ist so trocken, dass das Atmen wehtut und ich mir die Tropfen von den Armen lecken will, Gift hin oder her. Aber das Krampfen meiner Muskeln und der Schwindel lassen langsam nach, auch die schwarzen Punkte in meinem Sichtfeld verschwinden. Dafür schlottere ich jetzt vor Kälte. Meine Jeans besteht aus mehr Löchern als Stoff, mein Top ist durchnässt und unter der linken Achsel tief eingerissen. Notdürftig zupfe ich es so weit zurecht, dass es den Sport-BH verdeckt, aber die nächste Bewegung lässt den Spalt wieder aufklaffen.
Der Kapuzentyp murmelt einen Fluch. Ruppig streift er sich die Jacke ab. Kastanienbraune Haare hängen ihm tief in den Nacken und die Stirn. Er ist vielleicht Anfang zwanzig und sieht auf eine Weise fremd aus, die ich nicht benennen kann. Er hat markante Wangenknochen, leicht schräg stehende Augen und einen breiten Mund. Alles an ihm wirkt normal und dennoch unterscheidet sich sein Gesicht von denen aller Menschen, die ich bisher getroffen habe. Sein Englisch ist von einem starken Akzent gefärbt, am ehesten Highland-Schottisch. Ob wir dort sind – in Schottland?
Wortlos wirft er mir seine Jacke vor die Füße und ich wende hastig den Blick ab, als ich merke, dass ich ihn anstarre. Ich schwanke zwischen dem Bedürfnis, mich in der Jacke einzuwickeln, und dem Wunsch, sie ihm zurückzuwerfen. Schließlich verliert mein Stolz das Rennen – mir wird einfach zu kalt. Der Stoff ist eigenartig; wie Leinen, aber wärmer und viel weicher. Der Kragen riecht nach Heu, ein bisschen nach Pferd und irgendwie verstörend tröstlich. Vermutlich würde mich in meiner Lage jedes menschliche Wesen trösten. Hauptsache, ich bin nicht mehr ganz allein.
»Danke«, presse ich hervor. Meine Stimme zittert immer noch, ich weiß nicht, ob vor Schock, vor Kälte oder wegen des Gifts.
»Behalt sie«, sagt der Typ, streicht sich die Haare aus der Stirn und wendet sich ab. »Viel Glück.«
»Was? Warte!« Meine Stimme bricht. Ich versuche, auf die Beine zu kommen, aber ich stolpere und lande erneut auf den Knien. »Du kannst nicht einfach abhauen!«
»Nicht?« Er bleibt stehen und wirft mir das Wort wie ein Almosen hin, das sich als wertloser Knopf erweist. »Ich kann nichts für dich tun.« Und schon geht er weiter und ist nach wenigen lautlosen Schritten zwischen den Bäumen verschwunden.
Nein. Neinneinnein. Das darf nicht passieren! Ich irre nicht stundenlang durch diesen mörderischen Wald, gehe fast drauf und treffe dann auf einen Menschen, der mich wieder hilflos zurücklässt und einfach abhaut. Oh nein!
»Warte!«, schreie ich ihm nach, rapple mich auf und schwanke in die Richtung, in die er verschwunden ist. »Warte gefälligst!« Lass mich bitte, bitte nicht hier allein. »Bleib stehen! Warte, du … du … verdammtes Arschloch!« Mein Brüllen geht in ein Krächzen über und endet in einem Wimmern. Ich ziehe die Jacke vor der Brust zusammen, würde mich am liebsten darin verkriechen. Es wird bald Abend werden, irgendwann Nacht.
»Was ist, wenn die Biester wiederkommen, hey?«, schreie ich. »Willst du, dass ich draufgehe? Hast du mir dafür geholfen? Damit ich doch hier krepiere? Ist es das, was du wi…«
»Und was willst du?«
Ich fahre erschrocken herum und verliere dabei fast das Gleichgewicht. Da steht er, wie aus dem Nichts aufgetaucht. Oder als wäre er überhaupt nicht weg gewesen.
»Willst du, dass der ganze Wald dich hört?« Er blickt mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Ehrlicherweise bin ich davon nicht weit entfernt.
»Ich will nach Hause.« Ich gäbe viel darum, ihm das ruhig und beherrscht sagen zu können, aber daraus wird nichts. »Ich weiß nicht, wie ich hierhergekommen bin oder wo wir überhaupt sind, aber ich muss nach Hause zurück, so schnell wie möglich.«
Sein Blick geht zum Boden neben meinen Füßen, trotzdem nehme ich den Anflug von Bestürzung in seiner Miene wahr.
»Eine Stadt würde mir schon reichen. Ich muss nur einen Bahnhof finden.«
»Wohin willst du denn?«, fragt er vorsichtig.
»Killarney.«
Er verzieht keine Miene.
»Das ist eine kleine Stadt, sagt dir sicher nichts«, schiebe ich nach. »In Kerry.«
Nichts.
»Irland.« Komm schon, Irland kennst du. »Weißt du was? Es ist egal. Ich will bloß zum nächsten Bahnhof und …«
Ich habe nicht mal Geld dabei. Nur ein totes Handy. Wobei ein Griff an meine hintere Hosentasche mich noch weiter desillusioniert. Ich habe nicht mal mehr ein totes Handy. Es muss bei meiner Flucht aus der Tasche gefallen sein.
»Du bist verdammt weit weg von zu Hause«, sagt er. »Du ahnst nicht, wie weit. Tut mir leid.«
Wenn er mich trösten will, geht es gehörig schief. »Wo … sind wir denn?«
Er sagt etwas, womit ich nichts anfangen kann. Es klingt wie »Lia-Skei«.
»Isle of Skye?« Also doch Schottland? Aber wie bin ich hier gelandet?
»Lyaskye«, wiederholt er. Und dann sagt er noch einmal: »Tut mir leid.«
Von einem solchen Ort habe ich nie zuvor gehört. »Und wo soll das sein? Wir sind aber schon noch in Großbritannien, oder?«
»Verdammt!«, entfährt es ihm plötzlich heftig. »Ich bin nicht der Richtige, um dir das zu erklären.«
»Leider bist du der Einzige hier.«
Das scheint ihn zu überzeugen, wenn auch widerwillig. Er sieht sich um, entdeckt einen umgestürzten Baum in einiger Entfernung und lotst mich dorthin. Mit reichlich Abstand setzen wir uns.
»Sie tut das manchmal«, sagt er. »Lyaskye. Holt Mädchen oder junge Frauen aus der anderen Welt hierher.«
Er hat nicht wirklich »aus der anderen Welt« gesagt, oder? Oh, wie gut, dass ich sitze. Er ist verrückt. Er – oder ich.
»Frag mich bitte nicht, warum. Sie hat ihre Gründe, aber ich habe davon keine Ahnung und es interessiert mich auch nicht.« Er sieht mich nachdenklich an. »Allerdings landen diese Menschen normalerweise nicht allein in den Gierigen Wäldern.«
Gierige Wälder. Andere Welten. In meinem Kopf dreht sich alles. Der will mich doch verarschen, oder?
»Es tut mir leid.« Er sagt das jetzt zum dritten Mal, aber zum ersten Mal glaube ich ihm. Tief nach vorn gebeugt sitzt er da und betrachtet seine Hände. Zwischendurch schaut er zu mir rüber, vielleicht, um sich zu vergewissern, dass ich nicht in Ohnmacht falle. Was mir nur gelingt, da ich bewusst atme, wie ich es im Training gelernt habe.
Das darf alles nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein.
Aber eine kleine Stimme in meinem Kopf flüstert mir zu, dass es in Schottland weder Killerkaninchen noch fleischfressende Bäume gibt. Genau genommen gibt es die nirgendwo auf der Welt. Meiner Welt.
»Wer ist sie?«, frage ich. Ich darf nicht hysterisch werden.
»Lyaskye? Sie ist …«, er zögert, »alles hier. Das Land, der Himmel, die Wälder, Flüsse, Berge und Seen.«
»Und dieses Land entführt Menschen.«
Er stemmt sich hoch und lehnt sich mit verschränkten Armen an einen Baum. »Hin und wieder ruft sie Menschen zu sich.«
»Okay. Wie du meinst.« Ich schüttle den Kopf und versuche, die Gedanken darin zu sortieren.
Wie war das in der Umkleide? Ich glaubte, ohnmächtig zu werden, und ich erinnere mich an das Gefühl, in Millionen Einzelteile zu zerfallen. Nichts und niemand hat mich gerufen, da bin ich mir sicher. Ich wurde gepackt von etwas, was weder Hände noch Arme hat. Aber ich habe mich gewehrt – und dann war ich hier.
Ich atme tief durch. Und dann lasse ich mit äußerster Vorsicht die Vorstellung zu, er könnte die Wahrheit gesagt haben: Ich bin in einer anderen Welt.
Ach. Du. Scheiße.
Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Zeit, die ich nicht habe, weil ich zusehen muss, nach Hause zu kommen. Zu Mum und Vicky.
»Ich bin hergekommen. Es gibt also einen Weg hierher. Demnach muss es auch einen Weg zurück geben.« Ich forsche in seinem Gesicht nach einer Antwort. Jetzt, da er nicht mehr ganz so feindselig aussieht, wirkt er jünger, nur etwas älter als ich. In seinen Augen steht mehr Misstrauen, als ich nachvollziehen kann. Immerhin besteht kein Zweifel, wer von uns für den anderen bedrohlich werden könnte.
»Ich weiß von keinem Menschen, den Lyaskye zurückgeschickt hat«, sagt er.
»Es muss aber einen Weg geben. Ich kann auf keinen Fall hierbleiben.«
»Du könntest versuchen, einen Weltenspringer aufzutreiben und ihn bestechen, damit er dir sein Cercerys gibt.«
»Sein was? Und bestechen?« Ich sehe an mir herab. »Womit denn?«
Er zuckt mit den Schultern. Es scheint ihm herzlich egal zu sein.
»Okay«, seufze ich. »Was sind Weltenspringer, wo finde ich sie und was könnten sie haben wollen im Austausch für dieses Ding?«
»Magisch Begabte mit einem bestimmten Talent. Wenn du Glück hast, in Rubia. Und jede Menge, vermutlich, wenn du im Gegenzug verlangst, dass jemand sich dem Willen Lyaskyes widersetzt und Hochverrat begeht. Mein Rat: Vergiss es.«
»Rubia. Was ist Rubia?«
»Die Hauptstadt von Lyaskye. Ein Ort, an dem Menschen wie du den Tod finden.«
Ich ignoriere den zweiten Teil seiner Antwort, weil er mir absolut absurd erscheint, und denke über den ersten nach. Hauptstadt klingt besser als Gierige Wälder. »Wie weit ist das entfernt?«
»Einige Tage.«
»Fährt ein Zug dahin?«
Er schüttelt den Kopf, aber die Geste sagt nicht Nein, sondern etwas anderes. Schwierigeres.
»Du weißt nicht, was ein Zug ist. Oder ein Bahnhof.«
Seine Augen werden schmaler, noch mehr Vorsicht färbt seinen Blick dunkel. Er hat keinen Schimmer, wovon ich spreche. Was wohl bedeutet, dass es hier keine Züge gibt. Fuck!
Der Punkt, an dem ich zusammenbreche, kann nicht allzu weit sein. Aber ich traue diesem Typen nicht. Ich will nicht die Kontrolle verlieren, solange er in der Nähe ist.
»Ich muss nach Hause, vollkommen egal, wie. Wie finde ich nach Rubia?«
Er schnaubt, es ist fast ein müdes Lachen. »Du? Vermutlich in zwanzig Jahren nicht.«
»Kannst du mich hinbringen?« Ich verstehe selbst nicht, wie ich das über die Lippen bringe. Lieber würde ich ihn bitten, sich ins Knie zu … Doch es hilft nichts. Er ist der einzige Mensch weit und breit. »Bitte.«
Statt einer Antwort lächelt er kurz, ein knappes Hochziehen eines Mundwinkels nur, und mir schießt völlig ungebeten der Gedanke durch den Kopf, dass ich ihn unter anderen Umständen – in einer anderen Welt – gern lächeln gesehen hätte.
»Was sagst du? Hilfst du mir? Nur solange, bis ich jemand anders finde?«
Er sieht mich direkt an, abschätzend, wie er es die ganze Zeit schon tut, aber plötzlich wird sein Blick intensiver. Seine Augen sind grün. Das war mir vorher nicht aufgefallen. »Besser nicht.«
»Warum nicht?«
»Nenn mir einen Grund.«
»Ich brauche Hilfe.«
»Ich habe dir geholfen.«
»Du hast eine Baumwurzel erdolcht! Wie mutig von dir.« Am liebsten würde ich ihm vor die Füße spucken.
»Das war schwer«, sagt er.
Ich schüttle voller Entrüstung den Kopf. »Wie lange, denkst du, halte ich hier draußen allein durch? Ich gehe hier drauf!«
Er denkt darüber nach, nickt dann. »Das stimmt. Ich bringe dich zu einem Dorf an der Grenze zu Otrelien.«
Skeptisch lege ich den Kopf schief. »Finde ich dort auch Weltenspringer?«
Das scheint ihn zu erheitern. »Nein. Otrelien ist ein Nachbarland von Lyaskye. Aber in jedem Frühjahr findet eine Pilgerreise nach Rubia statt. Du kannst dich im nächsten Jahr anschließen. Falls du das wirklich willst. Bis dahin solltest du für dich behalten, woher du kommst.«
Im nächsten Jahr? »Du verstehst mich überhaupt nicht, oder? Ich muss sofort nach Hause!«
»Mehr kann ich nicht für dich tun.«
»Dann hättest du mich auch in dem verfluchten Baum hängen lassen können«, entfährt es mir. Meine Verzweiflung verberge ich unter Zorn. »Geh doch, verschwinde halt! Du verschwendest meine Zeit. Sie ist kostbar, wer weiß, wie viel ich davon noch habe. Ich finde dieses Rubia auch ohne dich!«
Irgendetwas an meinem Fatalismus scheint ihn neugierig zu machen. Er mustert mich langsam von oben bis unten. »Im Ernst, Mädchen aus Irland, wo immer das auch sein mag. Du hast nichts und erst recht nichts, was ich will. Warum sollte ich für dich einen Umweg in Kauf nehmen?«
»Nicht für mich«, sage ich beherrscht, denn ich bin ihm ja offensichtlich herzlich egal. Es wäre schön, wenn ich über ihn dasselbe sagen könnte. Aber ich muss in diese Hauptstadt und er kennt den Weg. »Tu es für meine Schwester. Sie braucht mich.«
»Deine Schwester?« Funkt da Interesse auf?
»Ja. Sie ist ein wundervoller Mensch. Sie ist die Einzige, die über meine Witze lacht.«
»Dann können sie nicht besonders komisch sein.«
»Ich glaube, es liegt daran, dass ich außer ihr niemandem Witze erzähle.«
Er lacht. Kurz nur, aber zum ersten Mal ehrlich, als wäre dieses Lachen übermütig durch die Arroganz geschlüpft, mit der er mich mustert.
»In Ordnung«, sagt er. »Ich bring dich nach Rubia. Allerdings kostet dich das etwas. Und ich hab eine Bedingung.«
Jetzt kommt’s. Ich ziehe seine Jacke enger vor meiner Brust zusammen.
»Keine Witze«, sagt er.
KAPITEL6
Wenig später denke ich allerdings, dass er es ist, der die Witze macht. Ich frage ihn bescheiden, ob er noch einen Schluck Wasser hat, denn der Durst macht mich schwach und langsam.
»Ich habe dir mein ganzes Wasser gegeben.«
Oh. »Aber wir werden doch sicher bald welches finden, oder?«
»Vermutlich morgen.«
Ich kann und will das kaum glauben. Das hier ist ein Wald, überall blüht und grünt und wuchert es. Wie kann es hier kein Wasser geben? Doch es wäre unklug, eine Diskussion mit ihm zu beginnen; zu groß ist die Gefahr, dass er sich umentscheidet und mich nicht nach Rubia führt, weil ich ihm auf die Nerven gehe.
»Erzähl mir etwas über das Land«, bitte ich ihn stattdessen. »Wo genau sind wir hier?«
Er atmet durch, als hätte er nur wenig Lust, sich mit mir zu unterhalten, aber dann sagt er: »Lyaskye ist das herrschende Land des Westlichen Kontinents.« Vermutlich hat er meinen fragenden Blick bemerkt, denn er fügt hinzu: »Du weißt doch, was ein Kontinent ist? Oder dass die Welt rund und größtenteils von Meeren bedeckt ist?«
Ich nicke. Das klingt doch schon mal vertraut.
»Wenigstens etwas. Der Westliche Kontinent besteht aus acht Ländern. Lyaskye ist weder das größte noch das bevölkerungsreichste, aber sie herrscht über alle anderen. In der Hauptstadt Rubia residiert die Königin, die über die Regierungen aller Länder befehligt.«
»Und der Kontakt zu meiner … Welt?«, frage ich kurzatmig. Der Weg, dem wir folgen, ist ein überwucherter Trampelpfad und es kostet mich alle Kraft, hinter ihm herzueilen.
Er zuckt mit den Schultern. »Darüber weiß ich nichts. Frag einen Weltenspringer. Solltest du je einen finden, meine ich.«
Ich schweige und betrachte seinen Rücken. Seine dunkle Kleidung scheint aus demselben Material zu sein wie die Jacke, die ich trage: vielleicht Wolle, Leinen oder ein Gemisch. Er sieht nicht so aus, als wäre er darin erst gestern losgelaufen, wirkt aber auch nicht ungepflegt. Das Hemd schmiegt sich um seine breiten Schultern und die leicht aufgekrempelten Ärmel spannen sich um muskulöse Unterarme. Um seinen Hals hängt ein Lederband mit einem Anhänger, den man unter dem Stoff des Hemds nur erahnen kann. Mit ein paar wenigen Utensilien, die er seitlich an der Hüfte an einem Gürtel trägt, sowie einer einfachen Umhängetasche, in die er auch das Messer gesteckt hat, marschiert er durch diese Wälder, als kennt er jeden Weg, alle Abzweigungen und sämtliche Gefahren im Schlaf. Auf den ersten Blick wirkt er entspannt. Doch je länger ich ihn beobachte, desto besser erkenne ich, wie konzentriert er ist. Er erfasst jede Bewegung und während ich noch den Kopf nach einem Rascheln drehe, hat er längst die Ungefährlichkeit ausgemacht und prüft etwas anderes, was ich nicht einmal wahrgenommen habe.
Was macht er hier in diesem Wald?
Der Abstand zwischen uns ist größer geworden. Mit zusammengebissenen Zähnen laufe ich ein paar Schritte, um wieder aufzuschließen.
»Wann werden wir Rubia erreichen?«
»Allein würde ich eine Woche brauchen«, erwidert er. »Mit dir länger. Zehn Tage, vielleicht zwölf.«
Mit einer so langen Reise hatte ich nicht gerechnet. Ohne, dass ich es will, werden meine Bewegungen vor Ernüchterung langsamer.
»Vierzehn, wenn du weiterhin gemütlich schlenderst.«
Ich reiße mich zusammen und folge ihm dichter auf.
»Und damit wir das später nicht ausdiskutieren müssen: Ab den Toren Rubias bist du auf dich gestellt, ganz gleich, was passiert.«
»Verstanden. Was machen wir, wenn die Killerhäschen zurückkommen?«
Abrupt bleibt er stehen, sodass ich fast in ihn hineinlaufe. »Killerwas?«
»Diese kleinen Monster, die mich auf den Baum gehetzt haben.« Ich blicke an mir herab. Meine Jeans sieht aus wie das Werk eines irren Designers und beinah jedes Loch ist von Blutflecken gesäumt. Ich muss mir dringend überlegen, wie ich die Bisse behandeln kann, damit sich nichts infiziert.


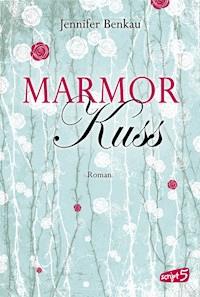














![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)










