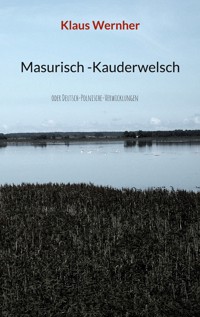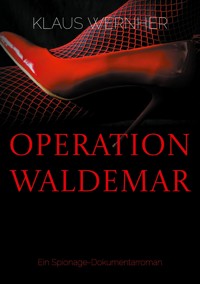
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Endlich haben Anna Putzmich, ihre Mutter und ihre neun Kinder die Ausreisegenehmigung, um sich in die Bundesrepublik Deutschland niederzulassen. Die Umsiedlung im Jahre 1960 ist die einzige Hoffnung, um dem armseligen Leben in dem kleinen Dorf in Polen zu entfliehen. Das Damoklesschwert: Anna wird gezwungen, ihr zehntes Kind, dem sie kurz vor der Ausreise das Leben schenkt, zur Adoption freizugeben. Ihre Kinder erfahren von Waldemar erst, als Anna viele Jahre später im Sterbebett liegt. Die Kinder müssen ihr versprechen, nach Waldemar zu suchen und ihn in die Familie zu vereinen. Mit ihrem Anliegen wenden sie sich an das polnische Rote Kreuz, das sofort den polnischen Auslandsnachrichtendienst informiert. Zeitgleich beginnt die Ausbildung des Agenten Wacek, der in die Rolle von Waldemar schlüpfen und in die Bundesrepublik geschickt werden soll - so beginnt eine Spionagegeschichte, wie sie typisch ist für die Zeit des Kalten Krieges. Basierend auf einer wahren Geschichte gewährt der Roman authentische Einblicke in die damalige Arbeitsweise der Geheimdienste auf beiden Seiten: Er führt den Leser hinter die Kulissen der deutschen Spionageabwehr und dokumentiert die Methoden und Arbeitsweisen des Auslandsnachrichtendienstes der damaligen Volksrepublik Polen: Ein absurder Kampf, der mithilfe von Wirtschaftskriminalität finanziert wurde, gegen den "Klassenfeind" in Westeuropa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Namen von Personen und Orte des Geschehens sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. Handlungen sind zum Teil funktionell.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Neuss 1990
Glombowen 1960
Krakau im Juni 1976
Glombowen 1934–1960
Krakau im Sommer 1976
Euskirchen im Juli 1978
Warschau 1978
Warschau 1978
Dresden 1982
Spione im Kalten Krieg
Euskirchen im Juli 1980
Warschau im Januar 1981
Jelenia Góra 1981
Euskirchen im Januar 1982
Zirndorf 1982
Warschau im Frühjahr 1982
Warschau und Euskirchen 1982
Warschau im Sommer 1983
Zirndorf 1983
Warschau im Oktober 1983
Polen und Deutschland 1984–988
Warschau 1989
Zirndorf 1990
Neuss 1990
Köln 1990
Epilog
Rückblick
Vorwort
Während des Kalten Krieges bezichtigte die Volksrepublik Polen – wie übrigens alle anderen ehemaligen so genannten sozialistischen Bruderstaaten des Warschauer Paktes – die Bundesrepublik Deutschland einer expansiv-revanchistischen Politik. Das „revanchistische“ Denken in Sachen der nach dem II. Weltkrieg verlorengegangenen ehemaligen deutschen Ostgebiete der Vertriebenenverbände in der BRD, die von der verlorengegangenen Heimat sprachen, beunruhigte die Staaten des Warschauer Paktes sehr. Zudem hatte „Bonn“ nie die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands in Frage gestellt. „Ostberlin“ hatte hingegen heftig die Zweistaatentheorie betrieben.
Straftaten polnischer Bürger wurden oft so konstruiert, dass die Quelle des Übels unter den westdeutschen Kapitalisten zu suchen war. Darüber hinaus lebten zahlreiche Polen im Westen, darunter in der Bundesrepublik Deutschland, die während des Krieges, auf welchen Wegen auch immer, nach dorthin gelangt und nach Kriegsende dort verblieben waren, weil sie die jetzt in Polen „herrschende Kaste“ nicht anerkennen wollten, d.h. der Polnischen Volksrepublik gegenüber feindlich eingestellt waren. Für den Sicherheitsapparat der Volksrepublik Polen war dies Anlass genug, so viel eigene Agenten wie möglich in der Bundesrepublik Deutschland zu platzieren. Diese Agenten versuchte man in Westdeutschland in alle Bereiche des öffentlichen Lebens einzuschleusen. Man arbeitete dabei nach dem „Staubsaugerprinzip“ – wie übrigens der ganze Ostblock: „Masse statt Klasse.“ Aber nicht nur Agenten (Illegale) kamen zum Spionieren, auch Reisende, Kuriere und Diplomaten wurden mit Aufklärungsaufträgen versehen. Die Nachrichtendienste des Warschauer Paktes arbeiteten unter der Führung der Sowjetunion eng zusammen und bildeten ein riesiges Spionagenetz, das den Westen allumfassend ausspionierte. Und das mit großem Erfolg. Einige Ostagenten sind während dieser Zeit übergelaufen und offenbarten sich den westlichen Sicherheitsbehörden. Ihre alten Herren waren bemüht diese zu lokalisieren, um sie zu liquidieren, was in Einzelfällen auch gelang. Was den Protagonisten dieses Romans betrifft, so erinnert der Fall an den legendären polnischen Meisterspion Jerzy Sosnowski, geboren im Dezember 1896 in Lemberg. Sosnowski war zunächst Oberleutnant der k.u.k. Monarchie und später polnischer Major. Unter dem Tarnnamen Georg von Sosnowski, Ritter von Nalecz, beschaffte er von 1926 bis 1934 wichtige Informationen, hauptsächlich aus dem deutschen Reichswehrministerium. Er sprach ein akzentfreies Deutsch, da er von 1914 bis 1918 in der österreichischen Armee gedient hatte. Seine Spionagetätigkeit in Deutschland tarnte er als Besitzer eines Reitstalls in Berlin. Sosnowski war eine elegante und charmante Erscheinung und beliebt bei den Damen der höheren Gesellschaft, was ihm unter anderem Eintritt zu Banketten verschaffte. Auf diese Weise war es ihm gelungen, sich an einflussreiche Politiker und Industrielle der damaligen Zeit heranzumachen und sie auszuhorchen. Vor diesem Hintergrund wurde aus ihm ein Meisterspion, der anfangs zur Spionagetätigkeit durch entsprechende polnische Stellen der Vorkriegszeit erpresst werden musste. Kurz vor seiner Verhaftung gelang ihm die Flucht aus Deutschland. Diejenigen aber, die er zur Mitarbeit gewonnen hatte, in der Regel Frauen, wurden nach seiner Enttarnung zum Tode verurteilt und im Gefängnis von Berlin-Plötzensee hingerichtet.
Auch der Protagonist dieses Romans wurde wie einst Sosnowski zur Mitarbeit mit dem polnischen Nachrichtendienst der Nachkriegszeit genötigt. Das Szenario ist also sehr realistisch. Es gab aber auch viele andere, die freiwillig zu Agenten wurden und im Operationsgebiet Bundesrepublik Deutschland und anderen westeuropäischen Staaten nachrichtendienstlich aktiv waren.
Neuss 1990
Den letzten Kontakt mit seinem Führungsoffizier hatte der Illegale vor über einem Jahr. Das ist in der Karnevalszeit 1989 gewesen. Seit dieser Zeit hat er keinen Auftrag mehr erhalten, Funkstille.
Den Karneval in Köln nennt man in diversen Kreisen „die Hochzeit der Agenten“. Immer, wenn im Rheinland die Narren los sind, kriechen die Agenten und „Maulwürfe“ aus ihren Löchern, jedoch nicht um sich ins närrische Treiben zu stürzen. Karneval ist die beste Gelegenheit, die nachrichtendienstlichen Aufträge erfolgreich zu Ende zu bringen.
In diesen Tagen geht am Rhein die Aufmerksamkeit der deutschen Agentenjäger gegen Null. Alle feiern Karneval, egal ob sie hier geboren oder zugereist sind. Problemlos dringt der rheinische Frohsinn in die geheimen Zugänge der Spionageabwehr. Mit närrischem Leichtmut stürzen sie sich, ihre Pflichten vernachlässigend, in das entfesselte Treiben. Für gegnerische Nachrichtendienste ein Geschenk des deutschen Brauchtums.
Anders als sonst starrt er auf seinen verstummten Weltempfänger, schaut teilnahmslos auf die ausgelassene Stimmung in den Straßen, spürt zunehmend, wie Zweifel an seiner antrainierten Sicherheit nagen. Hat er Fehler gemacht? Nicht unüblich, dass unbequeme geheime Mitarbeiter plötzlich weg sind. Wie soll er auf diese Funkstille reagieren? Ist es an der Zeit, unterzutauchen?
Seit Tagen regnet es. Trotz des Karnevaltrubels wirkt die Stadt grau in grau. Das Schmuddelwetter belastet noch zusätzlich sein Gemüt, die Resignation gewinnt Oberhand. Er fühlt sich allein gelassen und fern der Heimat.
Bereits das sechste Jahr lebt er in der Bundesrepublik Deutschland, alle nennen ihn Waldemar und an diesen Namen hat er sich längst gewöhnt. Auch an alles andere. Er kennt die Gepflogenheiten seines Gastlandes, dessen Staatsbürger er geworden ist – wenn auch auf illegalem Wege. In seinem alltäglichen Leben findet er sich ausgezeichnet zurecht, hat einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz. In der Firma wird seine Arbeit geschätzt, insbesondere von seinem Chef, dem Inhaber des Unternehmens. Aus „Dank“ dafür hintergeht er ihn, verrät technische Neuheiten an den Geheimdienst seines Vaterlandes, die Volksrepublik Polen. Der bisher angerichtete Schaden hält sich allerdings noch in Grenzen, denn es handelt sich nicht um Spitzenprodukte des technischen Knowhows. Trotzdem plagt ihn sein Gewissen, weil er zum Chef ein gutes Verhältnis pflegt. Die Interessen seines Vaterlandes sind jedoch höher zu stellen als das Verhältnis zu seinem Chef. Darauf hat er einen Eid geschworen und den gilt es zu befolgen, egal wer davon Nachteile haben sollte. Beruflich hat er viel erreicht, aber einen festen Freundeskreis oder eine echte Partnerschaft hat er nicht aufbauen können, nein nicht dürfen. Das alles zum Wohle seines Vaterlandes. War es das wert? Eine Antwort darauf kann ihm niemand geben, noch nicht einmal er selbst.
Diese zermürbenden Gedanken quälen den Illegalen schon seit Monaten und immer wieder zieht er Bilanz, besonders an solchen Tagen wie heute, wenn der Himmel weint und er in seiner Bude vor seinem Weltempfänger sitzt und abermals vergebens auf eine Nachricht wartet. Seit fast einem Jahr kein vertrautes, kein vereinbartes Zeichen und schon gar nicht die gewohnte Melodie des Krakauer Turmbläsers. Dieser Zustand verunsichert ihn zunehmend. Er fühlt sich wie eine Spinne ohne Netz! Wird er überhaupt noch gebraucht? Und war all das, was er bis dato getan hat, überhaupt von Nutzen, und wenn ja, für wen?
Während er so grübelt, läuft in Gedanken sein ganzes bisheriges Leben ab. Seine Kindheit, der frühe Tod seiner Eltern, seine Jugend, die dank seines Ziehvaters eigentlich unbeschwert verlaufen ist, aber eben nur eigentlich. Der Ziehvater war der beste Freund seines Vaters, aber war dieser das auch für ihn? Oder hat jener eigennützig gehandelt, wenn er ihn „förderte“, wie er stets behauptet hatte? Zunehmend wird Waldemar klar, dass er bislang nicht nach seinem Willen leben durfte. Nein, von Anfang an hat man ihn verplant, ihn hinters Licht geführt, mal mit Versprechungen gelockt, mal mit Drohungen genötigt.
Und er selbst, hat er sich immer richtig verhalten? Hätte er nicht energischer widersprechen müssen, wenn man ihn zu etwas drängte und ihn offensichtlich, wie es ihm jetzt scheint, nur benutzte? Haben seine Spitzeldienste für den polnischen Sicherheitsdienst SB ihm nicht mehr geschadet als genutzt? Wem haben sie wirklich genutzt und wie viel Leid haben sie anderen Menschen zugefügt? Warum hat er das nicht früher erkannt?
Am meisten ärgert er sich über seine Dummheit, wo er doch eigentlich ein gebildeter Mensch ist, ein Akademiker. Andere, denen keine solche Bildung zuteilwurde, haben Widerstand geleistet und ernten jetzt ihren gerechten Lohn, sind politisch engagiert und werden heute in ihrer Heimat, seiner Heimat, geachtet. Er dagegen ist in der Versenkung verschwunden, fern der Heimat. Und schlimmer, er muss mit der Angst leben, dass er eines Tages entdeckt und vor Gericht gestellt wird.
Seine größte Schandtat aber ist, dass er unschuldige, rechtschaffene Menschen, denen er sich als der verlorene Bruder ausgab, die ihn nach besten Kräften finanziell unterstützten, die ihm menschliche Wärme schenkten und immer ein offenes Ohr für ihn hatten, niederträchtig und maßlos enttäuscht hat. Auf Befehl seiner Auftraggeber erschlich er ihr Vertrauen und missbrauchte sie. Das hat ihm anfangs auch noch Spaß bereitet, ihn sogar stolz gemacht, was für ein toller Agent er doch sei! War es richtig, dies alles mit seinem Patriotismus zu rechtfertigen? Mittlerweile fühlt er sich so schuldig, dass er es nicht mehr übers Herz bringt, sich noch einmal bei dieser Familie – seinen angeblichen Halbgeschwistern – zu melden.
Gern würde Waldemar alles ungeschehen machen. Aber wie soll das gehen? Er hat vorsätzlich gehandelt, denn er wollte ein Kundschafter für die Erhaltung des Friedens sein. So hatte man es ihm zumindest eingeredet. Und alles diente lediglich zur Sicherung der Diktatur des Proletariats. Aber die ist den Bach hinuntergegangen. Aller Anfang dieser Entwicklung ist in seinem Heimatland geschehen. Die, die ihn in die Bundesrepublik Deutschland entsandt haben, sind jetzt wohl selber auf der Flucht, haben ihn im Stich gelassen und können ihm nicht helfen, ja noch nicht einmal einen Rat erteilen. Fragen über Fragen, auf die es keine Antworten gibt und die ihn deshalb in Lethargie stürzen. Voller Zweifel lässt der Illegale in Gedanken die „Akte Waldemar“ noch einmal von Anfang bis Ende abspulen, um vielleicht darin doch noch etwas Positives zu finden, das ihm sein Gewissen erleichtern oder seinem Leben Sinn verleihen würde. Hatte er die falschen Entscheidungen getroffen?
Glombowen 1960
Anna sprang auf, ließ den Löffel in den Teller fallen und rannte so schnell sie konnte vor die Haustür. Sie erreichte gerade noch den Gartenzaun und schon spie es aus ihr heraus. Als sie sich wieder an den Tisch setzte, schaute die Mutter sie von der Seite an und sagte: „Du bist ja schon wieder schwanger, dass du das nicht lassen kannst?!“
Anna schwieg eine Weile, dann sagte sie: „Mutter, sei still, nicht vor den Kindern. Nicht vor den Kindern, Mutter!“
Am Tisch saßen neun Kinder. Theodor war sechzehn, Agata ein Jahr jünger, die Zwillinge Gregor und Gerda waren gerade dreizehn geworden. Am unteren Tischende drängten sich die Kleinen: Jan mit zehn Jahren, der siebenjährige Jurek, die fünfjährige Dorota und die dreijährigen Zwillinge Stefan und Stefania. Die beiden Älteren verdienten ihr Brot bereits selbst, denn Anna und ihre zwei Ältesten waren Landarbeiter im angrenzenden staatlichen Agrarunternehmen und da gab es bereits für Heranwachsende ab dem vierzehnten Lebensjahr Arbeit. Seit Kriegsende hatte sich hier auf dem Lande nichts geändert. Mit vierzehn Jahren war die Volksschule beendet, dann kam die Lehre oder die Jugendlichen nahmen als Ungelernte einen Job an. Die meisten schlugen letzteren Weg ein. Hauptgrund war, dass es an Handwerksbetrieben mangelte. Wollte man an einer staatlichen Berufsschule eine Qualifikation erlangen, so lag diese in der Regel in der Kreisstadt und die war oftmals zwanzig oder dreißig Kilometer entfernt. Das Wagnis, die Kinder so weit weg in die Kreisstadt zu schicken und gewissermaßen die Kontrolle über die Sprösslinge zu verlieren, gingen viele Eltern nicht gerne ein.
„Dieser alte Hurenbock hat dich zur Hure gemacht. Keinen Mann haben, aber zehn Kinder, das ist eine Schande. Die Leute zerreißen sich die Mäuler über uns. Ich traue mich ja gar nicht mehr ins Dorf. Ludzie się bendą dupani schniać“, setzte Annas Mutter in Masurisch nach, was so viel hieß wie: Die Leute werden mit dem Hintern über uns lachen.
„Wie willst du die Kleinen durchbringen, wenn ich mal nicht mehr da bin? Und ich sehne mich auch schon danach, dass mich der Herrgott zu sich holt, damit ich diese Schande nicht länger ertragen muss. Hoffentlich schmort dieser alte Teufel in der Hölle“, brummte die alte Frau vor sich hin.
„Kinder, macht, dass ihr fertig werdet, esst anständig und dann Abmarsch ins Bett. Mama hat noch zu tun“, sagte Anna zu den Kleinen.
Für die vier Großen – Theodor, Agata und die beiden Dreizehnjährigen – ging’s ins abendliche Dorfvergnügen, welches diese Bezeichnung kaum verdiente. Der Raum, in dem sich die Jugend traf, war die ehemalige Gaststube eines abgewrackten Gasthauses, dessen Besitzer gleich nach Ende des Zweiten Weltkrieges in die Bundesrepublik Deutschland ausgesiedelt war. Viel war hier auf dem Dorf nicht geboten, es gab auch keinen Hauswart oder Jugendbetreuer. Den Schlüssel zu diesem Lokal, das nur dürftig möbliert war, holten sich die Jugendlichen beim Ortsvorsteher, der die Amtsbezeichnung Sołtys trug. Jenen kümmerte es wenig, womit sich die Jugendlichen beschäftigten. Und es war ihm auch egal, was sie so taten, denn schließlich war er ja Landwirt und musste sich in erster Linie um seinen Hof kümmern. Die Aufsicht über die Jugendlichen oblag dem kommunistischen Jugendverband ZMP, der seinen Amtssitz in der Kreisverwaltung Kętrzyn hatte. Dem wiederum mangelte es in erster Linie an finanziellen Mitteln und auch an Personal. Was vorhanden war, das reichte nur, um in erster Linie in der Kreisstadt und in größeren Gemeinden einen Hauch von Kultur anzubieten. Aber die Jugend von Glombowen kam auch ohne Hilfe zurecht. Es fand sich immer jemand, der Akkordeon spielen und ein wenig Tanzmusik machen konnte. Und, damit es ein wenig lustiger zuging, trank man Obstwein, entweder selbstgemachten oder gekauften. Echten Wein gab es hier nicht, nur die Delikatessläden in der Stadt führten Wein. Aber der war für die Dorfjugend unerschwinglich. Gelegentlich gab es auch Bier, wenn das kleine Kolonialwarengeschäft im Ort kurz zuvor beliefert worden war. Es gab auch harte Sachen, den selbstgebrannten Schnaps, der im Volksmund als Bymber bekannt war. Dieser Bymber hatte schon so manchen ins Gefängnis gebracht. Wer erwischt worden war, musste mit einem Jahr Gefängnis rechnen, abgesehen davon, dass der Bymber ohne Zusatz von Honig oder Kirschsaft beziehungsweise Himbeersaft kaum zu genießen war. Die polnische Landjugend, die offiziell als „das junge Kader der Volksrepublik Polen“ bezeichnet wurde, war ein vergessener und sich selbst überlassener Haufen von „Gurkendieben“.
In dieser fast trostlosen Zeit, die damals auf dem Lande herrschte, musste jeder zusehen, wo er blieb. Da ließ man immer etwas mitgehen, wenn sich die Gelegenheit dazu bot. Es ging ums nackte Überleben. Um die Jugendlichen kümmerte sich eigentlich nur einer: der polnische Inlandsnachrichtendienst SB. Der hatte nämlich ein Interesse daran, die Jugendlichen zu Spitzeldiensten anzuwerben. Die kleinen Delikte, die fast jeder auf dem Kerbholz hatte, reichten immer für ein Kompromat aus, dessen sich der SB in Regel bediente. Das Ziel war auch hier, allumfassend über die eigenen Staatsbürger informiert zu sein. Die Jugendlichen waren einer Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst nicht gänzlich abgeneigt. Der eine oder andere fühlte sich dadurch aufgewertet und kam sich wichtig vor. Der SB bot ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit, das ihnen zu Hause niemand geben konnte.
Anna stand vom Tisch auf und begann ihn abzuräumen. Auch sie hatte die Absicht, einen angenehmen Abend zu genießen, soweit das in dieser gottverdammten Einöde möglich war. Die Alte verzog sich in ihre Kammer und ging zu Bett. Sie hatte genug gelitten. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie zusehen müssen, wie sie ihre drei Kinder durchbringen konnte. Dann hatte sich der Gutsbesitzer Siekerka ein wenig um sie gekümmert, bis er sich Anna krallte, aber immerhin die Familie so weit versorgte, dass sie keinen Hunger leiden mussten. Die Alte hatte sich mit ihrer Tochter nie so recht verstanden und diese Zwietracht verschlimmerte sich, je älter Anna wurde. Vielleicht wäre alles anders gekommen, hätte es den Krieg nicht gegeben. Dann wären ihre Söhne da, die sich um sie hätten kümmern können. Jetzt war hier Polen und nicht mehr Ostpreußen. So vieles hatte sich gewandelt. Und Anna wäre wahrscheinlich auch nicht auf die schiefe Bahn geraten, hätte sich nicht all den Kerlen an den Hals werfen müssen, die sie ein ums andere Mal schwängerten … Ilse Putzmich seufzte bei dem Gedanken. Sie nickte ein wenig ein, von ihrem Sohn Tomas träumend, der noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges eingezogen worden und in Russland gefallen war.
Anna war im März 1928 als jüngstes Kind des Fischers Fritz Putzmich und dessen Ehefrau Ilse geboren worden. Die Putzmichs hatten schon damals direkt am Orlensee im Kreis Rastenburg gewohnt. Fritz Putzmich verwöhnte seine Jüngste sehr. So sehr, dass es die anderen Familienmitglieder fast neidisch machte. Ihre zwei älteren Brüder dagegen, Zwillingsbrüder, kümmerten sich nicht um Anna, sie besuchten bereits die Schule und waren mit Aufgaben als so genannte Pimpfe beschäftigt.
Anna wuchs in einer kaum besiedelten Gegend – frei wie ein Vogel – auf. Das Fischerhäuschen, das die Putzmichs ihr Eigen nannten, hatte vier Zimmer. Aus dem Flur, in dem ein großer Wasserkessel stand, ging es nach rechts in die Wohnküche. Gleich rechts in der Ecke stand die Waschschüssel, dann schloss sich der Esstisch an, wo alle Mahlzeiten eingenommen wurden. Links in der Ecke stand ein großer Kachelherd mit einem integrierten Backofen. Von der Küche aus ging es zur Vorratskammer, von wo aus eine Holztreppe auf den Dachboden führte. Dort war Annas Spielparadies, eine wahre Fundgrube mit alten, manchmal kuriosen Sachen aus längst vergangener Zeit. In der Wohnküche spielte sich quasi das ganze Leben der Familie Putzmich ab.
Natürlich gab es auch die „Gutstub“, diese wurde allerdings nur zu besonderen Anlässen oder an den großen Feiertagen benutzt. Wenn man sie aus dem Flur betrat, stand gleich in der linken Ecke ein Büfett. In der Mitte stand ein wuchtiger Tisch, rechts davon ein Vertiko. Ein Kachelofen war in der rechten Zimmerecke, der nur nach Bedarf in Betrieb genommen wurde. Von der guten Stube führte eine Tür ins elterliche Schlafzimmer. Die kleinen Kinderzimmer, in denen gerade mal ein kleiner Kleiderschrank und ein beziehungsweise zwei Betten Platz hatten, waren von allen Seiten zugänglich.
Das Fischerhäuschen stand direkt am See und war etwa eine Viertelstunde Fußweg vom Dorf Glombowen entfernt. Blumen und Gemüsegärten, die mit einem Staketenzaun eingefasst waren, ließen das Anwesen wertvoller erscheinen. Ein Schild mit der Aufschrift „Fritz Putzmich – Frisch- und Räucherfisch“ gab der kleinen Kate den letzten Schliff. In einer Miete lagerten Eisschollen, die im Winter aus der dick gefrorenen Eisdecke des Sees gesägt wurden. Kräftig mit Sägespänen umhüllt, hielten sie sich fast den ganzen Sommer hindurch kalt. Dieses Eis reichte für die Kühlung der Fische, die nach dem Fang nicht sofort verkauft werden konnten, fast bis zum ersten Nachtfrost im Oktober.
Dann und wann nahm der Vater Anna in seinem Kahn zum Fischen mit. Das hatte Anna besonders gern, denn da hatte sie ihren Papa für sich ganz alleine. Es bereitete ihr einen enormen Spaß, wenn ihr Vater die Fische aus den Netzen holte und sie ihm dabei helfen durfte. Die kleinen Fische durfte Anna wieder ins Wasser werfen. Die wird der Vater erst dann wieder fangen, wenn sie groß genug sind, um in der Pfanne oder im Kochtopf zu landen, erklärte Fritz Putzmich der kleinen Anna.
Ohne Mühe schaffte es Anna, alle Fischarten zu lernen. Sie war ein fröhliches Kind, das sich eigene Geschichten ausdachte und sie ihrem Vater, wenn sie beide allein waren, erzählte. Sie erzählte kuriose Geschichten. Zum Beispiel von ihrem imaginären Freund Hartmuth, der sie beschütze und sie gelegentlich auf seine nächtlichen Ritte auf einem weißen Schimmel zum Mond mitnahm. Da ihr Vater ein guter Zuhörer war, erfand sie immer neue Episoden aus Hartmuths Leben, das mit jeder neuen Geschichte bunter und aufregender wurde. So bekam Hartmuth im Laufe der Zeit eine Mutter, eine Schwester und andere Anverwandte.
Die Putzmichs lebten in einer Idylle, rundum von Natur und freier Landschaft umgeben. Sie waren nicht reich, hatten dennoch ein Auskommen, das mehr als nur zum Leben reichte. Fritz Putzmich war ein passionierter Fischer und es bereitete ihm Vergnügen, wenn er in der Früh Barsche, Plötze, Schleie, Hechte und Aale aus seinen Netzen herausholte. Am besten aber verkauften sich Stinte, ein kleinfingergroßer und fast durchsichtiger Fisch. Man aß ihn gekocht mit allem Drum und Dran einfach mit dem Esslöffel, insofern man sich nicht vor seinen winzigen Innereien ekelte. Neben dem Fischfang, der die Haupteinnahmequelle der Putzmichs war, gab es noch einen kleinen landwirtschaftlichen Nebenerwerb mit ein paar Morgen Acker, auf dem Obst, Gemüse und ein wenig Korn angebaut wurden. Es gab auch etwas Kleinvieh, eine Kuh, zwei Ferkel und Federvieh: Hühner, Enten, Gänse. Rundum ein fast autonomes Selbstversorger-Agrarunternehmen – im Kleinstformat, versteht sich. Damals waren die Putzmichs eine glückliche Familie. Doch bald zogen am Horizont dunkle Wolken auf und das idyllische Leben der Familie Putzmich fand ein jähes Ende.
Krakau im Juni 1976
„Kurwa, Wacek, du bist schon wieder leichtsinnig, arbeite an dir! Konspiration steht an erster Stelle, aber du lässt sie in letzter Zeit immer öfters außer Acht“, sagte Hauptmann Okoń, denn Wacek machte sich, wie immer, über den Hauptmann lustig.
„Ich ermahne dich zum letzten Mal, wenn du so weitermachst, werden wir uns trennen müssen und du kannst dein Studium in Dresden vergessen. Und ‚Kohle‘ bekommst du auch keine mehr von mir. Schreib dir das hinter die Ohren, cholera jasna – ist das klar!“, setzte der Hauptmann mit Bestimmtheit nach.
„Schon gut, schon gut, war nur ein kleiner Scherz“, erwiderte Wacek lachend.
Wacek, der mit vollem Namen Wacław Potocki hieß, wurde am 22. Juli 1958 in Racławice, Südostpolen, geboren. Sowohl sein Geburtsdatum als auch sein Geburtsort waren mit bedeutsamen Ereignissen der polnischen Geschichte verbunden. Denn am 22. Juli 1944 wurde in Moskau das Manifest des Polnischen Komitees für Nationale Befreiung (PKWN) veröffentlicht. Dieses Komitee bildete wenige Tage später de facto die polnische Regierung, und zwar mit Anerkennung Stalins, aber unter Umgehung der polnischen Exilregierung in London. Die kommunistische Regierung Polens erklärte diesen Tag später zum Nationalfeiertag, zum „Tag der Wiedergeburt Polens“.
Und als wäre das noch nicht genug, war auch der Ort, an dem Wacek das Licht der Welt erblickt hatte, geschichtsträchtig: Unter der Führung des polnischen Nationalhelden General Tadeusz Kośćiuszko hatte am 4. April 1794 bei der Ortschaft Racławice ein polnisches Bauernbataillon, bewaffnet mit Sensenbajonetten, eine russische Einheit vernichtend geschlagen. Dieses Ereignis wird in polnischen Geschichtsbüchern als die berühmte „Schlacht von Racławice“ gewürdigt. Sie ist für die polnische Geschichte sehr wichtig und erfüllt die Nation mit Stolz.
Wacek war der Sohn eines Kreisparteisekretärs der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PZPR). Er war ein aufgeweckter Knabe, mit strohblondem Schopf, einem etwas kantigen Gesicht, blauäugig mit leicht abstehenden Ohren. Wacek war kontaktfreudig und besaß kabarettistisches Talent. Trotz seiner Streiche mochten die Nachbarn seinen Schabernack und ermunterten ihn zu immer neuen Streichen. Er war ein Lausbub, wie er im Buche steht. Trotz der schlechten Zeit, in die er hineingeboren wurde, hatte er keine Not zu leiden. Denn sein Vater, ein Parteifunktionär der mittleren Ebene, sorgte dafür, dass es der Familie an nichts mangelte. Wenn auch der Vater nicht besonders viel verdiente, so kamen doch Geld und Naturalien auf anderen Wegen ins Haus. In dieser Zeit des Wiederaufbaus nach dem Ende des Krieges musste ein jeder zusehen, wie er über die Runden kam. Und wer am Ruder saß, wenn auch nur an einem kleinen, und ein wenig Einfluss hatte, war privilegiert. Die Bauern aus der Region drängten den Beamten in Partei und Verwaltung Geld und Lebensmittel förmlich auf, nicht als „Bestechung“, nein, sondern als eine Art Kompensation für eine schnellere Erledigung ihrer Anträge. Da gab es zum Beispiel die Anträge auf Zuteilung von staatlichen Entwicklungskrediten, Anträge auf Erteilung von Baugenehmigungen und vieles mehr.
Unter diesen glücklichen Umständen war der kleine Wacek ein stets sauber und gut gekleideter Junge. Und er war auch wohl erzogen, wenn man einmal von seinen Streichen absah. Er lief nicht herum wie viele andere Kinder, mit zerfetzten Hosen, die anstelle eines Knopfes unter dem Bauchnabel mit Draht zusammengehalten wurden. Wacek erschien im Sommer nie barfuß in der Schule wie andere Kinder, die zuweilen wie „Schwarzfußindianer“ zum Unterricht kamen. All das trug dazu bei, dass fast alle Mitschüler Wacek mochten und natürlich auch alle Lehrer, weil sie Respekt vor seinem Vater hatten, ja haben mussten. Dass Wacek ein fleißiger Schüler war, erleichterte es den Lehrern, ihn zu mögen. In solchen Verhältnissen aufgewachsen, war sich Wacek seines Wertes sehr wohl bewusst und er genoss es. Es war daher auch kein Zufall, dass er zum Klassensprecher und später zum Schulsprecher gewählt wurde. Aber nach einer Reihe fetter Jahre folgten magere. Als Wacek zehn Jahre alt geworden war, starb der Vater und Wacek verlor in der Schule seine privilegierte soziale Stellung. Wenige Jahre später starb auch seine Mutter. Wacek kam auf ein Gymnasium mit Internatsunterbringung und es wurde ihm von Amtswegen ein Vormund zugeteilt. Dieser Vormund war zum Glück Vaters bester Freund Mirosław Okoń. Erst viele Jahre später sollte Wacek an diesem vermeintlichen Glück zu zweifeln beginnen – nämlich als er erfuhr, dass Okoń Offizier des polnischen Sicherheitsdienstes, des SB, war …
Auch von Seiten der Polnischen Arbeiterpartei PZPR wurde Wacek protegiert. Dafür hatte sein Vater noch zu Lebzeiten gesorgt. Waceks Vater, Cezary Potocki, hatte am Ende des Zweiten Weltkrieges als Partisan gegen die sich zurückziehende Deutsche Wehrmacht und gegen die Ukrainische Aufständische Armee (UPA) gekämpft, die den Großraum Zamość für den von ihr angestrebten ukrainischen Staat beanspruchte. Darüber hinaus war es bis Mitte 1946, hauptsächlich im Süden Polens, zu Scharmützeln zwischen den polnischen Linken und den Anhängern der polnischen Exilregierung gekommen, die ihren vorläufigen Sitz unter der Führung von Stanisław Mikołajczyk in London hatte. Der Kampf der Rechten um die Macht hatte von Anfang an keine Aussicht auf Erfolg gehabt, weil die Linke von der Siegermacht Sowjetunion und insbesondere vom NKWD (so wurde damals der sowjetische Geheimdienst „Nacjonalnyj Komitet Wnutrennych Del“ genannt) unterstützt wurde. Bei diesen Kämpfen waren damals einige Tausend Menschen ums Leben gekommen. 1947 hatten die Kommunisten auf ganzer Linie gesiegt, etwa vierzigtausend Kämpfer der Rechten hatten sich ergeben, ein Teil war in die Gefängnisse gewandert und von der NKWD in die Sowjetunion deportiert worden. Waceks Vater war überzeugter Kommunist gewesen und hatte sich während der Entstehung des neuen polnischen Staates den Linken angeschlossen, die 1947 durch einen erzwungenen Zusammenschluss der Polnischen Arbeiterpartei, der Polnischen Sozialistischen Partei und der Demokratischen Bewegung in der PZPR mündete.
Mirosław Okoń, Waceks Vormund und bester Freund seines Vaters, war als Offizier in die neugegründete Miliz der Volksrepublik Polen übernommen worden und hatte an der Wojewodschafts-Kommandantur der Volksmiliz (KWMO) in Krakau gedient. 1956, als der neue Sicherheitsdienst UB (Urząd Bezpieczeństwa; Amt für Sicherheit) gegründet wurde, versetzte man Okoń zum UB, und zwar ins Department III, „Bekämpfung antistaatlicher Aktionen“. Auf diesem Posten konnte er sich besser um seinen Zögling Wacek kümmern, der ihm inzwischen fast wie ein eigener Sohn war. Um sein neues Amt beim UB ordnungsgemäß ausüben zu können, war es erforderlich, sich einen zuverlässigen Informantenkreis aufzubauen. Dieser musste sorgfältig ausgesucht und erfolgreich angeworben werden. So lag es nahe, dass sich Mirosław Okoń in eigener Sache auch der Karriere von Wacław Potocki annahm. Es fügte sich eins zum anderen, wenn Wacek hie und da einmal etwas über seine Freunde erzählte, zumindest anfangs.
Wenn Wacek volljährig würde, das stand fest, sollte er als Geheimer Mitarbeiter (Tajny Współpracownik oder kurz: TW) des UB, das inzwischen SB hieß, verpflichtet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Okoń ihn lediglich „locker an der langen Leine“ – wie man im Jargon zu sagen pflegte. Für Hauptmann Okoń würde es noch einiges zu tun geben, bis man Wacek zu einem brauchbaren TW machen und verpflichteten konnte. Neben der nachrichtendienstlichen Schulung musste Okoń auch noch an dessen Persönlichkeit feilen und ihm die Flausen aus dem Kopf treiben. Bei dessen Charakter war es harte Arbeit. Okoń musste das auf jeden Fall hinkriegen. Denn in den Richtlinien für die Ausbildung der TW hieß es unter anderem:
„Die Ausbildung der ‚Geheimen Mitarbeiter‘ beruht auf systematischem Einpauken der Liebe zum Vaterland, der Polnischen Volksrepublik, und des Schürens von Hass auf ihre Feinde. Ihre Erziehung soll der Ausführung schwieriger und verantwortungsvoller Aufträge dienen, welche die Sicherheitsorgane ihnen übertragen.
Die operativen Mitarbeiter erziehen die TWs ideologisch durch drillmäßiges Einprägen aktueller Ereignisse mit der korrekten Auslegung ideologisch-politischer Inhalte, die für sie Fragen aufwerfen. Sie geben den TWs korrekte und abschließend formulierte Antworten auf Themen ideologischen Charakters, an denen jene gewisse Zweifel hegen …“
Der Führungsoffizier hat für den TW Autoritätsperson, Vorbild und väterlicher Freund zu sein.
Mirosław Okoń war ein etwas grobschlächtiger Typ, der aus einfachen Verhältnissen stammte. Sein Vater war bei einem polnischen Kulaken, einem Großbauern, Knecht gewesen. Als Dank für seine treuen Dienste hatte der Kulake es seinem Sohn Mirosław ermöglicht, wenigstens die Mittelschule zu besuchen. Das hatte Mirosław nach dem Ende des Krieges die Offizierslaufbahn bei der Miliz gesichert. Er war nicht besonders intelligent, aber ehrgeizig und er verrichtete seinen Dienst zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten. Aufgrund seiner kantigen Art war er allerdings nach über zwanzig Jahren Dienstzeit nicht weiter als bis zum Dienstgrad eines Hauptmanns gekommen. Okoń wusste nur zu genau, dass in den Anfängen des UB vorwiegend Söhne von Arbeitern und armen Bauern aufgenommen wurden, wie er einer war. Manche von ihnen hatten noch nicht einmal einen Volksschulabschluss, aber ein dreijähriges Studium in Marxismus-Leninismus absolviert. Er wusste auch nur zu gut, dass die Aufnahme dieses Personenkreises in den Sicherheitsdienst zwei pragmatische Gründe hatte. Der erste Grund diente dem propagandistischen Zweck, die neue Regierung in den Augen der Gesellschaft zu legalisieren. Abkömmlinge armer Familien wurden mit festen Arbeitsstellen bedacht. Das fand bei den Bürgern Gehör. Damit wurde die wichtigste Losung der Marxisten-Leninisten ins Volk transferiert. Das war allerdings nur vordergründig. In Wirklichkeit, und das war der zweite Grund, wollten sich die Kommunisten Menschen, die bisher ohne Perspektive waren, jetzt aber eine feste Anstellung erhielten, zu treuen Dienern heranziehen, auf die sich der Sicherheitsapparat über Jahre hinaus würde verlassen können. Er, Okoń, zählte sich selbst nicht zu dieser Kategorie und es widerte ihn des Öfteren an, wie sich Kollegen mit diesem Werdegang bei ihren Vorgesetzten anbiederten. Deshalb zogen sie alle an ihm vorbei, was ihn manchmal aus der Fassung brachte. Dann versuchte er den Ärger im Wodka zu ertränken. Natürlich war es ihm bewusst, dass auch er in Wirklichkeit nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe der allmächtigen kommunistischen Partei war, deren Mitglied er als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sein musste. Und auch er hatte zu tun, was man von ihm verlangte. Es erfüllte ihn trotz allem aber mit großer Genugtuung, dass sein Posten ihm ein erhabenes Gefühl verlieh, nicht zu den Gejagten und Verfolgten, sondern zu den Jägern zu gehören.
Glombowen 1934–1960
Ein schweres Gewitter zog auf, wie in Ostpreußen in den Sommermonaten so oft. Im Norden sah man eine schwarze Wolkenwand näher kommen. Dennoch entschloss sich Fritz Putzmich noch auf den See hinauszufahren, um seine am Vorabend ausgebrachten Netze einzuholen. Er befürchtete, dass der Gewittersturm die Markierung der ausgebrachten Netze verwehen könnte. Das hatte er schon einmal erlebt und seine Netze nur mit Mühe und Not wiedergefunden. Seine Frau, Ilse, beschwor ihn, nicht zu gehen, denn sie habe letzte Nacht einen bösen Traum gehabt. Fritz aber war von seinem Vorhaben nicht abzubringen. Er war ein sturer Masure, der immer mit dem Schädel durch die Wand wollte. Der Ilse war das nicht neu. Deshalb hielt sie am Ende auch den Mund, um einem Krach aus dem Weg zu gehen. Fritz stieg in seinen Kahn und legte ab. Der Wind wurde immer stärker und Gischt peitschte Fritz ins Gesicht. Es blitze jetzt fast unaufhörlich. Tiefes Donnergrollen erschütterte die Luft. Der See tobte und warf das Boot hin und her. Fritz musste sich mit aller Kraft dem Wind entgegenstemmen. Er kam nun kaum mehr voran, obwohl er mit aller Kraft ruderte. Die Wellen brachen über die Bordwand. Starker Regen setzte ein und nahm ihm jede Sicht. Mitten auf dem See stand das Gewitter plötzlich direkt über ihm und alles um ihn herum lag – von einem ungeheuren Donnerschlag begleitet – mit einem Mal in gleißendem Licht. Vom Blitz getroffen, fiel ihm das Ruder aus der Hand. Fritz stürzte und fiel auf die Bordwand. Das Boot kenterte und versank samt Fritz im See.
Ilse und Anna warteten besorgt zu Hause in der Fischerkate. Der Regen trommelte gegen die dünnen Fensterscheiben. Plötzlich öffnete sich die Türe und Annas Brüder traten in den kleinen Raum. Völlig durchnässt und erschöpft kehrten sie von einem ihrer Streifzüge heim. Unaufhörlich schlugen die Blitze rund um die Kate ein und erhellten Land und See gespenstisch. Anna verzog sich in eine Ecke und zuckte bei jedem Donnerschlag zusammen. Lange verharrten Ilse und die Kinder stumm und regungslos. Es kam ihnen vor, als wollte das Gewitter nicht enden.
Nach dem Regen, dem Donner und den Blitzen warteten sie noch immer auf die Rückkehr von Fritz. Gegen Abend eilte Ilse ins Dorf und bat um Hilfe. Erst am nächsten Morgen fand sich sein Fischerkahn im Schilf. Fritzens Leiche wurde lange nicht gefunden. Man glaubte, der See habe ihn verschluckt.