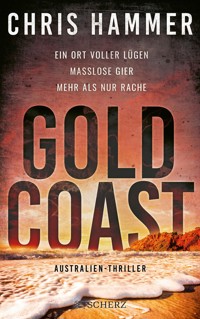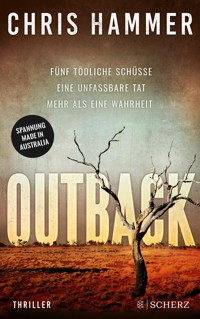
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hitze. Mord. Rätsel. Schuld. Erlösung: der atemberaubende Nr.1-Bestseller-Thriller aus Australien Rivers End, ein Städtchen in der flirrenden Hitze des Outbacks: eiskalt eröffnet der junge Pfarrer vor der Kirche das Feuer auf seine Gemeinde. Er tötet fünf Menschen. Ein Jahr später kommt Reporter Martin Scarsden in den Ort, um über die Morde zu schreiben. Aber als er die Einheimischen befragt, begreift er, dass es mehr als eine Wahrheit gibt, was die Tat des Pfarrers angeht. Warum hat er wirklich getötet? War er ein Monster oder ein idealistischer Rächer? Welche Geheimnisse wird die ausgedörrte rote Erde von Rivers End noch freigeben? "Ein unwiderstehlich spannender Thriller, in dem das glutheiße Outback eine faszinierende Hauptrolle spielt." The Guardian "Schnallen Sie sich an für diesen Höllenritt. Besser kann Spannungsliteratur kaum sein." Herald Sun "Der beste Thriller des Frühjahrs" Washington Post
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Chris Hammer
Outback - Fünf tödliche Schüsse. Eine unfassbare Tat. Mehr als eine Wahrheit
Über dieses Buch
Es ist Sonntag in Rivers End, einem Städtchen in der flirrenden Hitze des Outbacks. Kurz vor dem Gottesdienst,stehen Leute beisammen und reden miteinander. Da tritt der junge Pfarrer Byron Swift vor seine Kirche. Er hebt ein Gewehr, eröffnet das Feuer und tötet fünf Menschen. Danach wird er vom Ortspolizisten erschossen. Die Tat macht in ganz Australien Schlagzeilen.
Ein Jahr später kommt Reporter Martin Scarsden in den Ort, um erneut über die Morde zu schreiben. Aber als er die Einheimischen befragt, zeichnen diese ein anderes Bild von Swift als das, was bisher bekannt war: ein Pfarrer, der sich für seine Gemeinde einsetzte, der vielen Leuten half, der eine charismatische Persönlichkeit hatte. Aber er war auch ein Meisterschütze mit mysteriösem militärischem Hintergrund, sagt der Dorfpenner Harley Snouch. Und sehr attraktiv, sagt Mandy, die Cafébesitzerin und Buchhändlerin. Langsam spürt Martin, dass die Wahrheit über Byron Swift erst entdeckt werden muss. Die Feuerwalze eines Buschfeuers bringt eine neue, schockierende Wendung: die Leichen zweier deutscher Packpackerinnen werden gefunden – vermisst seit den Kirchenmorden. Hat Swift sie getötet? Martin muss Antworten finden - für sich und für die Menschen in Rivers End ...
»Einer der besten australischen Romane.« The Weekend
»Ein Roman wie ein Hitzesturm, der sich ins Gehirn einbrennt. Nicht verpassen!« A.J. Finn
»Die Bilder des Outbacks prägen sich unauslöschlich ein.« Tony Wright, Sydney Morning Herald
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Chris Hammer kennt sich als Journalist bestens mit spannenden, dramatischen Geschichten aus und lässt diese Erfahrungen überzeugend in seinen Bestseller »Outback« einfließen. Der Thriller wurde 2019 mit dem wichtigsten britischen Krimipreis, dem »New Blood« Dagger Award, ausgezeichnet. In Australien hat er für fast alle bedeutenden Medien gearbeitet. Als Auslandskorrespondent berichtete er über dreißig Jahre aus sechs Kontinenten, u.a. für die führende TV-Nachrichtensendung »Dateline«. Er ist politischer Korrespondent für »The Age« und »The Bulletin«. Seine Sachbücher wurden mehrfach ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Frau in Canberra.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© Chris Hammer 2018
Die australische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Scrublands« im Verlag Allen & Unwin, Sydney
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung und Coverabbildung: © Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490912-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Karte
Prolog
Eins Rivers End
Zwei Black Dog Motel
Drei Blutiger Sonntag
Vier Geister
Fünf Die Ebene
Sechs Scrublands
Sieben Der Drache
Acht Stalker
Neun Bellington
Zehn Mord
Elf Neueste Nachrichten
Zwölf Eine allegorische Geschichte
Dreizehn Das Hotel
Vierzehn Blutmond
Fünfzehn Selbstmord
Sechzehn Flüchtling
Siebzehn Angeklagt
Achtzehn Kaution
Neunzehn Schnee von gestern
Zwanzig Grabräuber
Einundzwanzig Outlaws
Zweiundzwanzig Dreißig
Dreiundzwanzig Die Zelle
Vierundzwanzig Die Leiche
Fünfundzwanzig Verkabelt
Sechsundzwanzig Freudenfeuer
Siebenundzwanzig Die Brücke
Achtundzwanzig Leben
Anmerkung des Autors
Danksagung
Für Tomoko
Prolog
Der Tag ist still. Im Laufe der Nacht hat die Hitze nachgelassen, aber jetzt breitet sie sich wieder aus. Der Himmel ist wolkenlos und unerbittlich, die Sonne brutal. Auf der anderen Straßenseite, an dem Rinnsal, das vom Fluss noch übrig ist, errichten die Zikaden eine Wand aus Lärm, aber die Kirche ist von Stille umgeben. Die Gemeindemitglieder fahren zum Elf-Uhr-Gottesdienst vor und parken gegenüber im Schatten der Bäume. Als drei oder vier Autos angekommen sind, treten ihre Insassen heraus in den gleißend hellen Morgen, überqueren die Straße und versammeln sich vor St. James, um zu plaudern – über Viehpreise, den Wassermangel auf den Farmen, das gnadenlose Wetter. Der junge Pfarrer, Byron Swift, ist auch da, noch leger gekleidet, und redet freundlich mit älteren Gemeindemitgliedern. Alles wirkt normal, niemand scheint beunruhigt.
Craig Landers, Besitzers des Supermarkts in Rivers End, nähert sich. Er ist mit seinen Freunden unterwegs zur Jagd, aber sie machen bei der Kirche halt, weil er vorher ein paar Worte mit dem Priester wechseln will. Wie Craig sind auch sie keine regelmäßigen Kirchgänger. Gerry Torlini wohnt unten in Bellington und kennt niemanden in der Gemeinde; deshalb kehrt er zu seinem Allradwagen zurück. Aber die Farmer aus dem Ort, Thom und Alf Newkirk, mischen sich unter die Leute, ebenso wie Horrie Grosvenor. Alfs Sohn Allen sieht sich umgeben von Leuten, die dreimal so alt sind wie er, und setzt sich zu Gerry in die Kabine seines Trucks. Wenn jemand findet, dass die Männer in ihrer Jagdkleidung, einer Mischung aus Tarnfarben und greller Warnschutzkleidung merkwürdig aussehen, bleibt es jedenfalls ungesagt.
Der Pfarrer sieht Landers und kommt herüber. Die Männer schütteln einander die Hand, lächeln und wechseln ein paar Worte. Dann entschuldigt sich der Pfarrer und geht in die Kirche, um den Gottesdienst vorzubereiten und sich umzuziehen. Nachdem Landers gesagt hat, was er sagen wollte, will er rasch aufbrechen, aber Horrie und die Newkirks sind mit ein paar Farmern ins Gespräch vertieft; also schlendert er um die Kirche herum zur Seite, wo es Schatten gibt. Er ist fast dort angekommen, als das Geplauder unvermittelt abbricht. Er dreht sich um und sieht, dass der Pfarrer oben auf den Stufen vor der Kirche steht. Byron Swift hat seine Gewänder angezogen. Das Kruzifix auf seiner Brust blitzt in der Sonne, und er hat ein Gewehr, eine schwere Jagdwaffe mit Zielfernrohr. Für Landers ergibt das keinen Sinn, und er ist immer noch verwirrt, als Swift das Gewehr an die Schulter hebt und in aller Ruhe aus einer Entfernung von höchstens fünf Metern auf Horrie Grosvenor schießt. Grosvenors Kopf zerplatzt in einer roten Wolke, und seine Beine knicken ein. Wie ein Sack fällt er zu Boden. Alle Gespräche verstummen, und Köpfe werden gedreht. Einen Augenblick lang ist es still; die Leute sind wie vom Donner gerührt. Der Pfarrer schießt noch einmal, und wieder bricht jemand zusammen: Thom Newkirk. Schreie hört man nicht, noch nicht, aber in panischer, lautloser Verzweiflung fangen die Leute an zu rennen. Landers rast auf die Ecke der Kirche zu, da donnert der nächste Schuss. Der Mann biegt um die Ecke und ist für den Augenblick in Sicherheit. Aber er hört nicht auf zu rennen, denn er weiß, ihn vor allem will der Priester töten.
EinsRivers End
Martin Scarsden hält auf der Brücke vor der Stadt und lässt den Motor laufen. Die Brücke ist einspurig – man kann weder überholen noch passieren – und wurde vor Jahrzehnten erbaut. Das Holz stammt von den roten Eukalyptusbäumen der Umgebung. Niedrig überquert sie die Flussebene, endlos lang. Ausgetrocknete Planken sind geschrumpft und klappern, Schrauben sind locker, die Bretter zwischen den Pfeilern hängen durch. Martin öffnet die Wagentür und steigt in die Mittagshitze, glühend und trocken wie ein Hochofen. Er legt beide Hände auf das Geländer, aber sogar das Holz ist zu heiß zum Anfassen. Er hebt die Hände wieder, und jetzt klebt abgeblätterte weiße Farbe daran. Mit dem feuchten Tuch, das er sich um den Hals gelegt hat, wischt er sie sauber. Er schaut hinunter, dahin, wo der Fluss sein sollte, und sieht statt des Wassers ein Mosaik aus rissigem Lehm, hartgebacken und zu Staub zerfallend. Jemand hat einen alten Kühlschrank dahin gekarrt, wo einmal Wasser floss, und hat auf die Tür geschrieben: FREIBIERAUFVERTRAUENSBASIS. Die roten Eukalyptusbäume auf der Uferböschung kapieren den Witz nicht; ihre Äste sind zum Teil abgestorben, andere tragen noch spärliche Büschel khakifarbener Blätter. Martin schiebt seine Sonnenbrille hoch, aber das Licht ist grell, und er lässt sie wieder herunterrutschen. Er greift in den Wagen und stellt den Motor ab. Jetzt ist alles still; die Hitze hat alles Leben aus der Welt gesaugt: keine Zikaden, keine Kakadus, nicht mal Krähen, nur das Knarren der Brücke, die sich in den Klauen der Sonne klagend dehnt und wieder zusammenzieht. Kein Lüftchen regt sich. Der Tag ist so heiß, dass er an ihm zieht und die Feuchtigkeit seines Körpers begehrt. Er spürt, wie die Hitze die dünnen Ledersohlen seiner Großstadtschuhe durchdringt.
Er steigt wieder in den Mietwagen, dessen Klimaanlage sich plagt, und er rollt von der Brücke herunter in die Hauptstraße von Rivers End, in die glutheiße Senke unterhalb der Uferböschung. Hier parken Autos, stehen alle schräg zum Bordstein: SUVs, Farm-Trucks, Stadtautos, alle staubig, keins neu. Martin fährt langsam und hält Ausschau nach irgendetwas, das sich bewegt, das lebendig ist, aber es ist, als fahre er durch ein Diorama. Nach der ersten Straßenkreuzung, einen Block vom Fluss entfernt, als er an einem Bronzesoldaten auf einer Säule vorbeigefahren ist, sieht er einen Mann im Schatten der Ladenmarkisen den Gehweg entlang schlurfen. Er trägt einen langen grauen Mantel, seine Schultern sind krumm, und seine Hand umklammert eine braune Papiertüte.
Martin hält an, setzt sorgfältig im vorgeschriebenen Winkel zurück, aber nicht sorgfältig genug. Er verzieht das Gesicht, als die Stoßstange über den Bordstein schrammt. Er zieht die Handbremse, stellt den Motor ab und steigt aus. Der Bordstein ist beinahe kniehoch und soll Regenfluten abhalten. Jetzt schmückt ihn das Heck des Mietwagens. Martin überlegt, ob er den Wagen von der Betonklippe herunterfahren soll, aber dann lässt er ihn stehen. Der Schaden ist angerichtet.
Er überquert die Straße und tritt in den Schatten der Markisen, aber der schlurfende Mann ist nirgends zu sehen. Die Straße wirkt verlassen. Martin betrachtet die Ladenfassaden. An der ersten ist ein handgeschriebenes Schild mit Klebstreifen an der Glasscheibe befestigt: MATILDA’S SECONDHAND- UNDANTIQUITÄTENHANDLUNG. BEREITSGELIEBTEKLEIDUNG, NIPPESUNDKURIOSITÄTEN. GEÖFFNETDIENSTAGSUNDDONNERSTAGSVORMITTAGS. Jetzt ist es Montagmittag, und die Tür ist verschlossen. Martin wirft einen Blick ins Schaufenster. Da ist ein mit Perlen besetztes Cocktailkleid auf eine alte Kleiderpuppe drapiert. Ein Tweedjackett mit Lederflicken an den Ellenbogen und etwas ausgefranstem Saum hängt auf einem hölzernen Kleiderbügel, und ein grell orangefarbener Overall schmückt eine Stuhllehne. Ein Eimer aus rostfreiem Edelstahl enthält eine Kollektion ausgemusterter Regenschirme, seit langem unbenutzt und verstaubt. An einer Wand hängt ein Plakat mit einer Frau im Badeanzug, die sich auf einem Strandlaken räkelt, während hinter ihr die Wellen über den Sand rollen. MANLY – MEERUNDSTRAND, steht auf dem Plakat, aber es hängt schon zu lange im Schaufenster, und die Sonne von Riverina hat das Rot aus der Schwimmerin und das Gold aus dem Sand gebleicht und einen hellblauen Schleier hinterlassen. Ganz unten in der Auslage steht eine Reihe von Schuhen: Bowling-Schuhe, Golf-Schuhe, abgenutzte Reitstiefel und ein Paar blank polierte braune Halbschuhe. Um sie herum, verstreut wie Konfetti, liegen die Leichen von Fliegen. Die Schuhe toter Männer, denkt Martin.
Der nächste Laden ist leer. Im Fenster hängt ein schwarz-gelbes »ZUVERMIETEN«-Schild, und auf der Scheibe sind die Umrisse einer Schrift, die abgekratzt wurde, immer noch lesbar: HAIRTODAY. Er zieht sein Handy aus der Tasche und macht ein paar Fotos, visuelle Gedächtnisstützen, die er zum Schreiben braucht. Das nächste Geschäft ist völlig verrammelt: zwei kleine Fenster mit Wetterschenkeln am unteren Rand des Rahmens, beide sind mit Brettern vernagelt. Die Tür ist mit einer rostigen Kette und einem Vorhängeschloss aus Messing gesichert. Es sieht aus, als wäre das schon ewig so. Martin fotografiert die Tür mit der Kette.
Als er auf die andere Straßenseite zurückgeht, dringt die Hitze wieder durch seine Schuhsohlen, und er weicht Flecken von halb flüssigem Asphalt aus. Als er den Gehweg und den wohltuenden Schatten erreicht hat, sieht er zu seiner Überraschung, dass er seinen Wagen vor einer Buchhandlung geparkt hat: THEOASISBOOKSTOREANDCAFÉ steht auf einer Tafel, die von der Markise baumelt. Die Worte sind in ein langes, verzogenes Brett geschnitzt. Eine Buchhandlung. Was sagt man dazu? Er hat kein Buch mitgebracht, hat bisher nicht mal daran gedacht. Sein Redakteur, Max Fuller, hat ihn in aller Herrgottsfrühe angerufen, ihn an seinem Geistesblitz teilhaben lassen und mit der Story beauftragt. Martin hat hastig gepackt, ist im letzten Augenblick zum Flughafen gekommen, hat die Ausschnitte heruntergeladen, die ihm per E-Mail geschickt worden waren, und ist dann als letzter Passagier über das Rollfeld zur Maschine gerannt. Ein Buch wäre nicht schlecht; wenn er die nächsten paar Tage in dieser trockenen Hülse von einer Stadt aushalten soll, könnte ein Roman ein bisschen Ablenkung verschaffen. Er greift zum Türknauf und rechnet damit, dass auch diese Tür verschlossen ist. Aber die Oase ist offen. Zumindest die Tür ist es.
Drinnen ist es dunkel und verlassen, und mindestens zehn Grad kühler als draußen. Martin nimmt die Sonnenbrille ab; nach der gleißenden Helligkeit auf der Straße müssen seine Augen sich erst an das Dämmerlicht gewöhnen. Die Schaufenster sind mit Vorhängen verhüllt, und davor stehen japanische Wandschirme, eine zusätzliche Barrikade gegen den Tag. Ein Deckenventilator dreht sich sehr langsam; das Einzige, was sich hier sonst bewegt, ist das Wasser, das über die Schieferterrassen eines kleinen Tischbrunnens auf der Theke rieselt. Die Theke neben der Tür ist dem offenen Raum zugewandt, wo zwei Sofas und ein paar durchgesessene Sessel auf einem verschlissenen Teppich zwischen einigen mit Büchern bedeckten Tischchen stehen. Drei oder vier Reihen schulterhoher Bücherregale führen in den hinteren Teil des Ladens. An den Seitenwänden ragen höhere Regale auf. Ganz hinten im Raum sieht man eine hölzerne Schwingtür, wie man sie in Restaurants zwischen Gastraum und Küche findet. Wenn die Bücherregale Kirchenbänke wären und die Theke ein Altar, dann wäre dies eine Kapelle.
Martin geht zwischen den Tischen hindurch zur hinteren Wand. Ein kleines Schild identifiziert den Regalinhalt als LITERATUR. Ein spöttisches Lächeln will sich auf seinem Gesicht ausbreiten, aber es kommt nicht weit, weil sein Blick zum obersten Bord wandert. Dort, säuberlich aufgereiht, Buchrücken an Buchrücken, stehen die Bücher, die er vor zwanzig Jahren an der Uni gelesen hat. Nicht nur dieselben Titel, sondern auch die gleichen zerfledderten Paperback-Ausgaben, sortiert nach seinen eigenen Seminaren. Da stehen Moby Dick, Der letzte Mohikaner und Der scharlachrote Buchstabe links neben Der große Gatsby, Catch-22 und Herzog. Da ist The Fortunes of Richard Mahoney, Im Sturm der Gefühle und Coonardoo, dann geht es weiter mit Freier Fall, Der Prozess und Der stille Amerikaner. Vereinzelt sind auch Theaterstücke dabei: Der Hausmeister, Die Nashörner, The Chapel Perilous. Er zieht die Penguin-Ausgabe von Zimmer mit Aussicht heraus; der Buchrücken wird durch einen mit den Jahren vergilbten Klebstreifen zusammengehalten. Er klappt das Buch auf und rechnet halb damit, den Namen eines vergessenen Klassenkameraden zu sehen, aber der Name, der ihm entgegenschaut, ist Katherine Blonde. Er stellt das Buch zurück, vorsichtig, um es nicht zu beschädigen. Die Bücher toter Frauen, denkt er, und er holt sein Handy hervor und macht ein Foto.
Auf dem Bord darunter stehen neuere Bücher, manche sehen beinahe druckfrisch aus. James Joyce, Salman Rushdie, Tim Winton. Er kann kein System erkennen in der Anordnung, nimmt ein Buch heraus, dann noch eins, findet aber keine Namen darin. Er sucht sich zwei Titel raus, dreht sich um und will sich in einen der bequem aussehenden Sessel setzen, als er erschrickt und unwillkürlich zusammenzuckt. Am Ende des mittleren Gangs ist eine junge Frau aufgetaucht.
»Was Interessantes gefunden?« Sie lächelt, und ihre Stimme klingt rauchig. Gelassen lehnt sie sich an ein Regal.
»Das hoffe ich«, sagt Martin, aber er ist nicht annähernd so entspannt, wie er klingt. Er ist verstört, erst wegen ihres Auftauchens, und jetzt wegen ihrer Schönheit. Ihr blondes Haar hat einen zerzausten Bob-Schnitt, und die Ponyfransen berühren die schwarzen Brauen. Ihre Wangenknochen sind wie aus Marmor, und ihre Augen funkeln grün. Sie trägt ein leichtes Sommerkleid und ist barfuß. Sie passt nicht in das Narrativ von Rivers End, das er sich konstruiert hat.
»Wer ist Katherine Blonde?«, fragt er.
»Meine Mutter.«
»Sagen Sie ihr bitte, dass ihre Bücher mir gefallen.«
»Geht nicht. Sie ist tot.«
»Oh. Tut mir leid.«
»Muss es nicht. Wenn Sie Bücher mögen, würde sie Sie mögen. Das Geschäft hat ihr gehört.«
Einen Moment lang stehen sie da und schauen einander an. In ihrem Blick liegt kein Versuch von Rechtfertigung dafür, dass sie ihn mustert, und er sieht als Erster weg. »Setzen Sie sich«, sagt sie. »Entspannen Sie sich ein bisschen. Sie haben einen weiten Weg hinter sich.«
»Woher wissen Sie das?«
»Wir sind hier in Rivers End«, sagt sie und lächelt. Sie hat Grübchen, sieht Martin. Sie könnte ein Model sein. Oder ein Filmstar. »Na los, setzen Sie sich«, sagt sie. »Möchten Sie einen Kaffee? Wir sind ein Café und eine Buchhandlung. Damit verdienen wir unser Geld.«
»Gern. Groß und schwarz. Und ein Wasser, bitte.« Plötzlich sehnt er sich nach einer Zigarette, obwohl er seit seinem Studium nicht mehr geraucht hat. Eine Zigarette. Warum jetzt?
»Gut. Bin gleich wieder da.«
Sie geht lautlos den Gang hinunter. Martin schaut ihr nach und bewundert den Schwung ihres Halses. Seine Füße sind dort festgewachsen, wo sie waren, als er sie das erste Mal gesehen hat. Sie verschwindet durch die Schwingtür am Ende des Raumes, aber ihre Gegenwart klingt nach: das cello-artige Timbre ihrer Stimme, die geschmeidige Zuversicht ihrer Haltung, ihre grünen Augen.
Die Schwingtür kommt zur Ruhe, und Martin schaut auf die Bücher in seinen Händen. Er seufzt und verspottet sich insgeheim als traurige Gestalt. Sein Blick geht von den Büchern zu seinen vierzig Jahre alten Händen. Sein Vater hat Handwerkerhände gehabt. Als Kind sind sie Martin so stark, so sicher und so zielstrebig vorgekommen. Er hat immer gehofft, ja, angenommen, dass seine eigenen Hände eines Tages genauso aussehen würden. Aber sie sahen immer noch jugendlich aus, denkt er. Bürohände, keine Arbeiterhände. Wenig authentisch. Er setzt sich in einen knarrenden Sessel – mit verschlissenem Bezug und leicht zur Seite geneigt – und fängt an, abwesend in einem der Bücher zu blättern. Diesmal erschrickt er nicht, als sie in sein Gesichtsfeld tritt. Er blickt auf. Zeit ist vergangen.
»Hier«, sagt sie und runzelt kaum merklich die Stirn. Sie stellt einen großen weißen Becher auf den Tisch neben ihm. Als sie sich herunterbeugt, nimmt er Kaffeeduft wahr. Idiot, denkt er.
»Es stört Sie hoffentlich nicht«, sagt sie, »aber ich habe mir auch einen gemacht. Wir kriegen hier nicht so viel Besuch.«
»Natürlich«, hört er sich sagen. »Nehmen Sie doch Platz.«
Ein Teil seiner selbst möchte Smalltalk machen, sie zum Lachen bringen und bezaubern. Wahrscheinlich weiß er noch, wie das geht – sein eigenes gutes Aussehen kann ihn ja nicht restlos im Stich gelassen haben –, aber wieder schaut er auf seine Hände und lässt es bleiben. »Was machen Sie hier?«, fragt er und ist selbst überrascht von der Direktheit seiner Frage.
»Was meinen Sie damit?«
»Was machen Sie in Rivers End?«
»Ich wohne hier.«
»Das weiß ich. Aber warum?«
Ihr Lächeln verblasst, und ihr Blick wird ernster. »Gibt es einen Grund, weshalb ich nicht hier wohnen sollte?«
»Ja, das hier.« Martin umfasst den ganzen Laden mit einer weiten Gebärde. »Bücher, Kultur, Literatur. Ihre Uni-Bücher da drüben auf dem Regal unter denen Ihrer Mutter. Und Sie. Diese Stadt liegt im Sterben. Sie gehören nicht hierher.«
Sie lächelt nicht und runzelt nicht die Stirn. Sie schaut ihn nur an, mustert ihn, zieht das Schweigen in die Länge, bevor sie antwortet. »Sie sind Martin Scarsden, nicht wahr?« Sie schaut ihm fest in die Augen.
Er hält dem Blick stand. »Ja. Der bin ich.«
»Ich erinnere mich an die Berichte«, sagt sie. »Ich bin froh, dass Sie da lebend herausgekommen sind. Es muss schrecklich gewesen sein.«
»Ja, das war es«, sagt er.
Augenblicke vergehen. Martin nimmt einen Schluck Kaffee. Er ist nicht schlecht; in Sydney hat er schon schlimmeren getrunken. Wieder überkommt ihn das seltsame Verlangen nach einer Zigarette. Das Schweigen ist erst unbehaglich und dann nicht mehr. Wieder verstreicht Zeit. Er ist froh, dass er hier ist, in der Buchhandlung Oasis, und mit dieser schönen jungen Frau zusammen schweigen kann.
Sie spricht als Erste. »Ich bin vor achtzehn Monaten zurückgekommen, als meine Mutter im Sterben lag. Ich wollte mich um sie kümmern. Und jetzt … na ja, wenn ich weggehe, wird der Buchladen, ihr Buchladen, geschlossen. Dazu wird es schon früh genug kommen, aber noch bin ich nicht so weit.«
»Entschuldigen Sie. Ich wollte nicht so direkt sein.«
Sie nimmt ihren Kaffeebecher, umschließt ihn mit beiden Händen. Es ist eine behagliche Geste voller Vertrauen und Anteilnahme – seltsam angemessen trotz der Hitze des Tages. »Und Sie, Martin Scarsden – was machen Sie in Rivers End?«
»Ich schreibe eine Story. Mein Redakteur hat mich hergeschickt. Er meinte, es würde mir guttun, mal rauszukommen und ein bisschen gute Landluft zu atmen. ›Die Spinnweben wegpusten‹, hat er gesagt.«
»Und worüber? Über die Dürre?«
»Nein. Nicht ganz.«
»Du lieber Gott. Die Schießerei? Noch mal? Das ist fast ein Jahr her.«
»Ja. Das ist der Aufhänger. ›Ein Jahr später – wie kommt Rivers End zurecht?‹ Eine Art Porträt, aber von einer Stadt, nicht von einer Person. Wir bringen es am Jahrestag.«
»Ist die Idee von Ihnen?«
»Von meinem Redakteur.«
»Was für ein Genie. Und er hat Sie geschickt? Damit Sie über eine Stadt im Trauma schreiben?«
»Anscheinend.«
»Himmel.«
Wieder sitzen sie schweigend da. Die junge Frau stützt das Kinn auf eine Hand und starrt ein Buch auf einem der Tische an, ohne es zu sehen, während Martin sie forschend ansieht. Er interessiert sich jetzt nicht für ihre Schönheit, sondern denkt nach über ihre Entscheidung, in Rivers End zu bleiben. Er sieht die zarten Fältchen um ihre Augen und vermutet, dass sie älter ist, als er zunächst dachte. Mitte zwanzig vielleicht. Jung, zumindest verglichen mit ihm. Eine Zeitlang sitzen sie so da, ein Tableau einer Buchhandlung. Dann hebt sie den Kopf und schaut ihm in die Augen. Einen Moment später ist die Verbindung hergestellt, und als sie spricht, ist ihre Stimme beinahe ein Flüstern.
»Martin, es gibt eine bessere Story, wissen Sie. Besser, als durch den Schmerz einer trauernden Stadt zu waten.«
»Und die wäre?«
»Warum er es getan hat.«
»Das wissen wir doch, oder nicht?«
»Wegen Kindesmissbrauch? Einem toten Pfarrer so etwas vorzuwerfen ist leicht. Ich glaube es nicht. Nicht jeder Pfarrer ist pädophil.«
Martin hält ihrem durchdringenden Blick nicht mehr stand. Er schaut seinen Kaffee an und weiß nicht, was er sagen soll.
Die junge Frau lässt nicht locker. »D’Arcy Defoe. Ist er ein Freund von Ihnen?«
»So weit würde ich nicht gehen, aber er ist ein ausgezeichneter Journalist. Die Story hat den Walkley-Preis gewonnen. Verdientermaßen.«
»Sie hat nicht gestimmt.«
Martin zögert; er weiß nicht, worauf sie hinauswill. »Wie heißen Sie?«
»Mandalay Blonde. Alle nennen mich Mandy.«
»Mandalay? Nicht schlecht.«
»Meine Mum. Sie liebte den Klang. Stellte sich gern vor, ungebunden um die Welt zu reisen.«
»Und, hat sie es getan?«
»Nein. Sie hat Australien nie verlassen.«
»Okay, Mandy. Byron Swift hat fünf Menschen erschossen. Sagen Sie es mir: Warum hat er das getan?«
»Das weiß ich nicht. Aber wenn Sie es herausfinden könnten, wäre das eine Wahnsinnsstory, nicht wahr?«
»Vermutlich. Aber wenn Sie nicht wissen, warum er es getan hat, wer wird es mir dann erzählen?«
Darauf gibt sie keine Antwort, jedenfalls nicht gleich. Martin ist verwirrt. Er hat gehofft, in der Buchhandlung Zuflucht zu finden, aber jetzt hat er das Gefühl, alles verdorben zu haben. Er weiß nicht genau, was er sagen soll – soll er sich entschuldigen oder locker darüber hinweggehen. Oder soll er sich für den Kaffee bedanken und gehen?
Aber Mandalay Blonde ist nicht gekränkt. Sie beugt sich zu ihm herüber und sagt mit leiser Stimme: »Martin, ich will Ihnen etwas erzählen. Aber Sie dürfen es nicht veröffentlichen und niemandem weitererzählen. Das bleibt zwischen Ihnen und mir. Ist Ihnen das recht?«
»Warum so geheimnisvoll?«
»Ich muss in dieser Stadt leben, darum. Schreiben Sie über Byron, was Sie wollen – den kümmert es nicht mehr –, aber bitte halten Sie mich aus der Sache raus. Okay?«
»Natürlich. Was ist es?«
Sie lehnt sich zurück und denkt nach. Martin wird bewusst, wie still es im Buchladen ist; der Raum ist vor äußeren Geräuschen genauso abgeschirmt wie vor Licht und Hitze. Martin hört nur das sanfte Fächeln des Ventilators und das leise Summen seines Motors, das Plätschern des Wasserspiels auf der Theke und Mandalay Blondes langsames Atmen. Mandy schluckt und nimmt ihren ganzen Mut zusammen.
»Er hatte etwas Erhabenes an sich. Wie ein Heiliger oder so.«
»Er hat fünf Menschen umgebracht.«
»Ich weiß. Ich war dabei. Ein paar der Opfer kannte ich, und ich kenne ihre Witwen. Fran Landers ist meine Freundin. Also sagen Sie mir: Warum hasse ich ihn nicht? Warum habe ich das Gefühl, das, was passiert ist, war irgendwie unausweichlich? Warum ist das so?« Ihr Blick ist flehentlich, und ihre Stimme klingt eindringlich. »Warum?«
»Okay, Mandy, erzählen Sie. Ich höre zu.«
»Sie dürfen nichts davon schreiben. Versprochen?«
»Versprochen. Was ist es?«
»Er hat mir das Leben gerettet. Ich verdanke ihm mein Leben. Er war ein guter Mann.« Der Schmerz weht über ihr Gesicht wie der Wind über einen Teich.
»Weiter.«
»Mum lag im Sterben. Ich wurde schwanger. Nicht zum ersten Mal. Ein One-Night-Stand mit irgendeinem Arschloch unten in Melbourne. Ich dachte an Selbstmord, denn ich sah keine Zukunft mehr, zumindest keine, die zu erleben sich lohnte. Diese beschissene Stadt, dieses beschissene Leben. Und das hat er gesehen. Er kam in den Buchladen, fing an zu flachsen und zu flirten wie immer, und plötzlich hörte er auf. Einfach so. Er sah mir in die Augen und wusste Bescheid. Und es kümmerte ihn. Er sprach mit mir, eine Woche lang, einen Monat lang, und er redete es mir aus. Zeigte mir, wie man aufhört zu rennen, zeigte mir den Wert von allem. Er war fürsorglich, er hatte Mitgefühl, er verstand den Schmerz anderer. Leute wie er missbrauchen keine Kinder. Wie könnten sie das?« Leidenschaft liegt in ihrer Stimme, Überzeugung in ihren Worten.
»Glauben Sie an Gott?«, fragt sie.
»Nein«, sagt Martin.
»Ich auch nicht. An das Schicksal?«
»Nein.«
»Da bin ich nicht so sicher. Und Karma?«
»Mandy, worauf wollen Sie hinaus?«
»Er kam immer in den Laden, kaufte Bücher und trank Kaffee. Anfangs wusste ich nicht, dass er Pfarrer war. Er war aufmerksam, charmant und anders. Ich mochte ihn. Und Mum mochte ihn auch. Er konnte über Bücher sprechen, über Geschichte und Philosophie. Wir haben uns immer gefreut, wenn er vorbeikam. Ich war enttäuscht, als ich erfuhr, dass er Pfarrer war; irgendwie hatte ich ein Auge auf ihn geworfen.«
»Er auf Sie auch?« Es fällt ihm schwer, sich einen Mann vorzustellen, der kein Auge auf sie werfen würde.
Sie lächelt. »Selbstverständlich nicht. Ich war schwanger.«
»Aber Sie mochten ihn.«
»Alle mochten ihn. Er war witzig, charismatisch. Mum lag im Sterben, die Stadt lag im Sterben, und da war er: jung, vital und unbeugsam, erfüllt vom Glauben an sich selbst und voller Verheißung. Und bald war er mehr als das; er war mein Freund, mein Beichtvater, mein Retter. Er hörte mir zu, er verstand mich, verstand, was ich durchmachte. Ohne über mich zu urteilen, ohne mich zu ermahnen. Er kam immer, wenn er in der Stadt war, und wollte wissen, wie es uns ging. In Mums letzten Tagen, im Krankenhaus unten in Bellington, hat er sie getröstet, und er hat auch mich getröstet. Er war ein guter Mann. Und dann war er auch weg.«
Es wird still, und diesmal ist es Martin, der als Erster spricht. »Haben Sie Ihr Baby bekommen?«
»Ja. Liam. Er schläft. Ich mache Sie miteinander bekannt, falls Sie noch da sind, wenn er aufwacht.«
»Das würde mich freuen.«
»Danke.«
Martin wählt seine Worte sorgfältig; zumindest bemüht er sich, aber er weiß, dass man die richtigen Worte niemals findet. »Mandy, ich verstehe, dass Byron Swift gut zu Ihnen war. Ich kann ohne weiteres akzeptieren, dass er nicht durch und durch schlecht, sondern ein aufrichtiger Mann war. Aber das gibt ihm keine Absolution, nicht für das, was er getan hat. Und es bedeutet nicht, dass die Vorwürfe nicht stimmen, tut mir leid.«
Was er da sagt, überzeugt sie nicht, sondern verstärkt ihre Entschlossenheit. »Martin, ich sage Ihnen, er hat in meine Seele geschaut und ich in seine. Er war ein guter Mann. Er wusste, dass ich leide, und er hat mir geholfen.«
»Aber wie vereinbaren Sie das damit, dass er hat einen mehrfachen Mord begangen hat?«
»Ich weiß. Ich weiß. Ich kann es nicht damit vereinbaren. Ich weiß, was er getan hat, und ich leugne es nicht. Es macht mich fertig, die ganze Zeit. Der einzige wirklich anständige Mensch neben meiner Mutter, den ich je kennengelernt habe, erweist sich als Horrorshow. Aber jetzt kommt’s: Ich kann glauben, dass er diese Leute erschossen hat. Ich weiß, er hat es getan. Es klingt auch wahr, ja, es fühlt sich auf eine perverse Weise richtig an, auch wenn ich nicht weiß, warum er es getan hat. Aber ich kann nicht glauben, dass er Kinder missbraucht hat. Als Kind bin ich schikaniert und herumgeschubst worden, als Teenager hat man mich verleumdet und begrabscht und als Erwachsene geschnitten, kritisiert und gemobbt. Ich hatte eine Menge gewalttätige Freunde – ja, ich hatte praktisch keine anderen, nur diese narzisstischen Arschlöcher, die immer an sich selbst denken. Liams Vater ist einer davon. Ich kenne die Mentalität. Ich habe sie aus der Nähe gesehen, in ihrer ganzen Abscheulichkeit. Aber er war nicht so. Er war das genaue Gegenteil. Er war fürsorglich. Und das macht mich fertig. Ich glaube nicht, dass er Kinder missbraucht hat.«
Martin weiß nicht, was er sagen soll. Er sieht die Leidenschaft in ihrem Gesicht, hört die Inbrunst in ihrer Stimme. Ein fürsorglicher Massenmörder? Er sagt nichts, schaut in Mandalay Blondes verstörte grüne Augen.
ZweiBlack Dog Motel
Als Martin wieder auf der Straße steht, ist es, als sei er aus einem Traum erwacht. Er hat kein Buch gekauft und hat nicht nach dem Weg zum Hotel gefragt. Er nimmt sein Handy und will Google Maps aufrufen, hat aber kein Mobilfunksignal. Du lieber Gott, keine Verbindung. Daran hat er nicht gedacht. Diese Stadt kommt ihm vor wie ein fremdes Land.
Der frühe Aufbruch, die lange Autofahrt und die Hitze haben ihn ausgelaugt, und er fühlt sich wie umnebelt. Der Tag ist inzwischen noch heißer geworden, das Licht vor den Markisen wirkt noch heller. Nichts regt sich außer dem Hitzeflimmern, das von der Straße aufsteigt. Die Temperatur hat bestimmt vierzig Grad erreicht, und es ist völlig windstill. Martin tritt hinaus in die Sonne. Er legt die Hand auf das Wagendach. Es ist heiß wie eine Bratpfanne. Etwas bewegt sich am Rand seines Gesichtsfelds, aber als er sich umdreht, sieht er nichts. Oder – doch, da, mitten auf der Straße: eine Eidechse. Er geht darauf zu. Es ist eine Stummelschwanz-Eidechse, und sie ist totenstill. Asphalt quillt aus den Rissen in der Straße, und Martin fragt sich, ob das Tier vielleicht kleben geblieben ist. Aber dann wieselt es davon; die Hitze hat sein Blut verflüssigt, und es verschwindet unter einem geparkten Auto. Dann hört er ein neues Geräusch. Einen rasselnden Husten. Martin dreht sich um und sieht einen Mann unter den Markisen auf der anderen Straßenseite entlangschlurfen. Es ist der Mann im grauen Mantel. Immer noch trägt er die Flasche in der braunen Papiertüte mit sich herum. Martin geht hinüber und begrüßt ihn.
»Guten Morgen.«
Der Mann hat einen krummen Rücken, und er ist offenbar taub. Er schlurft wortlos weiter.
»Guten Morgen«, wiederholt Martin lauter.
Der Mann bleibt stehen, hebt den Kopf und schaut sich um, als höre er ein fernes Donnern. Dann sieht er Martin an. »Was ist?«
Der Mann hat einen struppigen, graugesträhnten Bart und feuchte Augen.
»Guten Morgen«, sagt Martin zum dritten Mal.
»Weder gut noch Morgen. Was wollen Sie?«
»Können Sie mir sagen, wo hier ein Hotel ist?«
»Gibt kein Hotel.«
»Doch, gibt es.« Martin weiß es; er hat im Flugzeug die Zeitungsausschnitte auf seinem Laptop gelesen, auch Defoes preisgekrönten Artikel, in dem der Pub als das Herz der Stadt beschrieben wird. »Das ›Commercial‹.«
»Geschlossen. Seit sechs Monaten. Gott sei Dank. Da ist es, da drüben.« Er wedelt mit dem Arm. Martin späht in die Richtung, aus der er gekommen ist. Wie hat er es übersehen können? Der alte Pub, das einzige zweigeschossige Gebäude auf der Hauptstraße, steht an der Kreuzung, hat intakte Schilder und ist von einer einladenden Veranda umgeben. Er wirkt nicht aufgegeben. Eher würde man einen Ruhetag vermuten.
Der Mann rollt den oberen Rand seiner Tüte herunter, schraubt die Flasche auf und trinkt. »Hier. Auch was?«
»Nein danke. Im Moment nicht. Sagen Sie, gibt es sonst eine Übernachtungsmöglichkeit in der Stadt?«
»Versuchen Sie’s im Motel. Aber beeilen Sie sich. So beschissen, wie hier alles läuft, macht das vielleicht als Nächstes zu.«
»Wo finde ich es?«
»Woher sind Sie gekommen? Aus Bellington? Deni?«
»Nein, aus Hay.«
»Eine beschissene Fahrt. Na, fahren Sie da runter, wo Sie hergekommen sind. Biegen Sie am Stoppschild nach rechts. Richtung Bellington, nicht nach Deniliquin. Das Motel liegt auf der rechten Seite, am Stadtrand. Ungefähr zweihundert Meter von hier.«
»Cool.«
»Cool? Was sind Sie, ein Scheiß-Yankee? Die reden so.«
»Nein. Ich meinte nur, danke.«
»Okay. Dann verpissen Sie sich.«
Der Penner schlurft weiter. Martin nimmt sein Handy und fotografiert den Mann von hinten, als er davongeht.
Das Einsteigen ins Auto ist keine leichte Aufgabe. Martin befeuchtet seine Finger mit der Zunge, damit er den Türgriff lange genug festhalten kann, um die Tür zu öffnen, und er schiebt ein Bein hinein, damit die Tür nicht wieder zufällt. Im Wageninneren ist es heiß wie in einem Tandoori-Ofen. Er startet den Motor und dreht die Klimaanlage hoch, aber die pumpt lediglich heiße Luft herum. Die Backofenhitze lässt den hässlichen Geruch nach Resten von Erbrochenem eines früheren Mieters aus den Polstern aufsteigen. Die Gurtschnalle hat in der Sonne gelegen und ist so heiß, dass er sie nicht anfassen kann. Martin schnallt sich nicht an. Er schlingt das ehemals feuchte Halstuch um das Lenkrad, damit er es anfassen kann. »Verflucht«, murmelt er.
Er fährt die paar hundert Meter bis zum Motel, stellt das Auto in den Schatten eines Carports neben dem Eingang und steigt aus. Er gluckst leise; seine Stimmung hat sich gebessert. Er zieht sein Handy aus der Tasche und macht Fotos. BLACKDOGMOTEL steht auf der abblätternden Tafel in der Einfahrt. ZIMMERFREI. Und das Beste ist: KEINEHAUSTIERE. Martin lacht. Das ist Gold wert. Wie konnte Defoe das übersehen? Aber vielleicht hat der schlaue Kerl den Pub ja nie verlassen.
An der Rezeption ist es kaum weniger heiß. Martin hört einen Fernseher irgendwo hinten im Gebäude. Auf der Theke ist ein Summer – eine für diesen Zweck angepasste Türglocke. Martin drückt auf den Knopf und hört ein Zirpen aus der Richtung, aus der auch der Fernsehton kommt. Während er wartet, studiert er die Broschüren im Drahtständer an der Wand. Pizza, Kreuzfahrten auf dem Murray River, ein Weingut, eine Zitrusfarm, Paragliding, Gocarts, noch ein Motel, ein Bed-and-Breakfast. Ein Schwimmbad mit Wasserrutschen. Alles nur vierzig Minuten weit entfernt in Bellington, am Murray flussabwärts. Auf der Theke liegt eine Handvoll rot gedruckter Takeaway-Speisekarten. Saigon Asia – Vietnamesisch, Thai, Chinesisch, Indisch, Australisch. Services Club, Rivers End. Martin nimmt einen Flyer und steckt ihn ein. Zumindest wird er nicht verhungern.
Eine schlampig aussehende Frau erscheint in der halb verspiegelten Schwingtür hinter der Theke und bringt einen flüchtigen Hauch von kühler Luft und Putzmittel mit. Ihr schulterlanges Haar ist zweifarbig: hauptsächlich blond, aber ungefähr einen Fingerbreit über der Kopfhaut ist es zu einem Fußmattenton aus Braun und Grau herausgewachsen. »Hi, Schätzchen. Zimmer?«
»Ja, bitte.«
»Kurz pennen oder übernachten?«
»Nein, voraussichtlich drei oder vier Nächte.«
Jetzt schaut sie Martin eingehender an. »Kein Problem. Ich schau mir mal unsere Buchungen an.«
Die Frau setzt sich hin und erweckt einen betagten Computer zum Leben. Martin schaut hinaus. Im Carport steht kein Auto außer seinem.
»Sie haben Glück. Vier Nächte, haben sie gesagt?«
»Ja.«
»Kein Problem. Zahlbar im Voraus, wenn’s recht ist. Danach Tag für Tag, wenn Sie länger bleiben.«
Martin reicht seine Fairfax-Company-Karte hinüber. Die Frau betrachtet sie, sieht dann Martin an, versucht, ihn einzuordnen.
»Sie sind von The Age?«
»Vom Sydney Morning Herald.«
»Kein Problem«, brummt sie und zieht die Karte durch das Lesegerät. »Okay, Schätzchen, Sie sind in Nummer sechs. Hier ist der Schlüssel. Warten Sie eine Sekunde, ich hole Ihnen ein bisschen Milch. Schalten Sie Ihren Kühlschrank ein, wenn Sie reinkommen, und vergessen Sie nicht, Licht und Klimaanlage auszuschalten, wenn Sie das Zimmer verlassen. Die Stromrechnung bringt uns um.«
»Danke«, sagt Martin. »Haben Sie WLAN?«
»Nein.«
»Und keinen Mobilfunkempfang?«
»Hatten wir bis zur Wahl. Jetzt ist der Sendemast ausgefallen. Ich nehme an, vor der nächsten Wahl bringen die das wieder in Ordnung.« Ihr Lächeln ist sarkastisch. »In Ihrem Zimmer ist ein Festnetztelefon. Als ich letztes Mal nachgesehen habe, hat es noch funktioniert. Kann ich sonst noch was für Sie tun?«
»Der Name Ihres Motels. Der ist ein bisschen merkwürdig, oder?«
»Nein. Vor vierzig Jahren war er das nicht. Warum sollen wir ihn jetzt ändern, bloß weil er ein paar Losern nicht gefällt?«
Martins Zimmer ist seelenlos. Nach der Lektüre von Defoes Artikel hatte er sich darauf gefreut, im Pub zu wohnen: Bier mit den Einheimischen, eine Flut von Informationen, die offenherziges Tresenpersonal ihm zukommen ließ, Essen an der Theke, Steak aus der Gegend und zerkochtes Gemüse, eine kurze Treppe nach oben und ab ins Bett. Vielleicht um Mitternacht noch einmal durch den Korridor zum Pissen zur Gemeinschaftstoilette wanken, okay, aber eben ein altes Gebäude mit Charakter und voller Geschichten, nicht die nichtssagende Zweckmäßigkeit dieser Hundehütte: eine nackte Leuchtstoffröhre als Beleuchtung, ein durchgelegenes Bett mit einer braunen Tagesdecke, der chemische Gestank eines Luftauffrischers, ein grunzender Minibarkühlschrank und eine ratternde Klimaanlage. Auf dem Nachttisch stehen ein Telefon und eine Uhr, und beide sind Jahrzehnte alt. Besser, als im Auto zu schlafen, aber nicht viel besser. Er ruft in der Redaktion an, gibt ihnen die Nummer des Motels durch und macht sie darauf aufmerksam, dass sein Mobiltelefon außer Betrieb ist.
Martin zieht sich aus, geht auf die Toilette, spült die toten Fliegen herunter, die sich in der Kloschüssel angesammelt haben, pinkelt und spült noch einmal. Er dreht den Wasserhahn am Waschbecken auf und lässt eins der Gläser volllaufen. Das Wasser riecht nach Chlor und schmeckt nach Fluss. Er dreht die Dusche auf, ohne sich mit dem Heißwasserhahn zu befassen, runzelt die Stirn angesichts des kraftlosen Wasserdrucks, stellt sich unter die Dusche und lässt das Wasser über sich rieseln. Er bleibt stehen, bis es nicht mehr kühl ist. Dann hebt er die Hände und betrachtet sie. Sie sind weiß und aufgedunsen, runzlig vom Wasser wie die Hände eines Ertrunkenen. Seit wann sehen seine Hände so fremdartig aus?
Als er sich abgekühlt hat, trocknet er sich ab und geht ins Bett. Bis auf das Laken wirft er alle Decken beiseite. Er braucht Ruhe. Es war ein langer Tag: der frühe Aufbruch, der Flug, die Autofahrt, die Hitze. Er schläft. Wacht auf in einem Zimmer, in dem es dunkler wird.
Er steht auf, trinkt noch einmal vom dem abscheulichen Wasser, schaut auf die Uhr: zwanzig nach sieben.
Draußen hinter dem Motel steht die Sonne noch hartnäckig am Januar-Himmel, groß und orangegelb. Martin lässt den Wagen stehen und geht zu Fuß. Das Black Dog Motel, erkennt er, liegt wirklich am Stadtrand. Zwischen ihm und dem leeren Weideland gibt es nur noch eine verlassene Tankstelle. Auf der anderen Straßenseite verläuft ein Bahngleis neben turmhohen Getreidesilos, die in der untergehenden Sonne golden leuchten. Martin macht ein Foto. Dann geht er an der Tankstelle vorbei zur Stadtgrenze, die durch die obligaten Schilder markiert ist: RIVERSEND steht auf einem, 800 EINWOHNER auf einem anderen und auf einem dritten: WASSEREINSCHRÄNKUNGENSTUFE 5 INKRAFT. Martin steigt auf einen kleinen Grat, der senkrecht zur Straße verläuft, nicht mehr als einen Meter hoch; er rahmt die Schilder und die verlassene Tankstelle und die Getreidesilos auf der Rechten ein, und in der untergehenden Sonne wirft er seinen Schatten über die Straße. Martin fragt sich, wann die Einwohnerzahl wohl bei achthundert gelegen haben mag und wie viele es heute sind.
Er wandert zurück in die Stadt und spürt die Kraft der Sonne noch so spät am Tag im Rücken. Er sieht verlassene Häuser und bewohnte Häuser, Häuser mit verdorrten Gärten und Häuser, deren Gärten grün sind vom Brunnenwasser. Hinter dem Wellblechschuppen der Freiwilligen Feuerwehr, an der Einmündung der Hay Road, bleibt er stehen. Die aneinandergereihten Markisen bieten den Geschäften Schutz vor der Sonne. Wieder macht er ein Foto.
Dann geht er weiter den Highway entlang, vorbei an einem verlassenen Supermarkt. Ausgeblichene Transparente mit der Aufschrift RÄUMUNGSVERKAUF hängen immer noch an den Eingängen. Danach kommt eine Shell-Tankstelle, deren Besitzer ihm freundlich zuwinkt, während er für heute schließt. Daneben ein Park, grünes Gras mit weiteren Schrifttafeln – HIERNURBRUNNENWASSER –, ein Musikpavillon und eine Fernfahrertoilette, alles im Schatten eines Uferdeichs. Eine zweite Brücke, zweispurig asphaltiert, führt über den Fluss. Im Geiste zeichnet Martin einen Plan von Rivers End: eine T-Kreuzung, behaglich in eine Biegung des Flusses geschmiegt, und ein Hochwasserdeich, der die Stadt an der Nord- und Ostseite umgibt. Der Plan gefällt ihm; er wirkt wohlüberlegt und in sich geschlossen. Rivers End, treibend auf der endlosen Binnenlandebene, hat sich hier auf irgendwie sinnvolle Weise verankert.
Er klettert neben der Brücke auf den Deich hinauf und findet einen Fußweg, der auf dem Grat entlang führt. Er späht zurück über den Highway und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Der Horizont verliert sich in einem Dunst aus Staub und Hitze, aber es ist, als stünde er auf einer Landspitze und schaue hinaus auf das Meer. Ein Fernlaster donnert über die Brücke und an ihm vorbei in Richtung Westen. Der Staub färbt die untergehende Sonne in einem wütenden Orange, und er sieht dem Lastwagen nach, verschwommen im Dunst und schließlich ganz verschwunden.
Martin geht auf dem Grat des Flutdeichs entlang. Das Flussbett neben ihm, das zwischen den Gummibäumen hindurchschimmert, besteht aus rissigem, hartgebackenem Schlamm. Die Bäume sehen ganz gesund aus, denkt er, doch dann stößt er auf einen abgestorbenen Stamm, solide wie seine Nachbarn, aber ohne Laub. Ein Schwarm Kakadus flattert vorbei; ihr raues Gekrächze reißt andere Vögel und Tiere der Dämmerung aus ihrem Schweigen. Martin folgt dem Pfad bis zu einer Kurve des Flussbetts. Oberhalb davon, auf einer natürlichen Anhöhe, steht ein Gelbziegelgebäude, der Rivers End Services and Bowling Club. Licht fällt durch die großen Fenster auf eine Formstahlveranda. Das Ganze erweckt den Eindruck eines bei Ebbe gestrandeten Kreuzfahrtschiffes.
Im Club ist die Luft kühl. Auf einer Theke liegen Antragsformulare für eine befristete Mitgliedschaft, und ein Schild weist Besucher an, sich einzutragen. Martin gehorcht und reißt ein Gästeformular ab. Der Hauptraum ist groß und hat breite Fenster mit Blick auf die Flussbiegung. In der Dämmerung vor dem hell erleuchteten Raum sind die Bäume kaum noch sichtbar. Überall stehen Tische und Stühle, aber niemand ist da. Keine Menschenseele. Das Einzige, was sich regt, sind die grell blitzenden Lichter der Pokerautomaten hinter den niedrigen Trennwänden am anderen Ende. Hinter der langen Bar sitzt ein Bartender und liest ein Buch.
»Tag auch. Ein Bier?«
»Danke. Was haben Sie gezapft anzubieten?«
»Die beiden hier.«
Martin bestellt ein großes Glas Carlton Draught und fragt den Barmann, ob er ihn einladen darf.
»Nein, danke.« Der Mann fängt an, Martins Bier zu zapfen. »Sie sind der von der Zeitung?«
»Ja«, sagt Martin. »Das hat sich aber schnell herumgesprochen.«
»Ist ein Dorf hier. Was soll man sagen?« Der Barmann ist Anfang sechzig, und sein Gesicht ist rot von lebenslangen Sonnenschäden und Bier. Das weiße Haar ist glattgekämmt und mit Haaröl an den Schädel geklebt. Seine großen Hände sind voller Leberflecken. Martin betrachtet sie bewundernd. »Wollen Sie über die Schießerei schreiben?«
»Ja.«
»Wenn Sie noch was Neues finden wollen, viel Glück. Ich habe den Eindruck, das alles ist schon dreimal geschrieben worden.«
»Da könnten Sie recht haben.« Der Mann nimmt Martins Geld und legt es in seine Kasse.
»Sie haben hier nicht zufällig WLAN?«, fragt Martin.
»Doch, natürlich. Theoretisch jedenfalls.«
»Was heißt das?«
»Die halbe Zeit funktioniert es nicht. Und wenn doch, ist es wie mit der Dürrenothilfe: Es rieselt und tröpfelt. Aber probieren Sie es aus; hier ist sonst niemand, also ist es vielleicht nicht verstopft.«
Martin lächelt. »Wie heißt das Passwort?«
»Billabong. Aus der Zeit, als wir noch einen hatten. Ist längst ausgetrocknet.«
Martin schafft es, sich mit seinem Handy einzuloggen, aber seine E-Mails werden nicht geladen; er sieht nur das kreisende Rädchen computerlicher Unentschlossenheit, gibt schließlich auf und steckt das Handy ein. »Ich verstehe, was Sie meinen.«
Er weiß, er sollte sich nach den Toten erkundigen und fragen, wie die Stadt reagiert hat, aber aus irgendeinem Grund zögert er. Also fragt er, wo die Gäste sind.
»Kumpel, wir haben Montagabend. Wer hat an einem Montagabend Geld zum Trinken?«
»Warum haben Sie dann geöffnet?«
»Wenn wir nicht geöffnet haben, haben wir geschlossen. Und hier ist schon viel zu viel geschlossen.«
»Aber man kann sich immer noch leisten, Sie zu bezahlen?«
»Nein, kann man nicht. Wir arbeiten ehrenamtlich. Vorstandsmitglieder. Wir haben einen Dienstplan.«
»Beeindruckend. Das gäb’s in der Großstadt nicht.«
»Deshalb haben wir ja noch geöffnet, und der Pub ist zu. Kein Mensch arbeitet ehrenamtlich im Pub.«
»Trotzdem schade, dass es ihn nicht mehr gibt.«
»Da haben Sie recht. Der Kerl, der ihn hatte, war ganz anständig – für einen von außerhalb. Hat die örtliche Fußballmannschaft gesponsert und regionale Erzeugnisse für sein Bistro gekauft. Aber das hat ihn nicht vor der Pleite bewahrt. Apropos Bistro – wollen Sie was essen?«
»Ja. Was haben Sie da?«
»Hier gibt’s nichts. Aber hinten ist Tommy’s Takeaway, Saigon Asia. So gut wie in Melbourne oder Sydney ist es allemal. Aber beeilen Sie sich, die Küche schließt um acht.«
Martin sieht auf die Uhr: fünf vor acht.
»Danke.« Martin trinkt einen großen Schluck Bier.
»Ich würde Sie ja hier sitzen und essen lassen, aber ich muss selber Feierabend machen. Die einzigen Gäste, die wir an einem Abend wie heute haben, sind die, die noch rasch einen heben, während sie auf ihr Essen vom Takeaway warten. Aber wir haben jeden Abend außer sonntags geöffnet. Und jeden Tag außer Montag auch mittags. Wollen Sie sich was zu trinken mitnehmen?«
Martin stellt sich vor, wie er allein in seinem Zimmer im Black Dog Motel sitzt und trinkt. »Nein danke«, sagt er und trinkt sein Glas aus. Er dankt dem ehrenamtlichen Barmann und streckt die Hand aus. »Martin«, sagt er.
»Errol. Errol Ryding.« Der Mann ergreift Martins Hand mit seiner eigenen beeindruckenden Pfote.
Errol, denkt Martin. Jetzt weiß ich, wohin all die Errols verschwunden sind.
Im Dunkeln versucht Martin, sich auszustrecken, und stellt fest, er kann es nicht. Seine Beine haben nicht genug Platz. Grauen senkt sich herab wie ein Vorhang, und Klaustrophobie nimmt ihm den Atem. Vorsichtig tastend streckt er die Hand aus, voller Angst vor dem, was seine Finger vielleicht finden werden, obwohl er den Widerstand kennt, auf den sie stoßen müssen. Stahl. Unbeweglich, unnachsichtig, unerbittlich. Die Angst schnürt ihm die Luft ab. Er hält den Atem an, niemand soll ihn hören. Das Geräusch – was hört er da? Schritte? Kommt man, um ihn zu befreien oder zu töten? Noch mehr Geräusche. Ferner Artilleriedonner, das sanfte Beben der Einschläge. Martin will sich nicht mehr ausstrecken. Er krümmt sich zusammen, macht sich rund wie ein Fötus, und steckt die Finger in die Ohren, voller Angst vor der dröhnenden Eselsstimme eines AK-47. Aber da ist immer noch dieses Geräusch, ein Rumpeln und Rasseln. Er nimmt die Finger aus den Ohren und lauscht mit banger Hoffnung. Ein Panzer? Ist das ein Panzer? Er strengt sich an, kann das Dröhnen des Motors hören, das Klirren der Ketten. Der Panzer klingt ganz nah. Marschieren die Israelis ein? Um ihn zu retten? Aber wissen sie, dass er hier ist? Oder werden sie einfach mit dem Panzer über ihn hinweg rollen und ihn in seinem Gefängnis zermalmen, ohne von seiner Existenz zu ahnen? Soll er schreien? Oder lieber nicht? Nein. Die Soldaten würden ihn niemals hören. Aber andere vielleicht. Und jetzt – dieses Tosen. Es kommt näher. Ein donnerndes Tosen. Eine F16? Eine Rakete, eine Bombe, und niemand wird jemals wissen, dass er hier war und was aus ihm geworden ist. Das Tosen kommt näher und näher. Wieso?
Das Rasseln wird lauter, und dann ist er wach, schnappt nach Luft und zerrt an seinem Laken. Die Lichter des vorbeifahrenden Lasters dringen durch die dünnen Vorhänge des Black Dog Motels, als er tosend in Richtung Osten weiterrast. »Fuck«, ruft Martin. Das Donnern des Lasters verhallt, und zurück bleibt das leise Rasseln der Klimaanlage. »Fuck«, sagt Martin noch einmal, windet sich aus dem Laken und schaltet die Leuchtstofflampe ein. Die Uhr auf dem Nachttisch zeigt 3.45. Er richtet sich auf und stürzt ein Glas bitteres Wasser herunter, aber immer noch ist sein Mund salzig trocken vom Takeway-Essen. Vielleicht hätte er doch eine Flasche Schnaps mitbringen sollen. Er denkt an die Tabletten in seiner Reisetasche, aber auf die will er nicht zurückgreifen. Stattdessen richtet er sich auf das lange Warten bis zum Morgengrauen ein.
DreiBlutiger Sonntag
Martin verlässt sein Zimmer, bevor es hell wird. Die Luft ist kühl, der Himmel matt, und er geht durch die verlassenen Straßen zum Epizentrum seiner Story: zur Pfarrkirche St. James. Er steht davor, als die Sonne sich über den Horizont schiebt und goldene Strahlen zwischen den Zweigen der roten Eukalyptusbäume tanzen lässt. Martin sieht die Kirche zum ersten Mal, aber das Gebäude ist ihm trotzdem vertraut: ein Backsteinbau mit Wellblechdach, kaum höher als die Umgebung, ein halbes Dutzend Stufen, die zu dem länglichen Zweckbau hinaufführen, dessen Natur durch das Bogenportal, die Neigung des Daches und die Höhe seiner Fenster erkennbar gemacht und durch das Kreuz auf dem Giebel bestätigt wird. Ein rudimentärer Glockenturm steht auf der einen Seite: zwei Betonpfeiler, eine Glocke und ein Seil. ST.JAMES: GOTTESDIENSTAM 1. UND 3. SONNTAGDESMONATS, 11 Uhr, steht in schwarzen Lettern auf einer weißen Tafel. Die schmucklose Kirche steht allein. Keine Mauer umgibt sie, kein Friedhof, keine schützenden Büsche oder Bäume.
Martin geht auf dem rissigen Zementweg auf die Eingangsstufen zu. Nichts erinnert an das, was hier vor fast einem Jahr passiert ist: keine Gedenktafel, keine Kreuze, keine welken Blumensträuße. Warum nicht? Das traumatischste Ereignis in der Geschichte der Stadt, und nichts, was daran erinnert. Nichts für die Opfer, nichts für die Hinterbliebenen. Vielleicht sind die Wunden noch zu frisch, vielleicht ist die Stadt auf der Hut vor Souvenirjägern, vielleicht will sie die Morde aus dem kollektiven Gedächtnis tilgen, so tun, als wären sie nie geschehen.
Er untersucht die Stufen. Keine Flecken, keine Spuren; die Sonne hat den Zement gebleicht und den Tatort sterilisiert. Das Gras zu beiden Seiten des Weges wirkt wie tot, verbrannt von der Sonne und dem Wassermangel. Er will die Tür öffnen und hofft, das Innere sei vielleicht mitteilsamer, aber sie ist verschlossen. Also geht er um das Gebäude herum und sucht nach brauchbaren Details, aber umsonst. St. James gibt der journalistischen Neugier nichts preis. Martin macht ein paar Fotos, aber er weiß, er wird sie nie anschauen.
Das Verlangen nach Kaffee wird größer, und er fragt sich, wann der Buchladen öffnet. Auf seiner Uhr ist es halb sieben. Noch zu früh. Er folgt der Somerset Street in Richtung Süden und lässt St. James rechts und die Grundschule links liegen. Die Straße macht eine Kurve, und er entdeckt die Rückseite des Motels hinter einem Holzzaun. Als er die Polizeiwache hinter sich gelassen hat, kommt er wieder auf die Hauptstraße, die Hay Road. Auf einem Sockel mitten auf der Kreuzung steht mit gesenktem Kopf die lebensgroße Statue eines Soldaten in der Uniform des Ersten Weltkriegs: Stiefel, Leggings und Schlapphut. Der Soldat steht bequem und hält sein Gewehr an der Seite. Martin schaut hoch und betrachtet die leblosen Bronzeaugen. Auf weißen Marmortafeln am Sockel sind die Einheimischen aufgeführt, die für ihr Land gefallen sind – im Burenkrieg, in den Weltkriegen, in Korea und in Vietnam. Die Stadt kennt Trauma und Traumatisierte. Aber vielleicht ist das Gedenken an einen Krieg einfacher als das an einen Massenmord. Der Krieg hat wenigstens noch irgendeinen Sinn. Das erzählt man zumindest den Witwen.
Ein Offroader kommt vom Highway herunter. Der Fahrer zeigt Martin den erhobenen Finger in der üblichen Begrüßung, und Martin erwidert unbeholfen die Geste. Der Wagen fährt weiter, über die Brücke und zur Stadt hinaus. Es ist Dienstagmorgen. Martin erinnert sich, dass Matilda’s Antiquitätenladen nur dienstags und donnerstags morgens geöffnet ist. Halten es andere Geschäfte in der Stadt – die, die noch überlebt haben – genauso? Haben ihre Eigentümer sich verschworen, ihre kargen Einkünfte in ein paar Stunden pro Woche zu verdienen, und tun die Einwohner und die Farmer der Umgebung ihr Bestes, um sie dabei zu unterstützen? Eine Stadt, die sich in einer Wagenburg verschanzt, um sich gegen Dürre und wirtschaftlichen Niedergang zu wehren? Wenn ja, muss Martin das Beste daraus machen, muss sich den Leuten vorstellen, wenn sie draußen unterwegs sind, sie nach ihren Ansichten befragen und ihre Gefühle erforschen, herausfinden, wie viel Leben es noch in Rivers End gibt. Er geht zur Bank, und richtig: geöffnet dienstags und donnerstags vormittags. Das Gleiche gilt für das Textilgeschäft Jennings schräg gegenüber. Das Commercial Hotel mit seiner frisch gestrichenen Fassade dagegen wird an allen Tagen der Woche geschlossen bleiben. Neben dem Pub, näher bei der Brücke, befindet sich Landers’ Supermarkt. Geöffnet sieben Tage die Woche. Martin macht sich im Geiste einen Vermerk: Craig Landers war eines der Todesopfer bei der Schießerei. Wer führt das Geschäft jetzt? Seine Witwe? Mandalay hat ihren Namen erwähnt. Fran. Sie hat gesagt, sie seien befreundet.
Einen Moment lang ist er abgelenkt durch ein Geräusch, das wie ferner Donner klingt. Forschend sucht er den Himmel ab, aber da ist nicht das kleinste Wölkchen. Der Donner kommt näher und näher. Dann kommen vier Motorräder die Hay Road herunter, zwei und zwei nebeneinander. Die Biker verziehen keine Miene. Ihre Maschinen knattern, der Lärm hallt von den Häusern wider, und das Echo vibriert in Martins Brust. Die Männer tragen mattschwarze Helme, Sonnenbrillen und Vollbärte, aber keine Lederjacken, sondern ärmellose Jeanswesten mit ihrem Logo, das aus dem Namen Reapers und einer Silhouette des Sensenmanns besteht. Ihre Arme strotzen von Muskeln und Tattoos, ihre Gesichter von Überheblichkeit. Martin nehmen sie anscheinend nicht zur Kenntnis. Er macht ein Foto mit seinem Handy, dann noch eins, als sie die Brücke erreichen. Ein paar Augenblicke später ist der Donner verklungen, und Rivers End verfällt wieder in seine Friedhofsstarre.
Es dauert eine halbe Stunde, bis das nächste Fahrzeug erscheint. Ein roter Kombi kommt vom Highway herunter, fährt an dem Soldaten vorbei und hält vor dem Supermarkt. Martin geht darauf zu, und eine Frau steigt aus. Sie lässt die Heckklappe aufspringen und nimmt einen kleinen Packen Zeitungen heraus. Sie ist ungefähr so alt wie er, hat kurzes dunkles Haar und ein hübsches Gesicht.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragt Martin.
»Natürlich«, sagt die Frau. Martin beugt sich in den Wagen und hebt ein Tablett mit einem Dutzend Broten in braunem Packpapier heraus. Die Brote sind warm und duften verlockend. Er folgt der Frau in den Laden und stellt das Tablett auf die Theke.
»Danke«, sagt die Frau. Sie will noch etwas sagen, bricht aber ab, und ihr kokettes Lächeln verschwindet. »Sie sind der Journalist, nicht wahr?«
»Ja. Das stimmt.«
»Aber nicht dieser Defoe, oder?«
»Nein. Mein Name ist Martin Scarsden. Sind Sie Mrs Landers? Fran, richtig?«
»Ja. Aber ich habe Ihnen absolut nichts zu sagen.«
»Verstehe. Gibt’s einen besonderen Grund?«
»Stellen Sie sich nicht dumm. Wenn Sie nichts kaufen wollen, gehen Sie jetzt bitte.«
»Okay, verstanden.« Martin will gehen, aber dann überlegt er es sich. »Ach, übrigens – haben Sie Wasser in Flaschen?«
»Da hinten am Ende. Im Dutzend billiger.«
Am Ende des Ganges findet er einen Stapel No-Name-Literflaschen mit Mineralwasser, Sechserpacks in Klarsichtfolie. Martin nimmt zwei, eins mit jeder Hand. An der Theke nimmt er noch eins der Brote.
»Hören Sie«, sagt er zu der Witwe, die das Zeitungspaket aufschneidet. »Ich will mich wirklich nicht aufdrängen …«
»Gut, dann tun Sie es nicht. Ihr habt genug Schaden angerichtet.«
Darauf wüsste er eine Antwort, aber er behält sie für sich. Stattdessen nimmt er zwei Zeitungen aus Melbourne, die Herald Sun und The Age und dazu den Bellington Weekly Crier, bezahlt und geht. LABORSTIEHLT, schreit die Herald Sun.NEUEWELLEDERMETH-EPIDEMIE, warnt The Age, und DÜRREIMMERSCHLIMMER, heult der Crier. Draußen überkommt ihn der verzweifelte Drang, eins der Sixpacks aufzureißen, aber er weiß, wenn er die Folie zerstört, kann er die Flaschen nicht mehr transportieren. Also macht er sich auf den Weg zum Black Dog. Er kommt am Oasis vorbei, aber die Buchhandlung und ihre Kaffeemaschine haben den Betrieb noch nicht aufgenommen.
Um Viertel nach neun hat er auf dem von Zigarettenstummeln übersäten Parkplatz des Motels Brot, Mineralwasser und Instant-Kaffee zu sich genommen und steht vor dem Polizeirevier. Es ist ein solides kleines Backsteingebäude mit einem neuen grauen Blechdach, das hinter seinem großen, blau-weißen Schild geradezu winzig aussieht. Es steht an der Ecke Gloucester Road und Somerset Street, neben der Bank und gegenüber der Grundschule. Hier soll das einzige Interview stattfinden, das er im Voraus hat verabreden können, als er am Morgen des vergangenen Tages aus Wagga hier angerufen hat. Hinter der Theke sitzt Constable Robbie Haus-Jones. Nach den Schüssen hat man ihn als Helden dargestellt, aber für Martin sieht er aus wie ein Teenager mit Akne und einem nicht überzeugenden Schnurrbart.
»Constable Haus-Jones?«, fragt er und streckt die Hand aus. »Martin Scarsden.«
»Martin, guten Morgen«, sagt der junge Polizist mit einer unerwarteten Baritonstimme. »Kommen Sie durch.«
»Danke.«
Martin folgt dem schmächtigen jungen Mann in ein einfaches Büro: Schreibtisch, drei graue Aktenschränke, einer mit einem Kombinationsschloss, eine detaillierte Karte des Distrikts an der Wand, eine verwelkte Topfpflanze auf dem Fensterbrett. Haus-Jones setzt sich an den Schreibtisch, Martin nimmt einen der drei Stühle, die davor stehen.
»Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, mit mir zu sprechen«, sagt Martin und überspringt den üblichen Smalltalk. »Aus Gründen der Genauigkeit würde ich das Interview gern aufzeichnen, wenn es Ihnen recht ist, aber wenn Sie sich an irgendeinem Punkt unter vier Augen äußern möchten, sagen Sie es nur.«
»Schon in Ordnung«, sagt der Polizist. »Aber bevor wir anfangen, könnten Sie mir vielleicht erklären, worauf Sie es abgesehen haben. Ich weiß, Sie haben es mir gestern erklärt, aber ich war ein bisschen abgelenkt. Um ehrlich zu sein, ich war nur höflich; ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Interview genehmigt werden würde.«
»Aha. Was hat sich geändert?«
»Mein Sergeant unten in Bellington. Er hat mich gedrängt, es zu machen.«
»Na, dann muss ich mich bei ihm bedanken, wenn ich ihn sehe. Die Idee zu der Story ist nicht so sehr das Ereignis an sich, obwohl das der Ausgangspunkt ist. Aber eigentlich will ich darüber berichten, wie sich die Stadt ein Jahr später damit arrangiert.«
Der Blick des jungen Polizisten ist zum Fenster gewandert, während Martin geredet hat, und er lässt ihn dort, während er antwortet. »Verstehe. Okay. Schießen Sie los.« Sein Blick kehrt zu Martin zurück, und es liegt keine Spur von Ironie darin.
»Gut. Wie gesagt, die Tat selbst steht nicht im Mittelpunkt der Story, aber es ist sinnvoll, mit ihr anzufangen. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie zum ersten Mal mit der Presse über dieses Thema sprechen?«
»Was die Großstadtpresse betrifft, ja. Ich habe dem Crier ein paar Dinge erzählt.«