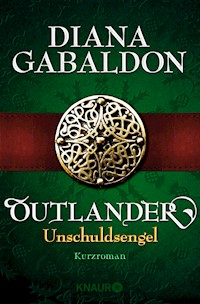2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Begleiten Sie Lord John auf der riskanten Mission, seine Mutter aus dem belagerten Havanna zu retten: »Die Kanonen von El Morro« ist ein mitreißender Kurzroman aus dem »Outlander«-Universum von Bestseller-Autorin Diana Gabaldon. Jamaika 1762. Lord John ist gerade im Begriff, seinen Posten als Militärgouverneur auf Jamaika aufzugeben, als er erfährt, dass seine Mutter sich bei seiner schwangeren Cousine in Havanna aufhält. Das Problem daran: die britische Marine ist auf dem Weg, die Stadt zu belagern. Kurz entschlossen reist Lord John mit seinem Leibdiener Tom Byrd, dem ehemaligen Zombie Rodrigo und dessen blutrünstiger Frau nach Havanna, um seine Mutter, die ehemalige Herzogin von Pardloe, zu retten - im Wettlauf gegen die britische Armee. »Die Kanonen von El Morro« spielt nach dem Roman »Die Fackeln der Freiheit« sowie dem Kurzroman »Lord John und der Herr der Zombies« und ist Teil von Diana Gabaldons »Outlander«-Universum. Fans der Reihe ist Lord John als einer der besten Freunde Jamie Frasers bekannt, aber auch abseits davon erlebt er fesselnde Abenteuer. Die kürzeren und längeren Romane um Lord John Grey bauen zwar chronologisch aufeinander auf, können aber auch einzeln gelesen werden. »Die Kanonen von El Morro« sowie sechs weitere Kurzromane von Bestseller-Autorin Diana Gabaldon finden Sie auch in dem Sammelband »Outlander – Im Bann der Steine«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Ähnliche
Diana Gabaldon
Outlander – Die Kanonen von El Morro
Ein Lord-John-Kurzroman
Aus dem Englischen von Barbara Schnell
Knaur e-books
Über dieses Buch
Jamaika 1762. Lord John ist gerade im Begriff, seinen Posten als Militärgouverneur auf Jamaika aufzugeben, als er erfährt, dass seine Mutter sich bei seiner schwangeren Cousine in Havanna aufhält.
Das Problem daran: die britische Marine ist auf dem Weg, die Stadt zu belagern. Kurz entschlossen reist Lord John mit seinem Leibdiener Tom Byrd, dem ehemaligen Zombie Rodrigo und dessen blutrünstiger Frau nach Havanna, um seine Mutter, die ehemalige Herzogin von Pardloe, zu retten - im Wettlauf gegen die britische Armee.
Dieser Kurzroman von Diana Gabaldon spielt nach dem Roman »Die Fackeln der Freiheit« sowie dem Kurzroman »Lord John und der Herr der Zombies« und ist Teil des Outlander-Universums.
Fans der Reihe ist Lord John als einer der besten Freunde Jamie Frasers bekannt, aber auch abseits davon erlebt er fesselnde Abenteuer. Die kürzeren und längeren Romane um Lord John Grey bauen zwar chronologisch aufeinander auf, können aber auch einzeln gelesen werden.
Dieses Buch widme ich Karen Henry, Rita Meistrell, Vicki Pack, Sandy Parker und Mandy Tidwell (die ich mit allem Respekt und der größten Dankbarkeit auch meine persönliche Erbsenzählertruppe nenne) für ihre unschätzbare Hilfe beim Aufspüren von Irrtümern, Anschlussfehlern und Kleinkram aller Art.
(Für etwaige verbleibende Fehler ist allein die Autorin verantwortlich, die nicht nur hin und wieder fröhlich die Chronologie ignoriert, sondern sich bisweilen auch ganz bewusst auf Abwege begibt.)
Die Kanonen von El Morro
LORD JOHN GREY TAUCHTE VORSICHTIG EINEN Finger in das kleine Steingutgefäß, zog ihn wieder heraus und roch vorsichtig an der glänzenden Haut.
»Himmel!«
»Ja, Mylord, das habe ich auch gesagt.« Sein Leibdiener Tom Byrd hielt das Gesicht sorgfältig abgewandt, während er den Deckel wieder auf das Töpfchen legte. »Wenn Ihr Euch damit einreibt, zieht Ihr die Fliegen zu Hunderten an. Als wärt Ihr schon tot. Schon lange tot«, fügte er hinzu und hüllte das Töpfchen als zusätzlichen Schutz in eine Serviette.
»Nun, um nicht ungerecht zu sein«, sagte Grey skeptisch, »dieser Wal ist vermutlich schon lange tot.« Er richtete den Blick zur Wand seiner Amtsstube. Auf der Vertäfelung saßen wie immer ein paar Fliegen, die sich fett und schwarz wie Johannisbeeren vom Weiß des Stucks abhoben. Und da, ein paar hatten sich bereits in die Luft erhoben und kreisten träge auf das Töpfchen mit dem Waltran zu. »Woher hast du das?«
»Der Wirt im Moor’s Head hat immer ein Fass im Haus; er verbrennt den Tran in seinen Lampen – sogar billiger als Talgkerzen, sagt er, von richtigen Wachskerzen ganz zu schweigen.«
»Ah. Das kann ich mir vorstellen.« So wie es abends im Moor’s Head roch, wenn dort viel zu tun war, würde niemand den Trangestank in der Symphonie der anderen Gerüche bemerken.
»Ist in Jamaica wohl leichter zu haben als Bärenschmalz«, stellte Tom fest und griff nach dem Töpfchen. »Möchtet Ihr es gern mit Minze versuchen, Mylord? Es könnte helfen«, fügte er hinzu, zog aber skeptisch die Nase kraus.
Tom hatte automatisch das Öltuch von der Ecke des Schreibtischs aufgehoben und mit einer geschickten Bewegung eine fette Fliege in der Luft erwischt und ins Jenseits befördert.
»Toter Wal mit Minze? Das dürfte mein Blut für den Blutsauger von Welt zur Delikatesse machen – in Charles Town und in Kanada erst recht.« Die Fliegen Jamaicas waren zwar lästig, aber eigentlich keine Fleischfresser, und die Meeresbrise sowie Insektenfenster aus Musselin hielten die meisten Moskitos fern. Die Sümpfe der amerikanischen Küstenregion dagegen … und die tiefen Wälder Kanadas, sein eigentliches Ziel …
»Nein«, sagte Grey widerstrebend und kratzte sich schon bei dem bloßen Gedanken an kanadische Bremsen den Hals. »Ich kann das Einweihungsfest von Mr Mullrynes neuem Plantagenhaus nicht mit einer Transchicht besuchen. Vielleicht bekommen wir ja in South Carolina Bärenschmalz. Vorerst … Mandelöl vielleicht?«
Tom schüttelte entschlossen den Kopf.
»Nein, Mylord. Azeel sagt, Mandelöl lockt Spinnen an. Sie kommen und lecken es ab, während Ihr schlaft.«
Lord John und sein Leibdiener erschauerten gleichzeitig, weil sie an ihr Erlebnis mit einer Bananenspinne dachten – einem Tier mit der Spannweite einer Kinderhand –, die letzte Woche bei Greys Gartenfest anlässlich seines Abschieds von der Insel und der Begrüßung seines Nachfolgers, des Ehrenwerten Mr Houghton Braythwaite, unerwartet aus einer reifen Banane hervorgeschossen war, gefolgt von ihrer Brut, deren Zahl ihnen damals in die Hunderte zu gehen schien.
»Ich dachte, er würde auf der Stelle einen Schlaganfall bekommen«, sagte Grey, und seine Lippen zuckten.
»Vermutlich wäre ihm das auch am liebsten gewesen.«
Grey sah Tom an, Tom sah Grey an, und sie brachen prustend in ersticktes Gelächter aus, als sie an das Gesicht des Ehrenwerten Mr Braythwaite dachten.
»Also wirklich«, sagte Lord John und riss sich zusammen. »So kommen wir nicht weiter. Habt ihr …«
Er wurde durch das Rumpeln einer Kutsche unterbrochen, die den Kiesweg zum King’s House heraufkam.
»O Gott, ist er das etwa schon?« Grey blickte sich schuldbewusst in seiner unaufgeräumten Amtsstube um: Ein halb gepackter Koffer stand mit klaffendem Deckel schief in der Ecke, und der ganze Schreibtisch war mit Dokumenten und den Überresten seines Mittagessens übersät, kein Anblick für einen Mann, der ihn morgen übernehmen würde. »Lauft hinaus und lenkt ihn ab, ja, Tom? Bringt ihn in das Empfangszimmer und schüttet ihn mit Rum voll. Ich komme ihn holen, sobald ich … hier … etwas unternommen habe.« Er wies mit der Hand auf die Verwüstung, und Tom verschwand gehorsamst.
Grey ergriff das Öltuch und erledigte eine unaufmerksame Fliege, dann hob er einen Teller mit Brotresten, Pudding und Obstschalen auf und schüttete die Reste aus dem Fenster in den Garten. Nachdem er den leeren Teller unter dem Schreibtisch versteckt hatte, begann er hastig, Papiere zu stapeln, wurde aber Sekunden später unterbrochen, weil Tom mit aufgeregter Miene wieder auftauchte.
»Mylord! Es ist General Stanley!«
»Wer?«, sagte Grey ausdruckslos. Sein Gehirn war so mit den Einzelheiten seines bevorstehenden Entrinnens beschäftigt, dass es sich weigerte, sich mit irgendetwas zu befassen, das besagtem Entrinnen in die Quere kommen könnte. Doch bei dem Namen »Stanley« klingelte es entfernt und leise.
»Ob das wohl der Gemahl Eurer Mutter ist, Mylord?«, sagte Tom mit der angebrachten Zurückhaltung.
»Oh … der General Stanley. Warum habt Ihr das nicht gleich gesagt?« John nahm hastig seinen Rock vom Kleiderhaken und strich sich die Krümel von der Weste, während er hineinschlüpfte. »Bringt ihn doch herein!«
Eigentlich mochte John den dritten Ehemann seiner Mutter gern – sie zwar zum zweiten Mal verwitwet gewesen, als sie den General vor vier Jahren abgeschleppt hatte –, aber im Moment galt es, jede militärische Einmischung grundsätzlich mit Argwohn zu betrachten.
Wie üblich war der Argwohn gerechtfertigt. Der General Stanley, der schließlich auftauchte, war nicht der joviale, herzliche, selbstbewusste Mann, den er zuletzt in Gesellschaft seiner Mutter gesehen hatte. Dieser General Stanley humpelte am Stock; sein rechter Fuß steckte in einem immensen Verband, und sein Gesicht war grau vor Schmerz, Anstrengung … und großer Nervosität.
»General!« John nahm ihn beim Arm, ehe er hinfallen konnte, und führte ihn zum nächsten Stuhl, den er hastig von einem Stapel Landkarten befreite. »Setzt Euch doch – Tom, würdet Ihr …«
»Schon da, Mylord.« Mit lobenswerter Geschwindigkeit hatte Tom die Feldflasche aus Greys offener Reisetasche geholt, und jetzt drückte er sie General Stanley in die Hand.
Der General nahm sie fraglos entgegen und trank einen großen Schluck.
»Grundgütiger«, sagte er schwer atmend und stellte die Flasche auf seinem Knie ab. »Ich dachte schon, ich schaffe es nicht hierher.« Mit geschlossenen Augen trank er noch einen Schluck, diesmal langsamer.
»Mehr Brandy, bitte, Tom«, sagte Grey, während er dies beobachtete. Tom warf dem General einen abschätzenden Blick zu, nicht sicher, ob dieser wohl sterben würde, ehe es ihm gelang, neuen Brandy zu holen, beschloss dann aber, sein Geld auf das Überleben des Generals zu setzen, und verschwand auf der Suche nach dem Leben spendenden Elixier.
»Gott.« Der General sah zwar immer noch nicht besonders menschlich aus, jedoch schon besser als zuvor. Er nickte John dankend zu und reichte ihm mit zitternder Hand die leere Flasche zurück. »Der Arzt sagt, ich darf keinen Wein trinken – es ist anscheinend schlecht für die Gicht –, aber ich erinnere mich nicht, dass von Brandy die Rede war.«
»Gut«, sagte John mit einem Blick auf den verbundenen Fuß. »Hat er etwas von Rum gesagt?«
»Nicht ein Wort.«
»Hervorragend. Ich bin bei meiner letzten Flasche französischem Brandy angelangt, aber wir haben jede Menge Rum.«
»Her mit dem Fass.« Allmählich bekam der General ein wenig Farbe, und jetzt begann er auch, seine Umgebung wahrzunehmen. »Ihr wart dabei, für Eure Abreise zu packen?«
»Ich bin dabei, ja«, sagte John, und das Gefühl des Argwohns bekam in seinem Magen kleine Kribbelfüße. »Ich soll heute Abend Richtung Charles Town in See stechen.«
»Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich komme nicht rechtzeitig.« Der General atmete einige Sekunden lautstark vor sich hin, dann riss er sich zusammen. »Es ist Eure Mutter.«
»Was ist meine Mutter?« Der Argwohn verwandelte sich auf der Stelle in flammenden Alarm. »Was ist ihr zugestoßen?«
»Noch nichts. Zumindest hoffe ich das aufrichtig.« Der General hob die Hände zu einer beruhigenden Geste, die absolut nicht beruhigend wirkte.
»Wo zum Teufel ist sie? Und was in Gottes Namen hat sie jetzt wieder angestellt?«, sagte Grey eher hitzig als mit dem gebührenden Respekt, aber die Panik ließ ihn gereizt reagieren.
»Sie ist in Havanna«, sagte General Stanley. »Und kümmert sich um deine Cousine Olivia.«
Das schien eine hinreichend respektable Betätigung für eine ältere Dame zu sein, und Grey entspannte sich ein wenig. Aber nur ein wenig.
»Ist sie krank?«, fragte er.
»Ich hoffe nicht. Sie hat zwar in ihrem letzten Brief geschrieben, dass in der Stadt eine Seuche ausgebrochen ist, sie selbst aber bei guter Gesundheit ist.«
»Schön.« Tom kam mit der Brandyflasche zurück, und John schenkte sich ein kleines Glas ein. »Ich hoffe, sie genießt das schöne Wetter.« Er sah seinen Stiefvater mit hochgezogener Augenbraue an, doch dieser seufzte tief und legte die Hände auf seine Knie.
»Gewiss, gewiss. Das Problem, mein Junge, ist, dass die britische Marine unterwegs ist, die Stadt Havanna zu belagern, und ich glaube, dass es eine hervorragende Idee wäre, wenn Eure Mutter nicht in der Stadt wäre, wenn die Flotte eintrifft.«
IM ERSTEN MOMENT stand John da wie erstarrt, das Glas in der Hand, den Mund offen und das Hirn so mit Fragen verstopft, dass er nicht imstande war, auch nur eine davon zu artikulieren. Schließlich schluckte er den Rest seines Brandys, hustete und sagte in aller Ruhe: »Oh, verstehe. Wie kommt es denn, dass meine Mutter überhaupt in Havanna ist?«
Der General lehnte sich zurück und atmete tief aus.
»Daran ist allein dieser Stubbs schuld.«
»Stubbs …?« Der Name klang zwar vage vertraut, doch Grey war so verdattert, dass ihm nicht einfallen wollte, warum.
»Ihr wisst schon, dieser Kerl, der Eure Cousine Olivia geheiratet hat. Sieht aus wie ein Ziegelstein. Wie heißt er noch mit Vornamen … Matthew? Nein, Malcolm, das ist es. Malcolm Stubbs.«
Grey griff nach der Brandyflasche, doch Tom war schon dabei, ein frisches Glas einzuschenken, das er seinem Brotherrn reichte. Er vermied es sorgsam, Grey anzusehen.
»Malcolm Stubbs.« Grey nippte an seinem Brandy, um Zeit zum Überlegen zu gewinnen. »Ja, natürlich. Dann … gehe ich recht in der Annahme, dass er vollständig genesen ist?« Das waren einerseits gute Nachrichten; Malcolm Stubbs hatte vor über zwei Jahren in der Schlacht von Quebec einen Fuß und einen Teil des dazugehörigen Beins verloren. Zu seinem Glück war Grey auf dem Feld über ihn gefallen und hatte die Geistesgegenwart besessen, seinen Gürtel als Druckverband zu benutzen und so zu verhindern, dass Stubbs verblutete. Er erinnerte sich lebhaft an den zersplitterten Knochen, der aus den Überresten des Schienbeins herausragte, und den beißenden, feuchten Gestank nach Blut und Scheiße, der in der kalten Luft dampfte. Er trank noch einen größeren Schluck Brandy.
»Ganz und gar. Hat einen künstlichen Fuß, ist ganz beweglich – reitet sogar.«
»Schön für ihn«, sagte Grey recht knapp, denn er verband auch noch einige andere Dinge mit Malcolm Stubbs. »Ist er auch in Havanna?«
Der General sah überrascht aus.
»Ja, sagte ich das nicht? Er ist jetzt irgendeine Art Diplomat – wurde letzten September nach Havanna entsandt.«
»Ein Diplomat«, wiederholte Grey. »Soso.« Diplomatie war vermutlich etwas, was Stubbs lag, wenn er bedachte, welches Talent der Mann für Lug, Trug und Ehrlosigkeit an den Tag gelegt hatte …
»Er wollte, dass seine Frau und seine Kinder zu ihm kamen, sobald er sich in Havanna eingerichtet hatte, also …«
»Kinder? Als ich ihn zuletzt gesehen habe, hatte er nur den einen Sohn.« Nur den einen ehelichen Sohn, fügte er im Stillen hinzu.
»Jetzt sind es zwei – Olivia hat vor zwei Jahren eine Tochter bekommen; ein süßes Kind namens Charlotte.«
»Wie schön.« An die Geburt von Olivias erstem Kind Cromwell erinnerte er sich beinahe genauso grauenvoll lebhaft wie an die Schlacht von Quebec, wenn auch aus anderen Gründen. Allerdings hatte beides mit Blut und Scheiße zu tun. »Aber Mutter …«
»Eure Mutter hat angeboten, Olivia zu begleiten, um ihr bei den Kindern zu helfen. Olivia ist wieder schwanger, und eine lange Seereise …«
»Schon wieder?« Nun, es war ja nicht so, als wüsste Grey nicht, was für ein Lüstling Stubbs war … und wenigstens trieb es der Mann mit seiner Frau. John zwang sich nur mit Mühe zur Ruhe, doch der General fuhr bereits mit seinen Erklärungen fort, ohne es zu bemerken.
»Ich sollte nämlich im Frühjahr – also jetzt – nach Savannah fahren, um einen gewissen Oberst Folliot zu beraten, der vor Ort eine Miliz aufstellen möchte, um den Gouverneur zu unterstützen, und Eure Mutter sollte mich begleiten. Also kam es uns ganz vernünftig vor, dass sie mit Olivia vorausfuhr und ihr half, sich einzuleben, und ich hatte dann vor, bei meinem Eintreffen ihre Weiterreise zu arrangieren.«
»Sehr vernünftig«, sagte John. »Das klingt ganz nach Mutter. Und was hat die britische Marine damit zu tun?«
»Admiral Holmes, Mylord«, sagte Tom mit einem tadelnden Unterton. »Er hat es Euch letzte Woche erzählt, als Ihr ihn zum Essen hier hattet. Er hat gesagt, der Herzog von Albemarle wäre unterwegs, um den Froschfressern Martinique abzunehmen und sich dann um Kuba zu kümmern.«
»Oh. Ah.«
Grey erinnerte sich an das Abendessen, bei dem es ein bemerkenswertes Gericht gegeben hatte, das – wie er zu spät begriffen hatte – aus eingelegten Seeigel-Innereien bestand, vermischt mit rohem Fisch und in Orangensaft mariniertem Meersalat. Um zu verhindern, dass seine Gäste – alle erst in jüngster Zeit aus London eingetroffen und alle voll des Wehklagens über den Mangel an Roastbeef und Kartoffeln auf den Westindischen Inseln – dies ebenfalls begriffen, hatte er angeordnet, dass man ihnen wiederholt und reichlich von einem hiesigen Palmenschnaps auftischte. Dies hatte seine Wirkung nicht verfehlt; beim zweiten Glas hätten sie nicht einmal mehr gemerkt, wenn es seinem abenteuerlustigen Koch in den Sinn gekommen wäre, ihnen Walfäkalien als zweiten Gang aufzutragen. In der Folge waren jedoch auch seine eigenen Erinnerungen an dieses Ereignis ein wenig verschwommen.
»Er hat aber nicht gesagt, dass Albemarle vorhatte, die Stadt zu belagern, oder?«
»Nein, Mylord, aber das muss er gemeint haben, glaubt Ihr nicht?«
»Weiß der Himmel«, sagte John, der nicht das Geringste über Kuba, Havanna oder den Herzog von Albemarle wusste. »Oder vielleicht Ihr, Sir?«, wandte er sich höflich an General Stanley, der aufgrund seiner Erleichterung und des Alkohols allmählich besser aussah. Der General nickte.
»Normalerweise nicht«, räumte er offen ein, »aber ich habe gerade sechs Wochen auf Albemarles Flaggschiff an seinem Tisch gespeist. Was ich jetzt nicht über den Hafen von Havanna weiß, braucht man vermutlich auch nicht zu wissen, obwohl ich dieses Wissen nicht mit Absicht erworben habe.«
Der General hatte erst am Abend vor dem Ablegen der Flotte von Albemarles Expedition erfahren, als ihn eine Nachricht aus dem Kriegsministerium an Bord beordert hatte.
»Zu diesem Zeitpunkt wäre das Schiff natürlich schneller in Kuba gewesen als jede Nachricht, die ich Eurer Mutter hätte schicken können, also bin ich trotz allem«, er warf einen finsteren Blick auf seinen verbundenen Fuß, »sofort an Bord gegangen.«
»Gewiss.« John unterbrach ihn kurz mit einer Handbewegung und wandte sich an seinen Leibdiener. »Tom – lauft, und ich meine, lauft zu Admiral Holmes und bitte ihn, mich aufzusuchen, sobald es ihm möglich ist. Und mit möglich meine ich …«
»Sofort. Ja, Mylord.«
»Danke, Tom.«
Trotz des Brandys hatte Greys Hirn die Situation jetzt erfasst und versuchte zu erwägen, was zu tun war.
Wenn die britische Marine im Hafen von Havanna auftauchte und anfing, die Stadt zu bombardieren, bedeutete dies nicht nur Lebensgefahr für Familie Stubbs und Lady Stanley, auch bekannt als verwitwete Herzogin von Pardloe. Sie alle würden vermutlich auf der Stelle in spanische Geiselhaft genommen werden.
»Sobald wir in Sichtweite von Martinique waren und dort zu Moncktons Truppen stießen, habe ich einen kleinen Kutter … äh … requiriert, um so schnell wie möglich hierherzukommen.«
»Requiriert, Sir?«, sagte John, der über den Ton des Generals lächeln musste.
»Nun, ich habe ihn gestohlen, um ganz offen zu sein«, gab der General zu. »Ich glaube nicht, dass sie mich in meinem Alter vor das Kriegsgericht bringen würden … und wenn ja, ist es mir gleich.« Er setzte sich aufrecht hin, schob das graue Stoppelkinn vor, und seine Augen glitzerten. »Alles, woran mir liegt, ist Benedicta.«
WAS DER GENERAL über Havanna wusste, war, dass es über einen der besten Seehäfen der Welt verfügte, der hundert Schiffen Platz bieten konnte und auf jeder Seite durch eine große Festung geschützt wurde; Kastell Morro im Osten und La Punta im Westen.
»La Punta ist eine Kaserne, die rein zur Verteidigung dient; sie überblickt die Stadt, obwohl natürlich eine Seite dem Hafen zugewandt ist. El Morro – so nennen es die Spanier – ist größer; es ist das Verwaltungshauptquartier des Gouverneurs der Stadt, Don Juan de Prado. Dort befindet sich auch der Großteil der Artillerie zur Sicherung des Hafens.«
»Mit etwas Glück benötige ich dieses Wissen nicht«, sagte John und goss sich Rum in ein Glas Orangensaft, »aber ich werde es mir vorsichtshalber merken.«