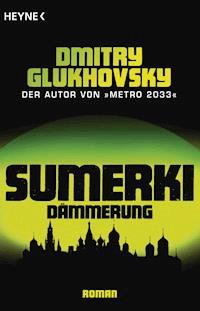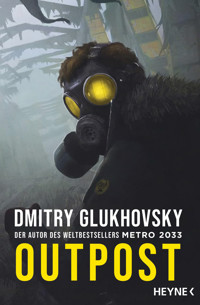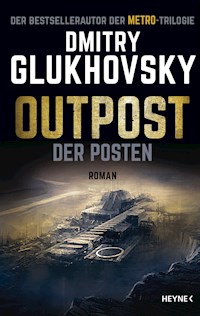
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Outpost-Romane
- Sprache: Deutsch
Russland in der nahen Zukunft. Nach dem Krieg sind ganze Landstriche verseucht, die Flüsse vergiftet. Die einzelnen Städte haben kaum noch Kontakt zur Regierung in Moskau. Schon seit Jahren harrt Jegor im Außenposten in Jaroslawl aus. Sein Stiefvater Polkan, der Kommandant des Postens, macht ihm das Leben schwer, und die schöne Michelle interessiert sich nicht für ihn. Jegor träumt von der Welt jenseits der Eisenbahnbrücke, auf der anderen Seite des Flusses. Doch schon seit Jahrzehnten ist niemand mehr über diese Brücke gekommen. Bis heute …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Russland in der nahen Zukunft. Nach einem verheerenden Bürgerkrieg mit chemischen, biologischen und atomaren Waffen sind ganze Landstriche verseucht und die Flüsse vergiftet. Moskau hat alle Gebiete östlich der Wolga aufgegeben. Die einzelnen Städte haben kaum noch Kontakt zur Regierung, nur über das ausgedehnte Eisenbahnnetz kommen ab und an noch Züge, die die Außenposten mit Lebensmitteln versorgen. Schon seit seiner Kindheit harrt Jegor im Outpost von Jaroslawl aus. Sein Stiefvater Polkan, der Kommandant des Postens, macht ihm das Leben schwer, und die schöne Michelle interessiert sich nicht für ihn. Jegor träumt von der Welt jenseits der Eisenbahnbrücke, auf der anderen Seite des Flusses. Doch schon seit Jahrzehnten ist niemand mehr über diese Brücke gekommen. Bis heute …
Der Autor
Dmitry Glukhovsky, geboren 1979 in Moskau, hat in Jerusalem Internationale Beziehungen studiert und arbeitete als TV- und Radiojournalist unter anderem für den Fernsehsender Russia Today und die Deutsche Welle. Mit seinem Debütroman METRO 2033 landete er auf Anhieb einen Bestseller. Er gilt als einer der neuen Stars der jungen russischen Literatur. Der Autor lebt in Moskau und Barcelona.
Instagram: @glukhovsky, Twitter: @glukhovsky, Facebook: @glukhovskybooks
Mehr über Dmitry Glukhovsky und seine Werke erfahren Sie auf:
diezukunft.de
DMITRYGLUKHOVSKY
OUTPOST
DER POSTEN
ROMAN
Aus dem Russischen vonJennie Seitz und Maria Rajer
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
ПОСТ
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Redaktion: Kristof Kurz
Copyright © 2020 by Dmitry Glukhovsky
Agreement by www.nibbe-literary-agency.com
Copyright © 2021 dieser Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,unter Verwendung eines Motivs vonShutterstock.com / Roman Kybus
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-28270-7V003
www.diezukunft.de
EINS
»Was ist denn da, auf der anderen Seite der Brücke?«
Diese Frage stellt Jegor zum tausendsten Mal, und warum auch nicht, die Antwort fällt schließlich jedes Mal anders aus.
Die riesige Brücke ragt in grünen Dunst hinein, einen dichten giftigen Nebel, und löst sich langsam darin auf, bis sie knapp zwanzig Meter vom Ufer entfernt ganz aus dem Sichtfeld verschwindet. Der Wind nimmt hin und wieder Anlauf, um den Nebel zu vertreiben, aber er schafft es nicht.
Der grüne Vorhang hebt sich nur leicht und legt den Blick frei auf die immer gleichen rostigen Gleise, rostigen Balken, das rostige Fachwerk, bewachsen mit etwas, das wie rotbraunes Seegras aussieht, aber keins ist; etwas, das im Wind schaukelt und bei Windstille.
Der Nebel lässt sich nicht vertreiben, weil er vom Wasser aufsteigt. Es ist der Atem des schwerfälligen, schaumbedeckten, kranken Flusses.
Der Fluss selbst ist nicht zu sehen, erst irgendwo im Dunkel tauchen die Betonpfeiler der Brücke hinein. Aber zu hören ist er durch den Nebel hindurch deutlich – sein Schmatzen, Schlürfen, Glucksen. Als wäre er lebendig – aber das täuscht. Dort unten gibt es kein Leben. Und gerät doch einmal etwas Lebendiges hinein, lebt es nicht lange. Holzboote verkohlen, Schlauchboote werfen Blasen und platzen. Wer hier wohnt, geht selbst dann nicht zu nah ans Wasser, wenn man ihm die Pistole auf die Brust setzt. Und überhaupt, was heißt hier Wasser …?
Der Fluss ist selbst mit stahlverstärkten Frachtkähnen nicht schiffbar. Wer einmal stromabwärts gefahren war, kehrte nicht mehr zurück. Auch aus der anderen Richtung hat sich der Brücke noch nie jemand genähert.
Deshalb braucht der Fluss auch keinen Namen mehr: Er heißt einfach nur Fluss.
Aber früher nannte man ihn »Wolga«.
Jegor lässt nicht locker. »Also, was?«
»Na, was schon … Städte, wahrscheinlich. Genauso leer wie unser Jaroslawl. Das weißt du doch selbst, was fragst du überhaupt?«
»Ich? Ich weiß gar nichts. Du bist doch der, der alles weiß, Sergej Petrowitsch.«
»Halt dich ja von der Brücke fern, klar? Sonst reiß ich dir den Kopf ab!«
»Geht klar, Sergej Petrowitsch. Du bist hier der Kommandant! Und ich nur ein Trottel mit Gitarre. Ich muss ja auch gar nichts wissen. Aber die Frage ist doch, wieso dich das nicht interessiert! Du sollst doch das Imperium an seiner Ostgrenze verteidigen!«
Polkan wirft Jegor einen finsteren Blick zu. Reibt sich die Glatze. Schiebt das Teeglas im silbernen Halter, in den ein Eisenbahnmotiv eingraviert ist, zur Seite.
»Ich weiß genug, du Klugscheißer, kapiert?«, knurrt er. »Die verfluchte Eisenbahn reicht von Moskau bis ans andere Ende der Welt. Aber sie könnte genauso gut hier bei uns zu Ende sein, so lange, wie sich niemand mehr von drüben hat blicken lassen. Jeder hat seine Aufgabe, klar? Jeder hat seinen Posten!«
Polkan trommelt mit den Fingern auf dem Tisch, sucht verbissen nach einer Beschäftigung, einem Vorwand, um Jegor aus seinem Dienstzimmer zu schmeißen. Der Politikunterricht ist vorbei, noch bevor er angefangen hat.
Jegor schlägt einen Waffenstillstand vor. »Gib mir die Gitarre wieder, und ich bin sofort weg.«
»Ich geb dir gleich was anderes, kapiert?! Geh und lern Geschichte, danach hast du Kampftraining. Heute Abend können wir dann über die Gitarre reden! Däumchen drehen will er, verdammt noch mal, anstatt zu lernen! Reichsgeografie pauken sollst du! Zermarterst dir den Kopf über die andere Seite, dabei will nicht mal rein, was auf dieser los ist!«
Aber was ist schon auf dieser Seite los?
Leere Häuser, leere Straßen. Leere Karossen der stehen gelassenen Autos. Knochen, die niemandem gehören, vereinzelt und in Häufchen. Wilde Hunde.
Leben gibt es kaum noch. Höchstens bei den Wachtposten, wo die Menschen in ihren Bahnhofsfestungen hocken, sich an die Eisenbahn klammern, sich verschanzen.
Polkans Posten befindet sich am äußersten Punkt. Die Garnison hat den Befehl, die östlichen Zufahrtswege zu bewachen, also beschützt die Garnison pflichtgemäß die Brücke. Ob vor Aufständischen, Umherziehenden oder Tieren – das kann nicht mal mehr Polkan sagen.
In den Geschichtsbüchern, aus denen Jegor lernen soll, geht es immer nur bergauf: Prosperität, Gerechtigkeit, der Anbruch einer neuen Ära. Aber wann diese Ära den Bach hinuntergeht, steht nicht mehr in den Büchern. Da muss er Polkan glauben, der sagt, das Volk habe gewütet und Verräter hätten das Land leer geplündert; die Hauptstadt sei so ausgeblutet gewesen, dass sie die wegbröckelnden Gebiete nicht mehr halten konnte. Schließlich habe Moskau entlang der verseuchten, giftigen Wolga eine Grenze gezogen, am hiesigen Ufer den Wachtposten aufgestellt, das andere Ufer vergessen und sich um seine Angelegenheiten gekümmert. Und Angelegenheiten gab es mehr als genug.
Was Russland gewesen war, wurde zu Moskowien.
Mehr musste Jegor nicht wissen. Er blickt in Polkans Schweinsaugen. »Ich scheiß auf eure Geschichte und Geografie«, sagt er. »Die alte Welt ist im Arsch, und da kann sie auch bleiben. Aber meine Gitarre hol ich mir trotzdem. Du hast sie mir nicht gegeben, also kannst du sie mir auch nicht wegnehmen, klar?«
Jegor nähert sich langsam dem Ausgang, damit er durch die Tür entwischen kann, bevor der fette, eingerostete Polkan hinter seinem Tisch hervorkommt. Dem dämmert allmählich, was Jegor da gerade gesagt hat; er schüttelt seine wulstige Faust. »Pass bloß auf, du Nichtsnutz! Sonst kannst du draußen schlafen, dann sehen wir ja, wie mutig du bist! Und deine Balalaika schmeiß ich in den Ofen!«
»Versuch’s nur!«
Aber Jegor hinterherzurennen, dafür ist der Kommandant zu faul. Wozu auch? Sie schlafen sowieso unter einem Dach. Der kommt schon von allein wieder angekrochen. Wird ja wohl kaum die Nacht draußen verbringen. Also bellt Polkan von seinem Stuhl aus: »Wenn du nicht lernen willst, dann lass es bleiben! Siebzehn Jahre und nur dein Geklimper im Kopf. Herumtreiben will er sich, statt nachzudenken! Weißt du was? Wenn du über die Brücke willst – nur zu! Geh! Hau ab! Kommst eh nicht weit. Wohin willst du schon ohne deine Mami? Du hängst ihr doch am Rockzipfel! Nur frech sein kannst du und sonst nichts!«
»Du bist doch hier der Pantoffelheld! Was kannst du denn schon, außer auf deinem Arsch hocken und rumkommandieren? Wie viel Verstand braucht man denn dafür? Ein Kommandant, ich lach mich tot!«
»Scher dich zum Teufel! Verschwinde!«
Das war auch schon alles, was Jegor wollte: Polkan zur Weißglut treiben.
Er steckt die Hände in die Hosentaschen und hüpft die Stufen hinab – aus dem obersten Stock der Kommune nach unten.
Im ersten Stock bleibt Jegor vor der gummiverkleideten Tür von Wohnung Nummer 4 stehen. Er hält die Luft an, lauscht: Hört man ihre Stimme? Nein?
Sein Gehör ist scharf. Die Gespräche der Nachbarn hört er aufs Wort genau, er hört am Hundegebell, wenn die Chinesen mit den Fuhren näher kommen; hört, in welcher Tonhöhe der Teekessel pfeift oder die Wölfe heulen. Von seinem leiblichen Vater hätte er das, sagt seine Mutter. Eine idiotische Gabe, sagt sie, die zu nichts Gutem führt.
Nein. Kein Ton von ihr. Nur die Litanei der Alten, sonst ist es still hinter der Tür. Er hat völlig umsonst angehalten. Dass er es wieder mal nicht lassen konnte, ärgert ihn. Er nimmt ein paar Stufen auf einmal und sprintet weiter hinab.
Am Eingang greift er sich sein an die Wand gelehntes Longboard.
Er steigt aufs Board, fährt aber nicht los; schaut stattdessen auf die Fenster über sich. Die Fenster im ersten Stock. Sie sind leer, aber für den Bruchteil einer Sekunde scheint ihm, als wäre hinter dem Glas, wie unter einer Eisschicht, etwas vorbeigeglitten – sie: offenes blondes Haar, schmale, sonnengebräunte Schultern, selbst die durchsichtigen grauen Augen meinte er, erkannt zu haben … Hat er sie doch überhört? Jegor hebt die Hand, winkt dem Glas und dem Eis unentschlossen zu.
Und sofort spürt er ihren Blick im Rücken.
Bei den Garagen steht Michelle und sieht ihn spöttisch und von vornherein gelangweilt an – dieses Gespräch will sie gar nicht erst führen: Hi, wie geht’s, ja, auch ganz gut. Sie weiß besser als er, was das Geplänkel soll. Sie ist vierundzwanzig, Jegor ist viel zu jung für sie und eindeutig zu uncool, auch wenn sein Stiefvater der Kommandant des Postens ist. Jegor ist siebzehn, er ist zwar keine Jungfrau mehr, aber er hat es nur der Vollständigkeit halber mit einer chinesischen Prostituierten drüben in Schanghai getan. Michelle dagegen ist ein Star, eine Prinzessin, nicht von dieser Welt.
Sie hält ein iPhone in der Hand: ihr immer gleiches altes iPhone, das sie ständig bei sich trägt, als wäre es angewachsen. Telefonieren kann man damit zwar nicht, weil die Funknetze vor einer Ewigkeit, schon zu Beginn des Kriegs, zusammengebrochen sind. Aber sie braucht es auch nicht, um mit der Gegenwart zu sprechen. Es ist ihre Verbindung zur Vergangenheit.
Jegor zieht die Nase hoch.
»Hi, wie geht’s?«
Michelle schaut ihn an, da ist noch etwas anderes in ihrem Blick als nur Frust über seine unbeholfenen Annäherungsversuche. Da ist Schwärze – etwas hinter ihren Augen ist durchgebrannt. Sie holt tief Luft, um Jegor aus ihrem Blickfeld zu pusten. »Mein Handy ist tot«, sagt sie kraftlos und mit aufgesetzter Gleichgültigkeit. »Wie – tot?«
»Keine Ahnung. Irgendwann musste es ja passieren.«
Sie sagt es so, als wäre es ihr egal, aber ihre Stimme zittert. Sie wendet sich ab und schaut über das Tor ins Leere.
Jegor gibt sich alle Mühe, möglichst selbstsicher auszusehen und zu klingen. »Das kriegt man doch bestimmt irgendwie wieder hin!«
Michelle sieht ihn aufmerksam an, fixiert ihn mit dem Blick. Jegor wird schwindlig. Er riecht ihren Duft.
»Wie denn? Bei Kolka Kolzow war ich schon. Der sagt, es ist hinüber. Hätte man ein zweites, könnte man wenigstens die Daten retten …«
»Na dann«, sagt Jegor mit einem dummen Grinsen, »willkommen auf dem Posten! Fühl dich wie zu Hause. Hier haben wir die Wache, dort das Krankenhaus und drüben ist die Schule. Die Klos sind draußen, die Kanalisation ist Schrott …«
Michelle verschränkt die Arme vor der Brust. Die blaue Jeansjacke schließt sich wie ein Panzer. Sie sieht ihn hasserfüllt an. »Idiot. Das ist nicht lustig.«
Sie dreht sich um, lässt den Kopf hängen und geht. Jegor schwitzt, sein Lächeln verzieht sich zur Grimasse, aber er findet keine Worte, um sie aufzuhalten. Das war’s, gleich hat er sie für alle Ewigkeit verloren. Nach dieser Unterhaltung würde er ja selbst nie wieder mit sich reden, und sie erst recht nicht … Echt jetzt, Idiot!
Jetzt muss er sich etwas einfallen lassen, schnell! Verzweifelt knautscht er Worte aneinander und stammelt irgendeinen Schwachsinn: »Ich hab ein Lied gemacht … geschrieben … Ich kann’s dir vorspielen, wenn du willst …«
Zum Glück kann sie ihn nicht mehr hören.
Michelle berührt den Türgriff ganz vorsichtig: Er knarzt, die Tür knarzt, die dick lackierten Kieferndielen knarzen, einfach alles knarzt in dieser verdammten Wohnung. Großvater witzelt immer, man liefe wie auf einem Minenfeld – ein falscher Schritt und: Peng! Mit Minenfeldern kennt Opa sich aus, im Krieg war er Pionier. Wenn Oma sie hört, ist sie geliefert.
In den Tiefen der Wohnung vibriert es sehnsüchtig-krächzend:
Rotes Zwielicht zeichnet feurig
Einen Horizont der Nacht
Ich komme zu dir, in die Weite
Um zu halten Feldandacht.
Meine Last zieht schwer nach unten
Doch mein Aug’ ist himmelblau
Weiß ich doch, wir sind verbunden
Über Mutter Erdes Tau.
Großmutter leiert melodramatisch und voller billigem Pathos ihren Jessenin herunter. Mit Lippen, die nicht mehr gehorchen wollen, wiederholt sie die immer gleichen Verse, versucht, auf diese Weise das Vergessen aufzuhalten.
Wir gelangen durch die Felder
Zu der Wahrheit vor dem Kreuz
Mit dem Licht des Taubenbuches
Werd ich stillen deinen Durst.
An der Türschwelle schlägt Michelle der säuerliche Geruch nach Alter entgegen. Die Luft ist zäh wie Wasser. In einem Sonnenstrahl wirbelt goldener Staub wie Plankton unter der Lampe eines Tauchers. Das Gesäusel verstummt.
Michelle macht einen Schritt, noch einen, und sofort tönt es aus dem Zimmer:
»Nikita? Nikita!«
Michelle stößt genervt die Luft aus der Lunge, die ihr eigentlich dabei helfen sollte, über den knarrenden Fußboden zu schweben.
»Nikita! Bist du das? Wer ist denn da?«
»Ich bin’s, Oma!«, ruft Michelle schließlich widerstrebend.
»Und wo ist Opa?«
»Der hat Dienst, Oma!«
Jetzt muss sie schnell zu ihr ins Zimmer, sonst bekommt die Alte noch Angst und fängt womöglich an zu weinen. Vor dem Schlaganfall war sie hart wie Granit; nicht einmal, als ihre Tochter im von der Außenwelt abgeschnittenen Moskau umkam, hat sie vor der Enkelin geweint. Aber jetzt bricht sie bei jeder Kleinigkeit in hilflose Krokodilstränen aus.
Abgesehen von ihrem rechten Arm ist sie vom Hals abwärts gelähmt. Sie hebt den Kopf, reckt sich in Michelles Richtung, runzelt ängstlich die Stirn, lächelt, als sie sie endlich erkennt, und lässt den Kopf zurückfallen. »Holst du mir Opa?«, fragt sie fordernd, aber auch auf eine kindliche Art.
»Er kommt nach seinem Dienst, Oma. Was willst du denn von ihm? Soll ich die Bettpfanne leeren? Dich waschen? Das kann ich doch machen«, sagt sie betont ruhig. Aber so klingt es erst recht böse. Ob die alte Frau die Wut in ihrer Stimme wohl hört? Dafür würde Michelle sich schämen.
»Nein, nein, Kindchen, danke.«
»Was dann?«
»Gar nichts, Kindchen. Ich warte einfach auf ihn.«
Großmutter versucht, dankbar zu lächeln, aber die linke Hälfte ihres Mundes ist taub, und anstatt eines Lächelns bringt sie nur ein schiefes Grinsen zustande.
Der ganze Raum ist mit altem Zeug vollgestopft. Im Glasschrank stehen traurige Hündchen mit abgeschlagenen Ohren, kleine Matrosenjungen, von deren Augen längst der Lack abgerieben ist; auf der Kommode stapeln sich Kisten mit obskurem Plunder, alles bedeckt von einer dicken Staubschicht.
Der säuerliche Mief treibt einem Tränen in die Augen. Erst recht, wenn man von draußen kommt.
Michelle verlässt das Zimmer so schnell sie kann, lehnt die Tür an und hört, wie die Großmutter wieder ihre Leier anstimmt:
Ganz in Weiß die Birke
ich vorm Fenster fand,
schneebedeckt im silbern
leuchtenden Gewand …
Natürlich weiß Michelle, wofür Oma ihren Nikita braucht. Sie kennt die Gespräche in- und auswendig, die sie mit ihm führen will. Oma tut ihr leid, aber Opa noch mehr, und deshalb wird sie ihn auch nicht suchen oder ihm ausrichten, dass Oma nach ihm gefragt hat.
Sie geht in die winzige Küche, zieht die Tür hinter sich fest zu, setzt sich auf ihren Hocker und fischt die Kopfhörer aus der Hosentasche, um Großmutters Gemurmel mit Musik zu übertönen. Erst als sie zum Handy greift, fällt ihr wieder ein, dass es tot ist.
Michelle starrt unwillkürlich, aus Gewohnheit, auf den leeren schwarzen Bildschirm und sieht darin nur sich selbst. Vor Kurzem noch war da eine ganze Welt, ihre ganze Moskauer Vorkriegswelt. Die Eltern – noch am Leben –, die Fünfzimmerwohnung im Stadtzentrum und das Haus auf dem Land, auf Hochglanz polierte Prospekte und gepflasterte Straßen, ihre hippen Schulfreunde, Cafés mit unterwürfigen Kellnern und den tollsten Speisen.
Lauter Videos von lachenden Menschen. Videos mit Papas Belehrungen.
Und Musik – der Soundtrack zu ihrem früheren Leben. Diese ganzen Jahre auf dem Wachtposten hat sie pausenlos ihrer Vergangenheit nachgelauscht, versucht, ihre coole schöne alte Musik über das hässliche neue Bild zu legen. Es hat nicht wirklich funktioniert, aber man konnte immer noch die Augen schließen.
Das geht jetzt nicht mehr.
Polkan tritt in den Hof hinaus und betrachtet seine Festung.
Für die Garnison ist sie eigentlich zu groß, aber einen besseren Ort hätte man dafür nicht finden können. Vor dem Zerfall war das hier die Reifenfabrik der Stadt; schon damals war das riesige Gelände mit einer von Stacheldraht gekrönten Betonmauer gesichert worden, und an den Zufahrten hatten die früheren Besitzer Kontrollposten aufgestellt. Die himmelhohen teerschwarzen Schornsteine hätten vortreffliche Aussichtstürme abgegeben – bei noch so dichtem Nebel hätte man über den Fluss und bis zum Horizont gesehen. Für die Kampfbomber waren sie jedoch ein leichtes Ziel gewesen, also waren sie nicht lange stehen geblieben.
Jetzt patrouillieren tagtäglich Streifen um all die vielen Hektar, Schäferhunde schnüffeln entlang der Grundstücksgrenze, ob auch niemand die Mauer untertunnelt oder übersprungen hat; die Wachen beziehen in den dunklen Backsteingebäuden der Fabrik Position und kehren bei Nacht in die Kommune zurück.
Die Kommune liegt am Rand der Fabrik: zwei niedrige Plattenbauten, ein paar Garagen, ein Hof. In einem Gebäude war früher die Verwaltung untergebracht, im anderen Einheitswohnungen, für die einfachen Arbeiter, die sich von Monatslohn zu Monatslohn hangelten; die meisten waren Angestellte der Reifenfabrik, die ihre Wohnung für ihren treuen Dienst bekommen hatten. Aber es gab auch noch andere, die sich zum Marktpreis ein paar Quadratmeter mit Blick auf die Gleise gesichert hatten.
Als das normale Leben mit seinen Krediten und Löhnen zusammengebrochen und die russische Bevölkerung beträchtlich geschrumpft war, versetzte man die Grenze der erschlossenen und zivilisierten Welt näher an die Hauptstadt, indem man sie am Fluss entlangzog. Die Überlebenden fanden sich wieder zusammen. Und weil es nicht sehr viele waren, gab es auch wenig Anlass zum Streit. Einsam und verlassen in seiner alten Wohnung zu hocken, ohne Fensterscheiben, womöglich ohne Wände, war nicht nur trostlos, sondern gefährlich. Außerdem wärmt der Mensch sich ja gern an seinesgleichen …
Und so drängten sie sich, als wären sie ohne Feuer im winterlichen Wald gelandet, auf dem Wachtposten in der ehemaligen Reifenfabrik zusammen, verschanzten sich hinter den Betonmauern, richteten sich im ehemaligen Wohnheim und dem Verwaltungsgebäude häuslich ein, setzten in den Garagen ein paar Werkstätten in Betrieb, stellten Wachtürme auf, schworen einen Treueeid auf Moskowien und machten irgendwie weiter – am Rande der Welt.
Theoretisch war die Welt zwar noch rund, aber daran glaubte längst nicht mehr jeder, und jemanden, der es einem hätte erklären können, gab es erst recht nicht mehr. Die geopolitische Karte war geschrumpft, dafür hatten die dunklen Flecken darauf zugenommen; eigentlich hätte auch Jaroslawl neu kartiert werden müssen, aber wer ging schon freiwillig in die Stadt.
Ein paar Wohnungen wurden zu Gemeinschaftsräumen umfunktioniert, aus einer machte man einen Klubraum, aus einer anderen die Kantine, in der dritten war jetzt die Krankenstation, in der vierten – Kindergarten und Schule zusammen. Denn Kinder wurden auch weiterhin unbeirrt gezeugt: Das Leben ging seinen Gang, und die, die ihre Familien im Krieg verloren hatten, suchten nun untereinander Trost und Vergessen. Stärker als die Liebe knallt nur Klebstoff – aber den muss man erst mal finden.
Polkans erste Frau hat ihn noch vor dem Zerfall verlassen und sich in Richtung Koroljow abgesetzt. Polkan war damals Polizeichef im Bezirk Leninski, kam immer blau nach Hause, und seine Frau musste darunter leiden – manchmal bekam sie auch ein paar Schläge ab. Eines Tages war sie einfach weg, zurück blieb nur ein Abschiedsbrief. Kinder hatten sie keine, aber einer Scheidung hätte er nie zugestimmt, das hatte er sich geschworen; gesucht hatte er trotzdem nicht nach ihr, obwohl ihm das sein Dienstgrad leicht gemacht hätte. Und dann war die glückliche neue Ära auch schon vorbei, und sämtliche Papiere des alten Russland verloren ihre Gültigkeit.
Schon damals hatte Polkan ein Auge auf Tamara geworfen. Aber sie war nicht allein – es gab sie nur im Doppelpack mit Jegor. So wie Polkan nicht daran dachte, nach seiner ersten Frau zu suchen, so wartete Tamara nicht auf Jegors Vater. Aus irgendeinem Grund wusste sie genau, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilte, und sah sich von allen ehelichen Pflichten entbunden. Tamara wusste viele Dinge – sie wusste sie einfach und Punkt.
»Ein Auge auf sie geworfen« – so hat es Polkan später selbst formuliert. Wer dabei war, erinnert sich ganz anders: »Hals über Kopf in sie verschossen«. Ja, Tamara war schön für ihr Alter. Aber dass Polkan sie, eine Zigeunerin, ernsthaft lieben könnte, nicht nur für eine Nacht, und dass er auch noch ihren Zigeunerjungen wie einen Sohn aufnehmen würde, damit hatte sie nicht gerechnet.
Ein halbes Jahr lang hatte er sie umworben, war auf den Knien herumgerutscht, hatte sie mit seinem öden Polizistengehabe zu beeindrucken versucht und geschworen, Jegor ein guter Papa zu werden; dabei war er nicht mal die schlechteste Partie für die geschiedene Vierzigjährige: Er war schon damals Kommandeur des Grenzübergangs, der später zum Wachtposten wurde.
Einen Monat nachdem ihn Tamara erhört hatte, begann Polkan, weniger zu trinken; seine Hand erhob er gegen seine neue Frau auch nie.
Ein Papa wurde er für Jegor aber nicht, und Jegor wurde ihm auch kein Sohn.
Anders als Tamara war Jegor nicht davon überzeugt, dass sein richtiger Vater tot war. Nach dem kam er offenbar auch – er hatte seine Wangenknochen und mandelförmigen grauen Augen. Von seiner Mutter hatte er weder die dunkle Haut noch die schwarzen Haare geerbt.
Erst recht wäre nie jemand auf die Idee gekommen, dass Jegor Polkans Kind sein könnte – diesem bulligen Koloss mit wulstigen Lippen und einem Kopf, der direkt aus den Schultern wuchs.
Aber aus Respekt vor Polkan wurde Jegor auf dem Posten nicht einmal hinter seinem Rücken Zigeunerkind genannt.
Man nannte ihn immer nur »Polkans Jungen«.
Jegor schaut zu den glutroten Umrissen der Plattenbauten, die sich hinter den Gleisen abzeichnen. Da rottet Jaroslawl allmählich vor sich hin. Soll er es dort versuchen? Vielleicht hat er ja Glück.
Das wäre doch was, wenn er einfach so ein Handy findet. Am besten noch ein iPhone. Und es ihr bringt, als wäre nichts dabei: Hier, das lag bei mir rum, ich dachte, vielleicht kannst du es gebrauchen, deins ist doch letztens abgeschmiert.
Oder nein.
Noch besser: Er erzählt ihr haarklein, was er alles durchgemacht hat, um es zu bekommen. Wie schwer es war, sich vom Posten wegzuschleichen, was er den Wachen vorgelogen hat und von wem er den Tipp mit der Wohnung hatte, in der die mittlerweile verstorbenen Bewohner das nagelneue iPhone gebunkert hatten. Ein neues mit Originalverpackung wäre echt cool; das würde Michelle hundertpro zu schätzen wissen!
Er könnte den Wachen erzählen, Polkan hätte ihn zum Checkpoint geschickt, aber am Ende rufen sie seinen Stiefvater an, und der verpetzt ihn bei seiner Mutter, und die dreht wieder durch, weil sich ihr kleiner Liebling in schreckliche Gefahr begibt. Wenn’s nach ihr ginge, würde er den ganzen Tag im Hof herumsitzen und Stöckchen schnitzen.
In den halb verfallenen Fabrikanlagen gibt es einen Bunker. Der Eingang befindet sich auf dem Fabrikgelände, aber die unterirdischen Gänge führen weit drüber hinaus. Dort ist es eine schwere Eisentür mit Ventilschloss, wie bei einem U-Boot: Jegors Geheimweg, den außer ihm niemand kennt.
Niemand außer ihm – und Polkan. Der hat ihm den Weg damals gezeigt, streng vertraulich natürlich, um damit Jegors Freundschaft zu gewinnen. Für eine Freundschaft hat es aber nicht gereicht.
Jegor nimmt eine verkürzte Kalaschnikow aus dem Wächterhäuschen, sucht nach der Gasmaske, die er im Bunker versteckt hat, klettert durch die Luke und hinter die Mauer, dann steigt er auf sein Board und rollt an den Gleisen entlang Richtung Stadt. Die Strecke führt direkt bis zum Bezirk Leninski, Polkans ehemaligem Revier.
Hinter dem Tor hat man die Wahl zwischen der Straße der Sowjets und dem Prospekt der Republik – beide führen vom Fluss weg ins Stadtzentrum.
Jaroslawl ist eine Stadt wie jede andere: Hier ein paar Stalin-Bauten, dort ein Plattenbau, da der dreistöckige Glaskasten einer Shoppingmall, ein Spielplatz, eine Müllhalde, eine von Tauben zugeschissene Leninstatue und eine Kirche mit bröckelndem Putz. Rostige Autos stehen wie leere Fischkonserven im ewigen Stau; Steppenläufer und knorrige Astgebilde, die vor dem Krieg mal Bäume waren und jetzt wie irre wuchern, weil sich niemand mehr um sie kümmert.
Die Bewohner des Postens gehen nicht gern in die Stadt, höchstens an Allerseelen anstatt auf den Friedhof. Sie kommen hin, stehen ein bisschen rum, seufzen, kippen ein Gläschen auf die Toten. Erinnern sich beim Anblick der vernagelten Fenster an damals, schmunzeln über ihre Sorgen von früher, beweinen leise die Gefallenen, und das war’s.
Aber Jegor mag die Stadt. Hier kann man wenigstens anständig skaten.
Der Asphalt ist noch völlig in Ordnung, nur hier und da reißen Wurzeln die graue Oberfläche auf oder unterbrechen ein paar Granattrichter die Bahn, aber so macht’s nur noch mehr Spaß.
Mutter kann sich ihre Paranoia sparen – in der Stadt ist nichts, womit die Polizei-Kalaschnikow nicht fertigwürde. Nach dem Krieg ist der Wald den Häusern natürlich auf die Pelle gerückt und hat die Vororte geschluckt. Und mit ihm sind auch alle möglichen Waldbewohner näher gekommen. Wer glaubt, im Krieg würden alle Viecher aussterben, hat keine Ahnung. Aber es sind bloß Tiere. Menschen meiden sie von sich aus, wittern das Schießpulver und Schmieröl auf einen Kilometer Entfernung und fressen sich hauptsächlich gegenseitig.
Und wenn’s am anderen Ufer von Monstern nur so wimmelt – über den Fluss kommen sie genauso wenig wie die Menschen.
Unter den Oberleitungen rollt Jegor zum Busbahnhof, vorbei an am Asphalt festgeschmolzenen Bussen, zur ausgebrannten Mall mit dem »Spielwaren«-Schild, das wie durch ein Wunder das Feuer überdauert hat. Im Einkaufszentrum war früher ein Handyladen, das weiß er noch genau: gleich hinter der Fressmeile im Erdgeschoss. Früher ging nichts so gut wie Handys, jeder hatte eins. Wo sind die Dinger alle hin, verdammt?
Er rollt auf seinem Board direkt ins Gebäude; an der Decke klafft ein Riesenloch, durch das fahles Licht und welkes Laub hineinfallen. Die dunklen Ladenflächen sind leer. Natürlich wurde die Mall längst geplündert. Kaum war der Krieg ausgebrochen, schleppten die Leute alles raus, was nicht niet- und nagelfest war. Daran konnte auch der Schießbefehl nichts ändern.
Ein ausgebranntes Café, eine ausgebrannte Crêperie, ein ausgebrannter Burger-Laden.
Da ist es! Schwarz-gelbe Aushänge und eine zerschmolzene junge Frau auf einem Plakat: Eine Gesichtshälfte lächelnd, die andere verkohlt.
Jegor stochert mit der Stiefelspitze im versengten Plastik herum, schaut im dunklen Lager nach. Nichts – war ja klar. Irgendwo tropft Wasser, durch die Rohre pfeift der Wind wie in eine Flöte. Die Ratten rascheln. Unwillkürlich verbindet Jegor die Tropfen zu einer Melodie, die Worte kommen von allein:
Durch die Rohre pfeift der Wind wie in eine Flöte
Schwere quecksilberne Tropfen
Dumpfes sinnloses Geklopfe
Tik tak tik. Sie liebt mich
Sie liebt mich nicht
Jegor bleibt stehen, er kann nicht aufhören, die angekokelte Frau anzustarren. Er schließt die Finger um den Griff der Gitarre, die Polkan ihm weggenommen hat, und tastet in der Luft nach passenden Akkorden; bricht aber mittendrin ab.
Dann steigt er wieder auf sein Longboard und fährt weiter. Mit leeren Händen will er nicht zurück.
Dort, wo die Brücke das diesseitige Ufer erreicht, befindet sich der Checkpoint. Aufgetürmte Sandsäcke, ein Lagerfeuer, ein paar Menschen drum herum. Von hier aus führt ein Telefonkabel zum Wachtposten: Für den Fall, dass jemand auf der Brücke auftaucht, kann man sofort im Wachhäuschen am Tor oder direkt bei Polkan anrufen. Aber auf der Brücke hat sich seit Ewigkeiten niemand blicken lassen, deshalb gehen die Männer auch nur zum Wachdienst, um sich bei einem Schnäpschen den Klatsch des Tages anzuhören. Nachts ist es kalt, und der Chef hat auch nichts dagegen.
Der Checkpoint ist weit genug vom Ufer entfernt, dass man die Ausdünstungen des Flusses nicht einatmen muss. Der Nebel ist dicht und schwer, wie aus Kautschuk: Er verweht nicht, als würde er vom Wasser angezogen. Wenn man einen Scheinwerfer darauf richtet, versinkt der Lichtstrahl augenblicklich im giftgrünen Morast, verliert alle Kraft und kommt kein Stück weiter – er wird gebrochen und verteilt sich gleichmäßig in alle Richtungen. Dann wirkt der Nebel wie eine weiche, aber undurchdringliche Wand. Wie eine Blase, in der sich der Posten und der ganze Rest Moskowiens befinden. Hinter der Wand schweben vielleicht ganze Galaxien durch die Dunkelheit, aber möglicherweise ist da auch gar nichts. Wahrscheinlich eher nichts, zumindest nichts, was man sehen kann.
»Na … Lenka, die Rothaarige, ist doch klar. Sag mir lieber, wem sie nicht gefällt, dann bist du schneller durch. Lenka hält hier doch alles zusammen.«
Die Männer lachen. »Also, ich würd’ ja mal mit Michelle«, sagt der rothaarige Kolka Kolzow entschlossen.
»Hoho, Michelle! Habt ihr das gehört, Jungs?«
»Michelle, Miss Sensationell!«
»Mit der würde jeder mal! Geh lieber zur rothaarigen Lenka oder kurz mal rüber nach Schanghai, Kolzow. Nicht dass du platzt, während du auf deine Michelle wartest!«
Bei der Wache reden die Männer gern. Sobald man verstummt, beginnt nämlich der Fluss zu reden – er gluckst und rumort, als würde er jemanden verdauen, und manchmal gibt er Geräusche von sich, die sich mit Worten gar nicht beschreiben lassen.
Plötzlich springt Jamschikow auf, tippt Anton, der gerade an der Flasche nuckelt, auf die Schulter und blinzelt ängstlich zur Brücke herüber. »Hat da grad jemand was gemurmelt?«
Anton setzt den Flachmann ab, lauscht jetzt auch angespannt und dreht sich zu Jamschikow um. Sein Gesichtsausdruck ist so jämmerlich, dass Jamschikow triumphierend gluckst: Wieder geschafft! Der Junge fällt aber auch jedes Mal drauf rein.
»Arschloch. Hab mich fast verschluckt wegen dir! Das brennt im Hals!«, brummt Anton.
Anton schraubt den Deckel auf den Flachmann – Jamschikow kriegt keinen Tropfen mehr ab. Der biegt sich immer noch vor Lachen. Er weiß, dass Anton sich aus unerklärlichen Gründen vor dem Checkpoint fürchtet. Alle wissen das – deswegen haben sie unter sich ausgemacht, Anton mindestens einmal pro Schicht zu erschrecken. Viel Unterhaltung gibt’s auf dem Posten nicht, da nimmt man, was man kriegen kann.
»Klingt doch wirklich so, oder? Und jetzt, hörst du das? Als ob da wer schnarcht! Findest du nicht?«
Als Jegor den hohen Plattenbau erreicht, hat sich die Stadt bereits wie ein Schwamm mit Dunkelheit vollgesogen. Er knipst seine Taschenlampe an und geht hinein.
Im Hausflur häuft sich angewehtes Laub, hier und da liegen kleine Skelette und vertrocknete Kotkringel herum, beim Müllschlucker in der Ecke hat jemand schimmlige Steppjacken zu einem Nest zusammengetragen – aber was hier auch war, von seinem und sonstigem Leben fehlt längst jede Spur. Die Aufzüge stehen still, in den Kabinen herrscht Dunkelheit.
Jegor geht von einem Stockwerk zum nächsten, rüttelt an den Türklinken der verlassenen Wohnungen.
Manchmal scheint ihm, als würde sich etwas bewegen, aber das ist sicher nur der Wind, der die Fensterrahmen und Küchenschranktüren zuschlagen lässt.
Endlich findet Jegor eine Tür, die nicht abgeschlossen ist, und geht in die Wohnung.
Am Küchentisch sitzt eine Mumie in Regenjacke. Die schwarzen, gekrümmten Hände liegen auf dem Tisch. Die Augen wurden von Vögeln ausgepickt.
Jegor setzt sich ans andere Tischende.
»Hi, wie geht’s?«
»Geht so. Hab irgendwas an den Augen.«
»Das ist echt Kacke, Mann. Was gibt’s sonst Neues?«
»Was soll’s schon Neues geben, Kumpel? Ich hock seit Jahren in der Bude hier.«
»Hast nichts verpasst. Ist nicht viel los da draußen.«
»Steht Moskau noch?«
»Wie eine Eins.«
»Was Neues von drüben?«
»Gar nichts. Kein Anruf, kein Brief. Wie heißt du eigentlich?«
»Semjon. Semjon Semjonytsch. Und du?«
»Ich bin Jegor. Jegor Batkowitsch.«
»Danke, dass du vorbeischaust, Jegor Batkowitsch. Ich freu mich, wenn alle fünf Jahre mal wer Hallo sagt.«
»Ach, kein Ding, ich wohne hier gleich um die Ecke. Hör mal, Semjon, kann ich dir in die Taschen greifen? Ich brauch dringend ein iPhone. Eine Braut, die ich kenne, hat ihres geschrottet, und da dachte ich … Jedenfalls, ich will ihr eins schenken.«
»Ist sie hübsch?«
»Megahübsch, Mann. Aber mich guckt die mit dem Arsch nicht an. Bin ihr zu jung und so, du weißt schon.«
»Na ja … ich stehe normalerweise nicht so drauf, wenn mir ein Typ an die Wäsche will. Aber wenn’s um ne heiße Schnecke geht …«
»Richtig heiß. Echt.«
»Also gut. Mach ruhig.«
»Was hat dich eigentlich weggerafft, Semjon Semjonytsch? Du bist doch nicht … irgendwie ansteckend?«
»Ich glaub nicht. So lange überlebt das Zeug nicht. Greif ruhig zu, zur Not wäschst du dir halt die Hände.«
»Alles klar. Danke. Ich bin auch vorsichtig.«
Jegor schiebt die Hände in Semjon Semjonytschs Taschen, der versucht, Haltung zu bewahren. Natürlich sind die Taschen leer. Jegor wischt sich die Hände ab, geht durch die Wohnung, schaut in den Schränken nach, aber bei Semjon Semjonytsch ist nichts zu holen.
Jegor durchforstet noch zwei weitere Wohnungen.
Beide sind völlig verwüstet. Die Schränke und Kommoden ausgeweidet, der ganze Inhalt auf dem Boden verteilt und kaputt getreten; von den anderen Möbeln fehlt jede Spur. Überall Bücher mit herausgerissenen Seiten, unter den Schuhen knirscht der Kristallsand von zerbrochenen Gläsern und Sektkelchen.
Vor dem Fenster färbt sich die Stadt von Scharlachrot zu Schwarzblau – die Sonne ist untergegangen.
Es wird Zeit.
Jegor wirft seine AK über die Schulter, greift sich sein Brett und rollt zurück über den rissigen Asphalt.
»Komm, lass uns heimgehen, Opa!« Michelle sieht Großvater Nikita bittend, aber auch streng an; der alte Nikita deutet auf sein Glas, das noch halb voll ist.
»Noch nicht!«
»Sie ruft nach dir. Sie kann nicht schlafen.«
Nikita schaut trübselig in die Runde. Die anderen beiden alten Knacker, Nikitas langjährige Freunde aus Fabrikzeiten, seufzen nur – schon gut, Kumpel, wir wissen Bescheid. Sie stoßen noch schnell an, kippen den trüben, selbst gebrauten Schnaps runter – Michelle nennt das Zeug »Craft« –, dann steht Nikita ächzend auf. Er stützt sich auf die Enkelin und setzt nicht ohne Mühe einen Fuß vor den anderen – das halbe Glas macht sich bemerkbar.
»Was sagt sie?«
»Na was wohl? Wo ist Opa? Und dazu noch in Endlosschleife ihre ›Birke‹.«
Am Hauseingang sehen sich die beiden kurz in die Augen, da packt Michelle ihn am Ärmel. »Opa, ich kann nicht mehr!«
»Geht das wieder los.«
»Wirklich. Ich geh hier ein.«
»Nun übertreib mal nicht.«
»Ich mein’s ernst.«
»Ich mein’s auch ernst, Schätzchen. Denk doch mal nach: Wenn deine Eltern noch am Leben wären, glaubst du denn wirklich, sie hätten dich nicht längst geholt? Dein Vater war verrückt nach dir. Ständig hat er dich auf seinen Schultern rumgetragen, keine zwei Schritte bist du selbst gelaufen … Wie viele Jahre haben wir jetzt nichts von ihnen gehört? Nun zähl doch eins und eins zusammen, hm?«
Michelle holt tief Luft. Wie oft schon ist ihr Gespräch an eben diesem Punkt gescheitert: an ihrem sturen Unwillen, sich einzugestehen, dass ihre Eltern längst tot sein könnten. Sie sieht ihren Großvater direkt an. »Ja, und? Dann sind sie eben tot. Was ändert das?«
»Und wo willst du dann hin?«
»Zu Onkel Mischa. Oder Tante Sascha.«
»Und anrufen konnte er wohl nicht, in all den Jahren? Warum hat er nicht angerufen, dein Onkel Mischa?«
»Dann hat er eben nicht angerufen. Mir doch egal!«
»Komm, Michelle. Gehen wir rein.«
Sie schüttelt den Kopf, trottet aber hinter ihm die Treppe hoch. Nachbarn kommen ihnen entgegen, aus offenen Türen blendet sie grelles Licht, man hört Kinder lachen und weinen, irgendwo streitet ein Ehepaar und denkt gar nicht daran, die Tür dabei zuzumachen. Die Kommune heißt ja nicht umsonst so – es ist eine einzige, auf vier Stockwerke verteilte Kommunalwohnung. Als könnte man da Geheimnisse voreinander haben. Oder ein Privatleben.
Die Tür knarrt natürlich, wie immer, die Großmutter hört es sofort. »Nikita! Bist du es? Nikita!«
»Ja, Marussja, ich bin es!«
»Komm her, Nikita. Ich muss mit dir reden. Komm.«
Michelle setzt sich in die Küche und starrt die Wand an. Ohne Handy kann man sich hier gleich die Kugel geben!
»Was ist denn, Marussja?«
»Ich will, dass wir heiraten, Nikita! Kirchlich heiraten.«
»Wozu denn das noch?«
»Wir müssen uns vor Gott das Jawort geben, Nikita. Ich sterbe bald. Wie sollen wir uns denn dann finden im Paradies? Du wirst mir doch fehlen. Ich dir nicht?«
»Du mir auch, Marussja. Du mir doch auch. Aber wer sagt überhaupt, dass ich ins Paradies komme?«
»Sag doch nicht so was! Hast du wieder getrunken?«
»Eben. Soviel ich weiß, nehmen die da keine Säufer. Dein Erzengel Michael sagt an der Tür: Hauch mich mal an! Und lässt mich draußen stehen. Oder wer steht da noch mal an der Pforte? Michael oder Gabriel?«
»Ein Dummkopf bist du! Warum sagst du so was?«
Die Alte schluchzt und wimmert. Michelle steht auf, presst ihre Stirn gegen die kalte Fensterscheibe, schaut auf den Hof hinaus.
»Verzeih mir doch, es war ein dummer Scherz, du hast ja recht. Aber wer soll uns denn trauen? Es gibt ja nicht mal wen für die Totenmesse, und du redest von Hochzeit. Soll das Polkan machen oder wer?«
»Dummkopf!«
»Hey, Jamschik … leuchte mal!«
»Wo hättest du’s denn gern?«
Jamschikow lacht, aber diesmal lässt sich Anton nicht so leicht abwimmeln. Er schaut gebannt auf die Brücke, von der niemand mehr weiß, wie lang sie eigentlich ist, und den glucksenden Nebel. Es ist, als würde sich darin tatsächlich etwas regen, zusammenbrauen, wachsen. Näher kommen.
Anton ist sechsundzwanzig. Seine Augen sind jung, er liest nicht gern, dafür schießt er wie ein Profi. Und Jamschikow könnte zwar einen Eber mit seinen bloßen Händen erlegen, so furchtlos ist er – aber auch ein wenig altersblind.
»Leuchte mal da hin! Mach schon! Da, zur Brücke.«
»Zur Brücke?«
Jamschikow prustet wieder los, Anton reißt ihm die Taschenlampe aus der Hand und richtet den gelben Lichtstrahl auf die grüne Wand.
»Da! Siehst du’s nicht?!«
Seine Hände zittern so, dass er die Taschenlampe kaum halten kann. Der schwache Lichtstrahl reicht ohnehin kaum bis zur Nebelwand, rutscht immer wieder von dem dunklen Fleck, der sich im grünen Schleier abzeichnet.
Aber der Fleck wird immer größer, und bald sehen ihn auch die anderen, selbst der kurzsichtige Jamschikow, der bis zuletzt geglaubt hat, man würde ihn verarschen.
Der zähe Nebel klebt an dem Etwas, hüllt es ein, lässt seine Umrisse nicht erkennen. Es bewegt sich sonderbar, ungleichmäßig, als würde es ruckartig, stoßweise kriechen und dabei von rechts nach links schwanken. An die zwei Meter groß muss es sein, wenn nicht drei. Ein langer, dürrer Körper, auf dem ein riesiger Kopf zu stecken scheint.
Die Männer auf der Wache stehen wie angewurzelt da und beobachten, wie es näher kommt – als wären alle Anweisungen wie weggeblasen. Zu sehr haben sie sich an den Gedanken gewöhnt, dass auf der anderen Seite nichts ist, dass von dort gar nichts kommen kann. Nichts und niemand.
Und erst als es schon in voller Größe durch die grüne Nebelwand schimmert, als endgültig klar ist, dass das hier gerade wirklich passiert, kommt Jamschikow zu sich. »Stehenbleiben! Wer ist da?«, schreit er.
Aber das Wesen bleibt nicht stehen. Es rückt weiter stur auf den Checkpoint zu, kommt näher, Schritt um Schritt um Schritt …
Jamschikow tastet nach seinem Maschinengewehr, richtet den Lauf in den tiefen, trüben Himmel – wie auf einer unsichtbaren Glasscheibe verteilt hängen die Wolken direkt über ihren Köpfen – und drückt den Abzug. Das Glas zerbricht nicht, der Himmel stürzt nicht ein, aber das Wesen kommt weiter direkt auf sie zu.
»Halt, oder ich schieße!«, brüllt Jamschikow.
Aber Anton nimmt ihm das Maschinengewehr weg. »Lass mich das machen. Leuchte du lieber mal …«
Jamschikow richtet den hüpfenden Lichtstrahl auf die näher kommende Gestalt. Der scharfsichtige Anton hat sie gleich im Visier. Sie ist immer noch vom grünen Schleier verhüllt, aber so ein Riesenschädel ist schwer zu verfehlen.
Anton atmet ein, atmet aus – und jagt dem Biest kniend das halbe Magazin in den Schädel.
Die Kugeln halten es nicht auf, nicht einmal kurz, als hätte Anton danebengeschossen … Oder als könnten Kugeln ihm nichts anhaben. Es setzt seinen Weg fort – unbeirrt, gleichmäßig, stur.
»An die Gewehre! Los, Männer!«
Jamschikow greift nach dem Telefonhörer: Beim Posten anrufen! Sie wenigstens warnen!
Da schält sich die Gestalt endgültig aus dem Nebel und gibt einen Ton von sich.
Ein wehmütiges, dumpfes, scheinbar menschliches – nein, ganz und gar unmenschliches Geheul.
»Wo ist Jegor?«
Polkan sitzt, Tamara hat sich vor ihm aufgebaut – groß, schlank, das schwarze, von Silberfäden durchzogene Haar ist zu einem engen Zopf gebunden, das silberne Kreuz hat sich aus dem Kragen befreit. Polkan zuckt mit den Schultern. »Treibt sich bestimmt irgendwo rum, dein Jegor. Was weiß ich!«
»Hast du ihm erlaubt, den Posten zu verlassen?«
»Gar nichts hab’ ich ihm erlaubt! Er hat mich angeschnauzt und ist abgehauen, du kennst ihn doch!«
»Er ist nicht im Hof.«
»Na und? Bestimmt ist er zur Fabrik und rollt auf seinem Brett herum.«
Tamara richtet sich auf.
»Ich habe geträumt: Uns droht Gefahr. Von drüben, von der anderen Seite.«
»Welche andere Seite, Tamarotschka?«
»Die Brücke. Es kommt über die Brücke gekrochen. Ein Schlangenwesen. Ein Drache …«
»Aha. Ein Drache, na klar.«
Polkan schiebt seinen Stuhl geräuschvoll zurück, macht einen Schritt zum Herd und hebt den Topfdeckel. Aus der Ecke blickt ihm entrückt Nikolaus der Wundertäter in einem Blechrahmen entgegen, und vom Nachttisch glotzt die Matrona von Moskau herüber, schwarz-weiß – nicht als Ikone, sondern noch zu Lebzeiten fotografiert; deshalb schaut sie auch nicht wohlmeinend, sondern finster und misstrauisch, wie es sich für Menschen aus Fleisch und Blut gehört. Die ganze Wohnung ist voll von diesen Heiligenbildern. Schlimmer als in der Kirche.
»Ein Drache … kommt gekrochen, er wird großes Unheil bringen.«
Tamaras hat die Augen zu einem Schlitz zusammengekniffen, ihr Blick durchbohrt Polkan. Der gähnt demonstrativ. »Geht das wieder los, immer dieses Geschwätz! Um Gottes Willen, Tamara, fang du nicht auch noch damit an! Ein Drache! Wenigstens im übertragenen Sinn? Oder ist der auch noch echt, dein Drache? Menschenskinder, gibt’s denn gar keinen Nachschlag?«
»Ich hab Angst um Jegor. Er war auch da, im Traum, etwas Schlimmes ist geschehen …«
»Jetzt ist aber mal gut mit deinen Weissagungen oder wie du das nennst … Dem passiert schon nichts, treibt sich ein bisschen rum und taucht dann wieder auf! Erklär mir lieber mal, warum so wenig Eintopf da ist? Oder hast du nur für uns beide gekocht?«
»Mein Junge, mein armer Junge …«
Tamara verdreht die Augen und sinkt langsam zu Boden. Polkan lässt seinen Löffel fallen, stößt den Stuhl beiseite und greift seiner Frau gerade noch rechtzeitig unter die Arme, damit sie nicht auf den Fußboden knallt.
»Was machst du denn! Immer steigerst du dich da so rein! Wie lange soll das noch so weitergehen? Du treibst uns noch alle in den Wahnsinn, dich selbst und mich gleich mit! Tamara! Tama-ara! Komm doch bitte zu dir, verdammte Scheiße!«
Plötzlich donnert es in der Ferne, die Fenster beginnen zu klirren.
ZWEI
Jegor kommt über die Asphaltstraße zum Checkpoint gerast, springt von seinem Brett und schlägt sich durchs Gebüsch zu den Gleisen, wobei er haufenweise graue Kletten von den verdorrten Pflanzen mitnimmt.
»Haltet durch, Männer! Ich komme! Ich bin hier!«
Zum Glück war er in der Nähe, als beim Checkpoint das Geballer losging.
Zum Glück war er nicht schon beim Wachtposten. Gerade noch rechtzeitig! Oder?
Sobald er endlich an den Gleisen ist, krallt Jegor die Hand noch fester um den Schaft, blickt hektisch um sich – wer hat geschossen, wer hat angegriffen?!
Die Männer beim Checkpoint haben die Gewehre abgesetzt.
Sie starren gebannt in den Nebel, wie gelähmt – jetzt wirklich.
Wankend, gebeugt, bewegt sich etwas … jemand auf sie zu. Er geht und … nein, er heult nicht, er singt. »Heeerr, erbaaaarme dich …«
Jetzt sind die Worte deutlich zu hören; warum sie beim ersten Mal nicht zu verstehen waren, sieht man jetzt auch.
Er trägt eine zerschlissene schwarze Kutte, die auf der Brust entzwei gerissen ist. Die Fetzen blähen sich auf wie ein Segel und verzerren seine Umrisse. Ein schweres Eisenkreuz tanzt an einer Kette, prallt bei jedem Schritt von den Rippen ab, holt aus und schlägt wieder dagegen.
»Heeerr, erbaaaarme dich …«
Was im Nebel wie der riesige Kopf eines Ungeheuers ausgesehen hat, ist ein schmutziges Kirchenbanner, auf dem das handgemalte Antlitz eines weißbärtigen Greises prangt – erschöpft, leidend, die Brust von Bleikugeln durchlöchert.
Während sich die seltsame Gestalt die letzten Meter zum Schlagbaum schleppt, flüstern die Männer.
»Wie kommt der über die Brücke?«
»Wie viele Kugeln waren das?! Und der läuft einfach weiter …«
»Heeerr, erbaaaarme dich!«
Da – endlich sieht man alles.
In der einen Hand baumelt eine uralte grüne Gasmaske mit schmutzigen Gläsern: Die muss er getragen haben, als er über die Brücke ging. So hat er es geschafft. Durch den Schlauch klang sein Gesang wie das Geheul einer Bestie.
Sein Gesicht und die Arme sind von Wunden übersät, die Brust voller Schrammen. Die milchig weißen Augen quellen aus den Höhlen. Er blinzelt nicht. An den Füßen trägt er zerschlissene Turnschuhe, blutgetränkt. Der Bart ist zerzaust. Viel mehr ist von seinem Gesicht nicht zu erkennen – es ist überzogen von einer Kruste aus Dreck und Schorf.
»He! Wer bist du?! Woher kommst du?«
Der Mann antwortet nicht.
Fünf Schritte vor den Wachtposten die sich hinter der Brustwehr drängen, bleibt er wie angewurzelt stehen, lässt den steifen Arm mit dem Banner sinken und steckt es in den Schotter der Eisenbahngleise.
Dann sinkt er kraftlos auf die Knie und kippt zur Seite.
Vom Wachtposten her kommen Leute angerannt – Polkan und die Patrouillen. Sie scharen sich um den Eindringling und durchsuchen ihn. Er ist offenbar unbewaffnet. Sie packen ihn an Armen und Beinen und tragen ihn zum Posten. Polkan lässt ihn auf die Krankenstation bringen.
In der allgemeinen Aufregung nähert sich Jegor der Brücke so weit er kann – bis der Nebel in den Augen zu brennen und in der Kehle zu kratzen beginnt. Er blickt in das glucksende grüne Gebräu, horcht hinein …
Mal scheint es, als würde dort drüben jemand murmeln, dann wieder – ein Röcheln wie von einem Erstickenden. Aber außer diesem seltsamen Gast durchbricht niemand mehr die Nebelwand.
»Jegor! Ab nach Hause mit dir!«
Eine brennende Ohrfeige lässt ihn einen Moment lang taub werden.
Polkan packt ihn am Nacken, zerrt ihn mit sich.
Jegor flucht leise, aber Polkan jetzt zu provozieren, wagt er nicht. Egal, dafür kann er sich später revanchieren.
Polkan selbst zögert; er bleibt, nachdem er alle zum Teufel gejagt hat, noch kurz an der Brücke stehen. Dann spuckt er wütend in ihre Richtung aus und geht nach Hause …
Faina, die Chefärztin und überhaupt die einzige Ärztin der Krankenstation auf dem Posten, nimmt den Hörer ab. »Ja, Sergej Petrowitsch. Faina hier. Nein, immer noch bewusstlos. Eine Vergiftung. Die Gasmaske war uralt, er hat zu viel eingeatmet. Er stammelt nur wirres Zeug, man versteht kein Wort … Mache ich. Ich lasse ihn nicht aus den Augen … Danke … ja, verstanden.«
Die Betten der Krankenstation sind leer, nur auf einem liegt unter einer Flanelldecke zusammengerollt der dürre, ausgemergelte Mann. Seine Hände sind zerkratzt, die Beine von blauen Flecken übersät, die Arme zerschnitten, der Rücken vor lauter Schürfwunden angeschwollen. Man könnte meinen, er sei eine einzige blutende Wunde, ein einziges Geschwür. Als man ihn eingeliefert hat, war davon noch nichts zu sehen, so dick war die Dreckkruste, die seinen Körper und sein Gesicht bedeckte.
Nun wurde die Kruste abgewaschen, und man kann das Alter des Mannes annähernd schätzen: Knapp über dreißig dürfte er sein. Genauer lässt es sich nicht bestimmen – sein Gesicht ist wettergegerbt und zu einer Grimasse verzogen. Aber im dünnen, offenbar noch nie geschnittenen Bart ist kein einziges graues Haar. Der Bart ist hellbraun, genau wie sein Haar; welche Farbe seine Augen haben, kann die Ärztin nicht sagen, weil er sie noch kein einziges Mal geöffnet hat.
Seine Augäpfel zucken unter den dünnen, von roten Äderchen durchzogenen Lidern. Er wälzt sich im Bett und stöhnt, streitet mit jemandem, schreit erschrocken auf und murmelt wieder zusammenhangloses Zeug. Dann befolgt Faina Polkans Anweisungen und beugt sich sofort über den Schlafenden. »Wie heißt du denn, hm?«, fragt sie sanft und geduldig.
Er reagiert nicht. Nach einer Weile scheint allerdings doch etwas zu ihm durchzudringen, und er beginnt zu stammeln, verstummt aber gleich wieder. Faina hört angestrengt zu, seufzt und versucht es weiter. »Woher kommst du?«
Ihre Frage schafft es nicht, die Membran des Schlafs zu durchdringen, ihn aus seiner Ohnmacht zu holen. Sein Körper wird ganz steif, dann rollt er sich zusammen, zieht Arme und Kopf ein, will ganz unter der Decke verschwinden. Immer wieder wird er vom Fieber geschüttelt.
Faina hat mit Mitleid mit ihm, in den paar Tagen hat sie ihn fast lieb gewonnen. Sie hat ihn insgeheim Aljoscha getauft und entschieden, dass er kein schlechter Mensch ist, sondern bloß Schlimmes durchgemacht hat und unter Schock steht. Faina merkt, dass Aljoscha Angst hat, aber sie darf ihn nicht in Ruhe lassen – Polkan hat ihr befohlen, nicht nachzugeben, bis der Eindringling zu Bewusstsein kommt oder sich im Schlaf verrät. »Was siehst du?«
Irgendetwas sieht er, aber er will es ihr nicht sagen. Er windet sich nur immerzu im Bett. Faina streicht ihm über die heiße, hohe Stirn, entwirrt die verklebten Haarsträhnen und redet ihm gut zu. »Ruhig, ganz ruhig …«
Er scheint auf sie zu hören, beruhigt sich.
Die Ärztin setzt Teewasser auf, holt ein Sudoku-Heft aus dem Schrank – ein Weihnachtsgeschenk, das vom Schimmel noch fast verschont ist – und macht sich ans Rätseln.
Beim dritten Sudoku unterbricht sie ein Geräusch aus dem Krankenzimmer. Sie springt auf und läuft zum Bett ihres einzigen Patienten.
Die Laken sind zerwühlt, das Fieber schüttelt ihn, mit einer Hand umklammert er das Kreuz an seiner Brust – so fest, dass sich seine Finger weiß gefärbt haben.
Seine Augen sind offen.
Polkan hat nicht gerade freiwillig auf der Krankenstation angerufen. Ihm könnte dieser Pope ja egal sein. Aber seit er Moskau informiert hat, dass nach all den Jahren zum ersten Mal jemand über die Brücke gekommen ist, herrscht am anderen Ende der Leitung Hochbetrieb.
Die direkte Verbindung nach Moskau – ein beiger chinesischer Telefonapparat mit Ringelschnur und dem ausgeblichenen Aufkleber mit dem Doppeladlers vor der Krone – klingelt von früh bis spät. Der Posten ist für den Kabelabschnitt bis zum nächsten Bahnhof zuständig. Ab und zu wird er geklaut oder von Tieren durchgenagt, aber meistens ist auf die Verbindung Verlass. Kontaktaufnahme ist nur über Kabel erlaubt, Funkverbindungen sind seit dem Krieg verboten, damit der Feind nicht mithört. Früher kamen Anrufe aus Moskau allerdings ziemlich selten – wenn überhaupt, dann nur im äußersten Notfall. Moskau war es ganz recht, dass auf dem Posten nichts los war.
Polkan schaut auf die Uhr: zehn Uhr morgens.
Das Telefon klingelt auf die Minute genau.
Er geht ran. »Posten Jaroslawl!«, kläfft er wie ein Wachhund. »Pirogow am Apparat! Ich höre!«
»Pokrowski hier. Gibt’s was Neues?«
»Nein, Konstantin Sergejewitsch. Er ist immer noch bewusstlos.«
»Sind unsere Männer eingetroffen?«
»Welche Männer, Konstantin Sergejewitsch?«
»Sie wissen von nichts? Immer diese Geheimnistuerei. Ein Trupp ist unterwegs zu euch. Er müsste jeden Moment eintreffen.«
»Geht es um unseren, Sie wissen schon – Gast?«
»Das erfahren Sie früh genug.«
»Zu Befehl.«
»Also, bereiten Sie den Männern einen guten Empfang. Und kein unnötiges Geschwätz.«
»Verstanden.«
»Gut, Ende.«
»Einen Moment noch, Konstantin Sergejewitsch. Eine Frage, wenn Sie gestatten. Wir warten hier schon seit einer Weile auf die Lieferung … Die Fleischkonserven gehen uns aus. Und das Getreide wird knapp …«
»Und was hat das mit mir zu tun? Klären Sie das mit der zuständigen Abteilung. Dem Versorgungsdienst. Was soll ich da machen?«, blafft es missmutig aus dem Hörer.
Polkan wischt sich mit dem Ärmel über die Stirn. »Bei den Zuständigen habe ich es schon versucht … Und die Leute, die zu uns unterwegs sind, haben die vielleicht …«
»Das fragen Sie die am besten selbst. Auf Wiederhören.« Er legt auf.
Polkan starrt den Hörer an, holt aus, als wollte er ihn an der Tischkante zerschmettern, legt ihn dann aber vorsichtig auf die Gabel zurück.
Er steht auf, öffnet die Tür, die mit Schaumstoff verkleidet ist, damit weder Geräusche noch Wärme nach außen dringen, und tritt in den Hausflur. Lauscht – und geht hinunter in die Kantine.
Vorbei an den zusammengeschobenen Tischen und den aus alten Zeitschriften gebastelten Girlanden – die jüngste Tochter der Frolows hatte gestern Geburtstag – und zu Lew Sergejewitsch, den er wie erwartet am Herd antrifft. Polkan räuspert sich. »Hör mal, Ljowa«, sagt er. »Besuch ist unterwegs. Aus Moskau. Wir sollten ordentlich auftischen. Dann kriegen auch unsere Leute mal wieder was Anständiges. Die lassen ja schon die Köpfe hängen.«
Lew Sergejewitsch, der sehnige Koch der Garnison, sieht ihn mit vor der Brust verschränkten Armen griesgrämig an. Mit einem Auge. Das andere ist von einer Augenklappe verdeckt, was Lew Sergejewitsch wie einen Piraten aussehen lässt. »Ich habe noch Fleisch für zwei Tage und für eine Woche Getreide«, antwortet er ruhig. »Wenn’s heute was Anständiges geben soll, muss ich nächste Woche Menschenfleisch servieren.«
»Was bist du denn so miesepetrig?! Die nächste Lieferung kommt bestimmt. Die werden uns schon was schicken!«
»Hast du mit denen gesprochen?«
»Gerade habe ich mit ihnen telefoniert.«
»Oha! So mutig heute! Und was sagen sie?«
»Na was schon? Schicken mich von Pontius zu Pilatus. Vertrösten mich auf morgen. Aber immerhin haben sie nicht Nein gesagt!«
Der Koch nimmt eine schrumpelige, seltsam geformte Zwiebel in die Hand und steckt ein Gerät mit einer langen, spitzen Nadel hinein. Das Gerät heult auf. Lew Sergejewitsch schleudert die Zwiebel in den Müll und nimmt die nächste vom Haufen »Das hätte gerade noch gefehlt!«, mault er. »Stehen wir hier zum Spaß an dieser Grenze, oder was? Ist ja wohl das Mindeste, dass die uns versorgen. Die und nicht die Chinesen! Sieh dir mal an, was die Schlitzaugen uns schicken, diese verfluchten Heiden! Die Kartoffeln sind ungenießbar, und von den Zwiebeln explodiert mir hier gleich das Gerät.«
»Wie die Arbeit, so die Versorgung«, versucht es Polkan mit einem Witz, aber der Pirat lacht nicht.
»Wenn sie uns hier nicht brauchen, sollen sie uns gehen lassen. Dann können wir endlich von diesem Fluss weg. Atmen hier ständig diesen Scheiß ein! Wer weiß, vielleicht gibt’s irgendwo noch fruchtbaren Boden? Was sollen wir hier noch rumsitzen, wenn sich Moskau einen Dreck um uns schert? Frag die das mal, wenn die hier aufmarschieren.«
»Jetzt mach mal halblang, Lew Sergejewitsch. Hast du einen Eid geschworen oder nicht? Ich schon. Also, du stellst das Dosenfleisch auf den Tisch, und ich kläre das mit der Politik, kapiert?«
»Das war mein Ernst, frag sie! Ich bin nicht der Einzige, den das interessiert.«
»Zu Befehl!«