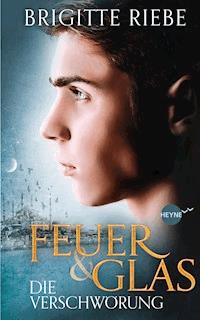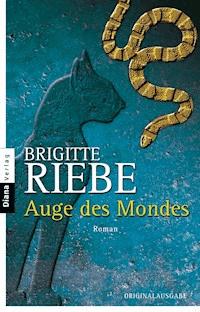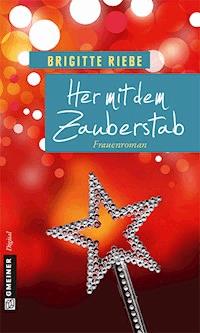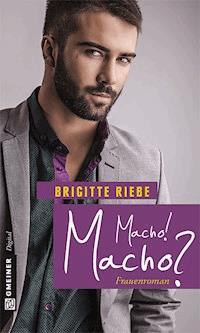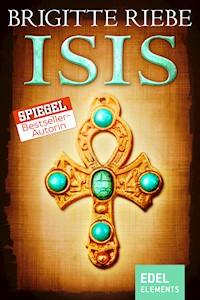7,99 €
7,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Griechische Mythologie aus weiblicher Perspektive
Kreta im Jahr 1500 v. Chr.: Der Hirtenjunge Asterios begegnet der schönen Königstochter Ariadne. Beide verlieben sich ineinander, doch dunkle Schatten liegen über ihrer Beziehung: Asterios ist der Auserwählte, und bald schon muss er der großen Göttin dienen und gefahrvolle Aufgaben bewältigen. Düstere Visionen, die Asterios nachts überkommen, künden außerdem von einer Naturkatastrophe …
Die aufregende Neudeutung einer antiken Sage!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
4,4 (48 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Autorin
Widmung
Lob
Prolog
Erstes Buch
Die Karawane der Träume
Die Mondkinder
Im Tanz der Elemente
WASSER
ERDE
LUFT
FEUER
Zweites Buch
Schwarze Segel
Strongyle
Athenai
Strongyle
Athenai
Strongyle
Athenai
Strongyle
Athenai
Zwischen den Welten
Wege in die Nacht
Die Flüchtlinge
Drittes Buch
Heilige Hochzeit
Der Faden der Ariadne
Tage des Zorns
Tod der Sonne
Epilog
Copyright
Das Buch
Den berühmten Mythos vom kretischen Labyrinth, von Theseus und dem Minotaurus kennen wir aus attischer, männlicher Sicht. Daß er sich aus der Perspektive der matriarchalisch orientierten kretischen Kultur ganz anders und ungeheuer spannend liest, beweist dieser Roman von Brigitte Riebe. Asterios, Sohn der Königin Pasiphaë und eines Stiertänzers, wird der erste männliche Priester, der dem Orakel zufolge Kreta vor dem Untergang retten soll. Doch als er sich in eine tragische Liebesgeschichte mit seiner Halbschwester Ariadne verstrickt und bei einem Zweikampf mit dem attischen Thronfolger Theseus beinahe zu Tode kommt, sieht es für seine Mission düster aus …
Die Autorin
Brigitte Riebe, geboren 1953 in München, promovierte Historikerin, lebt als freie Schriftstellerin in München. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane, darunter »Palast der blauen Delphine«, »Ehemänner und andere Fremde«, »Eine Katze namens Moon«, »Mann im Fleisch«, »Liebeslang«, »Der Wahnsinn, den man Liebe nennt«, »Schwarze Frau vom Nil«, »Schöne Männer sterben schneller«, »Isis«; außerdem schrieb sie die populären Sina-Teufel-Krimis, die unter dem Pseudonym Lara Stern erschienen.
Personen des Romans
PASIPHAËKönigin und Hohepriesterin von KretaMINOSihr GemahlASTERIOSBastard der Königin; liebt AriadneARIADNETochter von Pasiphaë und MinosANDROGEUSältester Sohn; in Athen ermordetDEUKALIONLieblingssohn von MinosAKAKALLISseine ZwillingsschwesterXENODIKETochter von Pasiphaë und MinosKATREUSSohn von Pasiphaë und MinosGLAUKOSSohn von Pasiphaë und MinosPHAIDRAjüngste Tochter; wird HohepriesterinIKSTOSGatte von AkakallisDINDYMETochter von AkakallisMIRTHOAmme der Königin und PriesterinMEROPEZiehmutter von Asterios; ihre SchwesterJESAOberschreiberin der KöniginEUDOREihre StellvertreterinPERIPOSKöniglicher StallmeisterAIAKOSLehrer und Freund von MinosHATASUseine Tochter, HalbägypterinGARAMOStoter Freund von MinosTYROFreund von Minos; EremitPANEBägyptischer Bootsbauer und Lehrer der MystenKEPHALOSSeemann und Lehrer der MystenHEMERAPriesterin, lehrt die MystenDAIDALOSBaumeister von Minos; AthenerIKAROSsein Sohn; Freund von AsteriosIASSOSParfummeister der KöniginAIGEUSKönig von AthenTHESEUSsein Sohn
Sieben Mädchen aus Athen, »Geiseln«:
LYSIDIKE ASTERIA KORONIS MENESTHO ERIBOIA DAMASISTRATE HIPPODAMEIA
Sechs Jungen aus Athen, »Geiseln«:
HERNIPPOS ANTIOCHOS ERYSTENES DAIDOCHOS PROKRITOS HEUXISTRATOS
Meinen wunderbaren Großmüttern – Maria und Therese
Wenn Ihr nicht Augen habt, um zu sehen, werdet Ihr Augen haben, um zu weinen.
Prolog
Der schwarze Vulkan hatte lange geschlafen.
Sein Kegel ragt auf über dem Braun der herbstlichen Felder, über dem Silbergrün der Olivenhaine. Kaum ein Lufthauch regt sich, alles ist in gleißendes Licht getaucht. Die ganze Insel ist verstummt, selbst Grillen und Zikaden schweigen. Zuweilen nur, wenn sich eine leise Brise von der Küste her erhebt, hört man das Rauschen der Baumwipfel.
Die Menschen ruhen im kühlen Schutz ihrer Häuser. Verklungen ist in den Innenhöfen das Klappern des Geschirrs, das Lachen der Kinder. In die mittägliche Stille dringt das Gurren der Turteltauben, die vor vielen Türen in geflochtenen Weidenkäfigen schaukeln, und das Knarren zweier hölzerner Wagen, drüben, auf dem sandsteingepflasterten Platz.
Da erwacht in kupferner Tiefe die Göttin des Feuers und läßt die Flanken des Vulkans erzittern. Heulende Pfeiftöne durchschneiden die Stille, seltsame Geräusche wie von grobreißendem Stoff.
Dann wieder Stille. Wenig später erschüttert dumpfes, bedrohliches Grollen die Luft.
Abermals schweigt das Land.
Die Tiere wittern als erste die Gefahr. Schlangen und Echsen verlassen die Ritzen und Spalten der alten Lava, fallen in die Felder ein und nähern sich den Siedlungen. Sperlinge und Eichelhäher fliegen in alle Himmelsrichtungen auf. In langem, grünsilbrigem Zug kriechen Heuschrecken zum Strand hinab. Fischschwärme drängen schutzsuchend dem Meeresgrund zu. Auf den Weiden mischt sich angstvolles Blöken mit dem Gebell der Hunde.
Und wieder ist das unterirdische Grollen zu hören, ein Brausen, gefolgt von unheilvollem Klirren, als zerbräche Glas in der Tiefe der Erde.
Die ersten Stöße.
Häuser erzittern, und in den gemauerten Wänden klaffen daumengroße Risse wie häßliche Wunden. Vasen und Figuren fallen hinab, zerschellen auf den berstenden Steinplatten. Türen springen auf. In vielen Ställen beißen sich quietschend die Schweine ineinander fest.
Der Berg! Der Feuerberg!
Durch donnerndes Getöse aus dem Schlaf gerissen, fliehen die Menschen ins Freie. Dunkler Rauch entströmt dem Krater, formt sich zu einer hohen Säule. Drohend steht sie über dem Schlund.
Als sie sich langsam neigt, brüllt der steinerne Riese lang und zornig auf. Er speit eine lodernde Flamme, deren Spitze sich spaltet und den Himmel blutrot färbt. Asche steigt auf und überzieht das Firmament wie schwarzer poröser Schaum.
Im Schein der Feuerfontänen, die Garben glühenden Gesteins in die Höhe reißen, bäumt sich die Erde stöhnend auf, kurz und kräftig, schnell hintereinander.
Häuser stürzen krachend zusammen. Der Boden spaltet sich, und auf die aufgebrochenen Schollen fällt dunkler Ascheregen, der sich mit dem bräunlichen Dampf aus dem Krater vermischt.
In der plötzlich hereingebrochenen Finsternis, von Ölfunzeln und Fackeln gespenstisch erhellt, schreien Kinder. Man hört verzweifelte Gebete und lautes Klagen. In den Gassen herrscht entsetzliches Gedränge. Inmitten von brennendem Dachgebälk, zwischen scheuenden Pferden und Hunden, Hunderte von Menschen in wilder Flucht. Die Köpfe nur notdürftig mit Tüchern und Kissen geschützt. Blind vom beißenden Rauch, vom Ätzbrand, der Leib und Gesicht zersetzt und die Augen blendet. Alte und Junge schieben sich schreiend und heulend vorwärts und versuchen, ihre Habseligkeiten zu retten.
Die Straßen sind voll von verlorenen Bronzekandelabern, von Kassetten aus geschmolzenem Metall, von Tonscherben. Wer stürzt, wer über Leichen und Tierkadaver stolpert, wird zu Tode getrampelt oder erstickt qualvoll in Rauch und Asche. Nur die Kräftigeren behaupten ihren Weg, die Jungen und Starken, die die Hände abschütteln und die Kinder beiseite drücken, die Frauen ihnen entgegenstrecken. Weiter, blindlings weiter drängt die Menschenmenge, bergab, dem Hafen zu, wo die Schiffe schon zu lodernden Fackeln geworden sind.
Es gibt kein Entrinnen. Während der Wind sengende Asche über die Stadt trägt, sich Schwefelschwaden mit giftigen Dämpfen mischen und im Gesteinshagel die Vögel tot zu Boden fallen, wälzt sich unaufhaltsam eine Schlammflut auf die Stadt zu. Vor den Mauern spaltet sich der Strom. Vielarmig dringt er in Gassen und Straßen vor, steigt hoch und immer höher. Verstärkt durch nachdrückende Fluten, wälzt er sich träge über Dächer und Tempel, erfaßt die Menschen und begräbt wie ein Leichentuch alles Leben unter schmutzigschwarzem, gurgelndem Brei.
Aus dem aufgerissenen Krater ergießt sich eine Lavalawine bis ins Meer und zieht als funkelnden Schweif geschmolzenes Gestein mit sich. Lava zischt, als das Meer sich zurückzieht und flüssiger Gesteinsbrei sich dampfend mit Luft und Wasser mengt. Wildes Wogen, Schäumen, Wirbeln, Spritzen – ein Feuermeer! Der Strand ist übersät von brennenden Trümmern. Überall verbrannte Bäume und Pflanzen. Überall verkohlte Leichen.
Und dann hält die geschundene Erde für einen Augenblick den Atem an – und zerspringt in glühende Splitter. Der Vulkan birst, und die wirbelnden Wasser des Meeres dringen nach innen. Gleich dem Stamm eines gigantischen Baumes saust der Berg dem Himmelsgewölbe entgegen, wo er seine Pinienkrone entfaltet. Wie eine dünne Eiskruste bricht das Land entzwei. Die einstmals runde Berginsel bleibt als schmale Sichel zurück.
Asche verfinstert die Welt, und die langen, die dunklen Nächte über dem alten Kontinent brechen an …
Vor dem Heiligtum der Doppelaxt kniet der Priester der Großen Mutter. Vor ihm liegen zwei Kulthörner aus Kalkstein und eine kleine Statue der Schlangengöttin. In der Linken hält er die Bügelkanne, gefüllt mit geweihtem Öl. Sein Gesicht bedeckt die lederne Stiermaske. Er erhebt seine Hände und beginnt leise zu beten.
Schon hat sich der Himmel über Kreta dunkel gefärbt. Ein dichter Regen aus rotglühendem Bimsstein prasselt auf die Insel nieder. Auf dem Meer drängt sich schwimmendes Gestein in wulstigen Brocken. Rasch und immer rascher treibt es südwärts und ballt sich zu festen Landbrücken zusammen. Wie aus blankem Metall gehämmert droht die Stirnwand der Flut. Ihr Rauschen erfüllt Himmel und Erde. Ein Wald wirbelnder Wasserschäfte, von Blitzketten hell erleuchtet, rast ihr voran.
Die Flut, die große Flut!
Sie kommt! Er spürt ihren gewaltigen Sog in seinem Blut. Er kann sehen, wie sie salzig bis weit ins Land hineinbricht. Wie sie sich ohne Unterschied über Häuser, Stallungen, Felder und Leiber ergießt. Schwarzer Regen rauscht nieder. Grollend erhebt sich in kurzen, kräftigen Stößen die Erde.
Die Wand vor ihm bricht auf. Rauch und Schwefeldämpfe erfüllen den Raum. Hinter der Ledermaske wird ihm der Atem knapp. Ascheteilchen dringen in die schmalen Öffnungen für Mund und Nase.
Er röchelt, ringt nach Luft. Mit der Rechten löst er den Riemen, der die Maske am Hinterkopf hält, und füllt tief seine Lungen. Erneut hebt er sein Gesicht zum Schrein. Und wieder setzt sein inbrünstiges Gebet ein …
Aber er hat ja meine Augen … mein Gesicht … er ist ich … das bin ich … ich …
Dunkel, stockdunkel. Schweißgebadet erwachte er, meinte noch den bitteren Geschmack des Rauches auf der Zunge zu schmecken. Im ersten Augenblick wußte er nicht, wo er war.
Benommen richtete er sich auf und strich das feuchte Haar aus der Stirn. Still war es im Raum, er hörte nur das schnelle Schlagen seines Herzens und die Musik der Zikaden, die durch das geöffnete Fenster zu ihm drang. Seine Hände berührten seinen Körper, dann sein Bett.
Das war nicht das harte Lager eines Hirten!
Schlagartig war er wach und wußte, vor er sich befand: im Palast der blauen Delphine. Er war nicht mehr Astro, der Hirte, sondern Asterios, der Bastard der Königin, der die Stiermaske trug.
Erstes Buch
Die Karawane der Träume
Der Duft von Kiefern-, Zedern- und Zypressenstämmen erfüllte die Kymbe, die auf ihrer Fahrt nach Ägypten durch das morgendliche Meer glitt. Nach der langen Flaute zu Beginn der Reise, die die Mannschaft zum Rudern gezwungen und den Steuermann zu Flüchen veranlaßt hatte, war der Wind endlich umgeschlagen und blies beständig aus Nordwest.
Sofort hatten einige Männer den hölzernen Mast aus seiner Sicherung auf dem Schiffsboden befreit und ihn aufgerichtet. Nun knatterte das Segel aus Spartgrasgeflecht in der auffrischenden Brise.
Dunstschleier hingen noch über den schroffen Felsen. Ganz allmählich hatte sich die Farbe der Berge verändert, war von dem beinernen Weiß der Karste im Westen der Insel zu rauchigem, manchmal fast bläulich schimmerndem Grau übergegangen. Bald schon würden auf den Höhenketten die Küstenfeuer zu sehen sein, die den Schiffen die Einfahrt in die geschützten Hafenbuchten des Südens wiesen.
Die Frau im dunklen Umhang aber, schon seit dem ersten Licht der Morgendämmerung unruhig, war in Gedanken immer noch in den Weißen Bergen, die ihr zur Heimat geworden waren. An den Hängen des hellen Kalksteinmassivs, weitab vom mächtigen Hof zu Knossos, hatte sie viele Jahre in Sicherheit gelebt. Dort war der Junge unter ihrer Obhut herangewachsen. Dort hatte er an ihrer Seite die Eichenwälder erforscht, die von Heidekraut und Buschwerk bewachsenen Schluchten, die Höhlen, in denen seine Tiere Schutz vor Unwetter gesucht hatten. Ob er jemals wieder die blauen Dolden der Keuschbäume sehen und die duftenden Myrten vor ihrem Haus riechen würde?
Sie seufzte und sah sich nach ihm um. Der Junge, der auf den Namen Astro hörte, stand ganz vorn am Bug des Schiffes und starrte ins Wasser.
»Da schwimmt etwas«, rief er, und seine Augen leuchteten vor Erregung. »Schau nur, Mutter! Da treibt etwas neben dem Schiff! Ist es ein Tier? Aber es bewegt sich nicht.«
Merope erhob sich langsam, überrascht von einem jäh aufsteigenden Unwohlsein, und trat dicht hinter ihn. Sie spürte die Hitze seines jungen Körpers. Dann erst sah sie den toten Delphin, der im Wasser trieb. In seinem silbernen Bauch klaffte eine tiefe Wunde.
Rasch wandte sie sich ab, um ihr Erschrecken zu verbergen. Große Göttin, ein toter Delphin, so kurz vor dem Ziel! Ein unheilverkündendes Omen für ihre Reise, die der Königin ihren Delphinring zurückbringen sollte – und ihren totgeglaubten Sohn!
Astros Rufe hatten auch einige der Männer aufmerksam gemacht, die sich jetzt ebenfalls über die Reling beugten. Merope hörte leise Flüche und ein paar gemurmelte Gebetsfetzen. Seeleute hielten es für ein glückbringendes Zeichen, wenn Delphine dem Schiff folgten. Und jetzt dieser aufgeschlitzte Kadaver! Mit aller Kraft zwang Merope ihr wild schlagendes Herz zur Ruhe. Nur jetzt keine Aufregung zeigen! Nichts durfte ihre Mission aufhalten.
Der Kapitän versuchte sie barsch zur Rede zu stellen; auf seinem sonnenverbrannten Gesicht wechselten Mißtrauen und Unsicherheit mit echter Besorgnis. Merope verstand, daß er eine Erklärung von ihr erwartete. Was aber konnte sie ihm sagen, ohne zuviel preiszugeben?
Als sie ihm bei ihrer ersten Begegnung im Hafen das goldene Doppelhorn mit der Sonnenscheibe gezeigt hatte, hatte er sich vor der Priesterin der Großen Mutter verneigt und um ihren Segen für Mannschaft und Schiff gebeten. Respektvoll hatte er angeboten, ihr und dem Jungen den Preis für die Überfahrt zu erlassen. Und er hatte nicht gefragt, warum die Frau und der junge Hirte ausgerechnet zur Zeit der Frühjahrsstürme nach Osten mitgenommen werden wollten. Um die Herrin der Tiefe für ihre Reise günstig zu stimmen, hatte Merope am Strand das Abfahrtsopfer dargebracht: Muscheln und einen Fang rötlich schimmernder Fische, zusammen mit einer Amphore Öl.
»Ist dein Opfer nichts wert gewesen, Priesterin?« herrschte er sie an und rieb seine Stirnglatze. »Was bedeutet dieses böse Zeichen? Du weißt doch, wie abergläubisch Seeleute sind! Was glaubst du, wie sie auf dieses tote Tier reagieren?« Sein Mund verzog sich unwillig. »Vielleicht liegt ein Fluch auf dir oder dem Jungen, und ich hätte euch nicht mitnehmen …«
»Hör sofort auf mit diesem Unsinn!« unterbrach sie ihn. »Du weißt genau, daß mein Strandopfer der Göttin wohlgefällig war! Oder hast du vielleicht jemals zuvor um diese Jahreszeit eine Reise ohne Sturm erlebt?«
Mit hocherhobenem Haupt stand sie vor ihm, und ihm war, als ginge von der Frau im einfachen Wollumhang eine zwingende Kraft aus. Ihre Augen blitzten, und die silberhellen Haare, die der Wind aus dem Knoten gelöst hatte, gaben ihr ein beinahe jugendliches Aussehen.
»Da magst du recht haben«, schnaubte er widerwillig. »Die Reise war friedlich – zumindest bislang. Aber was hat dieser tote Delphin zu bedeuten?«
»Bist du ein Mann oder ein ängstliches Kind?« entgegnete Merope heftig und tastete nach den Spitzen des Doppelhorns in ihrer Gewandtasche. »Willst du das Tun der Meeresgöttin beurteilen wollen, die Leben schenkt und Leben nimmt?«
Dieses Leben hat allerdings eine frevelnde menschliche Hand beendet, fügte sie für sich hinzu. Denn die tödliche Wunde stammte von einer gutgeschärften Harpune.
»Kein Wort mehr!« fuhr sie fort und fixierte ihn streng. »Oder bist du auch nichts anderes als ein abergläubischer Matrose? Und was deine Mannschaft betrifft, so werde ich sie schnell wieder zur Vernunft bringen.«
Entschlossen ging sie zum Achterdeck, wo sie ihr weniges Gepäck verstaut hatte. Sie öffnete einen ledernen Beutel, griff hinein und zog einen kleinen Gegenstand heraus. Die meisten der Männer waren ihr gefolgt und standen im Halbkreis um sie.
»Seht her!« Merope bemühte sich, ihrer Stimme die gewohnte Festigkeit zu geben. »Die Göttin hat uns ein warnendes Zeichen geschickt. Sie ermahnt uns, die Wesen des Meeres zu achten. Wir sollen nicht töten, um unsere Mordgelüste zu befriedigen. Jagen dürfen wir nur, um unseren Hunger zu stillen.«
In ihrer Hand blitzte ein silberner Skarabäus, den sie seit den längst vergangenen Tagen ihres Hoflebens aufbewahrt hatte.
»Große Mutter, nimm dieses Symbol des Todes und der Wiedergeburt gnädig an. Schenke uns eine friedliche Reise und eine gesegnete Heimkehr!« Damit warf sie den Anhänger mit weitem Schwung in die leichtgekräuselte See.
Allmählich zerstreuten sich die Matrosen, und auch der Kapitän kehrte brummend auf seinen Posten zurück. Merope merkte, wie der Junge um sie herumstrich.
»Dauert unsere Reise noch lang?« fragte er schließlich.
»Nein, mein Sohn. Wir haben den Hafen bald erreicht.« Und dann beginnt der Weg in die Berge, zu der alten Höhle, dachte sie. Dein Weg in ein neues Leben.
Sie bemerkte sein Zögern, spürte, wie er mit einer Frage kämpfte. »Nun sag schon, was du wissen willst«, half sie ihm liebevoll. In seinen grüngoldgesprenkelten Augen stand ängstliche Ungewißheit.
»Alles ist auf einmal so seltsam, nicht nur der tote Delphin«, sprudelte er hervor. »Warum bist du die ganze Zeit so geheimnisvoll? Warum die weite Reise? Ich sollte in diesem Frühjahr doch zum erstenmal eine eigene Herde bekommen! Was soll nun aus den neugeborenen Zicklein werden?«
Er brach ab und sah sie hilfesuchend an.
»Astro, du weißt doch, daß alle Jungen einige Tage in einer heiligen Höhle verbringen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Wenn sie das Dunkel verlassen, sind sie zu Männern geworden.«
Sein Gesicht verzog sich bei ihren Worten in kindlichem Trotz. »Natürlich weiß ich das!« begehrte er auf. »Männer können weder bluten noch gebären, deshalb nimmt sie der Schoß der Göttin auf und gebiert sie neu. Im letzten Jahr haben sie meinen Freund Tiyo in die Höhle gebracht. Aber warum müssen wir so weit segeln, wo doch unsere Berge auch voller Höhlen sind?«
Weil du eben kein Bauer bist, sondern der Sohn der Königin, dachte Merope. Aber das wirst du bald selbst erfahren. »Ich habe dir schon mehrmals gesagt, mein Sohn«, erwiderte sie ihm stattdessen, »daß nicht alles für alle gut sein muß. Tiyo erlebte seine Einweihung in der für ihn bestimmten Höhle, und für dich hat die Große Mutter eine andere bestimmt. Sei nicht so ungeduldig«, wehrte sie lächelnd weitere Einwände ab. »Wir sind beinahe da. Wir legen bald an.«
Ja, sie waren fast am Ziel. Mit Bedacht hatte Merope einen der kleineren Häfen an der Südküste ausgewählt, von dem aus sie ihren Weg in die Berge nehmen konnten. Vielleicht war sie übervorsichtig gewesen. Wer würde sich schon um eine alte Frau und einen Halbwüchsigen kümmern? Aber sie hielt es für besser, auf der Hut zu sein! Zwar hatte sie seit mehr als zwanzig Jahren die Nähe des Hofes gemieden, aber neugierige Augen und vorwitzige Münder, die Gerüchte verbreiteten, gab es überall. Denn der Sohn der Königin kehrte heim.
Inzwischen hatte das Schiff seinen Kurs geändert und steuerte direkt auf das Ufer zu. Langsam konnte man Häuser erkennen, halbmondförmig in die Bucht geschmiegt. Ein breiter Sandstrand war auf beiden Seiten von Felsen geschützt. Das Segel war schon eingeholt, der Anker, eine Pyramide aus rotem Porphyr, wurde gesetzt. Die Sonne war höher gestiegen und schien nun fast mit sommerlicher Kraft.
Wir müssen sehen, daß wir an Land kommen, dachte Merope. Wir haben noch ein ordentliches Stück Weg vor uns. Übermorgen ist die Nacht der Frühlingswende. Dann muß er an seinem Ziel sein.
Geschäftiges Treiben herrschte nun auf dem Schiff, dem sich langsam vom Ufer her ein kleines Ruderboot näherte.
»Kommen sie, uns zu holen, Mutter?«
Merope nickte.
»Und dann gehen wir in die Berge?«
Und wieder nickte sie. Ja, zu der großen Höhle, mein Sohn, die schon seit Anbeginn aller Zeiten auf dich wartet. Dort wirst du der Göttin begegnen.
»Laß uns dem Kapitän Lebewohl sagen«, forderte sie ihn auf, »und ihm für seine Freundlichkeit danken.«
Astro lief ihr voraus, und sie beobachtete, wie der Junge lebhaft auf den stämmigen Mann einredete, der ihn freundlich, fast väterlich betrachtete.
Wie sehr er männliche Gesellschaft zu genießen scheint, dachte sie mit leiser Wehmut. Vielleicht hat er den Vater doch vermißt, obwohl er mich nie nach ihm gefragt hat, nicht ein einziges Mal in all den Jahren! Es war, als ob er schon immer etwas geahnt hätte. Sein Vater, der Weiße Stier aus dem Meer, der ihn gezeugt hat …
»Ich wünsche dir eine glückliche Weiterfahrt, Kapitän«, sagte sie laut. »Danke, daß du uns so sicher hierhergebracht hast.«
»Die Göttin schütze euch«, antwortete der alte Seemann seltsam befangen, musterte sie ernst und zauste Astro den braunen Schopf. »Paß gut auf dich auf, Junge!«
Vorsichtig kletterten die beiden die baumelnde Strickleiter hinab. Ein junger Mann, kaum älter als Astro, ruderte sie schweigend ans Ufer. Im flachen Wasser stieg er aus und schob Boot und Insassen zum Strand. Als sie ihm etwas Wachs anbieten wollte, wehrte er ab.
»Der Kapitän hat schon für alles gesorgt.«
Dann zog er sein Boot weiter auf den nassen Strand.
Merope blickte sich ein letztes Mal nach der Kymbe um. Am Bug leuchtete ein gemaltes Auge im Sonnenlicht. Wie das allwissende Auge der Göttin, die über die alte Höhle wacht, dachte sie. Große Mutter, die Du allein die Macht hast, zu binden und zu lösen, die Wege der Sterne zu bestimmen und über die Winde zu befehlen, behüte Schiff und Mannschaft auf ihrer Reise nach Ägypten!
Sie marschierten zügig und hatten schon bald die Ebene verlassen, als Astro über Hunger und Durst klagte. Sehr still war er den ganzen Weg über gewesen, sein Gesicht blaß und verschlossen. Im Schein der Nachmittagssonne machten sie Rast, aßen Käse und Fladenbrot sowie eine Handvoll getrockneter Feigen und tranken Wasser aus einem nahen Bach. Merope sah ihm zu, wie er mit großem Appetit jeden Bissen verschlang. Als er sie schließlich um getrocknetes Fleisch bat, lehnte sie freundlich, aber bestimmt ab.
»Es ist nicht gut, wenn du so kurz vor dem Ziel noch Fleisch ißt. Denk daran, daß du schon ab morgen fasten mußt.«
Vor dem Hunger mußt du keine Angst haben, mein Sohn, dachte sie, als sie seinen fragenden Blick spürte. Der vergeht schnell. Aber dann kommen die alten Bilder. Du wirst erkennen, wer du bist. Und was deine große Aufgabe sein wird.
»Laß uns noch ein Stück gehen, bis der Abend hereinbricht«, forderte sie ihn auf. »Dann suchen wir uns einen Platz für die Nacht, und du kannst dich nach Herzenslust ausruhen.«
Sie erhoben sich, packten ihre Bündel zusammen und wanderten weiter. Die Oleanderbäume entlang der schmalen Wasserläufe trugen dicke Blütenbüschel, noch geschlossen, aber schon zum Aufspringen bereit. Löwenzahn blühte, wilder Mohn leuchtete rot. Der Himmel war von einem leichten Blau, durchzogen von Wolkenschleiern, die Luft lau, vom Duft der Mandelblüten getränkt.
Fast unvermittelt stiegen die Berge vor ihnen auf, schiefergraue Gipfelketten im Vordergrund, hinter ihnen silbern und bläulich schimmernde Silhouetten. Ihre Unterhaltung verstummte nun vollends. Schweigend erklommen sie die ersten Anhöhen, passierten einen Weiler, ließen ein kleines Dorf mit ein paar niedrigen Häusern aus verwitterten Kalkblöcken hinter sich. Als der Junge fragend auf den Weg wies, der hinunterführte, schüttelte Merope den Kopf.
»Nein, heute und die nächste Nacht verbringen wir nicht unter Dach. Wir wollen dem Mond ganz nah sein.«
Langsam senkte sich der Abend nieder. Dunkles Gold vermischte sich mit dem silbrigen Grün der Olivenbäume, die hier oben schon spärlicher wuchsen. Kein menschlicher Laut war zu hören, nur vereinzelte Vogelrufe und das Geräusch ihrer Schritte auf dem schmalen, steinigen Pfad: die seinen ungestüm, eilig, immer wieder absetzend, ihre in bedächtiger Regelmäßigkeit. Dann ließen sie auch die Ölbäume hinter sich und erreichten dunkelgrünes Nadelgehölz.
Merope hielt inne, ließ den Beutel sinken und blickte zum Gipfel empor, der immer noch fern und unnahbar schien. Zeit, sich ein Lager zu suchen, die letzte Mahlzeit zu bereiten und ein wenig zu ruhen, dachte sie. Er wird seine Kräfte noch brauchen. Und ich meine, um der Göttin heute nacht zu opfern.
»Laß uns hier halt machen, Astro«, schlug sie deshalb vor und sah ein Stück entfernt den heiligen Hain im schwindenden Abendlicht liegen. »Geh Holz sammeln, damit wir uns noch ein Feuer machen können!«
Er lief davon, und sie sah ihm gerührt nach. Du sentimentale Alte! schalt sie sich selbst. Gewöhne dich daran, daß er nun seinen eigenen Weg gehen wird! Du wirst ihn dabei nicht aufhalten. Du kannst Astro nur lehren, ihn mutig und wissend zu gehen.
Aber obwohl Merope versuchte, sich mit dem Unabänderlichen abzufinden, konnte sie dennoch die innere Stimme nicht zum Schweigen bringen. Die Stimme, die unüberhörbar forderte, ihre Wanderung zum Gipfel möge niemals zu Ende gehen.
Als er zurückkehrte, beide Arme voller Reisig, hatte sie bereits den Steinkreis für das Feuer vorbereitet. Nun schichtete sie die Zweige auf. Astro bestand darauf, selbst die Funken aus dem Feuerstein zu schlagen, und sie lobte ihn für seine Geschicklichkeit. Im Schein des Feuers saßen sie sich wenig später gegenüber und aßen ohne viele Worte. Sie reichte ihm Brot und Olivenpaste, und, anstelle des Wassers, einen kleinen Lederbeutel voll geharzten Weins, aus dem er gierig trank.
Das macht dich noch müder, mein Sohn, dachte sie. Und schenkt dir schöne Träume.
Schon bald rollte sich der Junge in seine Decke und schlief ein. Die Frau saß noch eine ganze Weile am Feuer, bevor sie sich langsam erhob und, einen glühenden Span in der Hand, sich auf den Weg machte.
Dann stand sie wieder im heiligen Hain, den sie seit ihrer Flucht in die Weißen Berge nicht mehr betreten hatte. Behutsam, zaghaft fast, berührte sie mit ihrer Hand die rauhen Stämme der Zypressen. Den Kopf an die rissige Rinde gelehnt, sog sie den vertrauten, leicht bitteren Geruch ein. Und vor ihr entstand deutlich das Bild der zitternden Novizin, deren ungelenken Händen das sichelförmige Mondmesser damals beinahe entglitten wäre. So viele Jahre waren vergangen, so vieles hatte sie erlebt, seit jener ersten Nacht im Hain!
Milchig und fern stand der Mond der Frühjahrswende an einem funkelnden Sternenzelt. Reglos blickte sie zu ihm hinauf und lauschte dem Schrei einer Eule. Westwind frischte auf, zerzauste ihr Haar und ließ sie plötzlich erschaudern. Sie rieb die Füße aneinander, die sie von den Reisestiefeln befreit hatte, und zog den Umhang enger über ihrer Brust zusammen.
Vergib mir, Große Mutter, dachte sie, ich bin heute nicht richtig bei der Sache. Meine Gedanken fliegen wie eine Schar aufgescheuchter Vögel zurück in die Vergangenheit und versuchen, das Dunkel der Zukunft zu durchdringen. Mein Herz wird schwer, wenn ich an den Weg denke, der vor Astro liegt. Den Weg, von dem so viel für uns alle abhängt. Ich weiß, seine Zeit ist gekommen. Aber ich fürchte nichts mehr als den Augenblick, wenn er in das Dunkel der großen Höhle tritt. Dann verliere ich den Sohn, den ich nicht geboren habe. Dann bin ich wieder allein.
Sie sprach ein flüsterndes Gebet und spürte, wie sie ruhiger wurde. Nun war sie bereit für die Zeremonie, die sie seit den Tagen ihrer Einweihung jedes Jahr am Ende des Winters vollzogen hatte. Merope richtete ihre Aufmerksamkeit auf den großen, runden Stein. Ihre Hand berührte leicht den Kranz silbriger Disteln, den sie um ihn gewunden hatte. Dann ließ sie sich mit gekreuzten Beinen vor ihm auf der Erde nieder. Auch durch den doppelten Schutz von Kleid und Mantel fühlte sie die aufsteigende Kälte des harten, unebenen Bodens. Nach einem letzten Blick zum Mond schloß sie die Augen und atmete tief ein.
Himmelsherrscherin, betete sie, Du älteste Tochter der Zeit! Dein Auge ist gewaltig, es schaut auf die Erde nieder. Dein göttlicher Leib ist das Universum, Deine Weisheit ist tiefer als das Meer. Schenke Deinen Kindern die Gnade des wiederkehrenden Lichts, das uns Leben und Fülle gibt!
Und dann gab es nur noch den Stein und die Priesterin, die eins war mit dem Lebensstrom der Erde. Wärme durchflutete ihren Körper, heiß strömte es aus Fuß- und Fingerspitzen, und sie spürte nicht mehr den kühlen Frühlingswind. Ihre Arme und Beine bildeten einen festen Kreis, der immer dichter wurde, bis sie ganz aus Stein war. Brüchiger und rauher Fels zunächst, den man hart vom Berg gebrochen hatte. Weicher geschmirgelt und poliert und immer glatter mit den Jahren, regengewaschen, sonnendurchglüht, auf einer langen Reise durch die Flüsse, durch die Meere, von Tieren besiedelt, von Menschenhand abgegriffen, in einem Meer von Zeit.
Wie aus weiter Ferne kam sie schließlich in ihren Körper zurück. Sie berührte ihn mit beiden Händen.
Ja, ich bin eine alte Frau geworden, dachte Merope wehmütig. Ich war schon damals nicht mehr jung, als Mirtho mir den Neugeborenen in die Arme legte und wir ihm den Namen Astro gaben.
Die alten Bilder stiegen in ihr auf, und sie sah sich wieder in mondloser Nacht zu dem kleinen Hafen laufen, den wimmernden Säugling vor die Brust gebunden. Dort hatte der Fischer, dessen Schweigen sie mit Edelsteinen erkauft hatte, mit seinem Boot auf sie gewartet. Sie dachte an die Überfahrt, während derer es ihr nicht gelang, das schreiende Kind mit der honiggesüßten Ziegenmilch aus dem durchlöcherten Horn zu beruhigen! Und endlich die Geborgenheit ihres Hauses, wo sie zum erstenmal seine Windeln gewechselt und das Mondmal an seiner Hüfte geküßt hatte.
Ja, ich habe immer gewußt, daß mir der Sohn der Königin nur für einige Jahre geschenkt sein würde! Sechzehn Sommer konnte ich seine Mutter sein. In dieser Zeit habe ich ihn eins mit der Natur werden lassen, ihn den Umgang mit den Heilkräften gelehrt. Seinen jungen, hungrigen Geist habe ich mit den geheimen Überlieferungen gespeist. Habe ich ihm mehr offenbart, als es Männern eigentlich zukommt? Aber er besitzt die Gabe. Er ist der Auserwählte! Es war richtig, ihm das Wissen der Weisen Frauen zu offenbaren, damit der Junge in unserem Sinne seiner großen Aufgabe gerecht werden kann.
Der Junge? Er ist längst kein Kind mehr, verbesserte sie sich selbst. Flaum bedeckt sein Gesicht an Kinn und Wangen, seine Stimme klingt tief. Und er schaut gern den Mädchen nach.
Ihr Herz zog sich schmerzlich zusammen. Große Mutter, was wird geschehen, wenn er der Frau gegenübersteht, die ihn geboren hat? Und was wird aus mir?
Mit einem Mal spürte Merope, wie erschöpft sie war. Sie mußte versuchen, noch ein wenig Schlaf zu bekommen, bevor sie erneut aufbrechen würden. Steif erhob sie sich.
Nach rituellem Brauch streifte sie den Stein ein letztes Mal mit ihrer linken Hand. Dann begoß sie ihn, zuerst mit Wein, anschließend mit Öl. Sorgfältig verschloß sie die Tonkrüge und verwahrte sie wieder in ihrem Beutel. Einen Segensspruch murmelnd, schnitt sie mit dem glattgescheuerten Obsidianmesser die zartgrünen Blätter der umstehenden Disteln ab und packte sie zu den Krügen. Mit einem letzten Blick umfaßte sie den Hain, und nickte. Ja, die Zeremonie war vollendet. Das Licht des Frühlings konnte auf die Insel zurückkehren.
Sie ließ den Opferplatz hinter sich und wandte sich dem Weg zu, der sie zurück zu dem Jungen führte. Ein schwacher rötlicher Schein kündete vom Nahen des Tages, und sie beschleunigte trotz ihrer Müdigkeit den Schritt. Ob Astro schon wach war?
Merope fand ihn schlafend. Liebevoll strich sie sein braunes Haar zurück. Der Bastard der Königin lächelte im Schlaf.
Eine Nacht, ein Tag, eine Nacht. Am Nachmittag erreichten sie endlich das Gipfelplateau. Ein schwieriger Weg lag hinter ihnen, ein strenger, oftmals gefährlicher Marsch auf steilen Pfaden und über Geröllfelder; eine unruhige Nacht, in der sie seine wachsende Anspannung gespürt hatte. Beide hatten sie während dieser Zeit nichts gegessen. Immer wieder hatten sie das Tempo drosseln müssen, um Rast zu machen und ihren Durst aus Quellen zu stillen.
Merope sah die Zeichen von Hunger und Anstrengung in seinem geröteten Gesicht. Sie hörte seine stummen Fragen und fühlte ihren eigenen Magen rumoren wie ein hungriges Tier. Einen Lidschlag nur hatte sie die Augen geschlossen, um das Verlangen nach Nahrung, die Sehnsucht nach Ruhe aus ihrem Geist zu bannen, als sein lauter Schrei sie aufschreckte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hielt er sich den Oberarm, auf dem sich ein flächiger Stich abzeichnete, der schnell anschwoll.
»Eine Biene hat mich gestochen!«
Augenblicklich war sie bei ihm und saugte das Bienengift aus. Kreidebleich hielt er still, während sie mehrmals kräftig ausspie.
Der Schmerz hatte die nur mühsam aufrechterhaltene Mauer seiner Beherrschung zum Einsturz gebracht. Er hatte Angst! Das las sie in seinen Augen, das bewies sein säuerlicher Schweiß. Angst vor dem Unbekannten. Angst vor dem Wissen, das er wiederfinden sollte. Das Ende der Kindheit, dachte sie. So plötzlich. So unwiederbringlich.
Sie hörte, wie er scharf die Luft durch die Zähne zog. »Ist es schon besser?« fragte sie liebevoll.
Er bemühte sich, tapfer zu nicken, und sie nahm wahr, wie froh er über diesen offensichtlichen körperlichen Schmerz war.
Das richtige Mittel gegen Bienenstiche war rohe Zwiebel. Wo sollte sie die hier finden? Da fiel ihr Blick auf ein Büschel Löwenzahn. Sie zog es heraus, ritzte mit dem Nagel den Stiel und drückte den milchigen Saft auf dem Stich aus.
»Es wird gleich vorbei sein. Wenn du später noch Schmerzen hast, machst du es so, wie ich dir eben gezeigt habe. Steck dir noch ein Büschel in die Tasche!«
Dann forderte sie ihn auf, sich hinzusetzen und ihr zuzuhören. »Ich führe dich jetzt in die große Höhle und lasse dich dort allein. Drei Tage wirst du dort bleiben. Du wirst nichts anderes essen als die getrockneten Pilze und die Kräuter in diesem Säckchen, nichts trinken als das Wasser dieser drei Krüge. Sei wach und aufmerksam! Dir werden unbekannte Dinge begegnen, Bilder, vielleicht Stimmen oder Gestalten. Du bist ihr Meister, Astro! Du kannst sie entstehen und wieder verschwinden lassen – ganz wie du willst. Aber du kannst sie nur beherrschen, wenn du sie genau ansiehst. Wenn du vor ihnen fliehst, wenn du die Höhle früher verläßt, dann haben sie für immer Macht über dich. Bist du bereit?«
Sie sah, daß der Junge mit enger Kehle nickte.
»In der Höhle erfährst du auch deinen neuen Namen. Den Namen, der dich zum Mann macht. Den Namen, der dein weiteres Schicksal bestimmt.«
Unverwandt starrte er sie an.
»Und noch etwas, mein Junge«, sagte sie, sehr sanft nun. »Es ist kein Kinderspiel, was dich erwartet. Angst zu zeigen, zu schreien, zu weinen, ist keine Schande. Es kann sein, daß du Dinge siehst, die dein Innerstes berühren – dann weine, schreie und brülle! Aber stell dich! Nimm den Kampf mit ihnen auf!«
»Ich laufe nicht davon, das weißt du doch«, entgegnete Astro ernst und sah dabei sehr verletzlich aus. »Und was ist nach den drei Tagen? Was geschieht dann?«
Dann bist du Asterios, der Sternengleiche, dachte sie. Der Sohn Pasiphaës, der sich anschickt, sein schwieriges Erbe anzutreten. Der Lilienprinz, der als einziger unsere Insel vor dem Untergang bewahren kann.
»Nach drei Tagen hole ich dich wieder ab«, gab sie ihm statt dessen zur Antwort. »Dann sage ich dir, was weiter zu geschehen hat.«
»Und woher weiß ich, daß drei Tage vorüber sind?«
»Mach dir deswegen keine Sorgen«, sagte Merope mit Nachdruck. »Du wirst es wissen.«
Dann war er allein in dem großen, leicht gewölbten Dunkel, das nur schwach vom Licht seiner Fackel erhellt wurde. Noch meinte er ihre Umarmung zu spüren, ihr Segenszeichen auf seiner Brust. Aber sie war fort.
Seine Augen brauchten eine ganze Weile, bis sie sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten und mehr als Schatten oder verschwommene Umrisse erkennen konnten. Nackter Fels, so weit er sehen konnte, faltige Risse, zerklüftete Gesteinsbrocken. Er fröstelte trotz des Umhangs. Welch riesiger, unwirtlicher Raum! Wasser tropfte von den Wänden und sammelte sich in kleinen Rinnsalen auf dem Boden. Diese Höhle hatte nichts gemein mit den Schutzhöhlen der Weißen Berge. Sie war anders. Alt, bedrohlich und unerbittlich.
Er lachte laut auf, versuchte, sich durch den Klang seiner eigenen Stimme Mut zu machen. Wie konnte eine Höhle unerbittlich sein? Und dennoch spürte er, daß zwischen diesen Wänden, in diesen feuchten Spalten und Ritzen etwas auf ihn wartete.
Schau dir die Dinge an, hatte sie gesagt. Dann kannst du ihnen begegnen.
Ich werde ihnen begegnen, dachte er grimmig. Entschlossen schritt er den Raum ab und untersuchte den Boden. Er hielt erschrocken inne, als sein Fuß an einen harten Gegenstand stieß. Astro bückte sich und nahm ein Steinfigürchen auf: eine hockende Frauengestalt, zwischen deren geöffneten Beinen ein kleiner Kopf herauskam. Ganz in der Nähe fand er weitere Gegenstände, Doppelspiralen, Haarnadeln, Spitzen von Spinnrocken, eine kleine Bronzekröte, die übliche Votivgabe für eine glücklich verlaufene Geburt.
Große Göttin, was sollte er in einer Frauenhöhle? Natürlich wußte er, daß Frauen im heiligen Leib der Großen Mutter um Liebesglück und Fruchtbarkeit beteten. Daß sie der Göttin vor und nach der Entbindung mit kostbaren Opfergaben huldigten. Daß nach dem ersten Mondfluß Mädchen das Dunkel als Frauen verließen, für immer mit der Großen Gebärerin verbunden.
Aber ich bin kein Mädchen, das zur Frau gereift ist. Ich bin ein Mann.
… wirst du zum Mann, erfährst die Kraft und die Macht der Göttin und erhältst deinen neuen Namen. Such dir einen guten Platz, öffne das Leinensäckchen und kaue eine Handvoll Pilze, hatte Merope gesagt. Er würde der weisen Frau, die seine Mutter war, gehorchen, wie er ihr meistens gehorcht hatte.
Er breitete seine Decke auf dem Boden aus, ließ sich nieder und begann die ledrigen Pilze zu kauen. Bitter schmeckten sie und hinterließen auf seiner Zunge ein pelziges Gefühl. Mit ein wenig Wasser spülte er nach. Sein hungriger Magen zog sich abwehrend zusammen, und er versuchte, ihn durch gleichmäßiges Kauen und wiederholtes Wasserschlucken zu beruhigen.
Und obwohl Merope ihm ausdrücklich strenges Fasten geboten hatte, schüttelte er seinen Brotbeutel aus. Eine Käserinde war alles, was er entdecken konnte. Er nagte sie sorgfältig ab.
Eine heiße Welle von Übelkeit stieg in ihm auf. Heftig atmend ließ er sich rücklings auf die Unterlage sinken und schloß die Augen. Angst krampfte sein Sonnengeflecht zusammen, stand in kalten Perlen auf seiner Haut. Hilflos fühlte er sich dem Unbekannten ausgeliefert.
Ruhig bleiben, ganz ruhig, befahl er sich selbst zitternd.
Allmählich, ganz langsam, wurde das Unwohlsein schwächer, bevor es unerwartet in einer zweiten, kürzeren Welle zurückkam und ihm bitteren Speichel in den Mund trieb. Dann verebbte es.
Er fühlte sich entspannt. Heiterkeit stieg in ihm auf und ließ ihn leicht werden. Er öffnete seine Augen. Schwindelig war ihm, schwebend, zum Fliegen bereit.
An den Wänden tanzten Schatten, wie er sie niemals zuvor gesehen hatte. Sie zogen sich zusammen, bildeten verschlungene Linien und komplexe, geheimnisvolle Muster. Langsam und anmutig schwebten sie über Decke und Boden, kamen auf ihn zu und entfernten sich wieder.
Er versuchte aufzustehen. Aber er konnte sich nicht mehr bewegen. Ein Teil von ihm glitt diesen Schatten entgegen und flog zu ihnen hinauf.
Eine schwüle Sommernacht, eine kleine, geschützte Bucht, schwarz von Menschen, die voller Erwartung sind. Unter dem hellen Mondlicht ist ein Weidengestell in den Boden gerammt, auf das mit ledernen Gurten bäuchlings eine Frau geschnallt ist. Vom Meer her nähert sich ein nackter Mann, der eine lederne Stiermaske trägt. Dann beginnt das Lied der Trommel.
Ihr schwarzes Haar verhüllt ihre Augen wie ein schwerer Vorhang, ihre Haut ist heiß. Sie ist das fruchtbare Land, das sich ihm öffnet. Und der mit der Maske findet sie, schiebt das Tuch beiseite, das sie bedeckt.
Er dringt in sie ein. Die Menschen ringsherum schreien auf.
Eins werden sie, und ihr keuchender Atem geht immer schneller. Die Frau bäumt sich auf unter ihm, daß die Weiden brechen und beide zu Boden fallen. An ihrem Arm baumelt noch das Lederband der Fesselung. Aber sie halten nicht inne. Und dann ist er fort. Niemand hat gesehen, wohin er gegangen ist. Im nahen Gatter brüllt der weiße Stier, den man zum Opfer bestimmt hat.
Die Schenkel naß von seinem Samen, geht sie zum Meer und läßt sich von den Wellen liebkosen. Sie streichelt ihren bloßen Leib und weiß, er wird sich wölben, nachdem im Frühjahr das Licht auf die Insel zurückgekehrt ist. Sie wird ein Kind tragen. Einen Sohn.
Meine Mutter. Meine Mutter!
Das laute Echo seines Weinens holte ihn beinahe aus der Tiefe seiner Träume. Doch die Wirkung der Pilze war noch nicht abgeklungen. Seufzend versank er noch einmal in Raum und Zeit.
Monate vergehen. Das Kind läßt den Leib der Königin schwellen, aber ihre Augen werden immer trauriger. Sie weint in den Nächten und grämt sich tagsüber. Harte Worte fallen zwischen ihr und ihrem Mann. Er steigert sich in rasende Eifersucht hinein. Wer ist der Vater des Kindes, das sie trägt?
Keiner sagt es ihm. Niemand außer den Priesterinnen darf erfahren, wer sich hinter der Stiermaske verbirgt.
Lange Zeit ist die Königin stolz und stark, beruft sich auf ihr heiliges, altes Recht. Dann erfährt sie von der Verschwörung.
Heimlich hat der Mann an ihrer Seite versucht, nach der Macht zu greifen. Er mißbraucht sein Amt. Anstatt sich um die Bewässerung zu kümmern, läßt er im Süden der Insel eine Flotte erbauen. Hinter ihrem Rücken trifft er Abmachungen mit anderen Völkern. Er spielt sich als König auf, wo immer er kann.
Er ist nicht allein. Mit drei Freunden wagt er den Aufstand. Die Männer auf der Insel horchen auf. Überall entsteht Unruhe. Ist die Vorrangstellung der Frauen bald gebrochen? Sitzt bald ein Mann auf dem Greifinnenthron?
Sie stellt ihn zur Rede, er streitet alles ab. Er handelt nur in ihrem Namen. Er will die Insel schützen, die sie regiert.
Aber die Zeichen mehren sich. Noch hält sie ihm stand. Sie fürchtet ihn nicht, bis zu dem Tag, an dem zwei ihrer Priesterinnen spurlos verschwinden. Weise Beraterinnen drängen sie zur Flucht. Sie werden ihn in seine Schranken weisen – wenn sie außer Gefahr ist. Sie kann nicht länger in seiner Nähe bleiben, will sie nicht ihr Leben und das des Ungeborenen gefährden.
Schweren Herzens verläßt sie den Palast, begleitet von ihrer Amme. Sie wenden sich erst nach Westen, schließlich nach Süden. Die Angst vor den Häschern sitzt ihnen im Nacken.
Sie sind noch nicht an ihrem Ziel angelangt, als die Wehen einsetzen. Die Fruchtblase platzt, und sie durchleidet die Strapazen der Geburt an einem kleinen Ort im Süden. Als sie ihr sagen, das Kind sei tot, bricht sie in nicht enden wollendes Weinen aus.
Eine Frau bindet sich das Neugeborene vor die Brust und trägt es im Dunkel der Nacht fort, um es in Sicherheit zu bringen. In der Windel steckt ein Ring mit zwei tanzenden Delphinen. Beim Lösen des Tuchs erkennt sie das geweissagte Mal an seiner Hüfte, das heilige Mondzeichen: die Spitzen des Doppelhorns, die sich dunkel von dem helleren Fleisch abzeichnen. Sie sieht auf und er erkennt ihr Gesicht.
Merope!
Wo war er? Wer war er?
Quälender Durst, seine Kehle war wie verdörrt. Seine Hand tastete unsicher nach dem Krug. Er trank so gierig, daß ihm Wasser über Gesicht und Hals rann. Dann schob er das kurze Gewand zur Seite und berührte das Mal an seiner Hüfte.
Die Spitzen des Doppelhorns. Die Mondbarke.
Sein Schrei gellte von den tropfenden Wänden der alten Höhle.
Allmählich verblaßten die Bilder und lösten sich auf. Er spürte wieder den kühlen Steinboden, auf dem er lag, und streckte sich mit schmerzenden Gliedern.
Erschöpft fühlte er sich, wie nach einer langen Wanderung, und hellwach zugleich. Sein Kiefer war taub und spannte. Er hatte das dringende Bedürfnis zu kauen.
Neben sich fand er den Beutel mit den getrockneten Kräutern, die er langsam mit den Zähnen zermahlte. Blättriger Staub drang in die feinen Ritzen seiner Zunge und schmeckte leicht säuerlich. Er trank einen Schluck Wasser, wickelte sich fester in seine Decke und streckte sich aus.
Ohne Widerstände verließ er seinen Körper. Vorsichtig zunächst, ängstlich, indem er sich immer wieder versicherte, daß die pulsierende Verbindung, die im Dunklen leuchtete, noch bestand. Freier schließlich, fast ungestüm.
Er stieg auf und sah seine Gestalt unten liegen, eingehüllt in seine Decke. Er selbst schien durch den vorderen Höhlenraum zu schweben, dann weiter, durch schmale, dunkle Schläuche. Kein Ausgang war in Sicht, kein Licht, nur das Ziel, das er in sich spürte.
Und dann war Sie neben ihm, die Göttin, von der Merope stets voll tiefer Ehrfurcht gesprochen hatte. Eine schlanke Frauengestalt in Rot, deren Züge er nicht richtig erkennen konnte. Er roch ihren Duft, er hörte ihre Stimme, er hatte sie schon tausendmal gesehen. Die Gesichter aller Frauen, die ihm je begegnet waren, schienen sich in ihrem zu vermischen. Ihre Augen aber konnte er klar erkennen. Wissend und unergründlich schauten sie ihn an und drangen bis zum tiefsten Grund seines Selbst.
Schlagartig wußte er, daß er sah. Seine Visionen waren keine wirren Träume, sondern Botschaften, die Sie ihm sandte. Er besaß die Gabe des Zweiten Gesichts.
Eine Welle von Traurigkeit brandete über ihn; er ahnte, daß Ihre Gabe sehr schmerzvoll sein konnte. Daß er nicht nur sehen würde, was in der Vergangenheit geschehen war, sondern auch, was noch in weiter Zukunft lag.
Seine Kopfhaut begann zu prickeln, und er spürte, wie seine Nackenmuskeln sich zusammenzogen.
Er kämpft im dunklen Bauch der Erde. Er trägt eine schwere Ledermaske und weicht vor dem kurzen Schwert eines anderen zurück. Er ist verletzt. Blut tropft von seinem linken Arm. Klirrend fällt sein Schild zu Boden. Nichts schützt ihn mehr vor den harten, wütenden Hieben seines Gegners. Schmale Augen wie helle Gischt sind über ihm und funkeln ihn haßerfüllt an.
Da weiß er, daß sein Tod nahe ist. Er wird sterben. Die Zeit des Stiers geht unaufhaltsam zu Ende …
Du darfst nicht aufgeben – kämpfe! Du bist Asterios, der Sternengleiche, Sohn der Königin und des Weißen Stiers aus dem Meer. Du bist der Auserwählte, der als einziger Kreta vor dem Untergang retten kann. Dein Kommen hat das Orakel prophezeiht. Du wirst die Herde führen. Du sollst der Großen Mutter dienen.
Du bist Asterios …
Widerwillig nur kehrte er in seinen Körper zurück. Er lag auf dem feuchten Höhlenboden wie hingeschmettert, mit zuckenden Gliedern, Schaum vor dem Mund.
Die Fackel war längst erloschen, in dem diffusen Dämmerlicht konnte er nur wenig sehen. Aber er lebte; er bewegte eine Hand, einen Fuß, weit weg, so als ob sie nicht zu ihm gehörten. Er sehnte sich nach Licht. Er versuchte, auf die Füße zu kommen. Es mißlang. Einmal. Zweimal. Schließlich stand er zitternd da und bewegte sich wie ein Schlafwandler auf den Ausgang zu.
Vom Licht geblendet, trat er hinaus in die Welt. Sah hinauf zum endlosen Blau des Himmels.
»Willkommen, Asterios«, begrüßte ihn Merope. »Der dritte Tag geht gerade zu Ende.«
Die Mondkinder
Er watete bis zu den Knien ins Wasser und genoß den warmen Wind auf seiner Haut. Eine Brise kräuselte die Wellen und trug den würzigen Duft der Strandpinien zu ihm herüber. Zu seiner Linken, im stachligen Ufergestrüpp, graste seine Herde.
Er war nicht groß, aber kräftig und muskulös. Braunes, dichtes Haar fiel ihm bis auf die Schultern. Das Gesicht war länglich, die überraschend zierliche Nase leicht nach oben gebogen, was sie neugierig und kühn zugleich machte. Ausgeprägte Backenknochen und ein kantiges Kinn gaben seinen Zügen auf den ersten Blick etwas Bäuerliches – wären da nicht die moosgrünen Augen gewesen. Tiefliegend unter starken Jochbögen, blickten sie skeptisch und aufmerksam. Beinahe verheilte Kratzer zeigten, daß er beim Rasieren noch etwas ungeschickt war. Aber obwohl ein nachdenklicher Zug seine schmalen Lippen versonnen wirken ließ, war nichts Kindliches mehr an ihm.
Er war ein Mann geworden. Er war der Höhle entkommen. Er war Asterios.
Zum erstenmal seit Tagen konnte er wieder richtig atmen, fühlte sich frei und unbeschwert. Nächtelang hatten ihn die Bilder und Gesichter der Höhle verfolgt, nächtelang war das Flüstern in seinem Kopf zu lautem Dröhnen angeschwollen, dem er mit brennenden Augen in der Dunkelheit nachsinnen mußte.
Welch seltsame, weit versprengte Geschichte! Wieder und wieder hatte er die Bilder und Worte in seiner Erinnerung gewendet und versucht, um seine eigene Rolle in dem Geschehen zu begreifen. Die Vergangenheit erschien ihm wie ein dunkles, hungriges Tier. Bedrohlicher aber noch kam ihm die Zukunft vor. Welche Gefahr drohte der Insel? Wieso sollte ausgerechnet er sie retten können? Verzweifelt suchte er nach dem Schlüsselwort, das ihm alles erklären würde. Aber er fand es nicht. Und auch Merope war nach den Tagen in der Höhle ungewohnt wortkarg gewesen, daß er schließlich die meisten seiner Fragen für sich behalten hatte.
Sie hatte nicht geweint beim Abschied, obwohl ihre Augen wie polierte Haselnüsse geglänzt hatten. Eine kurze, innige Umarmung, die in ihm die Gerüche und Empfindungen seiner Kindheit heraufbeschworen hatte. Schließlich hatte er kühles Metall in seiner heißen Hand gespürt.
»Sehe ich dich wieder?«
»Ich bin immer bei dir, mein Sohn. Immer.«
Dann war sie fortgegangen, mit raschen, festen Schritten, die Schultern unter dem Wollumhang ein wenig höhergezogen als gewöhnlich, den Lederbeutel geschultert. Sie hatte sich nicht mehr umgedreht. Da erst hatte er die Faust geöffnet. Eine kostbare Goldschmiedearbeit hatte in seiner Hand gelegen, ein fast taubeneigroßes Medaillon aus dunklem, rötlich schimmerndem Gold: der Sonnenball zwischen dem Doppelhorn des heiligen Stiers.
»Geh nicht!« hatte er tränenerstickt geflüstert. »Komm zurück! Ich brauche dich.«
Doch sie war fort.
Aber hier am Meer wurden die schwermütigen Gedanken der letzten Zeit immer unwirklicher. Asterios ließ sich in den warmen Sand gleiten. Hungrig war er, abenteuerlustig, voller Tatendrang. Längst war seine Kraft zurückgekehrt. Merope hatte ihn vor der Höhle mit Brei und süßem Beerensaft gestärkt, den er noch im Liegen getrunken hatte. Bis zum Morgen waren sie dann auf dem Plateau geblieben, bevor er sich im ersten Grau der Dämmerung stark genug für den Abstieg gefühlt hatte.
Am Fuß des Berges, nach einer Tageswanderung durch die Messaraebene, entlang gelbblühender Flachsfelder, waren sie schließlich am Spätnachmittag an ihrem Ziel angekommen. Der alte Schäfer, dessen Herde er zur Großen Zählung führen sollte, bewohnte keine der Hirtenhütten, wie sie in den Weißen Bergen üblich waren. Am Rand des Dorfes, das nur aus einer Handvoll Häuser mit tiefgezogenen Dächern bestand, lebte er in einem baufälligen Steinhaus.
Gregeri hatte sie schon erwartet. In seiner Stube empfing er sie mit Fladen aus Kichererbsenmehl, Linsengemüse und einem Krug schaumiger Ziegenmilch. Bevor es Nacht wurde, führte er sie zu seinem Pferch. Scheu, dichtgedrängt im blauen Abendlicht die Schafe, neugierig die Ziegen; zwei der Jungtiere legte er Asterios besonders ans Herz.
Später richtete der Alte auf einem Gurtbett das Lager für Merope. Asterios wies er eine Holzbank in einem kleinen Nebenraum zu, der ihm sonst als Vorrats- und Werkzeugkammer diente. Entlang der Wände reihten sich abgeschlagene Tröge und Stampfbüchsen, dazwischen Oliven- und Kornreiben aus Speckstein. Über der Schlafstelle baumelten ein paar Tontöpfe. Schleifsteine, Schüsseln, Becher und Kannen waren auf einem Wandbrett gestapelt. Auf dem Boden standen klobige Keramikamphoren, halbgefüllt mit Öl, dazwischen kniehohe Pithoi, in denen Oliven, Weizen und Gerste aufbewahrt wurden.
Vor dem Einschlafen hatte Merope ihn endlich zu sich gerufen. Im Schein der Kerze war ihr Gesicht blaß und traurig gewesen. Sie hatte die Hand ausgestreckt, und ihm war es so vorgekommen, als wollte sie ihn wie früher an sich ziehen. Plötzlich aber war er sich nicht mehr sicher gewesen. Die alte Vertrautheit war seit den Tagen der Höhle verschwunden. Es war, als wäre mit einem Mal etwas Fremdes, Trennendes zwischen sie getreten, das sie beide schweigsam und einsam machte.
Als Asterios noch diesem Unfaßbaren nachspürte, fing Merope an zu reden. »Geh zur Villa der Königin«, sagte sie. »Reih dich ein in die Schar der Hirten zur Großen Zählung und führe Königin Pasiphaë die besteuerten Tiere zu! Wenn du vor ihr stehst, dann übergib ihr diesen Ring.«
»Und dann?«
»Dann wirst du sie erkennen und sie dich.«
Ihre Worte hatten erneut die Bilder und widersprüchlichen Empfindungen des Höhlendunkels in ihm heraufbeschworen. Wieder sah er sie: den Mann mit der ledernen Stiermaske und die schwarzgelockte Frau, beide nackt, lüstern, schweißnaß. Die Frau, die ihm das Leben geschenkt hatte. Die Königin, vor der er bald schon stehen würde.
Bald, denn er hatte Meropes Befehle nicht gleich befolgt. Anstatt sich sogleich mit den Tieren auf den Weg nach der königlichen Villa in Elyros zu machen, war er mit seiner Herde hier in der Nähe der Bucht geblieben. Er hatte diesen Aufschub dringend gebraucht, um zu sich selbst zurückzufinden. Den wirren Träumen der ersten Nächte waren Tage voll innerer Spannung und unbestimmter Sehnsucht gefolgt. Tage des Grübelns, erfüllt von einer jähen, hitzigen Vorfreude, die ihn untätig und ruhelos machte.
Vorgestern hatte er zum erstenmal das Mädchen am Strand gesehen. Im ersten Morgenlicht, noch traumbenommen, war er plötzlich aufgewacht. Nicht die Kühle des Taus hatte ihn geweckt, sondern das Geräusch schneller Schritte vom Wasser her. Braunes, wehendes Haar über einem hellen Gewand. Nackte Arme und Beine. Bevor er sich noch den Schlaf aus den Augen reiben konnte, war sie schon an ihm vorbei, war aufgesessen und auf ihrem Pferd zwischen den Tamarisken verschwunden.
Am nächsten Tag, zur Zeit der langen Schatten, war sie zurückgekommen. Er war schon am Nachmittag mit seiner Herde ein Stück bachaufwärts gezogen, durch die eng eingeschnittene Schlucht hinauf auf die ersten Anhöhen. Zu Füßen der schroffen Felswände breitete sich ein buntgescheckter Blütenteppich aus. Beiderseits des Wasserlaufs standen Ringelblumen, Blausterne und Bärentrauben in kugeligen Büschen. Die Tiere aber hatten weiter nach oben gedrängt, den Plätzen zu, wo die Zistrosen wuchsen.
Allen voran stürmte ein gescheckter Jungbock. Asterios hatte ihm nachgesetzt, damit er nicht die Blüten des Liebeskrautes Diptam fraß und anschließend nicht mehr zu halten sein würde. Als das Tier schließlich wieder zur Herde abgedreht hatte und er schweißgebadet stehengeblieben war, entdeckte er unten am Strand ihr weißes Gewand. Ungeduldig pfiff er seinen Hund herbei und drängte die Tiere zum Aufbruch. Doch er war zu langsam. Als er atemlos am Meer ankam, war nichts mehr von ihr zu sehen.
In der folgenden Nacht war sie ihm als lichte, verschwommene Traumgestalt erschienen, ein Wesen, das sich sofort auflösen würde, wenn er nur die Hände nach ihm ausstreckte. Und dennoch war er beim Aufwachen zuversichtlich. Er wußte, er würde sie wiedersehen.
Sie kam erst zurück, als sich der Nachmittag schon neigte. Asterios, der sich gerade im Schatten Brot und Ziegenmilch schmecken ließ, hörte das Wiehern ihres Pferdes. Lähmende Befangenheit überfiel ihn, und er war plötzlich sehr froh über die Sträucher, die ihn vor ihr verbargen. Sie ging so nah an ihm vorbei, daß sie sein grünes Versteck beinahe gestreift hätte. Durch die Zweige konnte er die blonden Härchen auf ihren Armen sehen, die Rundung ihrer Brüste, die sich unter dem dünnen Gewand hoben und senkten. Niemals zuvor war ihm ein Mädchen so nah gewesen. Nie zuvor war ihm eine Frau so schön erschienen.
Eine Mischung aus Entzücken und Verlegenheit beunruhigte ihn, als sie ihr Kleid in den Sand gleiten ließ. Nackt ging sie zum Wasser, netzte vorsichtig ihre Beine, zog fröstelnd die Schultern hoch, als die Wellen ihren Bauch erreichten, und warf sich dann in die Fluten.
Sie schwamm mit gleichmäßigen Zügen hinaus und ließ sich auf dem Rücken treiben. Asterios konnte seine Augen nicht von ihrem hellen Körper lösen, der langsam auf- und abschaukelte. Dann kam sie wieder zurück und ließ sich in den Sand sinken.
Er starrte auf ihre schönen Brüste und den Schwung ihrer Hüften und spürte, wie seine Erregung stieg. Als er seine unbequeme Haltung verändern wollte, stieß er an seinen dösenden Hund, der empört aufjaulte.
Das Mädchen wandte irritiert den Kopf.
Verzweifelt versuchte Asterios, das Tier zum Verstummen zu bringen, und hielt ihm die Schnauze zu. Aber sein schattiges Versteck war verraten. Als er vorsichtig zu dem Mädchen hinüberschaute, trafen sich ihre Blicke.
Blitzschnell war sie auf den Beinen, streifte sich das kurze Kleid über und lief zu ihrem Pferd, das an einer Pinie angebunden war.
»Lauf nicht fort! Bitte!« rief er ihr zu.
Sie blieb stehen, wandte sich wütend um und musterte ihn mißtrauisch.
»Was tust du hier? Was fällt dir ein, mich zu belauern?«
»Ich habe dich nicht belauert«, versuchte er sich zu rechtfertigen. »Ich bin schon seit einigen Tagen hier. Ich wollte allein sein, um nachzudenken.«
»Nachdenken!« schnaubte sie und musterte seinen einfachen Schurz und das mehrfach geflickte Hemd. »Warum versteckst du dich dann und wartest, bis du nackte Frauen zu sehen bekommst? Wer bist du überhaupt? Sind das dort drüben deine Tiere? Dann solltest du dich lieber um sie kümmern!«
»Laß die Herde nur meine Sorge sein«, erwiderte er. »Ich bin ein freier Hirte und kann tun und lassen, was ich will.«
»Ein freier Hirte«, äffte sie ihn nach und knüpfte dabei ein buntes Band um ihre Taille. Aber seine Antwort hatte sie überrascht. Ihre anfängliche Feindseligkeit jedenfalls war verschwunden. Mit unverhohlener Neugierde starrte sie ihn an, und er starrte verzückt zurück. Sie hatte große, beinahe bernsteinfarbene Augen.
»Offensichtlich bist du zu frei, um einen Namen zu haben«, schnitt ihre helle Stimme in seine Tagträume.
»Ich bin …«, stotterte er, »ich heiße Ast… Astro. Und wie heißt du?«
Er konnte ihr den neuen Namen nicht sagen, nicht, bevor er die Königin gesprochen hatte. Kein Hirte hieß Asterios.
»Mein Name ist unwichtig«, versetzte sie leichthin und registrierte, wie sein Blick sich verdüsterte. »Wir werden uns ohnehin nicht wiedersehen. Geh zur Seite, Hirte, ich muß losreiten.«
»Du darfst nicht gehen«, stieß Asterios hervor. »Bitte! Ich werde dich nie wieder belauern!«
»Nein?« gab sie kokett zurück und lächelte vielsagend. »Nie wieder? Kann es sein, daß du dir gar nichts aus Frauen machst?«
»O doch! Besonders, wenn sie so schön sind wie du.«
Jetzt war sie es, die den Blick senkte. Beide standen sich so nah gegenüber, daß ihre Körper sich fast berührten. Daß sie den Atem des anderen auf der Haut spüren konnten. Einen langen Augenblick.
»Ich muß gehen«, sagte sie endlich leise. »Ich habe mich schon verspätet.«
»Aber was ist morgen?« drängte er und versuchte, ihr den Weg zu verstellen. »Kommst du morgen wieder?«
»Vielleicht. Wenn ich rechtzeitig von zu Hause wegkomme. Es ist ein gutes Stück von der Stadt bis ans Meer.«
»So stammst du aus Chalara, das beim Palast der Königin liegt!« rief Asterios.
»Nicht direkt«, erwiderte sie rasch und wurde rot. »Aus der Nähe, könnte man sagen.«
Wieder sahen sie sich unverwandt an.
»Wirst du kommen?« Das war seine letzte Frage.
»Vielleicht.«
Damit ritt sie davon.
Unendlich langsam verging der Abend. Er dachte an ihren warmen Duft, an ihr kehliges Lachen, an ihren nackten Körper. Er fühlte keinen Hunger und wollte nicht müde werden. Wie im Traum verrichtete er seine gewohnte Arbeit. Die Tiere waren unruhig, als spürten sie seine Gedankenverlorenheit. In der mondlosen Nacht lag er wach, lauschte dem Rauschen der Wellen und dachte an den Delphinring, den er der Königin überbringen sollte. Schließlich schlief er ein.
Ihr Haar kitzelte sein Gesicht. Ihre Augen waren ganz nah.
»Guten Morgen, Hirte. Schön geträumt?«
Verschlafen rappelte er sich auf. Sie schien direkt seinem Traum entstiegen zu sein.
»Du kommst so früh«, brachte er schließlich hervor und versuchte, mit den Fingern sein störrisches Haar zu bändigen.
»Soll ich wieder gehen?« kicherte sie. »Alle haben noch geschlafen, als ich mich fortgeschlichen habe. Niemand hat mich gesehen.«
Ihre Lippen waren so sanft, ihre Augen wie dunkler Honig.
»Natürlich nicht! Ich freue mich, dich zu sehen. Ich muß zuerst meine Ziegen melken. Aber danach können wir zusammen schwimmen, wenn du Lust hast.«
Sie antwortete mit einer vagen Handbewegung. Schweigend sah sie zu, wie er seine Decke sorgfältig zusammenschnürte. Als er zu den Tieren ging, folgte sie ihm.
Asterios molk die dicken Euter der Ziegen und ließ die Milch in einen Ledereimer fließen. Anschließend legte er frische Scheite auf das Feuer, das die ganze Nacht über geglüht hatte. Die Milch goß er in einen kleinen Kupferkessel und achtete darauf, daß er stabil über den aufflackernden Flammen stand. Aus einem flachen Lederschlauch gab er ein paar Spritzer Feigensaft dazu und begann, vorsichtig umzurühren.
Das Mädchen war inzwischen nähergekommen und sah ihm aufmerksam zu. Obwohl er äußerlich ruhig blieb, fühlte er, wie heiße Wellen seinen Körper durchfluteten. Nur mit Mühe konnte er verhindern, daß seine Hände zitterten.
Nach einer Weile hatte die Milch im Kessel den Gerinnungspunkt erreicht. Behutsam schöpfte Asterios mit einer Holzkelle die Sauermilch ab, goß sie durch ein Sieb aus geflochtenen Weiden und ließ sie über eine Tonschale abtropfen. Dann prüfte er den Stand der Sonne und nickte zufrieden. Er hatte den Platz gut gewählt. Der weiße Käse würde im kühlen Schatten reifen können.
Mit heftig klopfendem Herzen wandte er sich schließlich ihr zu.
»Wie geschickt du bist!« sagte sie lächelnd in sein erhitztes Gesicht, und er war sich wieder nicht sicher, ob sie ihn nicht verspottete. Mit ihrem durchsichtigen Kleid und den koketten Blicken war sie so anders als die Bauernmädchen, denen er bisher begegnet war.
»Was ist nun? Wollen wir schwimmen?« fragte er deshalb betont forsch.
»Geh schon voraus«, erwiderte sie und löste die Spange, die ihr Haar im Nacken zusammenhielt. »Ich komme nach.«
Bemüht, seine Verlegenheit vor ihr zu verbergen, schlenderte Asterios zum Meer und warf Hemd und Schurz ab. Nackt spürte er, wie sie prüfend ihre Augen über seinen Körper gleiten ließ. Er konnte diese Musterung nicht länger ertragen, rannte ins Wasser und tauchte weit hinaus.
Schon als Junge hatte er sich gern im Meer getummelt. Du schwimmst wie ein Delphin, hatte Merope ihn oftmals geneckt. Der plötzliche Gedanke an sie verscheuchte seine Ausgelassenheit. Er hatte versprochen, den Delphinring zu überbringen. Und die Zeit wurde allmählich knapp. Unwillig drehte er um und schwamm wieder zum Ufer zurück. Nach längerem Zögern streck te er sich in den Sand und schloß die Augen.