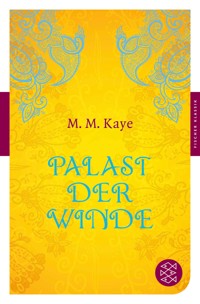
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Der berühmte Weltbestseller, das große Indien-Epos: eine faszinierende west-östliche Liebe in den Hochtälern des Himalaja. Der junge Engländer Ash und die indische Prinzessin Anjuli geraten zwischen die Fronten der blutigen Kolonialkriege: Ash wächst wie ein Hindu in den Bergen des Himalaja auf. Zerrissen zwischen der Liebe zum Land seiner englischen Vorfahren und dem seiner Kindheit kämpft Ash als Offizier der britischen Armee. Als er die schöne Anjuli kennen lernt, setzt er alles daran, zwischen Indern und Briten zu vermitteln - und das Herz der Prinzessin zu gewinnen. Doch Anjuli ist bereits einem anderen versprochen. Inmitten der Fronten kämpfen die beiden Liebenden verzweifelt um ihr Glück…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2076
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
M.M. Kaye
Palast der Winde
Roman
Über dieses Buch
Der junge Engländer Ash und die indische Prinzessin Anjuli geraten zwischen die Fronten der blutigen Kolonialkriege: Ash wächst wie ein Hindu in den Bergen des Himalaja auf. ER fühlt sich weder im Land seiner englischen Vorfahren noch dem seiner Kindheit wirklich akzeptiert. Als Offizier der britischen Armee versucht er seinen Platz im Leben zu finden. Als er die schöne Inderin Anjuli kennenlernt, setzt er alles daran, als Kundschafter zwischen Indern und Briten zu vermitteln - und das Herz der Prinzessin zu gewinnen. Doch Anjuli ist bereits einem anderen versprochen. Inmitten der Fronten kämpfen die beiden Liebenden um ihr Glück …
Der große Roman wurde erfolgreich verfilmt, mit Ben Cross, Amy Irving und Omar Sharif in den Hauptrollen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
M. M. Kaye wurde in indischen Simla geboren. Ihre Familie war seit Generationen fest mit dem Land verwurzelt: Großvater, Vater, Bruder und Ehemann dienten indischen Herrschern. Die Autorin verbrachte den größten Teil ihrer Kindheit in Indien, lebte später mit ihrem Mann, einem General der englischen Armee, unter anderem in Quetta, Dehra Dun und Rajputana und verbrachte mehrere Jahre auf einem Hausboot in Kaschmir. Sie starb 2004 in Südengland.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel ›The Far Pavillions‹
im Verlag Allen Lane, Penguin Books Ltd., London
© by M. M. Kaye 1978
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© Wolfgang Krüger Verlag GmbH im S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main, 1979
Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hinsinger
Coverabbildung: Hannes Jähn
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490325-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
[Erstes Buch – Der Zweig wird gebogen]
1
2
3
4
5
6
7
[Zweites Buch – Belinda]
8
9
10
11
12
[Drittes Buch – Zeitlose Welt]
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
[Viertes Buch – Bhithor]
27
28
29
30
31
[Fünftes Buch – Das Narrenparadies]
32
33
34
35
[Sechstes Buch – Juli]
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
[Siebentes Buch – Mein Bruder Jonathan]
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
[Achtes Buch – Das Land Kains]
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Anmerkungen für Wißbegierige
[Die Abbildungen des Buches]
Gewidmet den Offizieren und Mannschaften unterschiedlicher Abstammung und unterschiedlichen Glaubens, die mit Stolz und Hingabe seit 1846 im
Kundschafterkorps
gedient haben, darunter Leutnant Walter Hamilton, Träger des Viktoriakreuzes, mein Mann, Generalmajor Goff Hamilton und dessen Vater, Oberst Bill Hamilton.
Meister, wir sind die Pilger, wir gehen immer noch einen Schritt weiter. Denn hinter jenem blauen schneebedeckten Gipfel, jenseits des tosenden, glitzernden Meeres, weiß auf einem Thron oder bewacht in einer Höhle, lebt vielleicht der Seher, der weiß, wozu der Mensch geboren ist …«
JAMES ELROY FLECKER
»Nie ist’s zu spät zu suchen eine neu’re Welt.«
TENNYSON
Gründung der East India Company in London.
Ziel: Das portugiesische Handelsn1ono pol mit den1 Fernen Osten soll gebrochen werden.
1757Die Streitmacht der East India Company besiegt das Heer des Herrschers von Bengalen bei Plassey. Mit diesem Sieg beginnt die englische Vormachtstellung, in Indien; zunächst in Bengalen; wichtigster Handelsplatz ist Kalkutta.
1764Indische Erhebung gegen die East India Company.
Die vereinigten indischen Truppen werden von der Streitmacht der Company bei Baksar geschlagen.
1798Der neue Generalgouverneur, Lord Wellesley, leitet die britische Expansionspolitik in Indien ein.
1816–18Wellesleys Nachfolger, Lord Hastings, setzt die Eroberungspoitik in mehreren Feldzügen fort. Die East lndia Company kontrolliert nun den größten Teil Indiens.
1829Die Engländer verbieten die bei den Hindus übliche Witwenverbrennung.
1833Abschaffung der Sklaverei im Britischen Weltreich.
1839–421. Afghanischer Krieg. Versuch Englands, Afghanistan zu unterwerfen, scheitert. ernichtende Niederlage der britischen Streitmacht am Chaiber-Paß.
1857Blutiger Aufstand der Inder gegen die englischen Besatzer. Indische Truppen in englischen Diensten meutern: (Sepoy-Aufstand). Die Rebellion wird niedergeschlagen. Die East lndia Company wird aufgelöst.
1858Indien wird Kronkolonie.
1876Erhebung Indiens zum Kaiserreich. (Viktoria Kaiserin von Indien).
1878–802. Afghanischer Krieg.
Erstes BuchDer Zweig wird gebogen
1
Ashton Hilary Akbar Pelham-Martyn wurde in einem Zeltlager unweit eines Passes im Himalaja geboren und kurz darauf in einem zusammenlegbaren Wassersack aus Segeltuch getauft.
Sein erster Schrei wetteiferte kühn mit dem Gebrüll eines Leoparden, der sich etwas weiter unten am Hang befinden mußte, und sein erster Atemzug füllte die Lungen mit der eisigen Luft, die von den hohen Gipfeln blies und den Dunst der Ölfunzel, den Geruch nach Blut und Schweiß und den durchdringenden Gestank der Tragtiere mit dem frischen Duft von Schnee und aromatischen Kiefernnadeln mischte.
Als der eisige Windstoß den nachlässig verschnürten Zelteingang aufriß und die Flamme der verrußten Ölfunzel heftig zu flackern begann, hörte Isobel das lebenslustige Krähen ihres Sohnes und sagte matt: »Wie ein Siebenmonatskind schreit er eigentlich nicht, oder? Ich muß mich wohl … muß mich wohl verrechnet haben …«
So war es denn auch, und dieser Rechenfehler kam Isobel teuer zu stehen. (Schließlich muß bei weitem nicht jeder gleich mit dem Leben für eine solche Nachlässigkeit bezahlen.)
Zu ihrer Zeit – es war die von Königin Viktoria und Prinzgemahl Albert – galt Isobel Ashton als eine empörend unbürgerliche junge Frau, und als sie – Waise, ledig und in der offen bekundeten Absicht, ihrem unverheirateten Bruder den Haushalt zu führen – im Jahr der Weltausstellung an der nordwestlichen Grenze Indiens in der Garnison Peshawar eintraf, wurden nicht nur viele Augenbrauen mißbilligend hochgezogen, es fielen auch abschätzige Bemerkungen. Der Bruder William war übrigens erst kürzlich zur Heeresabteilung der Kundschafter versetzt worden.
Als Isobel dann ein Jahr später Hilary Pelham-Martyn heiratete, einen auf seinem Gebiet berühmten Sprachwissenschaftler, Ethnologen und Botaniker, und mit ihm eine offenbar unbegrenzt lange, gemächliche Forschungsreise ins Vorgebirge von Hindustan antrat, ohne festen Reiseplan und ganz ohne weibliche Bedienung, da wurden die Brauen neuerlich hochgezogen, diesmal eher noch indignierter.
Hilary war ein eingefleischter Junggeselle von mittleren Jahren. Wie er auf den Gedanken hatte verfallen können, ein wenn auch ansehnliches, so doch mit Indien ganz und gar unvertrautes Mädchen zu heiraten, nicht halb so alt wie er selber, wußte er wohl auch nicht zu sagen, geschweige denn wer anders. Daß er überhaupt hatte heiraten wollen, einerlei wen, blieb der »Gesellschaft« von Peshawar unerklärlich, während sie Isobel unterstellte, mit der Heirat handfeste Ziele verfolgt zu haben: Hilary war so vermögend, daß er sich sein Leben nach Belieben einrichten konnte, und mit seinen Veröffentlichungen hatte er sich in wissenschaftlichen Kreisen bereits einen Namen gemacht. Miß Ashton, so lautete die übereinstimmende Ansicht, hatte sich nicht übel versorgt.
In Wahrheit heiratete Isobel weder des Geldes wegen, noch um unter dem Schutze eines Mannes zu stehen. Sie hatte ein offenes Wesen, war spontan, impulsiv und unverbesserlich romantisch, und das Leben, das Hilary führte, erschien ihr als der Gipfel romantischen Daseins. Was konnte zauberhafter sein, als das sorglose Leben dessen, der fremde Gegenden durchstreifte, die Ruinen versunkener Reiche erforschte, unter offenem Himmel schlief, sich um Konventionen und Verbote der modernen Gesellschaft nicht scherte? Übrigens spielte ein weiteres Motiv mit, und dieses mag den Ausschlag gegeben haben: sie befand sich in einer unerträglichen Lage, der sie entkommen wollte.
Daß sie bei ihrer Ankunft in Indien erfahren mußte, ihr Bruder sei nicht nur entsetzt darüber, mit einer unverheirateten Schwester belastet zu werden, sondern auch ganz und gar nicht imstande, ihr ein passendes Quartier zu stellen, war eine demütigende Erfahrung. Die Kundschafter waren damals in endlose Scharmützel mit den Grenzstämmen verwickelt und kamen kaum je in ihrer Garnison in Mardan zur Ruhe; erklärlich also, daß nicht nur William, sondern auch das Regiment insgesamt Isobels Eintreffen mit Unbehagen zur Kenntnis nahmen. Es war dann vereinbart worden, Isobel vorerst im Hause von Oberst Pemberthy und seiner Frau in Peshawar unterzubringen, doch ruhte darauf kein Segen.
Pemberthys waren wohlmeinende Menschen, doch unerträgliche Langweiler. Überdies hatten sie deutlich zu erkennen gegeben, daß sie Miß Isobels Reise nach Indien ohne passende Begleitung mißbilligten, und sie bemühten sich nach Kräften, mittels Vorbild und Rat den schlechten Eindruck zu verwischen, den Isobel durch ihre Ankunft gemacht hatte. Sie merkte rasch, daß man von ihr erwartete, sich steif und hölzern und den Anstandsregeln peinlich genau entsprechend zu betragen. Dies dürfe sie keinesfalls tun, es sei nicht ratsam, jenes zu tun … Die Liste der Verbote war endlos.
Die Gattin des Obersten, Edith mit Namen, interessierte sich nicht die Spur für das Land, in welchem sie und ihr Gatte den größten Teil ihres Lebens verbrachten, sie betrachtete die Einwohner als unzivilisierte Heiden, aus denen sich mit viel Geduld und Strenge und bei etwas Glück brauchbare Dienstboten machen ließen. Ein echter Austausch mit ihnen, einerlei auf welcher Ebene, war für Mrs.Pemberthy einfach unvorstellbar, und daß Isobel in den Basaren umherwandern und das umliegende Land bis zum Indus und zum Khaibarpaß zu Pferde erkunden wollte, fand sie höchst abwegig.
»Zu sehen gibt es hier nichts«, verkündete Mrs.Pemberthy. »Und die Eingeborenen sind blutdürstige Wilde, nicht die Spur vertrauenswürdig.« Der Gatte stimmte dieser Auffassung bei, und die acht Monate, die Isobel unter dem Dach dieser guten Menschen verbrachte, kamen ihr vor wie acht Jahre. Freundinnen fand sie nicht, denn die Damen der Garnison hatten über zierlich gehaltenen Teetassen entschieden, Miß Ashton sei leichtfertig und höchstwahrscheinlich nur nach Indien gekommen, um sich einen Mann zu angeln. Diese Beurteilung wurde so häufig wiederholt, daß auch die unverheirateten Offiziere der Garnison sie sich zu eigen machten. Sie bewunderten zwar Isobels Erscheinung, ihr freies Auftreten, ungekünsteltes Betragen und ihre Reitkünste, hüteten sich aber geradezu ängstlich davor, als die Beute einer gerissenen Männerjägerin zu erscheinen; deshalb hielten sie sich denn auch zurück. Es war daher nicht verwunderlich, daß Isobel von der Garnison Peshawar gründlich genug hatte, als Professor Pelham-Martyn auftauchte. Er befand sich in Gesellschaft seines lebenslangen Freundes und Reisebegleiters Sirdar Bahadur Akbar Khan und einer zusammengewürfelten Horde von Dienern und Helfern, samt vier versperrten, von Ponies transportierten Lederkoffern. Diese Behältnisse bargen das Manuskript über die Ursprünge des Sanskrit und einen umfassenden, verschlüsselten Bericht teils amtlichen, teils halbamtlichen Interesses über Vorgänge im Bereich der Ostindischen Handelskompanie.
Hilary Pelham-Martyn ähnelte Isobels verstorbenem Vater ungewöhnlich stark. Mr.Ashton war ein liebenswerter und skurriler Gentleman gewesen, und wurde von seiner Tochter geradezu vergöttert. Dies mag ihr spontanes Interesse für den Professor erklären; dazu kam die Hoffnung, in seiner Gesellschaft unangefochten sie selber sein und sich ungezwungen benehmen zu dürfen. Sie fand eigentlich alles ungemein anziehend an ihm – seine Lebensumstände, das intensive Interesse, das er Indien und dessen Bewohnern entgegenbrachte, seinen graustoppeligen, verkrüppelten Freund Akbar Khan, und seine absolute Gleichgültigkeit gegenüber allen Maßstäben, die für Menschen wie Pemberthys von Bedeutung waren. So sonderbar es klingt, in ihm bot sich ihr Flucht und Sicherheit zugleich, und sie steuerte auf die Ehe mit der gleichen Kühnheit zu und mit ebenso wenig Bedenken künftiger Fährnisse wegen, wie sie in Tilbury die Gordon Castle für die lange Reise nach Indien bestiegen hatte. Und diesmal wartete am Ende keine Enttäuschung.
Anzumerken ist, daß Hilary sie mehr wie eine Lieblingstochter behandelte denn als Ehefrau, was ihr durchaus recht war und viel dazu beitrug, daß das unregelmäßige Lagerleben, welches sie in den kommenden zwei Jahren mit ihm führte, einen Anstrich von Stabilität und Kontinuität bekam. Da sie nie zuvor verliebt gewesen war, hatte sie auch keinen Maßstab für das Gefühl, das sie ihrem umgänglichen und so unkonventionellen Gatten entgegenbrachte und war folglich so zufrieden, wie ein Mensch nur sein kann. Hilary gestattete ihr, im Herrensitz zu reiten, und zwei glückliche Jahre lang bereisten sie das Land, erkundeten die Vorgebirge des Himalaja, folgten der Straße, auf der der Herrscher Akbar nach Kaschmir gezogen war und verbrachten die Winter in den wärmeren Ebenen, umgeben von verfallenen Gräbern und Palästen längst vergessener Städte. Während dieser Zeit ermangelte Isobel so gut wie aller weiblichen Gesellschaft, ohne daß sie darunter gelitten hätte. Es gab immer interessante Bücher zu lesen, Hilarys botanische Sammlung war zu ordnen, Pflanzen waren zu pressen – Beschäftigungen, denen sie abends nachging, wenn ihr Mann und Akbar Khan über dem Schachbrett saßen oder hitzige Diskussionen führten, bei denen es um Politik und Religion, göttliche Vorsehung und Rassenfragen ging.
Sirdar Bahadur Akbar Khan, ein grauhaariger ehemaliger Kavallerieoffizier, war in der Schlacht von Mianee schwer verwundet worden und hatte sich auf den Besitzungen seiner Vorväter am Flusse Ravi niedergelassen, um seine Tage dort mit so friedlichen Beschäftigungen wie Pflanzenbau und dem Studium des Koran zu verbringen. Die Männer lernten einander kennen, als Hilary unweit des Heimatortes von Akbar Kahn sein Lager aufschlug, und sie empfanden schon bei der ersten Begegnung große Zuneigung füreinander. In Charakter und Lebensanschauung glichen sie einander sehr, und es kam hinzu, daß Akbar Khan sich eigentlich doch noch nicht so recht damit abfinden mochte, bis zu seinem Lebensende an ein und demselben Ort zu verweilen.
»Ich bin ein alter Mann, ich habe keine Frauen und auch keine Kinder mehr, denn meine Söhne haben im Dienst der Ostindischen Handelskompanie den Tod gefunden, und meine einzige Tochter ist verheiratet. Was also sollte mich hier halten? Laß uns zusammen reisen, denn ein Zelt ist besser als die vier Wände eines Hauses, besonders für jemanden, der wie ich sein Leben hinter sich hat«, sagte Akbar Khan.
Seither also reisten die beiden zusammen und leisteten einander Gesellschaft. Akbar Khan entdeckte bald, daß die Tätigkeit seines Freundes, das Botanisieren, das Erforschen der Ruinen und die Aufzeichnung der ländlichen Dialekte eine hervorragende Tarnung abgaben für eine ganz andere Tätigkeit: Im Auftrage gewisser Regierungsmitglieder, die den Verlautbarungen der Ostindischen Handelskompanie mißtrauten, fertigte Hilary vertrauliche Berichte an, eine Tätigkeit, die Akbar Khan durchaus billigte und zu der er wertvolle Hilfe leistete, weil die Kenntnis seiner Heimat ihn instand setzte, genau einzuschätzen, welche Bedeutung den mündlichen Äußerungen seiner Landsleute zukam. Die beiden hatten also im Laufe von Jahren ganze Aktenbündel zusammengetragen, in denen es von Fakten und Warnungen nur so wimmelte; einiges davon wurde in der britischen Presse veröffentlicht, wohl auch im Ober- und Unterhaus debattiert, jedoch war der Nutzen, der daraus entstand, gleich null, denn die Öffentlichkeit ignorierte vorsätzlich alles, was zu besorgtem Nachdenken hätte Anlaß geben können – eine Schwäche, welche die englische Öffentlichkeit mit der anderer Länder teilt, Hilary hätte sich also ebenso gut auf seine botanische Sammlung beschränken können.
Als Hilary seiner Karawane ganz überraschend eine Ehefrau hinzufügte, waren der Professor und sein Freund bereits fünf Jahre beisammen, und Akbar Khan nahm die Veränderung mit jener Gelassenheit hin, die ohne viel Aufhebens auch einem Eheweib einen Platz in der Weltordnung zubilligt. Er, als einziger von den drei Beteiligten, war auch keineswegs unangenehm überrascht, als Isobel entdeckte, daß sie schwanger war; schließlich ist es die Pflicht der Weiber, Kinder zu gebären, vorzugsweise Söhne.
»Er soll Offizier bei den Kundschaftern werden wie sein Onkel«, sagte Akbar Khan, ganz in eine Schachpartie vertieft, »vielleicht auch Gouverneur einer Provinz.«
Wie die meisten Frauen ihrer Generation war Isobel erschreckend unwissend, was die Geburt eines Kindes anging. So war ihr lange verborgen geblieben, daß sie schwanger war, und die Tatsache als solche überraschte und verärgerte sie – auf den Gedanken, Angst zu empfinden, kam sie überhaupt nicht. Ein Baby mußte das Lagerleben komplizierter machen, schließlich brauchte es ständige Aufmerksamkeit, es brauchte eine Amme, es brauchte besondere Mahlzeiten … wirklich, das war mehr als ärgerlich.
Der ebenso überraschte Hilary meinte zunächst, sie täusche sich über ihren Zustand. Als Isobel ihm aber versicherte, dies sei nicht der Fall, fragte er, wann denn das Kind geboren werden würde. Auch darüber wußte Isobel nicht im geringsten Bescheid, sie überdachte die vergangenen Monate, zählte sie an den Fingern ab, runzelte die Stirn, zählte noch einmal und stellte dann eine Prognose, die absolut unzutreffend war.
Hilary erklärte darauf: »Dann sollten wir uns Richtung Peshawar auf den Weg machen, denn dort gibt es bestimmt einen Arzt und verständige Frauen. Ich nehme an, es reicht, wenn wir einen Monat vor deiner Niederkunft dort eintreffen? Doch um ganz sicher zu gehen, wollen wir lieber schon sechs Wochen früher dort sein.«
Und so kam es denn, daß sein Sohn in der Wildnis geboren wurde, ohne Beistand eines Arztes, einer Hebamme oder auch nur jener Arzeneien, über welche die Wissenschaft damals verfügte.
Es gab im Lager zwar mehrere verschleierte weibliche Verwandte männlicher Hilfskräfte, doch geeignet, sich eines Kindes anzunehmen, war einzig Sita, die Frau von Hilarys Pferdeknecht Daya Ram, eine Frau aus den Bergen von Kangan, die doppelte Schande über sich gebracht hatte, indem sie in den vergangenen fünf Jahren ausschließlich Töchter – fünf an der Zahl – geboren und diese schon bald durch den Tod verloren hatte. Das letzte Kind war in der Vorwoche gestorben und hatte keine drei Tage gelebt.
»Es sieht ganz so aus, als könnte sie keine Söhne gebären! Die Götter haben ihr aber vielleicht genug Verstand mitgegeben, sie zu befähigen, ein Kind auf die Welt zu befördern«, sagte Daya Ram angewidert. Und so amtierte denn die bedauernswerte, eingeschüchterte, vom Schicksal so schwer geschlagene Sita bei Isobels Niederkunft als Hebamme, und fürwahr, sie besaß genügend Geschick, einem männlichen Kind ins Leben zu verhelfen.
Daß Isobel dennoch starb, war nicht Sitas Schuld, es war der Wind, welcher Isobel tötete, der Wind, der von den hohen, schneebedeckten Gipfeln hinter den Pässen herunterfegte. Er wirbelte Staub und trockene Kiefernnadeln auf, er trieb sie durch das Zelt, wo die Ölfunzel flackerte, und dieser Staub war voller Bakterien und voller Schmutz – Schmutz, den es selbstverständlich in der geschützten Garnison von Peshawar nicht gegeben hätte, wo ein englischer Arzt der jungen Mutter sich angenommen haben würde.
Als drei Tage später ein wandernder Missionar, der den Bergpfad auf dem Weg in den Pandschab herabstieg, am Lager rastete, forderte man ihn auf, das Kind zu taufen. Dies tat er in einem zusammenlegbaren Wassersack aus Segeltuch und er gab dem Knaben auf Verlangen des Vaters den Namen Ashton Hilary Akbar. Die Mutter des Kindes bekam er nicht zu sehen, er hörte nur, sie befinde sich nicht wohl, was ihn weiter nicht überraschte, weil ihm klar war, daß diese bedauernswerte Dame in einem solchen Lager nicht mit der notwendigen Pflege rechnen konnte.
Wäre er zwei Tage länger geblieben, er hätte die Bestattung von Mrs.Pelham-Martyn vornehmen können, denn vierundzwanzig Stunden nach der Taufe ihres Sohnes starb Isobel und wurde von ihrem Gatten und dessen Freund auf einer Paßhöhe beigesetzt, von der aus man auf das Zeltlager herunterblicken konnte. Wer zum Lager gehörte, nahm an der Trauerfeier teil und zeigte seinen Kummer unmißverständlich.
Hilary trauerte. Darüber hinaus fühlte er sich aber auch gekränkt. Was, um Himmels willen, sollte er nun mit dem Kind ohne Isobel anfangen? Von Babies wußte er nur, daß sie ständig heulen und zu allen Tages- und Nachtstunden gefüttert werden wollen. »Was machen wir denn bloß mit ihm?« fragte er daher Akbar Khan und starrte seinen Sohn mißbilligend an.
Akbar Khan stupste das Baby mit einem seiner knochigen Finger, und als es diesen umklammerte, lachte Akbar laut: »Ah, das ist ein starker, ein kühner Junge. Er soll Soldat werden, Offizier und Anführer vieler Berittener. Mach dir seinetwegen keine Sorgen, mein Freund, die Frau von Daya Ram wird ihn nähren, wie sie es schon vom ersten Tage an getan hat. Daß sie ihr eigenes Kind erst kürzlich verloren hat, ist gewiß dem Willen Allahs zuzuschreiben, dessen Weisheit wir achten sollten.«
Hilary widersprach: »Wir können das Kind doch nicht im Lager behalten, irgendwie muß es nach England gebracht werden. Gewiß fährt bald jemand auf Heimaturlaub. Pemberthys wissen bestimmt jemanden. Besser noch, wir schicken den jungen William. Im übrigen habe ich in England einen Bruder, und dessen Frau kann sich des Kleinen annehmen, bis ich selbst zurückkomme.«
Dies beschlossen, hielt er sich an den Rat seines Freundes und machte sich weiter keine Gedanken mehr. Und weil das Kind glänzend gedieh und kaum jemals weinte, meinte Hilary, daß es mit der Rückreise nach Peshawar wohl doch nicht so eilig sei. Man brach das Lager ab, und nachdem Isobels Name in einen schweren Felsbrocken auf ihrem Grab eingemeißelt worden war, schlugen sie den Weg ostwärts Richtung Garhwal ein.
Nach Peshawar kam Hilary überhaupt nicht mehr, und als unverbesserlich zerstreuter Mensch unterließ er es, seinen Schwager William und die anderen Verwandten in England davon zu unterrichten, daß er jetzt nicht nur Vater war, sondern auch Witwer. Erinnert wurde er an diese Tatsache nur sehr selten, dann nämlich, wenn ein an seine Frau adressierter Brief eintraf. Weil er aber stets mit anderem zu sehr beschäftigt war, um sich dieser Korrespondenz anzunehmen, verschob er deren Erledigung immer wieder auf einen späteren Zeitpunkt, was bedeutete, daß er es unweigerlich vergaß, wie er denn auch bald Isobel vergaß. Gelegentlich entfiel ihm sogar, daß er einen Sohn besaß.
»Ash-Baba«, wie das Kind anfangs von seiner Pflegemutter Sita und den übrigen Lagerbewohnern genannt wurde, verbrachte die ersten achtzehn Monate seines Lebens im Hochgebirge und machte seine Gehversuche auf den grasbewachsenen Hängen am Fuße des aufragenden Gipfels des Nanda Devi und der schneebedeckten Bergkette, aus der er emporragte. Wer ihn im Lager umherkriechen sah, hätte ihn ohne weiteres für Sitas Kind gehalten, denn Isobel hatte schwarze Haare, graue Augen und eine honigfarbene Haut gehabt und ihrem Sohn diese Farben vererbt. Auch hatte er viel von ihrer Schönheit geerbt, und Akbar Khan sagte denn auch, aus ihm werde eines Tages mal ein ansehnlicher junger Mann werden.
Man blieb nie lange am gleichen Ort, weil Hilary die Dialekte der Eingeborenen aufzeichnete und wilde Pflanzen sammelte. Endlich aber ließ es sich nicht vermeiden, daß sie dem Gebirge den Rücken kehrten. Sie reisten südwärts über Jhansi und Sattara an die üppig-grüne Küste von Coromandel mit ihren unendlich langen, weißen Stränden.
Ash-Baba vertrug die hier herrschende Hitze und die Luftfeuchtigkeit längst nicht so gut wie die kühle Luft der Berge, und Sita, die ja selbst aus dem Gebirge stammte, erzählte ihm endlose Geschichten aus ihrer Heimat, die weit im Norden in den Bergketten des Hindukusch lag. Sie berichtete von Gletschern und Lawinen, von verborgenen Flußtälern, wo es in den Gewässern von Eisforellen wimmelte, wo die Talgründe ganze Teppiche von Blumen trugen, wo im Frühjahr der Duft von Blüten die Luft sättigte, wo Äpfel und Walnüsse in trägen goldenen Sommertagen heranreiften. Solche Geschichten waren dem Kleinen am liebsten. Ihm zuliebe erdachte Sita sich ein Tal, das ihnen beiden ganz allein gehörte. Dort würden sie eines Tages aus Lehm und Brettern eine Hütte errichten und auf deren flachem Dach Mais und rote Pfefferschoten trocknen. Es würde einen Garten geben, in dem Mandeln und Pfirsiche gediehen, wo man eine Ziege halten konnte, eine Katze und einen kleinen Hund.
Weder Sita noch die anderen Hilfskräfte im Lager sprachen Englisch, und erst im Alter von vier Jahren wurde Ash klar, daß die Sprache, in welcher sein Vater ihn gelegentlich anredete, seine Muttersprache hätte sein sollen. Weil er aber Hilarys Sprachbegabung geerbt hatte, erlernte er im Lager verschiedene Dialekte: von Swab Gul lernte er Pushtu, Hindi von Ram Chand, und von den Südländern Tamil, Gudscharati und Telegu, wenngleich er es vorzog, die Sprache des Pandschab zu sprechen, wie er sie von Akbar Khan, von Sita und deren Mann hörte. Europäische Kleidung trug er fast nie, weil es dort, wo Hilary sich aufzuhalten pflegte, keine zu kaufen gab. Außerdem hätten derartige Kleidungsstücke weder zum Klima noch zum Lagerleben gepaßt. Akbar Khan und Sita schlossen, was die Kleidung des Kleinen betraf, einen Kompromiß, demzufolge er abwechselnd als Hindu oder Moslem angezogen wurde, und zwar jeweils wochenweise. Freitags jedoch war er stets als Mohammedaner gekleidet.
Den Herbst 1855 verbrachte man in den Bergen von Seoni, angeblich mit dem Studium des Dialektes der Gond beschäftigt. In Wahrheit verfaßte Hilary hier einen Bericht über jene Ereignisse, die der Annektion der Fürstentümer Nagpur, Jhansi und Tanjore durch die Ostindische Handelskompanie gefolgt waren. (Hilary nannte das rund heraus »Raub«.) Wie er die Amtsenthebung des bedauernswerten ehemaligen Hochkommissars von Nagpur, Mr.Mansel, beurteilte (der den Fehler beging, eine größere Abfindung für die Familie des verstorbenen Fürsten zu fordern und überdies gegen die Annektion als solche zu protestieren), kam in dem Bericht sehr drastisch zum Ausdruck.
Hilary war der Meinung und schrieb das auch, das System der Annektion, so wie es von der Ostindischen Handelskompanie auf Fürstentümer angewendet wurde, deren Herrscher keine männlichen Erben hinterließen (obwohl es seit Jahrhunderten Brauch war, daß in solchen Fällen ein Verwandter des Herrschers von diesem an Sohnes Statt angenommen werden durfte), sei in Wahrheit nichts als ein absolut ungerechtfertigter räuberischer Akt, in Tateinheit mit Betrug, ausgeübt an Witwen und Waisen. Die hier in Frage stehenden Fürsten – Hilary wies ausdrücklich darauf hin, daß Nagpur, Jhansi und Tanjore nur drei von zahlreichen Opfern dieses verwerflichen Vorgehens waren –, seien überdies stets loyale Partner der Ostindischen Handelskompanie gewesen, doch eben diese Loyalität sei ihnen damit vergolten worden, daß man ihren Hinterbliebenen nicht nur ihre unbestreitbaren Erbrechte genommen, sondern sie auch gleich noch aller Juwelen und Familienerbstücke beraubt habe. Im Fall des Fürstentums Tanjore, das nach dem Tod des Fürsten annektiert worden sei, habe es zwar keinen Sohn, doch immerhin eine Tochter gegeben, und der englische Statthalter, ein Mr.Forbes, habe versucht, ihre Sache zu vertreten, indem er darauf hinwies, daß der Vertrag zwischen Tanjore und der Ostindischen Handelskompanie, was die Erbfolge angehe, nur »Erben« im allgemeinen, nicht aber männliche Erben im besonderen erwähne. Daß er den Mut dazu gefunden hatte, wohl wissend, wie es jenem glücklosen Mr.Mansel ergangen war, sei zu bewundern, doch habe man seine Einlassungen rundheraus ignoriert. Indische Infanterie, die bekannten Sepoys, sei in den Palast verlegt worden, und man habe das gesamte Vermögen, mobiles wie immobiles, beschlagnahmt. Sämtliche Wertgegenstände seien mit dem Siegel der Ostindischen Handelskompanie versehen, die Truppe des verstorbenen Fürsten entwaffnet und der Grundbesitz seiner Mutter enteignet worden.
Hilary fuhr fort, es sei nun Schlimmes zu erwarten, denn dies alles wirke sich auf die Existenz zahlloser Menschen aus. Im gesamten Bezirk seien die Besitzer aller ehemals fürstlichen Liegenschaften vor den Hochkommissar bestellt worden, der von ihnen den Nachweis verlangt habe, daß sie das Land rechtsgültig erworben hätten, und wer bislang im Dienste des Herrscherhauses sein Brot verdient habe, wisse nicht, wie er sein Leben fristen solle.
Tanjore, zuvor eines der ruhigsten Gebiete innerhalb des Herrschaftsgebietes der Ostindischen Handelskompanie, hatte sich innerhalb einer einzigen Woche in einen brodelnden Unruheherd verwandelt. Die Bevölkerung hing mit Leib und Seele an ihrem Fürstenhaus und war höchst aufgebracht über dessen Entmachtung. Selbst die Sepoys weigerten sich, ihre Löhnung entgegenzunehmen. Auch in Jhansi hatte es einen Sproß aus dem Fürstengeschlecht gegeben – zwar nur einen entfernten Vetter, der aber vom Radscha immerhin an Sohnes Statt angenommen worden war –, und die zauberhaft schöne Witwe Lakshmi-Bai hatte sich auf die zeitlebens von ihrem Gemahl bewiesene Loyalität der Kompanie gegenüber berufen – auch dies ganz vergeblich. Jhansi wurde für »der englischen Krone verfallen« erklärt und der Verwaltung des Gouverneurs der Nordwestprovinzen unterstellt; alle mit dem Fürstenhause verbundenen Einrichtungen und Ämter wurden aufgelöst und die im Dienste des Fürsten stehende Truppe entwaffnet und entlassen.
Hilary schrieb: »Nichts ist so geeignet, Haß und Verbitterung unter der Bevölkerung hervorzurufen, wie dieses brutale, gewissenlose, nur als Raub zu bezeichnende Vorgehen.« Die englische Öffentlichkeit aber beschäftigten wichtigere Dinge. Der Krimkrieg erwies sich nicht nur als kostspielig, sondern auch als verlustreich, und Indien lag in weiter Ferne, war aus den Augen und aus dem Sinn. Wer nach Lektüre von Hilarys Bericht sorgenvoll den Kopf schüttelte, hatte doch Tage später alles bereits wieder vergessen. Der Oberste Rat der Ostindischen Handelskompanie nannte Hilary derweil einen »irregeleiteten Kauz« und bemühte sich, seine Identität zu erfahren und ihn daran zu hindern, die amtliche Post zu benutzen.
Beides gelang allerdings nicht; Hilary schickte seine Berichte nicht auf dem üblichen Wege, und wenn auch so mancher hohe Beamte seine Tätigkeit mit Argwohn beobachtete – insbesondere seine enge Freundschaft mit einem »Eingeborenen« –, so fehlte es doch an Beweisen gegen ihn. Verdacht allein reichte nicht aus. Hilary bewegte sich also auch fortan ungehindert im Lande und ließ sich angelegen sein, seinem Sohn einzuschärfen, daß Ungerechtigkeit das größte Verbrechen ist, das der Mensch seinem Mitmenschen antun kann, und daß man Ungerechtigkeit immer und unter allen Umständen bekämpfen muß, auch wenn keinerlei Hoffnung besteht, diesen Kampf zu gewinnen.
»Vergiß das nie, Ashton. Gerechtigkeit ist die höchste Tugend. Es heißt: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu, was bedeutet, sei niemals unfair. Niemals. Unter keinen Umständen und gegen niemanden. Verstehst du mich?«
Selbstverständlich verstand er nicht, er war ja noch viel zu jung. Doch diese Lektion wurde ihm täglich eingebläut, bis er schließlich begriff, was der »Burra-Sahib« meinte (er dachte niemals anders an seinen Vater als an den Burra-Sahib), um so mehr, als Onkel Akbar ihn in gleicher Weise beeinflußte, ihm einschlägige Geschichten erzählte, aus dem heiligen Buch zitierte und Beispiele dafür anführte, daß »Der Mensch größer ist als Könige«. Später, wenn er ein Mann geworden sei, werde er finden, daß all dies wahr sei. Und daher müsse er sich schon jetzt bemühen, niemals eine Ungerechtigkeit zu begehen oder zuzulassen. Derzeit würden überall im Lande viele und schreckliche Ungerechtigkeiten von Männern begangen, die zu Macht gekommen und davon wie berauscht waren.
»Warum lassen eure Leute sich das eigentlich gefallen?« wollte Hilary von Akbar wissen. »Ihr seid Millionen, und die Kompanie nicht mehr als eine Handvoll. Warum macht ihr keinen Aufstand, setzt eure gerechten Ansprüche durch?«
»Oh, das kommt schon noch. Eines Tages«, versetzte Akbar gelassen.
»Wenn es nach mir ginge, würde das bald geschehen, je eher, desto besser«, meinte Hilary, »allerdings muß man fairerweise zugeben, daß es auch eine ganze Anzahl guter Sahibs hierzulande gibt: Lawrence, Nicholson und Burns; auch Mansel und Forbes gehörten dazu und der junge Randall in Lunjore, und Hunderte von deren Sorte.« Ausgemerzt werden müßten die aufgeblasenen, geldgierigen, verstockten älteren Herrschaften, die bereits mit einem Fuß im Grabe stünden, diese Typen in Simla und Kalkutta, die sich übermäßig wichtig nähmen und vermutlich fortgesetzt unter Sonnenstich litten. Was nun das Heer betreffe, so sei kaum ein Stabsoffizier jünger als siebzig Jahre. »Ich bin kein unpatriotischer Mensch«, sagte Hilary, »aber totale Unfähigkeit, Ungerechtigkeit und schiere Dummheit in hohen Ämtern finde ich einfach nicht bewundernswert, und von allen dreien ist in der derzeitigen Verwaltung zuviel vorhanden.«
»Darüber brauchen wir nicht zu streiten«, erwiderte Akbar Khan. »Doch das wird sich ändern; die Kinder deiner Kinder werden ihre Schuld vergessen und sich nur des Ruhmes erinnern, unsere aber werden sich nur der Unterdrückung erinnern und bestreiten, daß es auch Gutes gegeben hat. Denn es gibt viel Gutes.«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Hilary und lächelte bekümmert. »Ich gehöre vielleicht selber zu jenen aufgeblasenen Tröpfen, die sich zu wichtig nehmen. Und ich nähme gewiß weniger Anstoß, wären jene Narren, über die ich mich beklage, Franzosen, Deutsche oder Holländer, denn dann würde ich denken: was kann man von denen schon anderes erwarten? und mich über sie erhaben fühlen. Mich ärgert ja nur, daß es Menschen meiner Nationalität sind, die hier so eine üble Rolle spielen.«
»Nur Gott ist gut«, sagte Akbar Khan trocken. »Wir, seine Geschöpfe, sind sämtlich sündhaft und unvollkommen, einerlei welche Hautfarbe wir haben. Immerhin streben manche von uns nach Gerechtigkeit, und darin liegt doch viel Hoffnung.«
Hilary verfaßte keine weiteren Berichte über die Verwaltungstätigkeit der Ostindischen Handelskompanie, des Generalgouverneurs und des Rates, sondern konzentrierte sich nunmehr auf jene Gegenstände, denen sein eigentliches Interesse seit je gegolten hatte. Seine darüber verfaßten Manuskripte wurden, anders als die chiffrierten Berichte, mit der Post geschickt, geöffnet und geprüft und hatten die Wirkung, daß man amtlicherseits zu der Auffassung kam, Professor Pelham-Martyn sei letzten Endes doch nur ein gelehrter Exzentriker und über jeden Argwohn erhaben.
Wiederum wurde das Lager abgebrochen, man wandte den Palmen und Tempeln des Südens den Rücken und zog gemächlich nordwärts. Seinen vierten Geburtstag feierte Ashton Hilary Akbar in der befestigten Hauptstadt der Mogulen, der Stadt Delhi, wohin Hilary gereist war, um das Manuskript seines neuesten und letzten Buches zu vollenden, zu korrigieren und abzusenden. Zur Feier des Tages steckte Onkel Akbar das Geburtstagskind in sein schönstes moslemisches Gewand und führte es zum Gebet in die Moschee Juma Masjid – ein herrliches Bauwerk, das der Herrscher Shah Jehan am Ufer des Jumna gegenüber den Mauern der »Roten Festung« Lal Kila hatte errichten lassen.
Weil es ein Freitag war, war die Moschee überfüllt, und viele Menschen, die im Innenhof keinen Platz gefunden hatten, waren auf den Torbogen geklettert. Im Gedränge fielen zwei herunter und kamen zu Tode. Onkel Akbar bemerkte dazu nur: »So war es ihnen vorherbestimmt«, und fuhr fort zu beten. Ash verneigte sich, kniete nieder und erhob sich, das Vorbild der anderen Gläubigen nachahmend, und anschließend erlernte er von Onkel Akbar die Khutpa, das Gebet von Shah Jehan, welches beginnt: »O Herr! Erweise dem Glauben des Islam große Ehre, wie auch den Verkündern dieses Glaubens, durch die unaufhörliche Macht und Majestät deines Sklaven, des Sultans, des Sohnes des Sultans, des Herrschers, des Sohnes des Herrschers über zwei Erdteile und des Herrn über zwei Meere, dem, der für die Sache Gottes das Schwert führt, dem Herrscher Abdul Muzaffar Shahabuddin Muhammad Shah Jahan Ghazi …«
Ash wollte wissen, was ein Meer sei? Und warum nur zwei Meere? Und wer denn vorherbestimmt habe, daß diese beiden Männer vom Torbogen fielen und getötet wurden?
Sita nahm Revanche, indem sie ihr Ziehkind als Hindu verkleidet in einen Tempel der Stadt führte, wo ein Priester in gelben Gewändern gegen Zahlung kleiner Münze mit roter Farbe einen Fleck auf die Stirn des Knaben machte, während das Geburtstagskind zusah, wie Daya Ram eine uralte, recht unförmige steinerne Säule verehrte, die den Gott Schiwa symbolisierte.
Akbar Khan besaß in Delhi viele Freunde und hätte sich normalerweise dort gern längere Zeit aufgehalten, es entging ihm aber nicht, daß sonderbare und beunruhigende Unterströmungen in der Stadt fühlbar wurden, und die Gespräche mit seinen Freunden stimmten ihn noch besorgter. Die Stadt war erfüllt von merkwürdigen Gerüchten. In den engen, lärmerfüllten Gassen und Basaren herrschte eine gespannte, bedrohliche Atmosphäre. Akbar gewann daraus den Eindruck, daß Böses bevorstand, ein Eindruck, der ihn ängstigte.
»Irgendwas Schlimmes bereitet sich vor, das liegt förmlich in der Luft«, sagte Akbar. »Für Menschen deines Blutes, mein Freund, bedeutet das nichts Gutes, und ich möchte nicht, daß unserem Kleinen etwas zustößt. Laß uns fortgehen von hier, dorthin, wo die Luft reiner ist. Ich liebe die Städte nicht. Sie bringen Fäulnis hervor wie ein Dunghaufen Maden und Fliegen, und was hier ausgebrütet wird, ist schlimmer als beides zusammen.«
Hilary fragte gelassen: »Sprichst du von Aufstand? Der bereitet sich im halben Lande vor, und du kennst meine Einstellung: je früher er kommt, um so besser ist es. Wir brauchen dringend eine Explosion, damit die Luft gereinigt wird und jene Hohlköpfe in Kalkutta und Simla endlich mal aus ihrer Selbstzufriedenheit aufgeschreckt werden.«
»Sehr wahr, doch bei Explosionen gibt es Tote, und ich möchte nicht, daß unser Knabe für die Fehler seiner Landsleute bezahlen muß.«
»Du meinst, mein Junge«, berichtigte Hilary etwas schroff.
»Nein, ich meine unseren, obwohl er mich lieber hat als dich.«
»Nur, weil du ihn verwöhnst.«
»Keineswegs, sondern weil ich ihn liebe, und weil er das weiß. Er ist der Sohn deines Körpers, aber meines Herzens, und ich will nicht, daß er zu Schaden kommt, wenn der Sturm losbricht – und das wird er. Hast du deine englischen Freunde in der Garnison gewarnt?«
Hilary bemerkte nur, er habe das wie immer getan, doch wolle man ihm nicht glauben. Das Übel läge darin, daß nicht nur die Ratsmitglieder in Kalkutta und die Beamten in Simla nicht wüßten, was in den Köpfen der Einheimischen vorgehe, sondern daß viele Offiziere ebenso unwissend seien.
»Das war in alten Zeiten anders«, sagte Akbar Khan bedauernd. »Doch die Generäle sind jetzt alt und fett und müde, und die Offiziere werden so häufig versetzt, daß sie die Gewohnheiten ihrer Männer nicht kennen und die Unruhe nicht bemerken, die sich unter den Sepoys breitmacht. Denk an den Bericht aus Barrackpore. Der will mir nicht gefallen. Es ist wahr, nur ein einziger Sepoy rebellierte, doch als er drohte, seinen Offizier zu erschießen und den General dazu, schauten seine Kameraden stumm zu und hinderten ihn nicht daran. Trotzdem glaube ich, es war falsch, das ganze Regiment aufzulösen, nachdem man jenen Übeltäter aufgehängt hat, denn nun gibt es dreihundert Unzufriedene mehr, die der Unzufriedenheit vieler anderer Vorschub leisten. Das wird noch Ärger geben, und zwar bald.«
»Ganz deiner Meinung. Und wenn es dazu kommt, werden meine Landsleute empört und entsetzt ob solcher Undankbarkeit und Illoyalität sein, du wirst sehen.«
»Mag sein – falls wir es überleben«, gab Akbar Khan zu bedenken, »und deshalb sage ich, fort ins Gebirge.«
Hilary packte seine Kisten und verstaute sie im Haus eines Bekannten in der Garnison hinter dem Wall. Vor der Abreise aus Delhi beabsichtigte er, Briefe zu schreiben, die er seit Jahren hätte schreiben müssen, verschob das aber einmal mehr, weil Akbar Khan ungeduldig wurde und ja auch reichlich Zeit für derartige Angelegenheiten blieb, hatte man erst das friedliche, stille Bergland erreicht. Übrigens sagte er sich, daß ein oder zwei Monate nun auch keine Rolle mehr spielten, nachdem er seine Korrespondenz jahrelang vernachlässigt hatte. Er stopfte einen Haufen unbeantworteter Briefe, darunter solche, die an seine verstorbene Frau adressiert waren, in einen Karton, schrieb »Dringend« darauf und wandte sich wichtigeren Aufgaben zu.
Im Frühjahr 1856 erschien der erste Band eines von Professor H. F. Pelham-Martyn verfaßten Buches über die unbekannten Dialekte von Hindustan, das er »Dem Andenken meiner geliebten Frau Isobel« gewidmet hatte. Der zweite Band kam erst im Herbst des folgenden Jahres heraus, mit einer etwas längeren Widmung: »Gewidmet Ashton Hilary Akbar, in der Hoffnung, dieses Buch möge sein Interesse für einen Gegenstand wecken, welcher dem Verfasser endloses Vergnügen bereitet hat«. Um diese Zeit jedoch lagen sowohl Hilary als auch Akbar Khan schon seit einem halben Jahr in ihren Gräbern, und für den Verbleib von Ashton Hilary Akbar interessierte sich kein Mensch.
Man war in nördlicher Richtung durch den Dschungelgürtel des Tarai gereist und hatte das Lager in das Vorgebirge des Doon verlegt, und hier, Anfang April, als die Temperatur stieg und die Nächte keine Kühlung mehr brachten, wurden die Forscher von ihrem Unglück ereilt.
Pilger aus Hardwar, denen man gastfreundlich Unterkunft bot, schleppten die Cholera ein. Ein Pilger starb kurz vor Sonnenaufgang, seine Begleiter flohen und ließen den Leichnam zurück. Er wurde morgens von den Dienern gefunden. Gegen Abend hatten drei von Hilarys Bediensteten sich angesteckt, und die Cholera wütete so entsetzlich, daß keiner von ihnen die Nacht überlebte. Im Lager brach Panik aus. Viele packten ihre Sachen und verschwanden, ohne sich auszahlen zu lassen. Tags darauf erkrankte Akbar Khan.
Zu Hilary flüsterte er: »Geh fort, nimm den Jungen und geh fort, sonst stirbst du auch. Betrauere mich nicht, ich bin ein alter Mann, ein Krüppel ohne Frauen und Kinder. Weshalb sollte ich den Tod fürchten? Du aber hast den Knaben, und ein Knabe braucht den Vater.«
»Du warst ihm ein besserer Vater als ich«, sagte Hilary und packte die Hand seines Freundes.
Akbar Khan lächelte. »Ich weiß das, denn ihm gehört mein Herz, und ich hätte ihn gelehrt, hätte ihn gelehrt … doch es ist zu spät. Geht rasch.«
»Wir können nirgendwo hin«, sagte Hilary. »Wer ist schneller als die Schwarze Cholera? Gehen wir fort, begleitet sie uns. In Hardwar sterben täglich Tausende. Hier sind wir besser dran als in den Städten, und bald wirst du dich erholen. Du bist stark und wirst gesund werden.«
Akbar Khan jedoch starb.
Hilary beweinte seinen Freund mehr, als er seine Frau beweint hatte, und als er ihn begraben hatte, schrieb er in seinem Zelt einen Brief an seinen Bruder in England und einen Brief an seinen Anwalt, denen er einige wichtige Papiere und Bilder hinzufügte. Dann machte er aus dem Ganzen ein kleines Päckchen und wickelte es sorgsam in Wachstuch. Nachdem er das Päckchen versiegelt hatte, begann er einen dritten Brief zu schreiben, nämlich jenen längst überfälligen Brief an Isobels Bruder William, zu dem er nie gekommen war – und auch diesmal kam er nicht mehr dazu. Die Cholera, die seinen Freund dahingerafft hatte, packte auch ihn mit knochiger Hand, die Feder glitt ihm aus den Fingern und rollte zu Boden.
Als er eine Stunde später den furchtbaren Schmerzanfall überstanden hatte, faltete Hilary den unbeendeten Brief zusammen, versah ihn mühsam mit einer Adresse und wollte ihn durch seinen Träger Bux befördern lassen. Doch auch Bux lag im Sterben, und schließlich war es Sita, die dem »Burra-Sahib« etwas zu essen brachte, denn Koch und Küchenhelfer waren schon vor Stunden davongelaufen.
Sie kam in Begleitung des Kindes, doch als sie sah, wie es um den Vater bestellt war, verbot sie dem Jungen, das Zelt zu betreten.
»Du tust recht«, keuchte Hilary, »du bist eine vernünftige Frau, das war schon immer meine Meinung. Kümmere dich um ihn, Sita, bring ihn zu seinen Verwandten … er soll nicht –« diesen Satz konnte er nicht mehr beenden. Statt dessen langte er matt nach dem Bogen Papier und dem versiegelten Päckchen und schob ihr beides hin. »In der Blechdose da ist Geld. Nimm es. Das müßte reichen, damit ihr beide …«
Wieder packte ihn ein Krampf, und Sita zog sich zurück. Sie verbarg Geld und Papiere in ihrem Sari, eilte mit dem Kind zu ihrem eigenen Zelt und bettete es dort – zum ersten Mal und zu seiner maßlosen Empörung ohne die Lieder und Geschichten, die sie ihm normalerweise vor dem Schlafengehen zu erzählen pflegte.
In jener Nacht starb Hilary, und am folgenden Nachmittag hatte die Cholera vier weitere Opfer gefordert, darunter Daya Ram. Die Überlebenden – es war kaum noch eine Handvoll – plünderten die Zelte und flohen auf Pferden und Kamelen südwestwärts in den Tarai. Die frisch verwitwete Sita ließen sie zurück aus Furcht, sie könnte sich bei ihrem toten Mann angesteckt haben. Sita, und den vier Jahre alten Waisenknaben Ash-Baba.
Im Laufe der Jahre vergaß Ash vieles, doch an diese Nacht erinnerte er sich stets. Er sah das Mondlicht, spürte die Hitze, hörte das gräßliche Jaulen der Schakale und Hyänen, die sich unweit des kleinen Zelts rauften, in welchem Sita neben ihm hockte und zitternd seine Schultern streichelte in dem vergeblichen Bemühen, seine Furcht zu beschwichtigen und ihn einzuschläfern. Er hörte, wie die vollgefressenen Geier sich mit klatschenden Flügelschlägen von den Bäumen emporschwangen, auf denen sie nisteten, er roch den Gestank von Verwesung, empfand wieder jene grauenerregende, verwirrende Einsamkeit einer Lage, die er nicht begriff und die ihm niemand erklären konnte.
Bis dahin hatte er Angst nie gekannt, denn nie hatte er Anlaß gehabt, sich zu ängstigen, und Onkel Akbar hatte ihn gelehrt, daß ein Mann niemals Angst zeigt. Auch war er seinem Temperament und seiner Veranlagung nach ungewöhnlich mutig, und das Wanderleben, in dessen Verlauf er Dschungel, Wüsten und unberührte Gebirgsketten kennenlernte, hatte ihn mit dem Verhalten wilder Tiere vertraut gemacht. Doch jetzt wußte er nicht, warum Sita weinte und zitterte, warum sie ihn nicht zum »Burra-Sahib« hatte hereinlassen wollen, verstand nicht, was Onkel Akbar und den anderen zugestoßen war. Daß sie tot waren, wußte er, denn den Tod kannte er: Zusammen mit Onkel Akbar hatte er Tigern aufgelauert und gesehen, wie der Onkel sie totschoß. Ziegen und junge Büffel, die der Tiger am Vortag gerissen und teilweise gefressen hatte, dienten dabei als Köder. Für den Kochtopf wurden Böcke geschossen oder auch Enten und Rebhühner. Diese Lebewesen also waren tot gewesen, doch gewiß war Onkel Akbar nicht in der gleichen Weise tot? Es mußte doch etwas Unzerstörbares geben, was zurückblieb von einem Menschen, der mit einem umhergegangen war, Geschichten erzählt hatte, einem Menschen, den man liebte und zu dem man aufblickte. Aber wo war dieses Unzerstörbare geblieben? Alles war höchst sonderbar, und er verstand es nicht.
Sita hatte dornige Äste aus dem Gestrüpp gezerrt, das schützend das Lager umgab, und sie rund um das Zelt angehäuft. Das war klug gehandelt, denn gegen Mitternacht vertrieben ganz in der Nähe zwei Leoparden die Schakale und Hyänen von deren Beute, und vor Morgengrauen ließ sich ein Tiger vernehmen. Anderntags sah man deutlich die Spuren seiner Pranken, die bis dicht an die dürftige Barriere aus dornigen Ästen führten.
Es gab an jenem Morgen keine Milch und kaum etwas zu essen. Sita gab dem Knaben Reste von ungesäuertem Brot, machte aus ihren wenigen Habseligkeiten ein Bündel, nahm ihn bei der Hand und führte ihn fort von dem Schrecken und der Ödnis des Lagers.
2
Sita kann damals nicht älter als fünfundzwanzig gewesen sein, sah aber doppelt so alt aus, was schwerer körperlicher Arbeit, den alljährlichen Schwangerschaften und der Trauer über den vorzeitigen Tod all ihrer Kinder zuzuschreiben war. Sie konnte weder lesen noch schreiben, und gescheit hätte man sie auch nicht nennen können, doch war sie mutig, loyal und großherzig, und es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, Hilarys Geld für sich zu behalten oder seine Anweisungen zu mißachten. Sie liebte Hilarys Sohn seit seiner Geburt; der Vater hatte ihn ihr anvertraut und ihr aufgetragen, ihn zu jenen Menschen zu bringen, zu denen er gehörte. Niemand sonst hätte sich Ash-Babas angenommen, folglich ruhte die ganze Verantwortung für ihn auf ihren Schultern, und sie nahm sich vor, ihrer Aufgabe gerecht zu werden.
Sie ahnte nicht, wer nun eigentlich die Verwandten des Kleinen und wo sie zu finden sein mochten, doch machte ihr das zunächst wenig Kummer, denn sie erinnerte sich des Hauses in der Garnison von Delhi, wo Hilary den größeren Teil seiner Habe deponiert hatte und auch an den Namen jenes Sahib, der das Haus bewohnte und der ein Oberst war. Sie wollte daher das Kind zu Abuthnot-Sahib und dessen Memsahib bringen, die gewiß alles weitere in die Wege leiten würden; und weil man zweifellos eine Ayah für den Kleinen aufnehmen müßte, würde es nicht nötig sein, daß sie, Sita, sich von ihm trennte. Delhi lag weit im Süden, doch bezweifelte Sita keinen Moment, daß sie sicher hingelangen werde, denn in der Blechdose befand sich mehr Geld, als sie je im Leben gesehen hatte. Sie fürchtete, unterwegs Aufsehen zu erregen, falls etwas von ihrem Reichtum sichtbar würde, und steckte Ash daher in seine ältesten Kleider. Auch verbot sie ihm strikt, sich auf ein Gespräch mit Fremden einzulassen.
Es wurde Mai, bevor die Stadt der Mogulen in Sicht kam. Ash war so schwer, daß Sita ihn nur noch über kurze Entfernungen tragen konnte, und er selber vermochte täglich nur wenige Meilen auf eigenen Beinen zurückzulegen. Obschon die Jahreszeit normalerweise kühles Wetter brachte, wurde es täglich wärmer, und an heißen Tagen reiste es sich noch langsamer. Ash nahm alles dies hin, ohne Fragen zu stellen, denn er war an ein Wanderleben gewöhnt, und eine ständig wechselnde Umgebung war für ihn nichts Neues. Was seinem Dasein bis dahin eine gewisse Stabilität verliehen hatte, war die ständige Anwesenheit derselben Personen gewesen: Sita, Onkel Akbar und der »Burra-Sahib«, ferner Daya Ram und Kartar Singh, Swab Gul, Tara Chand, Dunno und andere. Die waren nun bis auf Sita alle tot, doch Sita war um ihn, und dazu die ihm vertraute indische Landschaft.
Die beiden kamen nur langsam voran, sie kauften in den Dörfern an der Straße, was sie zu essen brauchten, und übernachteten möglichst im Freien, um allen Neugierigen aus dem Wege zu gehen. Als eines Abends im staubigen goldfarbenen Dunst des Sonnenunterganges Mauern, Türme und Minarette von Delhi gegen den Horizont sichtbar wurden, waren beide schon recht ermattet. Sita hatte gehofft, vor Einbruch der Dunkelheit anzukommen und die Nacht bei entfernten Verwandten ihres Mannes zu verbringen, die in einer Seitengasse des Chandi Chowk eine Kornhandlung betrieben; dort wollte sie die in ihrem Bündel mitgeführten englischen Kleidungsstücke von Ash-Baba waschen und bügeln, um ihn ordentlich gekleidet in die Garnison bringen zu können. Sie hatten an diesem Tage aber bereits sechs Meilen zurückgelegt, und die Schiffsbrücke über den Jumna, die den Zugang zur Stadt bildete, war bei Sonnenuntergang noch eine gute Viertelmeile entfernt.
Innerhalb der Stadt hätten sie eine weitere halbe Meile bis zur Kornhandlung der Verwandten gehen müssen, und unterdessen wäre es Nacht geworden. Weil Sita noch ausreichend zu essen und zu trinken bei sich führte, bettete sie den Kleinen abseits der Straße unter einen Baum, dessen Gezweig eine Ruine beschattete, und sang ihn mit dem Liedchen in Schlaf, das von den Kindern im Pandschab am meisten geliebt wird:
»Schlaf Kindchen, schlaf,
Butter, Zucker, Brot.
Butter, Zucker, Brot sind verspeist
und mein Kindchen schläft.«
Die Nacht war warm, windstill und voller Sterne, und Sita, die Arme um den Kleinen geschlungen, sah fern die Lichter der Stadt blinken wie Goldstaub auf einem Vorhang aus schwarzem Samt. Zwischen den Ruinen zerfallener älterer Stadtteile heulten Schakale, im Gezweig des Baumes über ihr krächzten Nachtvögel, Fledermäuse huschten über sie hin und einmal ließ ganz in der Nähe im hohen Elefantengras eine Hyäne ihr Lachen vernehmen, und in der Düsternis schimpfte ein Mungo vor sich hin. Das waren vertraute Geräusche, vertraut wie die Tomtoms, die aus der Stadt herüberdrangen, wie das Schrillen der Zikaden. Sita zog einen Zipfel ihres Kopftuches übers Gesicht und schlief ein.
Sie erwachte bei Tagesanbruch, jäh geweckt von ihr fremden Geräuschen: galoppierenden Hufen, Schüssen, Gebrüll. In der Morgendämmerung brauste aus der Richtung von Meerut eine Reiterkolonne heran, eingehüllt in eine Wolke aus Staub, die sich über die Ebene ausbreitete. Sie ritten wie Besessene oder Gejagte dicht an dem Baum vorbei, unter dem Sita lag, und sie sah deutlich die verstörten Augen der Reiter, die verzerrten Gesichter, die Schaumflocken an den Mäulern und Flanken der Pferde, hörte das Gebrüll der Männer, die sich aufführten wie bei einem Wettrennen und während des Reitens ihre Gewehre in die Luft abfeuerten. Es waren Sowar. Sie trugen die Uniform eines Regimentes der bengalischen Kavallerie und kamen von Meerut. Die Uniformen waren staubig und zerfetzt und wiesen dunkle Flecke auf, zweifellos Blutflecke.
Eine verirrte Kugel sirrte durchs Gezweig des Baumes, und Sita warf sich über Ash, der unterdessen von diesem Lärm erwacht war. Doch schon waren die Berittenen vorüber, und der von ihnen aufgewirbelte Staub deckte alles zu. Er drang Sita und dem Kleinen in die Kehle, ließ sie husten und keuchen. Sita bedeckte das Gesicht schützend mit ihrem Sari. Als der Staub sich verzog und Sita wieder etwas wahrnehmen konnte, waren die Reiter bei der Brücke angelangt, und sie vernahm, gedämpft zwar, doch deutlich, das dumpfe Poltern der Hufe auf den Bohlen der Schiffsbrücke.
Sita war so sehr davon überzeugt, flüchtende Soldaten gesehen zu haben, daß sie sich unverzüglich in einiger Entfernung von der Straße mit dem Kinde im hohen Elefantengras verbarg, ganz darauf gefaßt, bald das Triumphgebrüll der Verfolger zu hören.
So verbrachte sie die folgende Stunde und war immer wieder genötigt, den Kleinen zu ermahnen, sich still zu verhalten. Aus Richtung Meerut folgten zwar keine Reiter mehr, doch in der morgendlichen Stille war trotz der großen Entfernung deutlich hörbar, daß unter den Mauern von Delhi gekämpft wurde; Gewehrfeuer knatterte, Männer schrien. Dann vermischte sich dieser Lärm mit den Geräuschen des erwachenden indischen Alltages: Brunnenräder knarrten, auf den Feldern kreischten Fasane, Kraniche trompeteten am Fluß, in einem Getreidefeld schrie ein Pfau, Eichhörnchen und Webervögel lärmten im Gezweig der Bäume. Auf den Ästen des Baumes, unter dem die beiden geschlafen hatten, ließ sich eine Horde brauner Affen nieder. Wenig später erhob sich vom Strom her eine leichte Morgenbrise, und das von ihr verursachte Rascheln des Grases überdeckte alle anderen Geräusche.
»Warten wir auf einen Tiger?« fragte Ash, der gemeinsam mit Onkel Akbar so manchem Tiger aufgelauert hatte und Bescheid wußte.
»Nein, aber reden dürfen wir trotzdem nicht. Wir müssen ganz stille sein«, drängte Sita. Sie hätte weder die Angst beschreiben können, die der Anblick der brüllenden Reiter in ihr erweckt hatte, noch was genau sie eigentlich fürchtete. Und doch, ihr Herz ging doppelt so rasch wie sonst, und sie wußte, daß weder die Cholera noch jene schreckliche letzte Nacht im Lager ihr mehr Furcht eingeflößt hatten als der Anblick der Reiter. Die Cholera war etwas, das sie ebensogut kannte wie den Tod und die Gewohnheiten der wilden Tiere, dies hingegen war etwas ganz anderes, furchterregend und unerklärlich …
Nun kam ein von zwei Ochsen langsam gezogener Karren auf der Straße in Sicht, und das vertraute Knarren des gemächlich dahinrollenden Gefährtes beschwichtigte Sita ein wenig. Die Sonne stieg über den Horizont, und es war übergangslos Tag. Sita atmete jetzt ruhiger. Sie erhob sich behutsam und spähte zwischen den Grashalmen hindurch. Die Straße lag verlassen im hellen Tageslicht, nichts bewegte sich darauf, so weit Sita sehen konnte. Das war ungewöhnlich, denn die Straße von Meerut war meist stark befahren und begangen, weil es sich um einen Hauptverbindungsweg handelte, der von Rohilkund über Oude nach Delhi führte. Dies konnte Sita nicht wissen, und sie schöpfte Mut – allerdings war sie umsichtig genug, nicht sogleich hinter den brüllenden Reitern her zur Stadt aufzubrechen; besser, man wartete noch ein Weilchen ab. Ein wenig trockene Nahrung war noch vorhanden, doch hatten sie keine Milch mehr, und beide litten unter Durst.
»Warte hier«, sagte Sita zu Ash. »Ich gehe zum Fluß um Wasser. Es dauert nicht lange. Rühr dich nicht von der Stelle, mein kleiner Schatz. Sitz ganz still, und es wird dir nichts geschehen.«
Ash gehorchte ihr, denn ihre Angst hatte sich ihm mitgeteilt, und zum ersten Mal im Leben empfand er Furcht, obschon er ebensowenig wie Sita hätte sagen können, wovor.
Ash mußte lange warten, denn Sita nahm nicht den kürzesten Weg zum Fluß, der sie an die Brücke geführt hätte. Sie ging etwas flußaufwärts ans Ufer. Von hier aus konnte sie über Sandbänke und Nebenläufe des Jumna bis zum Kalkuttator sehen und überblickte die Mauer vom Arsenal bis zur Wasserfestung. Die Geräusche aus der Stadt drangen deutlich zu ihr her, und sie hatte den Eindruck, als summe die Stadt wie ein unvorstellbar großer Bienenstock, den jemand umgeworfen und damit den Zorn dieser Insekten erregt hat.
Dazwischen hörte sie vereinzelte Schüsse, manchmal auch das Knattern vieler Gewehre, und über den Dächern flatterten zahllose aufgescheuchte Vögel – Falken und Krähen in Schwärmen, erschrockene Tauben, die sich niederließen und von neuem aufschwirrten, als würden sie von Vorgängen in den Straßen aufgeschreckt. Oh ja, an diesem Morgen ereigneten sich offenbar üble Dinge in Delhi, und gewiß war es besser, sich von der Stadt fernzuhalten, bis man mit Gewißheit erfahren konnte, was dort vorging. Schlimm, daß sie so wenig Nahrung hatten, aber für das Kind würde es noch eine Weile reichen. Und Wasser wenigstens gab es ausreichend.
Sita füllte ein Messinggefäß im seichten Wasser und kehrte zu dem Platz nahe der Straße zurück, vorsichtig und meist gedeckt von dem entlang der Straße wachsenden Gebüsch; gelegentlich verbarg sie sich hinter Steinbrocken oder Baumstümpfen, um nicht beobachtet zu werden. Sie nahm sich vor, hier draußen bis zur Abenddämmerung zu warten und erst nach Dunkelwerden über die Brücke zu gehen; auf Umwegen, nicht mitten durch die Stadt, gedachte sie die Garnison zu erreichen. Das würde für Ash-Baba ein anstrengender Marsch werden, doch wenn er den ganzen Tag über ruhte … sie richtete für sie beide einen bequemeren Lagerplatz im Grase her, und obwohl es unterdessen unerträglich heiß geworden war und Ash, der seine Furcht vergessen hatte, quengelig wurde, schläferten die erzwungene Untätigkeit und die Hitze ihn gegen Mittag ein.
Auch Sita verfiel ins Dösen, eingelullt durch das vertraute Knarren der zweirädrigen Karren, die die staubige Straße befuhren und das gelegentliche Klingeln der Glöckchen an einem vorüberrollenden leichten Einspänner. Aus beidem schloß sie, daß der Verkehr auf der Straße von Meerut sich normalisiert habe und daß die Gefahr – wenn es denn überhaupt eine gegeben hatte – vorüber sei. Sie redete sich ein, die galoppierenden Reiter, die sie gesehen hatte, seien in höchster Eile mit Kundschaft zum Mogul unterwegs gewesen, und ein wichtiges Ereignis, von dem sie berichtete, habe die Stadt in die von ihr beobachtete Aufregung versetzt. Vielleicht wurde ein Fest gefeiert, oder ein Sieg, den die bengalischen Truppen der Ostindischen Handelskompanie auf einem fernen Schlachtfeld errungen hatten. Vielleicht war auch einem befreundeten Herrscher ein Sohn geboren worden, am Ende gar der Königin im fernen England?
Solche und ähnliche beschwichtigende Überlegungen dämpften ihre Angst. Auch konnte sie den Lärm in der Stadt nicht mehr hören. Wenn das Kind aufwacht, gehen wir los, überlegte Sita, doch noch während sie diesen Gedanken dachte, wurde der scheinbare Friede mit einem Schlage zerstört. Eine furchtbare Erschütterung ging wie eine unsichtbare Welle über die Ebene hin, ließ das Gras erzittern, ja, die Erde beben, und kurz darauf erfolgte ein grauenerregender Donnerschlag, der in die gedämpfte Stille des heißen Nachmittags einschlug wie der Blitz in einen Baum.
Die Heftigkeit dieses Geräusches weckte Ash aus dem Schlaf und brachte Sita auf die Beine, die, starr vor Schrecken, zwischen den Grashalmen hindurchspähend über den fernen Mauern von Delhi eine Rauchwolke erblickte, eine grauenerregende, pilzförmige Erscheinung, besonders schrecklich, weil sie vom Schein der Nachmittagssonne wie in feurige Glut getaucht war. Die Frau und das Kind konnten sich die Erscheinung nicht erklären und erfuhren auch niemals, daß sie Zeugen der Explosion des Pulvermagazins von Delhi geworden waren, das von einigen wenigen Verteidigern in die Luft gesprengt wurde, um zu verhindern, daß das Schießpulver dem aufrührerischen Pöbel in die Hände fiel.
Noch Stunden später hing die Rauchwolke über der Stadt, rosenfarben jetzt im goldenen Sonnenuntergang, und als Sita und das Kind sich schließlich aus ihrem Versteck hervorwagten, säumten die ersten Strahlen des niedrig stehenden Mondes den Umriß dieser Wolke silbern.
Sita fand, es sei ausgeschlossen, so kurz vor dem Ziel umzukehren, hätte allerdings einen anderen Weg als den ihr bekannten in die Garnison vorgezogen. Sie wußte aber von keiner Furt durch den Jumna, und die nächste Brücke war meilenweit entfernt. Es blieb nichts übrig, als die Pontonbrücke zu benutzen, und zu diesem Zweck schlossen sie sich beim Sternenschein einer Hochzeitsgesellschaft an. Während diese eingehend von den Wachen überprüft wurde, ließ man die Frau mit dem Kind als ungefährlich passieren, doch aus den Gesprächen, aus Fragen und Antworten, die zwischen den bewaffneten Posten und den Hochzeitern hin- und hergingen, erfuhr Sita wenigstens einiges von dem, was sich im Laufe des Tages ereignet hatte.
Hilary hatte Recht behalten und Akbar Khan ebenfalls. Zu viele Klagen waren auf taube Ohren gestoßen, zu viele Ungerechtigkeiten begangen worden, als daß die Menschen es noch länger hätten ertragen wollen. Ausgelöst wurden die Ereignisse durch eine Lappalie: An die bengalische Armee wurden für neue Gewehre Patronen ausgegeben, die in einer, wie es hieß, Mischung von Rinder- und Schweinefett gelagert worden waren. Die Berührung mit Schweinefett hätte jeden Hindu zum Pariah gemacht und jeden Moslem verunreinigt. Dies war aber nur ein Vorwand.
Seit es ein halbes Jahrhundert zuvor zu einer blutigen Meuterei unter den Truppen von Vellore in Madras gekommen war, die sich weigerten, eine neuartige Kopfbedeckung zu tragen, die von der Ostindischen Handelskompanie eingeführt worden war, argwöhnten die Sepoys, daß man sie ihrer Kaste berauben wolle, jener ehrwürdigsten aller hinduistischen Einrichtungen. Die Meuterei von Vellore war rasch und brutal niedergeschlagen worden, und das galt für ähnliche Aufstände in den darauf folgenden Jahren. Die Ostindische Handelskompanie war aber außerstande, die Zeichen richtig zu deuten, und als es wegen der eingefetteten Patronen unter den Soldaten zu Unruhen kam, reagierte man darauf nur mit Entrüstung.





























