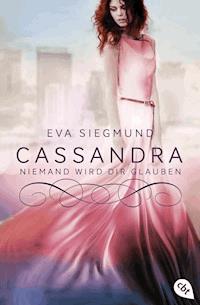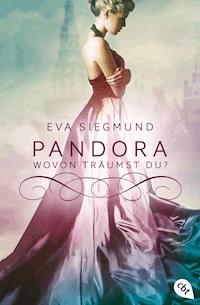
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Pandora-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Sophie lebt in einer Welt, in der alle durch einen Chip im Kopf jederzeit unbeschwert online gehen können. Als sie erfährt, dass sie adoptiert ist und eine Zwillingsschwester hat, erkunden die Mädchen damit ihre Vergangenheit – und stoßen schon bald auf seltsame Geheimnisse. Ihre Recherchen bringen den Sandman auf ihre Spur. Er will die Menschheit mithilfe eines perfekt getarnten Überwachungssystems beherrschen, und nur die Zwillinge können ihn und seine allmächtige NeuroLink Solutions Inc. zu Fall bringen. Doch das bringt sie in höchste Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Ähnliche
DIE AUTORIN
Foto: © Random House/Isabelle Grubert
Eva Siegmund, geboren 1983 im Taunus, stellte ihr schriftstellerisches Talent bereits in der 6. Klasse bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb unter Beweis. Nach dem Abitur entschied sie sich zunächst für eine Ausbildung zur Kirchenmalerin und studierte dann Jura an der FU Berlin. Nachdem sie im Lektorat eines Berliner Hörverlags gearbeitet hat, lebt sie heute als Autorin mit ihrem Mann in Barcelona.
Von Eva Siegmund ist bei cbt bisher erschienen:
LÚM – Zwei wie Licht und Dunkel
EVA SIEGMUND
PANDORA
Wovon träumst du?
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2015 by Eva Siegmund
© 2016 für die deutschsprachige Ausgabe by
cbt Verlag in der Verlagsgruppe
Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur, München.
www.ava-international.de
Covergestaltung: Carolin Liepins, München
Covermotive: unter Verwendung verschiedener Motive von © Shutterstock (carlo dapino/YuriyZhuravov/Matusciac Alexandru)
mg · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-18285-4V002
www.cbt-buecher.de
Der Bahnhof Friedrichstraße war komplett abgesperrt, als ich ihn erreichte. Überall standen Polizisten und Soldaten, die versuchten, Ordnung ins Chaos zu bringen. Auf dem Platz vor dem Bahnhof drängelten sich Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen und die Straße war hoffnungslos verstopft. Blaulicht zuckte über das wogende Meer an Köpfen hinweg. Leute redeten wild durcheinander, Polizisten riefen einander Kommandos zu und ich konnte die Anspannung spüren, die in der Luft lag. Etwas weiter entfernt meinte ich, ein paar Menschen weinen zu hören. Irgendwo brüllte sich ein Baby die Lungen aus dem Leib. Etwas Schreckliches musste geschehen sein, das wusste ich sofort, auch wenn ich in dem Durcheinander kein Wort verstehen konnte. Dazu war das Rotorengeräusch der Hubschrauber, die über unseren Köpfen kreisten, viel zu laut. Rauch und Staub hingen am grauen Berliner Himmel, und mit dem Regen fielen immer wieder Asche und kleine Metallteile auf mich herunter. Ein Gefühl von Endzeit lag in der Luft.
Der Rauch biss mir in die Augen und kratzte in meinem Hals. Ich band mir meinen Schal um Mund und Nase und drängte mich vorwärts. Was auch immer passiert war, ich musste zum Bahnhof – ich war ohnehin schon viel zu spät dran. Unruhig schob ich mich durch die Menge und kam langsam, aber stetig vorwärts. Schließlich rückte einer der Seiteneingänge in mein Blickfeld – das Bild, das sich mir bot, ließ meinen Atem stocken. Es erschien fast zu absurd, um wahr zu sein: Der gesamte Bahnhof Friedrichstraße hatte ein Loch. Wie ein gewaltiges Maul klaffte es vom Dach bis hinunter zum Erdgeschoss und spie Rauch und Flammen in die Luft. Mein Fuß stieß gegen einen großen Stein, der vermutlich einmal Teil des Gebäudes gewesen war. Eine ungeheure Explosion musste den Bahnhof auseinandergerissen haben. Wenn ich meinen Hals reckte, konnte ich noch ein paar Schienenenden sehen, die lose in die Luft stakten. Ein Zugwaggon war mitten zwischen die Geschäfte gekracht, und über dem Kopf eines Soldaten, der die Unglücksstelle absicherte, sah ich die Hälfte des Bahnsteigschildes aus der Wand ragen. »Fried« stand darauf. Ein kleiner Mann mit Mantel und Hut versuchte gerade mit fahrigen Bewegungen, das rot-weiße Absperrband der Polizei an einem Laternenmast festzumachen, doch der starke Wind und seine zitternden Hände behinderten ihn. Selbst aus dieser Entfernung konnte ich erkennen, dass sein Gesicht von Asche und Ruß ganz grau war; nur dort, wo die Tränen liefen, war die Haut sauber gewaschen.
Mit einem Schlag wurde mir klar, was passiert war. Vor diesem Szenario hatten sie uns in den Nachrichten seit Monaten gewarnt und nun war es Realität geworden. Terroristen hatten einen Zug gesprengt und dabei einen der wichtigsten Bahnhöfe Berlins zerstört. Mir wurde kalt, als ich begriff, was das bedeuten konnte. Ich war hier, um meinen Vater abzuholen, der vor einer Viertelstunde mit dem Zug hätte ankommen müssen. Wegen der verstopften Straßen hatte sich die Tram nur im Schneckentempo vorwärtsbewegt und ich war schließlich ausgestiegen, um die letzten beiden Haltestellen zu laufen. Nun brach das gesamte Ausmaß der Katastrophe über mich herein. Mein Vater hatte im gesprengten Zug gesessen! Das konnte nur bedeuten, dass er nicht mehr am Leben war. Nackte Panik ergriff von mir Besitz. Ich spürte, wie mir kalter Schweiß auf die Stirn trat und mein Herz zu rasen begann. Mir wurde übel und ich hatte Mühe, mein Gleichgewicht zu halten. Unwillkürlich krallten sich meine Hände in das Nächstbeste, das ich zu fassen bekam. Es war der Pelzmantel einer alten Dame, die mich, ein tadelndes Zischen von sich gebend, brüsk abschüttelte. Ich taumelte zur Seite und prallte gegen meinen Nachbarn, der mich ebenfalls direkt wieder von sich schob. Das Verhalten der anderen Menschen machte mir mehr als deutlich, wie alleine ich war. Pa war alles, was ich auf der Welt noch hatte, er durfte nicht tot sein!
Ich riss mich zusammen und kämpfte mich rücksichtslos weiter voran. Egal wie, ich musste wissen, was passiert war. Musste es mit meinen eigenen Augen sehen, meinen Vater finden. Vielleicht war ihm ja auch gar nichts passiert? Doch tief in meinem Inneren ahnte ich, dass er tot war. Ich schob, zog, drückte, rempelte und boxte. Schließlich entdeckte ich zwischen zwei Leuten eine Lücke, zwängte mich hindurch, stolperte und fiel vornüber. In letzter Sekunde bewahrten mich zwei Paar zarter Hände vor dem Fall.
Ich hob meinen Kopf und sah in die Gesichter meiner Retterinnen. »Dieses verflixte Kopfsteinpflaster«, zwitscherte die eine, von der ich erstaunlicherweise wusste, dass sie Stina hieß. Sie war so schön und stumpf wie ein Abziehbild, genau wie die schwarzhaarige Version von ihr, die sich auf meiner anderen Seite untergehakt hatte. Diese nickte eifrig und sagte zu mir: »Süße! Du solltest lieber aufpassen, sonst versaust du dir noch deine teuren neuen Schuhe! Und das wäre so schade, die sind wirklich traumhaft!«
Verdattert blickte ich auf meine Füße, die in abenteuerlich hohen Pumps mit Leopardenfellmuster steckten. Was passierte denn hier? Als ich mich erneut umsah, war das Chaos auf dem Bahnhofsvorplatz verschwunden – alles war wie immer. Die Sonne schien mit der LED-Reklame an der Bahnhofsaußenwand um die Wette, auf der für die Kosmetikstudiokette »Styl(f)ish« geworben wurde. In den Filialen des Konzerns konnte man sich von kleinen Fischen überschüssige Haut vom Körper fressen lassen. Meine Sportlehrerin schwor auf diese Methode.
Hinter dem großen Bahnhofsgebäude floss der Verkehr träge die Straße hinab. Ich war so erleichtert, dass ich beinahe laut aufgelacht hätte. Ein Traum! Das hier war nur ein Traum. Von der anderen Seite des Vorplatzes sahen Jungs interessiert zu uns herüber, die mich im wahren Leben keines Blickes gewürdigt hätten. Alleine diese Tatsache war Beweis genug für mich: Ich schlief und meinem Vater war nichts Schlimmes zugestoßen.
Doch obwohl ich erleichtert war, blieb ein beunruhigendes Gefühl in meiner Magengegend zurück. »Los, Mädels! Gehen wir einen FancyFennel™ trinken!«, schlug Stina lachend vor, während sie den Jungs kokett zuwinkte.
Ich zuckte die Schultern. »Warum nicht?«, antwortete ich und ließ mich von ihnen mitziehen.
SOPHIE
Nachdem ich eine ganze Weile auf die pinkfarbenen Wildlederstiefel im Schaufenster gestarrt hatte, musste ich mir eingestehen, dass ich trödelte. Und das lag nicht an den Stiefeln, die ich aus diversen Gründen niemals kaufen würde, sondern daran, dass ich nicht tun wollte, was ich gleich würde tun müssen. Alles in mir sträubte sich dagegen, auf die Messingklingel zu drücken, die ich aus meinem linken Augenwinkel bereits sehen konnte. Dabei kam ich eigentlich ungern zu spät. Ich hasste das peinliche Gefühl, das mich immer dann befiel, wenn ich einen Raum betrat, in dem alle nur auf mich warteten. Und ich war ohnehin schon aufgeregt genug.
Gerade wollte ich mich abwenden, da fiel mir auf, dass Schuhe in meinem Leben eine immer größere Rolle zu spielen schienen. Seltsam.
In meinen Sleepvertisements träumte ich seit Neustem von Pumps mit Leopardenfellmuster aus der aktuellen Kollektion des italienischen Designers Francesco Videlli, in denen ich, ungefähr zehn Kilo schlanker und mit Traumfreundinnen am Arm (die allesamt wie Barbie aussahen), von Belanglosigkeit zu Belanglosigkeit stöckelte. Im Traum war ich verrückt nach diesen Schuhen, im wahren Leben fand ich sie einfach nur scheußlich. Nur gut, dass diese Pumps noch teurer waren als mein geliebter SmartPort, den ich mir eurodollarweise hatte zusammensparen müssen. Aber es hatte sich gelohnt! Ich tippte mir an die Schläfe und verfasste eine Nachricht in der Gruppe Die besten drei, deren andere Mitglieder meine Freundinnen Sandra und Jule waren. Ich schrieb: »Hey, Leute, gleich ist mein Notartermin. Irgendwelche letzten Tipps?« Doch ich erhielt, wie so häufig in den vergangenen Tagen, keine Antwort von den beiden. Neuerdings benahmen sie sich ziemlich merkwürdig. Selbst wenn wir zusammen waren, schienen sie nie zu hundert Prozent bei mir zu sein, was mich unheimlich traurig machte. Ich tippte mir erneut an die Schläfe und murmelte: »Nicht erreichbar.« Sofort erschien auf meiner Netzhaut das kleine, rote Kreuz, als Zeichen dafür, dass die Verbindung meines Ports mit dem Internet gekappt war. Auf der Peinlichkeitsskala lag ein SmartPort, der in unpassenden Situationen einfach ansprang, direkt hinter zu spät kommen. Ein letztes Mal betrachtete ich mich in der Reflexion des Schaufensters und war nicht gerade zufrieden mit dem Bild, das sich mir bot.
Ich hatte sehr schlecht geschlafen und sah dementsprechend aus wie ein Zombie, der gerade frisch aus dem Grab gestiegen war. Meine Augenringe endeten nur knapp über den Mundwinkeln und meine Haare erinnerten an den struppigen Pelz einer Kokosnuss. Missmutig zog ich meinen fisseligen, schmutzig blonden Pferdeschwanz fester und rückte die weiße ›Anlassbluse‹ zurecht, die ich immer trug, wenn es etwas schicker zugehen musste. Und ich schätzte, dass ein ominöser aber hochoffizieller Notartermin genau der richtige Anlass war, um meine Anlassbluse zu tragen.
Schließlich fasste ich mir ein Herz und drückte auf die Messingklingel.
Eine sehr blonde, sehr schlanke Frau öffnete mir die Tür, stellte sich als Assistentin von Notar Wittmann vor und bat mich herein. Dabei lächelte sie so reglos, als seien ihre Lippen eingefroren. Oder als hätte ihr jemand die Mundwinkel auf Höhe der Ohrläppchen festgetackert. Wie ich selbst war auch die Frau in weiße Bluse und schwarze Hose gekleidet, jedoch war ihre Bluse weit genug aufgeknöpft, um ihre enormen und eindeutig gemachten Brüste zur Schau zu stellen.
Ich ertappte mich dabei, ihre Intelligenz ernsthaft infrage zu stellen. Sie führte mich durch einen langen Gang, an dessen Ende eine verschlossene Holztür lag. Als sie die Tür öffnete, erhob sich ein großer, braun gebrannter Mann von seinem Schreibtischstuhl und strich sich dabei die pomadierten, dunkel gelockten Haare nach hinten. Ganz klar: So hatte ich mir einen Notar definitiv nicht vorgestellt. Er war der perfekte Ken zu seiner Vorzimmerbarbie. Das rosa Polohemd und die weiße Hose ließen ihn wirken, als gehöre er mehr in ein Sonnenstudio oder auf den Golfplatz, als in ein Notariat. Der Blick, mit dem er mich bedachte, war genauso unnatürlich und reglos wie der seiner Assistentin. Die zwei konsultierten eindeutig denselben Chirurgen.
»Ah, da kommt ja Sophie! Ich darf doch Sophie sagen, oder?«, rief der Notar, ohne dass sich sein Gesicht auch nur ein paar Millimeter verschob. Ich nickte schwach und spürte, dass die Assistentin mich über die Schwelle schieben wollte, doch ich konnte mich nicht rühren. Grund dafür war nicht etwa der Solariumadvokat, sondern die andere Person, die sich außer ihm noch in dem Büro befand.
Auf einem Stuhl vor dem Schreibtisch saß ein Mädchen mit feuerroten Haaren, schwarzen Designerklamotten und, wie ich bestürzt feststellte, Leopardenfellpumps von Francesco Videlli. Doch auch das hatte mich nicht so erschreckt. Als sie mir ihr Gesicht zudrehte, fühlte sich der Türrahmen, an dem ich mich festhielt, an wie aus Gummi. Ich blinzelte mehrmals hintereinander, aber das brachte sie leider nicht zum Verschwinden. Unglücklicherweise war ich zudem noch ziemlich sicher, dass ich nicht träumte. Ihre Anwesenheit gehörte zu den Dingen, die ich mir nicht erklären konnte. Abgesehen von ihren feuerroten, fransig kurzen Haaren sah die junge Frau ganz genauso aus wie ich. Nicht im Sinne von ›sehr ähnlich‹, sondern mehr wie ›neunundneunzig Prozent Übereinstimmung‹. Auch sie starrte mich an, als hätte ich ein Storchennest auf dem Kopf. Scheinbar hatte sie mit meinem Anblick ebenso wenig gerechnet wie ich mit ihrem. Und während ich noch krampfhaft versuchte, eine logische Erklärung für diese absurde Situation zu finden, stieß sie bereits hervor: »Scheiße, die sieht ja aus wie ich!«
Ja, genau! Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Was um alles in der Welt ging hier vor sich? Seit knapp einer Woche hatte ich gerätselt, was es mit diesem Notartermin wohl auf sich haben würde. Und nun hatte ich noch mehr Fragen als zuvor. Zum Beispiel: Wer war dieses Mädchen?
Der Notar räusperte sich vernehmlich, legte seine Hände an den Fingerspitzen zusammen und lächelte gezwungen. »Ja, das ist, sehr vereinfacht ausgedrückt, der Grund unseres Zusammentreffens. Aber bitte, Sophie, setz dich doch. Wie wäre es mit einem Tee?«
Wie durch ein Wunder schaffte ich es tatsächlich, die Distanz zum Stuhl zu überbrücken, mich auf das antike Polster fallen zu lassen und dazu noch »Nein danke« zu murmeln. Dabei fühlte ich genau, dass mich mein Klonmädchen die ganze Zeit über anstarrte, aber ich vermied es, ihren Blick zu erwidern. Tief in mir drin regte sich die kindliche Hoffnung, dass sie verschwinden würde, wenn ich einfach nur nicht hinsah. Ein anderer Teil von mir hätte gerne zurückgestarrt. Schließlich war sie mein Spiegelbild; wenn auch in einer Filmstar-Version. Schon an der Art, wie sie auf dem Stuhl saß, konnte ich erkennen, dass sie über ein weitaus größeres Selbstbewusstsein verfügte als ich. So, als müsste, wenn überhaupt, ich ihr Klon sein.
Irgendwie machte sie mir Angst.
Der Notar streifte den Siegelring ab, reinigte ihn sorgfältig mit einem Taschentuch und steckte ihn sich anschließend mit einem beinahe zärtlichen Blick wieder an den Finger. Danach betrachtete er sein Gesicht eine Weile versonnen in der blank geputzten Oberfläche des Glasschreibtisches. Erst, nachdem Spiegelbild-Sophie mit der Spitze ihres rechten Schuhs mehrmals vernehmlich gegen einen der Metallfüße des Tisches geklopft hatte, sah er zu uns auf und sagte: »Äh, ja. Nun also zum offiziellen Teil. Mein Name ist Lucius Wittmann, ich bin Notar. Aber das habt ihr euch sicher schon gedacht.« Er atmete tief durch und straffte die Schultern. »Eigentlich sollte unser Treffen erst in ein paar Monaten stattfinden, wenn ihr volljährig seid, aber nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden bin ich zu dem Schluss gekommen, dass in eurem speziellen Fall das Recht auf eure Herkunft schwerer wiegt als die Schutzpflicht des Staates. Zumal ihr ja keine kleinen Kinder mehr seid, nicht wahr?« Lucius Wittmann machte eine Pause und schlug einen schmalen Aktenordner auf.
Ich schielte zu dem Mädchen neben mir und unsere Blicke trafen sich. Ihre Augen waren genauso dunkelbraun wie meine. Nussnugatcremebraun. Langsam dämmerte mir, worauf das Ganze hier hinauslief. Und es gefiel mir ganz und gar nicht. Die Gesamtsituation gehörte eindeutig in die Kategorie ›Albträume, die ich mit zehn Jahren hatte‹.
Der Notar erhob seine Stimme: »Es wird festgestellt, dass die geladenen Personen pünktlich zum Termin erschienen sind und dass neben ihnen und mir selbst keine weiteren Personen diesem Termin beiwohnen. Liebe Sophie, liebe Elisabeth. Was ich euch nun zu sagen habe, wird für euch sicher ein großer Schock sein, aber versucht bitte, es nicht allzu schwer zu nehmen.« Er blickte mich kurz an und ich nickte schwach. Zu mehr fühlte ich mich momentan einfach nicht in der Lage, doch Lucius Wittmann schien das vollauf zu genügen. Er machte ohnehin den Eindruck, als wolle er die Angelegenheit so schnell wie möglich hinter sich bringen. »Nun denn«, fuhr er fort. »Es ist meine Pflicht, euch eure Herkunft zu enthüllen. Ihr wurdet unter den Namen Sophie Charlotte Zweig und Elisabeth Ingrid Zweig als Kinder der Eheleute Sebastian Wolfgang und Helen Katharina Viktoria Zweig am 22. Dezember 2014 in Berlin geboren. Elisabeth um 04.30 Uhr, Sophie um 04.42 Uhr.« Als wir den Notar weiter wortlos anblickten, setzte er mit einem schmalen Lächeln hinzu: »Ihr seid demnach Zwillinge! Eineiige, wie man unschwer erkennen kann.«
Elisabeth und ich rissen gleichzeitig die Köpfe herum und starrten einander nun ganz offen an. Dabei blickte sie genauso verwirrt, ängstlich und wütend drein, wie ich mich fühlte.
»Was?«, fragten wir unisono. Herr Wittmann hob die Hand zum Zeichen, dass er uns noch mehr mitzuteilen hatte. Sein goldener Ring funkelte im Licht der Schreibtischlampe. Ich schluckte meine Fragen herunter und versuchte, mich gegen das zu wappnen, was noch kommen würde. Und mich auf die Worte des Notars zu konzentrieren, die wie durch eine Schicht Watte in mein Hirn vordrangen.
»Es ist weiterhin meine traurige Pflicht, euch mitzuteilen, dass euer leiblicher Vater leider vor knapp zwei Wochen in der Justizvollzugsanstalt Tegel verstorben ist. Er …«
»Stopp, halt, cut!« Elisabeth unterbrach den Notar lautstark, wobei ihre Hände ein perfektes T formten. Ihr Gesicht war rot angelaufen und näherte sich allmählich ihrer Haarfarbe an. »JVA Tegel. Habe ich das gerade richtig verstanden?«
»Ganz recht, ja«, bestätigte Lucius Wittmann mit einem Nicken.
»Soll das etwa heißen, er saß im Gefängnis?«, fragte sie scharf, und ich war irgendwie froh, diesen Termin nicht alleine bestreiten zu müssen. Im Gegensatz zu mir hatte es ihr nicht die Sprache verschlagen. Lucius Wittmann nickte erneut, wobei er ein besonders ernstes Gesicht machte. »Und was ist mit unserer Mutter?«, setzte Elisabeth genau in dem Augenblick hinzu, in dem mir die Worte durch den Kopf schossen.
»Nun«, sagte der Notar und kratzte sich an der Schläfe. Dann seufzte er zweimal schwer. In dem Augenblick wurde mir klar, dass der dicke Brocken erst noch kommen würde. Mein Herz rutschte in Lichtgeschwindigkeit dem Erdkern entgegen und ich war ziemlich sicher, dass ich nicht hören wollte, was als Nächstes kam. »Ja, das ist ein gewaltiges Problem. Eine regelrechte Tragödie würde ich sogar sagen. Ich weiß, es klingt vermessen, aber dennoch bitte ich euch beide, das, was ich euch jetzt sagen muss, nicht zu sehr an euch heranzulassen, okay?«
»Das entscheiden wir selbst, nachdem wir es gehört haben«, gab Elisabeth spitz zurück.
Herr Wittmann hob beschwichtigend die Hände. »Selbstverständlich. Also dann.« Letzteres sagte er mehr zu sich selbst als zu uns. »Liebe Sophie, liebe Elisabeth.«
»Liz!«, unterbrach ihn meine Schwester (meine Schwester! Ist das zu fassen??) erneut. »Niemand nennt mich Elisabeth. Also müssen jetzt nicht ausgerechnet Sie damit anfangen.«
Ich riss die Augen auf. Die traute sich was! Ich hatte gelernt, mich Menschen gegenüber, die ein offizielles Amt innehatten, immer besonders höflich zu zeigen – obwohl ich zugeben musste, dass mir das bei Lucius Wittmann auch nicht gerade leichtfiel. Schließlich sah er aus wie ein in die Jahre gekommenes Model für luxuriöse Sportbekleidung. Aber ihn so zu behandeln, wie Liz es gerade tat, würde mir niemals in den Sinn kommen. Dennoch musste ich feststellen, dass der Name Liz wesentlich besser zu dem zierlichen, aufbrausenden Wesen auf dem Stuhl neben mir passte als Elisabeth.
Herr Wittmann ließ sich von ihrem Einwurf nicht aus dem Konzept bringen. »Auch recht«, fuhr er etwas ungeduldig fort und strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. »Jedenfalls muss ich euch leider mitteilen, dass euer Vater wegen Mordes rechtskräftig verurteilt und inhaftiert wurde.«
Ich schnappte nach Luft. Mord?
»Er wurde für schuldig befunden, Helen Katharina Viktoria Zweig an seinem Arbeitsplatz erstochen zu haben. Seine Frau. Und eure Mutter. Ihr seid demnach jetzt Vollwaisen. Es tut mir leid.«
Bei diesen Worten hatte ich urplötzlich das starke Bedürfnis, mich in Luft aufzulösen. Ich wollte zu einer Molekülwolke zerfallen und unter dem Türschlitz hindurch ins Freie wabern. Inexistent, unsichtbar, alleine. Nichts mehr sehen oder hören müssen. Nicht reagieren müssen. In meinem Kopf stand nur ein einziger Gedanke: »Das kann nicht wahr sein!«
Ich schielte verstohlen zu Liz hinüber, die, falls das überhaupt möglich war, nun noch wütender aussah. »Das ist nicht wahr«, fauchte sie. »Es muss ein Fehler vorliegen. Ich kann auf gar keinen Fall die Tochter eines Mörders sein. Und die Zwillingsschwester einer …«, sie schien angestrengt nach den richtigen Worten zu suchen. Ich schaute an mir herunter und kam mir mit einem Mal vollkommen unpassend gekleidet vor. Neben Liz wirkte ich ungefähr so glamourös wie ein Aktenordner.
Diese atmete zweimal tief durch und fuhr etwas ruhiger fort: »Na ja. Von ihr eben sein. Entschuldigung, aber das kann ich nicht glauben.«
Absurderweise war genau das der Moment, in dem ich meine Stimme wiederfand. »Sieh uns doch an«, hörte ich mich leise sagen. »Natürlich ist es wahr. Ich müsste mir nur deine Frisur zulegen und schon würde uns jeder verwechseln.«
»Nicht mit den Klamotten!«, gab Liz zurück, doch ihre Stimme hatte an Schärfe verloren und ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass sie mit den Tränen kämpfte. Auch wirkte sie auf mich viel kleiner als noch vor wenigen Minuten. Sie schien, genau wie ich, zu begreifen, dass der Notar die Wahrheit sagte. Ich konnte mit jeder Faser meines Körpers spüren, dass es so war.
Nun keimte Neugier in mir auf. »Warum hat man uns getrennt? Wir hätten doch zusammenbleiben können.«
Wittmann legte den Kopf schief und machte ein Gesicht, das wohl auf Mitgefühl hindeuten sollte. »Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Wenn Geschwisterkinder eines Delinquenten in staatliche Obhut gelangen, ist eine getrennte Vermittlung vorzunehmen. Oder einfacher gesagt: Kinder von Verbrechern dürfen nicht gemeinsam aufwachsen. Einmal, weil sie von eventuell in das Verbrechen verwickelten Personen dann schwerer aufzufinden sind, zum anderen, weil die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie später selbst einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Und gerade bei Zwillingen wird Wert auf die Trennung gelegt, da sie besonders stark dazu neigen, auf die schiefe Bahn zu geraten. Womit ich euch beiden natürlich nichts unterstellen möchte.«
Liz schnaubte vernehmlich, doch sie hielt sich zurück.
»Und woran ist er gestorben? Sebastian Zweig, meine ich.« Meine Frage schien den Notar zu überraschen, doch er kommentierte sie nicht, sondern fing an, in der schmalen Akte herumzublättern. »Krebs«, sagte er schließlich. »Euer leiblicher Vater litt an einer sehr bösartigen Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs.«
Ich weiß nicht genau, was ich erwartet hatte, aber irgendwie erleichterte mich seine Antwort. Auch wenn heute eigentlich niemand mehr an dieser Krankheit sterben sollte, so war es immerhin eine ›normale‹ Todesart. Schließlich hätte er auch im Gefängnis von der japanischen Mafia erdrosselt worden sein können oder so. Mittlerweile hielt ich nichts mehr für unmöglich. Andererseits hatte ich urplötzlich einen genetisch sehr nahen Verwandten, der an Krebs gestorben war. Mir wurde übel. Ich schielte zu Liz hinüber und bemerkte, dass sie unter ihrer Make-up-Schicht ganz blass geworden war. Dachte sie gerade dasselbe wie ich?
Herr Wittmann lächelte sein Botox-Lächeln. »Und da nun der unangenehme Teil dieses Termins erledigt ist, kommen wir zum angenehmen Teil.« Er bückte sich und brachte mit spitzen Fingern eine abgegriffene Plastiktüte zum Vorschein. »Ich habe euch unter anderem eingeladen, um euch die Besitztümer von Sebastian Zweig auszuhändigen. Ein Testament liegt nicht vor, daher erbt ihr zwei alles, was er jemals besessen hat. Dazu gehören auch diese Gegenstände, die von der JVA Tegel an mich überstellt wurden. Ihr müsst mir bitte quittieren, dass ich sie euch übergeben habe.«
Er schob uns einen Zettel hin, auf dem
Gegenstand 1: Laborkittel
Gegenstand 2: Sanduhr (Dekoration)
Gegenstand 3: Familienfotos (privat)
stand. Darunter verlief eine gestrichelte Linie, unter der die Worte ›Gegenstände erhalten‹ verliefen.
Während ich stirnrunzelnd den Zettel begutachtete, leerte Herr Wittmann die Tüte auf seinem Schreibtisch aus, sichtlich darum bemüht, möglichst wenig mit Tüte oder Inhalt direkt in Berührung zu kommen. »Wie ihr seht, ist alles da.«
Das war es tatsächlich. Allerdings nahm mich der Anblick des Laborkittels vollkommen ein. Überall auf dem weißen Stoff waren dunkle, rotbraune Flecken zu sehen und mir drehte sich endgültig der Magen um. Ich brauchte all meine Willenskraft, um nicht in Ohnmacht zu fallen.
Der Notar schien meinen Zustand bemerkt zu haben, denn er schob die Sachen unter Zuhilfenahme eines Tischkalenders eilig wieder in die Plastiktüte zurück und diese anschließend zu uns herüber. »Nun. Der Kittel wurde eurem Vater bei der Verhaftung abgenommen. Da sich Sebastian Zweig freiwillig gestellt hat, gehe ich davon aus, dass das Kleidungsstück einfach nur fünfzehn Jahre lang in der Asservatenkammer lag. Die Fotos durfte er behalten und die Sanduhr war der einzige private Gegenstand, der in seiner Zelle gefunden wurde. Sonst hat er keinerlei persönliche Besitztümer angesammelt.«
»Und was genau soll daran jetzt der angenehme Teil sein?«, fragte Liz, während sie mit hochgezogenen Augenbrauen auf die Tüte blickte.
»Nur noch einen kleinen Augenblick Geduld«, bat Lucius Wittmann. »Bitte quittiert mir erst den Erhalt der Gegenstände. Ich muss mich der Gefängnisverwaltung gegenüber rechtfertigen. Ihr versteht das hoffentlich.«
Liz griff nach dem Zettel und ließ sich vom Notar einen Stift geben. Dann setzte sie ihre Unterschrift derart schwungvoll auf das Dokument, als würde sie so etwas ständig tun. Anschließend schob sie mir das Blatt zu. Ich zögerte kurz, da ich nicht wusste, wie ich nun unterschreiben sollte. Liz’ formschöne Unterschrift war völlig unleserlich, sodass ich mich daran nicht orientieren konnte. Der Notar schien meine Gedanken lesen zu können, denn er sagte: »Dein Name ist immer noch Sophie Kirsch. Deine Eltern haben dich adoptiert und dir diesen Namen gegeben. Daran hat sich nichts geändert.«
»Meine Mutter ist tot«, murmelte ich zerstreut, während ich meine Unterschrift neben die ausladende Signatur von Liz quetschte. Danach erst fiel mir auf, wie dämlich diese Bemerkung für die anderen klingen musste.
»Das, äh, das tut mir leid«, murmelte Lucius Wittmann verwirrt.
Ich schob das Blatt über den Schreibtisch und Herr Wittmann nahm es lächelnd entgegen. Dann klatschte er in die Hände. »Das war natürlich nicht alles. Euer Vater besaß ein Haus im Süden von Kreuzberg, das nach seiner Inhaftierung äußerst gewinnbringend verkauft wurde. Ich persönlich habe damals den Kauf abgewickelt. Der Erlös wurde auf ein Treuhandkonto überwiesen, von dem die Beerdigungskosten für die Beisetzung und der Grabstein eurer Mutter sowie die Anwaltskosten eures Vaters bezahlt wurden. Zudem verfügten eure Eltern noch über Aktienvermögen und einige Sparbriefe, darüber hinaus natürlich noch Autos, Einrichtung, Kleidung etc. Nach dem Tod eures Vaters erging eine richterliche Verfügung, die mich ermächtigte, die Vermögenswerte zusammenzufassen und zu gleichen Teilen auf zwei Konten zu überweisen. Er schob zwei Kontokarten über den Tisch, die jeweils auf einem Auszug lagen.
Meine Hand zitterte, als ich danach griff. Die Zahl, die am Ende des Kontoauszuges stand, konnte ich kaum begreifen. Sie verschwamm regelrecht vor meinen Augen. Ganz offensichtlich lagen auf dem Konto, das auf meinen Namen lief, über 800.000 Eurodollar. Noch nie in meinem gesamten Leben hatte ich mehr als ein paar Hundert Dollar auf meinem Konto gehabt. Und selbst das nur wenige Tage, bevor mir mein SmartPort eingesetzt worden war. Ein kurzes Glücksgefühl durchströmte mich. Nun musste ich mir keine Sorgen mehr machen, wie ich mein Studium finanzieren sollte. Ich könnte mir einen werbefreien PremiumPort einsetzen lassen und müsste nie wieder nachts von Produkten träumen, die ich nicht kaufen wollte. Vielleicht würde ich sogar meinem Pa …
Der Gedanke an meinen Vater, vielmehr an den Mann, den ich mein Leben lang für meinen Vater gehalten hatte, holte mich ins Hier und Jetzt zurück. Mir fiel mit einem Mal wieder ein, woher das Geld stammte, und ich ließ den Kontoauszug auf den Tisch fallen, als hätte ich mir daran die Finger verbrannt. Mir wurde augenblicklich eiskalt. »Ich … Ich will das Geld nicht«, stammelte ich.
»Bist du wahnsinnig?«, fragte Liz mit weit aufgerissenen Augen. »Dieses Geld ist höchstwahrscheinlich das einzig Gute, was der Kerl uns hinterlassen hat!«
»Da hat sie wohl recht«, stimmte Herr Wittmann zu. »Außerdem kann ich es nicht zurücknehmen, so sehr ich das auch bedaure. Das Geld ist dein Erbe. Du alleine musst entscheiden, was du damit anfangen willst.«
Ich blickte hilflos von einem zum anderen. »Aber … das … das ist das Geld eines Mörders! Ich will von dem Mann nichts haben. Überhaupt nichts!«
Zu meiner großen Verärgerung spürte ich, dass mir Tränen in die Augen schossen. Wie immer zuverlässig zum falschen Zeitpunkt. Sekunden später verbarg ich mein Gesicht in den Händen und ließ ihnen freien Lauf. Kurz darauf spürte ich eine kleine Hand, leicht wie ein Vogel, meine Schulter streicheln. Ich blickte auf und Liz lächelte mich schief an.
»Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Unannehmlichkeiten, Schwester. Je früher man das akzeptiert, desto ruhiger schläft man.« Ich lächelte zurück, nickte und nahm das Taschentuch entgegen, das Herr Wittmann mir hinhielt. Nachdem ich mich geräuschvoll geschnäuzt hatte, sagte er: »Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, in der ihr euch überlegen könnt, was ihr mit eurem Vermögen anstellen wollt. Der Staat gibt die Konten ohnehin erst frei, wenn ihr achtzehn seid.«
Liz lehnte sich stöhnend in ihrem Stuhl zurück. »Was hab ich gesagt? Da hast du den Beweis!«
Der Notar lächelte dünn. Dann erhob er sich. »Wenn ihr meinen Rat hören wollt: Nehmt das Geld und freut euch, dass ihr ab heute eine Schwester habt. Darüber hinaus solltet ihr die ganze Angelegenheit einfach so schnell wie möglich vergessen.« Er warf einen Blick auf die dicke Armbanduhr, die an seinem rechten Handgelenk saß und die, wie alles an ihm, billig und überteuert zugleich wirkte. »Und nun müsst ihr mich leider entschuldigen. Ich habe eigentlich seit fünf Minuten einen anderen Termin.«
Wie auf Kommando öffnete sich die Tür und die Assistentin steckte ihren Kopf herein. Ihr Lächeln war nicht einen Millimeter verrutscht. »Ich bringe euch noch hinaus«, sagte sie. Es war mehr als offensichtlich, dass diese Aktion zuvor zwischen den beiden abgesprochen worden war, doch es blieb uns nicht anderes übrig, als unsere Kontokarten einzustecken und ebenfalls aufzustehen. Liz griff energisch nach der Tüte und funkelte den Notar an. »Welche Rolle spielen Sie eigentlich bei dem ganzen Mist hier?«
Er räusperte sich verlegen und erklärte: »Ich hatte vor eurer Adoption die Vormundschaft für euch beide inne. Zudem oblag mir die Treusorge über das Vermögen eures Vaters.«
»Haben Sie ihn gekannt?«, fragte ich. Doch Notar Wittmann schüttelte den Kopf. »Der Staat hat mich beauftragt. Ich selbst habe euren Vater nie persönlich kennengelernt. Sein Anwalt hat mir sämtliche Instruktionen zukommen lassen. Und jetzt müsst Ihr mich wirklich entschuldigen.«
»Nur noch eine Frage!«, sagte ich. »Kann ich mir die Gerichtsakten ansehen?«
Der Notar sah mich erst fassungslos an und brach dann in schallendes Gelächter aus, was seinem steifen Gesicht groteske Züge verlieh. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, nicht allzu sehr auf seine wächsernen Mundwinkel zu starren.
»Also das geht nun wirklich nicht!«, sagte er schließlich, sichtlich bemüht, mich nicht noch länger auszulachen. »Erstens sind abgeschlossene Fälle seit einem Gesetz von 2020 fünf Jahre nach Berufungsfrist nicht mehr einsichtsfähig und zweitens braucht man für die Akten eines Mordfalles einen Rechtsanwalt und der wiederum benötigt die Genehmigung des Oberstaatsanwaltes. Außerdem gäbe es in der Akte ohnehin nichts Interessantes zu lesen. Der Mann hat sich freiwillig gestellt – Fall gelöst!« Lucius Wittmann lächelte süffisant. »Wie ich schon sagte: Am besten ist, ihr vergesst das Ganze. Und jetzt habe ich wirklich keine Zeit mehr.«
Er hielt mir die Hand mit dem Siegelring hin und ich ergriff sie artig. »Hat mich gefreut«, murmelte ich, während Liz mit einem »Auf Nimmerwiedersehen« an mir vorbeirauschte und sich neben der Assistentin des Notars durch die Tür schob. Ich beeilte mich, ihr zu folgen. »Hat mich auch gefreut!«, hörte ich den Notar noch murmeln, bevor die Tür hinter mir zufiel.
LIZ
Ich musste da raus. Dringend. Noch eine Minute länger und meine Selbstbeherrschung wäre dahin gewesen. Aber wer die Fassung verliert, ist angreifbar, das hatte mein Vater mir wieder und wieder eingetrichtert. Vielmehr mein Adoptivvater. Ach verdammt. Wenn ich mich schon auf sonst niemanden verlassen konnte, wollte ich mich wenigstens auf mich selbst verlassen können.
Ich drückte mich an der Empfangsdame vorbei (die viel zu hübsch war, als dass meine Mutter sie jemals akzeptiert hätte), stürmte mit der verflixten Tüte auf die Straße und atmete ein paar Mal tief durch. Die Sonne schien wie verrückt vom Himmel und die Menschen flanierten über die Straße und unterhielten sich lachend, als wäre nichts passiert, was in den meisten Fällen ja durchaus zutraf. Für mich hatte sich soeben alles verändert. Mein ganzes Leben zerfiel gerade in seine Einzelteile. Und ich war so ungeheuer wütend darüber, dass ich am liebsten geschrien hätte.
Jetzt, in der Berliner Nachmittagssonne, die ich ganz besonders liebte, kam mir meine eigene Situation komplett surreal vor. Als hätte ich die letzten Minuten einfach nur in einem abgefuckten Traum verbracht. Doch die abgewetzte Plastiktüte in meiner Hand belehrte mich eines Besseren. Darin befanden sich die letzten Besitztümer meines leiblichen Vaters. Inklusive eines weißen Kittels, an dem noch das Blut meiner Mutter klebte. Alleine beim Gedanken daran wurde mir schlecht.
Mein Leben lang hatte ich gewusst, wer ich war und wo ich hingehörte. Doch jetzt hatte ich komplett die Orientierung verloren.
Wenige Momente nach mir kam Sophie zur Tür herausgestolpert. Sie sah genau so aus, wie ich mich fühlte: als wäre ihrer Seele übel.
Es war einfach nur ungerecht. Die vergangenen zehn Jahre meines Lebens hatte ich in meinem Elternhaus meist alleine mit unserer Haushälterin Fe, dem Security-Manager Juan und meiner Dalmatiner-Dame Daphne verbracht. Bei so vielen Dingen, Problemen und Entscheidungen war ich völlig auf mich alleine gestellt gewesen. Ich hätte für eine Zwillingsschwester getötet. Wirklich wahr. Und doch konnte ich mich jetzt nicht darüber freuen, eine zu haben.
In einer normalen Welt wüsste ich alles über sie und sie wüsste alles über mich. In einer normalen Welt würden wir abends lange aufbleiben, Frisuren, Outfits und Jungs durchdiskutieren und einander auf Partys beim Kotzen die Haare aus dem Gesicht halten. Wir würden uns bis aufs Blut streiten und in der nächsten Sekunde wieder vertragen. Ich könnte ihren Musikgeschmack nicht ausstehen und sie meinen nicht, aber wir würden trotzdem zusammen tanzen. In einer normalen Welt. Leider war das hier keine normale Welt. Die schreckliche Wahrheit war, dass die Welt selbst immer verrückter wurde und ich nicht mehr über meine Zwillingsschwester wusste als ihren Namen. Und dass sie keine Frisur hatte, sondern einfach nur Haare auf dem Kopf. In einer normalen Welt würde ich sie spätestens jetzt zum Friseur schleppen, um diesen Zustand zu beheben.
Stattdessen aber sagte ich: »Wir hätten ihn nach der Adresse dieses Anwalts fragen sollen!«
Sophie sah mich mit ausdrucksloser Miene an. »Wir hätten ihn lieber fragen sollen, ob unsere Eltern von all dem wussten. Unsere Adoptiveltern, meine ich. Das ist alles so …«
»Scheiße?«, bot ich an und Sophie nickte. Sie war weiß wie eine Wand und ich hatte schon Angst, dass sie umkippen würde, als sie sich auf den Treppenvorsprung des Notariatseingangs setzte. Mein erster Impuls war, mich zu ihr zu setzen, doch irgendetwas hielt mich davon ab. Ihre Worte hatten mir einen Stich versetzt. Was, wenn meine Eltern die ganze Zeit gewusst hatten, dass ich noch eine Zwillingsschwester hatte, die ebenfalls in Berlin lebte? Und was noch viel wichtiger war: Warum hatten sie mir nie gesagt, dass ich adoptiert war? Wieso hatten sie überhaupt ein Kind adoptiert, wenn sie gar keine Zeit für Kinder hatten? Weil es schick war? Weil sie beweisen wollten, dass sie es auch konnten? Ein wenig kam ich mir vor wie ein ebenso teures wie nutzloses Accessoire. Oder wie ein exotisches Haustier, das man sich anschaffte, ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein. Mein Freund Carl beispielsweise hatte sich zu seinem dreizehnten Geburtstag einen kleinen Alligator gewünscht. Und dank seines Dickkopfes auch bekommen – die Narbe an seinem Zeigefinger war heute noch deutlich zu sehen. Das kleine Biest haben die Eltern dem Berliner Zoo geschenkt. Also den Alligator – Carl haben sie behalten.
Traurig schüttelte ich den Kopf. Ich war so sehr daran gewöhnt, dass meine Eltern nicht bei mir waren, dass ich gar nicht erst darüber nachgedacht hatte, wie tief sie wohl in der Sache drinsteckten. Durfte ich sie eigentlich noch als Eltern bezeichnen? Und wollte ich das überhaupt?
Ich brauchte dringend ein paar Antworten, wenn ich nicht durchdrehen wollte. Und ich brauchte sie jetzt. Während ich meinen SmartPort aktivierte, drehte ich mich leicht von Sophie weg und wählte anschließend die ID-Nummer meines Vaters, der sich momentan geschäftlich in Dubai befand. Leider war Miss Sharif, Vaters Assistentin vor Ort, wie so häufig dazwischengeschaltet und nicht gewillt, mich zu ihm durchzustellen. Ich versuchte nach Kräften, ruhig zu bleiben, während ihre honigsüße Stimme mir mehrfach in perfektem Oxfordenglisch versicherte, dass Mr. Karweiler in einer wichtigen Sitzung und für niemanden, nein, auch nicht für seine Tochter, zu sprechen sei. Währenddessen hatte ich begonnen, wie ein nervöser Tiger auf dem Bürgersteig hin und her zu laufen, doch auch das half nicht, den Druck zu verringern, der sich in mir aufgestaut hatte. Ich rastete aus.
Als ich »But this is fucking important!« in die Nachmittagssonne hinausschrie, blickten sich einige Leute nach mir um, was mich allerdings wenig kümmerte. Doch es nützte alles nichts. Miss Sharif wimmelte mich ab und kappte schließlich nach einem freundlichen, aber bestimmten Abschiedsgruß einfach die Verbindung.
»Dämliche Ziege«, murmelte ich und wählte die Port-ID meiner Mutter, nur um gleich darauf festzustellen, dass sie ihren Port auf ›unerreichbar‹ gestellt hatte. Meine Mutter arbeitete als Gesellschaftsjournalistin und trieb sich unablässig auf Events rum, bei denen jegliche Form der Port-Kommunikation unerwünscht war – zu hohe Promidichte. Eigentlich erreichte ich sie nur über Port, wenn wir vorher einen Termin vereinbart hatten. Ich hinterließ also eine Aufforderung auf ihrer Mailbox, mich so schnell wie möglich zurückzurufen und kappte niedergeschlagen die Verbindung.
Als ich mich wieder dem Kanzleieingang zuwandte, um Sophie einen Besuch bei Wondermug’s vorzuschlagen, war sie nicht mehr da. Ich sah mich um und erblickte gerade noch ihren wippenden Pferdeschwanz, der hinter einer Hausecke verschwand. Warum war sie denn jetzt einfach so abgehauen? Wir waren Zwillingsschwestern, da ließ man sich doch nicht im Stich! Vor allem dann nicht, wenn man noch nicht einmal Port-IDs ausgetauscht hatte. Hatte sie überhaupt einen Port?
Wundervoll, einfach wundervoll. Was war das bloß für ein nutzloser Tag? Ich versetzte der abgewetzten Plastiktüte, die vor mir auf dem Boden lag, einen wütenden Tritt und starrte das Ding etwas ratlos an. Einen Moment lang erwog ich, die Tüte kurzerhand im nächsten Mülleimer zu versenken. Der Gedanke, einfach so zu tun, als wäre gar nichts passiert, erschien mir ziemlich verlockend. Ich könnte die Tüte wegwerfen, Sophie Sophie sein lassen und niemandem erzählen, was ich heute erfahren hatte. Dann würde mein Leben genauso bleiben, wie es schon immer gewesen war. Doch eine Mischung aus Trotz und Neugier hielt mich dann doch davon ab. Mit einer derart grässlichen Tüte durch Berlin Mitte zu laufen, war allerdings auch keine Option. Schließlich stopfte ich den Inhalt der Tüte in meine Umhängetasche und warf die Tüte weg. Dann machte ich mich alleine auf in Richtung Koffein.
Ein paar Minuten später saß ich mit einem großen Sojalatte inklusive viel Karamellsirup in der Sonne vor Wondermug’s am Gendarmenmarkt und kaute auf meinen Nagelbetten herum. Es war mir ein absolutes Rätsel, was ich nun tun sollte; ich war, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben, vollkommen ratlos.
Meinen spontanen Impuls, Carl oder Ashley anzurufen und eine sofortige Krisensitzung einzuberufen, hatte ich schnell wieder unterdrückt. Meine Freunde stammten alle aus wohlhabenden Familien, da bildeten meine zwei besten Freunde keine Ausnahme. Und sie verkehrten selbst ausschließlich mit Leuten aus wohlhabenden Familien. Upper Class, allesamt. Ich wusste nicht, was passieren würde, wenn sich herumsprach, dass ich nicht die Tochter von Leopold und Carlotta Karweiler war, sondern die eines Mörders und dessen Mordopfer. Und selbst, wenn er es noch so sehr beteuerte: Carl war einfach nicht in der Lage, ein aufregendes Geheimnis für sich zu bewahren. Das hatte ich schon mehrmals schmerzhaft am eigenen Leib erfahren müssen. Mit Grauen erinnerte ich mich an die schreckliche Geschichte von meinem neuen Kaschmirpulli und Peter McMillans fester Zahnspange. Wenn meine Familiengeschichte an der Schule die Runde machte, konnte ich auch gleich auswandern. Oder mir ein Loch in die Erde buddeln, mich reinsetzen und mir von Fe zweimal am Tag etwas zu essen herunterwerfen lassen. Alles in allem also keine Option.
Dennoch hatte ich eine heftige Sehnsucht nach meinen Freunden, vor allem nach Carls endlosen, unbedarften Geplapper. Bevor ich allerdings auch nur einem meiner Lieblingsmenschen unter die Augen trat, musste ich noch eine Weile darüber nachdenken, inwieweit ich sie einweihte.
Mit einem Mal bekam ich Angst, meine Mutter könnte tatsächlich zurückrufen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Eltern nichts von meiner Herkunft wussten. Garantiert setzte der Staat in einem solchen Fall die Adoptiveltern in Kenntnis. Ich war ja schon sauer genug darüber, dass sie mir die winzige Information, dass ich gar nicht ihre Tochter war, vorenthalten hatten. Wie sollte ich via Port anständig mit ihnen darüber reden, dass ich außerdem noch Tochter eines Mörders und kein Einzelkind war, wenn sie so weit weg waren? Mir stiegen Tränen in die Augen, doch ich zwang sie wieder zurück. Plötzlich wunderte ich mich nicht mehr über den straffen Bauch meiner Mutter. Oder über die Tatsache, dass meine Eltern beide blaue Augen hatten im Gegensatz zu meinen braunen mit den kräftigen, schwarzen Brauen. All die kleinen Unähnlichkeiten zwischen uns ergaben auf einmal einen Sinn.
Ich zwang die Gedanken an meine Eltern beiseite. Zuerst musste ich mich entscheiden, was ich Fe und Juan erzählen würde. Sie wussten von dem Notartermin und mir war klar, dass sie versuchen würden, mich auszuquetschen, sobald ich zu Hause die Tür aufschloss. Aber konnte ich ihnen erzählen, was ich gerade erfahren hatte? Sie in das ganze Ausmaß der Katastrophe einweihen? Eigentlich waren die beiden mehr meine Familie, als es meine Eltern jemals gewesen waren, und ich liebte sie sehr. Auf der anderen Seite jedoch waren sie noch immer Angestellte der Familie Karweiler und ich wollte nicht, dass sie sich in irgendeiner Form in eine Sache einmischten, die am Ende ja doch nur meine Eltern und mich betraf. Diese Geschichte könnte die beiden in tiefe Gewissenskonflikte stürzen.
Außerdem sah ich mich nach so einem Tag außerstande, Mitleid zu ertragen. Es gehörte zu den Dingen, die Fe im Überfluss zu geben hatte, die ich jedoch am allerwenigsten zu schätzen wusste. Ich wollte von niemandem als bedauernswert oder schwach angesehen werden, selbst dann nicht, wenn ich mich hundeelend fühlte. Aber irgendetwas musste ich ihnen erzählen. Fe merkte immer, wenn ich log.
Ich nahm einen Schluck aus meiner Kaffeetasse und rieb mir erschöpft die Schläfen. Sofort setzten laute Musik und kitschige Bilder ein. Zwei Teenager hüpften singend über einen Schulflur. Ich erschrak fürchterlich und kippte mir etwas Kaffee über die Hose. Das war zwar nicht weiter schlimm (die einzige, wirkliche Gefahr für schwarze Kleidung sind weiße Tierhaare), dennoch fluchte ich leise. Scheinbar hatte ich vergessen, den Film von gestern Abend zu beenden, nachdem ich ihn für Schrott befunden hatte. »Film beenden«, knurrte ich nun verärgert und die Netzhautprojektion verschwand. Mir war jetzt ganz sicher nicht nach Highschool-Romanze zumute.
Ich musste wirklich dringend eine Feinjustierung meines neuen SmartPorts vornehmen lassen. In letzter Zeit sprang das Ding sogar an, wenn ich mich nachts in meinem Bett von der einen auf die andere Seite drehte. Aber das hatte Zeit, im Augenblick hatten ganz andere Dinge Vorrang.
Zum Beispiel, was ich mit der Zwillingsschwester anstellen sollte, die mein Leben heute plötzlich aus dem Hut gezaubert hatte. Warum war Sophie bloß vorhin abgehauen? Das war ziemlich unhöflich. Sie hätte sich wenigstens von mir verabschieden können – schließlich hatte ich ihr überhaupt nichts getan. Seltsamerweise machte mir ihr Verschwinden tatsächlich etwas aus. Normalerweise scherte mich nicht besonders, was fremde Menschen taten oder dachten, entweder sie mochten mich, oder sie ließen es eben bleiben. Und das war Sophie schließlich für mich: eine Fremde. Und doch war sie scheinbar der einzige Mensch auf der Welt, der wirklich zu mir gehörte; was für eine bescheuerte Ironie. Hätte ich mich erst um sie kümmern müssen, anstatt in Dubai anzurufen? Vielleicht.
Ich rief LiveBook auf und suchte nach Sophies Profil. Was hatte der Notar noch mal gesagt? Wie war ihr Nachname? Kirsch, richtig. Dank ihres Zögerns bei der Unterschrift kannte ich wenigstens ihren Nachnamen. Sonst würde ich sie überhaupt nicht mehr wiederfinden. Doch so war es ein Kinderspiel, denn glücklicherweise benutzte sie ihren echten Namen bei LiveBook. Sophie war auch nicht der Typ für einen Nicknamen, dafür wirkte sie viel zu … na ja … bieder. Es kostete mich nicht einmal eine Minute, sie zu finden. Leider gab ihr Profil nicht viel her, die Privatsphäreeinstellungen waren nervtötend rigide gewählt. Dabei hatte sie kaum hundert Freunde und so gut wie keine Bilder online. Ein paar Fotos von ihr in einem Kittel vor irgendwelchen alten Gemälden, im Arm eines graubärtigen Mannes mit runder Brille, mit ein paar anderen Pferdeschwanzmädchen artig vor einer Geburtstagstorte usw. Und offensichtlich ging sie auf ein staatliches Gymnasium in Prenzlauer Berg, was mich zugegebenermaßen doch etwas verwunderte. Meine Eltern hätten nie zugelassen, dass ich eine staatliche Schule auch nur ein einziges Mal von innen sehe. Ihr Vater schien nicht genügend Geld für eine anständige Ausbildung zu haben.
Eines war jedenfalls sicher: Meine Zwillingsschwester war dermaßen anders als ich, dass sie genauso gut auch vom Mond hätte stammen können. Hieß es nicht, dass eineiige Zwillinge sich auch dann charakterlich ähnelten, wenn sie getrennt voneinander aufwuchsen? Nun, das war bei Sophie und mir ganz offensichtlich nicht der Fall. Wenn ich mir jemals eine Schwester erträumt hatte, dann eine, die cool und witzig und stylish war. Eine Schwester, die perfekt in meine Clique passte und mit der ich manchmal zum Spaß die Identität tauschen konnte. Warum musste mein fremder Zwilling, wenn ich schon einen hatte, ausgerechnet so ein graues Mäuschen sein? Hatte das Schicksal an diesem Tag denn überhaupt gar keine Gnade mit mir? Ich betrachtete Sophies Profilbild und seufzte. Offensichtlich nicht. Wie hieß es doch so schön? Familie kann man sich eben nicht aussuchen.
Kurz erwog ich, ihr direkt eine Nachricht zu schreiben, doch dann überlegte ich es mir anders und begnügte mich vorerst damit, ihr eine Freundschaftsanfrage zu schicken und mich anschließend voll und ganz dem Frustshoppen hinzugeben. Wenn ich mich schon bei niemandem ausheulen konnte, musste ich mich eben anders aufheitern.
SOPHIE
Als ich endlich in unserer Wohnung angekommen war, kam mir Schrödinger, unser uralter, fusseliger Kater mit einem vorwurfsvollen Blick entgegen. Er schaute immer so drein, wenn er der Meinung war, man hätte ihn zu lange alleine gelassen. Und mit der Zuverlässigkeit eines Uhrwerks bekam ich bei diesem Blick ein schlechtes Gewissen. Ich hob ihn auf den Arm und kraulte ihn gedankenverloren hinter dem rechten Ohr. Das schien zwar nicht ganz das zu sein, was er sich vorgestellt hatte, doch er ließ es mit seiner ihm eigenen Würde über sich ergehen.
Mein Vater war schon seit dem frühen Morgen auf einer Baustelle und wir hatten vereinbart, dass ich nachkam, wenn ich ›meiner Klassenkameradin Merle bei ihrem Kunstprojekt geholfen hatte‹. Das war die Lüge, die ich meinem Vater auf die Frage hin, wie ich den heutigen Nachmittag verbringen würde, aufgetischt hatte. Es war mir schwergefallen, diese Worte über die Lippen zu bringen, da ich ihn eigentlich nicht anlog. Doch der Brief des Notars hatte mich seit seinem Eintreffen letzten Montag beschäftigt. Von Anfang an hatte ich ein ungutes Gefühl gehabt und meinem Vater deshalb nichts von dem Schreiben erzählt. Denn ein Wort in diesem Brief hatte in mir den Verdacht gesät, dass Pa etwas vor mir verheimlichte.
Etwas unsanft setzte ich Schrödinger auf dem Boden ab und ging in mein Zimmer. Dort kramte ich den Brief unter einem Stapel Schulunterlagen hervor. Solch offizielle Schreiben waren so ziemlich das Einzige, was überhaupt noch gedruckt mit der Post ankam. Der Großteil aller Kommunikation lief vollkommen elektronisch ab. Ich weiß noch, dass ein seltsames Gefühl meine Wirbelsäule heraufgekrochen war, als ich den Briefkopf erblickte.
Notariat Wittmann & Wittmann
Am Kupfergraben 6
10117 Berlin
Sophie Charlotte Kirsch
Finnländische Straße 23
10439 Berlin
Betreff: Bitte um Erscheinen am 23.04. um 15.30 Uhr
Sehr geehrte Sophie Kirsch,
wie im Betreff bereits angekündigt, möchte ich Sie bitten, zum oben genannten Termin in unserem Notariat zu erscheinen. Der Grund meines Ersuchens liegt in einer vertraulichen Familienangelegenheit, die von höchster persönlicher Relevanz für Sie selbst ist. Sollten Sie zum o. g. Termin verhindert sein, bitte ich Sie, sich umgehend mit meinem Sekretariat in Verbindung zu setzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Lucius Wittmann
Notar
Familienangelegenheit. Dieses Wort hatte mich schon beim ersten Lesen stutzig gemacht. Außer meinem Vater und mir gab es keine Familie Kirsch. Meine Mutter war vor vierzehn Jahren gestorben und Geschwister hatte ich keine. Dieses kleine Wort hatte mich nicht nur schweigen, sondern auch lügen lassen. Und ich hatte recht behalten. Nun wusste ich, dass eine Familie Kirsch, wie ich sie gekannt hatte, überhaupt nicht existierte. Verflucht, ich wusste nicht einmal, ob ich meinem Pa Blut spenden konnte, wenn es darauf ankam.
Und jetzt wartete er auch noch nichts ahnend in der Marienkirche auf mich. Die kleine Restaurierungsfirma meines Vaters hatte den Auftrag erhalten, das Totentanzfresko der Kirche zu restaurieren, dem Zeit und Feuchtigkeit sehr zugesetzt hatten. Und es hatte schon immer zu meinen absoluten Lieblingsbeschäftigungen gehört, Fresken möglichst originalgetreu wieder herzustellen. Je größer dabei die Schäden waren, desto mehr Freude machte mir die Arbeit. Und wenn man am Ende überhaupt nicht mehr erkennen konnte, dass etwas ausgebessert worden war, erfüllte mich das mit großem Stolz.
Leider gab es keinen Weg mehr, mein eigenes Leben wieder so herzustellen, dass von dem Schaden, den es heute Nachmittag genommen hatte, nichts mehr übrig blieb. Kein Kitt, kein Putz, keine Farbe dieser Welt konnte das wiedergutmachen.
Ich selbst hatte mich schon seit Wochen auf diese Baustelle gefreut. Meine alte, lederne Werkzeugtasche stand seit gestern Abend fertig gepackt neben der Wohnungstür. Ich hatte sogar meinen Kittel gebügelt, dabei konnte ich Bügeln auf den Tod nicht ausstehen. Okay, vielleicht hatte ich es auch getan, um meine Nervosität vor dem Termin ein wenig runterzukochen und mir selbst zu versichern, dass alles wie immer war. Das hatte ja schon mal wunderbar funktioniert.
Mein erster Impuls war, Pa sofort anzurufen und nach Hause zu zitieren, doch fühlte ich mich selbst noch nicht in der Lage, das anstehende Gespräch zu führen. Zur Baustelle fahren und so zu tun, als sei überhaupt nichts gewesen, war allerdings auch keine Option. Und ihm vor den Kollegen eine Szene zu machen, kam ebenfalls nicht infrage.
Ich tippte mir an die Schläfe und murmelte: »Kurznachricht verfassen!« Sofort öffnete sich ein Textfenster vor meinen Augen und ich gab meinem SmartPort die benötigten Informationen: »Adressat: Pas Handy. Nachricht: Hey, mir geht es heute nicht so gut. Hab vielleicht was Falsches gegessen. Kann leider nicht auf die Baustelle kommen. Ich leg mich ein bisschen hin, o. k? Sophie.« Dann checkte ich das Geschriebene kurz und sagte anschließend: »Nachricht senden.« Das Textfeld verschwand mit einem leisen Zischen.
Wenn irgend möglich, so fühlte ich mich nun noch schlechter. War es überhaupt in Ordnung, meinen Vater so ins Messer laufen zu lassen? Wenn er nach Hause kam, erwartete ihn eine verletzte, zornige Tochter, die Antworten von ihm verlangen würde. Das fühlte sich nicht besonders fair an. Andererseits hatte Pa mich jahrelang über meine Herkunft belogen. Es piepste und eine Antwort erschien. Mein Vater antwortete erstaunlich schnell, obwohl er nur ein abgegriffenes Smartphone besaß. »Mein armes Mädchen. Ich mache mich sowieso gleich auf den Weg und bring Thaisuppe mit – die hilft gegen alles!«
Er hatte unrecht. Gegen das hier würde Thaisuppe auch nicht helfen. Aber meine Freundinnen konnten es vielleicht.
Bis mein Vater kam, wollte ich mit Sandra und Jule sprechen. Ich öffnete ein Videochatfenster und wählte nacheinander erst Sandras, dann Jules Port-ID, doch beide hatten ihre Geräte auf ›Nicht erreichbar‹ gestellt. Seltsam. Es kam so gut wie nie vor, dass meine beiden Freundinnen gleichzeitig nicht erreichbar waren. Eigentlich konnte ich mich nicht erinnern, dass es überhaupt schon einmal vorgekommen war. Sie hatten doch von meinem Termin gewusst, warum fragten sie nicht wenigstens einmal nach, wie es gelaufen war? Ich fühlte mich betrogen und alleine gelassen.
Ich ließ mich auf mein Bett fallen und zählte die Stuckblumen an der Decke. Es waren exakt fünfundsiebzig, das wusste ich schon lange. Dennoch zählte ich sie erneut und würde es wohl so lange immer wieder tun, bis Pa nach Hause kam. Zu etwas anderem sah ich mich nach diesem Tag einfach nicht mehr imstande. Ich fühlte mich so elend, als hätte mich etwas vergiftet. Oder als hätte ich heute etwas Wichtiges unwiederbringlich verloren. Und es war schnell und eindeutig zu erkennen, was das war: das Vertrauen in die Welt im Allgemeinen. Dieser Grundglaube, dass alles irgendwie gut werden würde. Ich hatte ihn mein Leben lang in mir getragen, doch nun war er verschwunden und einem fiesen, dunklen Nichts gewichen, das mich wie mit unsichtbaren Gewichten auf die Bettdecke drückte.
Aber etwas anderes war dafür unverhofft hinzugekommen: eine Zwillingsschwester. Ich dachte an Liz und augenblicklich bekam ich ein schlechtes Gewissen. Es war mir ziemlich unangenehm, dass ich mich vorhin ohne einen Abschiedsgruß aus dem Staub gemacht und Liz einfach so stehen gelassen hatte. Aber während sie auf Englisch vermutlich eine Mitarbeiterin ihres Adoptivvaters beschimpft hatte, war in mir das Bedürfnis, einfach wegzulaufen und nichts mehr sehen oder hören zu müssen, ins Unermessliche gewachsen. Ein riesiger Ballon schien in meinem Bauch größer und größer zu werden, mich schließlich auf die Füße zu zwingen. Wäre ich nicht wie ein kleines Kind fortgelaufen, wäre ich sicherlich geplatzt. Ich seufzte. Was für eine Performance! Erst bekam ich ewig kein Wort heraus, und dann rannte ich auch noch weg.
Schon wieder liefen mir Tränen die Schläfen hinab. Ich fühlte mich so einsam. Da half es auch nicht, dass Schrödinger seit geraumer Zeit auf meinen Beinen lag und vernehmlich schnarchte.
Nun hatte ich zwei tote Mütter, die ich vermissen musste. Bisher hatte ich nur um eine getrauert. Michelle, die, wie ich jetzt wusste, meine Adoptivmutter gewesen war, starb, als ich gerade einmal drei war, bei einem Autounfall. Mein Vater hatte mir so viel über sie erzählt und immer wieder betont, wie ähnlich ich ihr sei. Ich kannte Michelles Macken und Angewohnheiten, ihr Lieblingsessen, ihre Ängste und so manches Geheimnis. Über meine leibliche Mutter, Helen, wusste ich hingegen nichts. Nur ihren Namen und, dass mein inzwischen ebenfalls toter Erzeuger sie ermordet hatte. Ermordet!
Würde ich Pa jemals verzeihen können, dass er mir so viele Jahre lang verschwiegen hatte, dass ich nicht seine, sondern die Tochter eines Mörders war?
Wie Liz sich wohl mit dieser Wahrheit gerade fühlte? Die Tatsache, dass ich eine Zwillingsschwester hatte, obwohl ich mich ein Leben lang als Einzelkind angesehen hatte, konnte ich noch kaum begreifen. Sagte man Zwillingen nicht eigentlich eine besondere Verbindung nach? Wenn ich an Liz dachte, konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, eine besondere Verbindung zu ihr zu haben, geschweige denn jemals aufbauen zu können. Trotzdem bereute ich es, sie einfach zurückgelassen zu haben.
Ich aktivierte meinen SmartPort und recherchierte ein wenig über Zwillingsforschung. Erstaunlich war, dass sich viele Zwillinge tatsächlich sehr ähnlich entwickelten, die gleichen Berufe ergriffen oder das gleiche Lieblingsessen hatten, selbst dann, wenn sie einander niemals begegnet waren. Einige der Beispiele jagten mir kalte Schauer über den Rücken, so unwahrscheinlich erschienen sie mir. Zu diesem Thema gab es auch einige sehr rührselige Wiedersehensvideos auf Cine Tube, in denen sich berückend ähnlich aussehende, völlig fremde Menschen zu Klaviermusik in die Arme fielen. Ganz so war das bei Liz und mir heute ja nicht gelaufen.
Es schockierte mich zu erfahren, dass Liz und ich genetisch identisch waren. Absolut und vollkommen identisch. Diese Tatsache faszinierte und erschreckte mich gleichermaßen. Rein theoretisch hätte ich genau wie sie werden können. Ein merkwürdiger Gedanke. Eigentlich hatte ich mir immer eingebildet, einzigartig zu sein, und war stolz gewesen auf die Dinge, die mich vermeintlich ausmachten. All unsere vielen Unterschiede hatten also mit der Art zu tun, wie wir beide aufgewachsen und erzogen worden waren. Und natürlich auch mit den Dingen, die wir erlebt hatten.
Wenn ich mir das Bild von Liz vor Augen rief, war nicht schwer zu erraten, dass sie, im Gegensatz zu mir, in einem reichen Elternhaus groß geworden war. Alles an ihr strahlte den Glanz aus, den nur wirklich teure Dinge an sich hatten – als wäre sie selbst ein sehr wertvolles Anlageobjekt mit einer Hammerrendite. Und ihre Art, mit Menschen umzugehen, strahlte ebenfalls Geld und Einfluss aus. Aber viel mehr wusste ich nicht über sie. Gerade in diesem Augenblick fand ich das sehr schade.
Ich stieg aus dem Bett, ging in die Küche und stellte den Wasserkocher an. Dann warf ich einen Fenchelteebeutel in meine abgegriffene gepunktete Lieblingstasse. Eigentlich kann ich Fencheltee nicht ausstehen – er erinnert mich an Kranksein. Außerdem hatte man mich in der Kinderkrippe mit solchen Mengen an Fencheltee abgefüllt, dass es wohl für den Rest meines Lebens ausreichen würde. Aber nach einem besonders penetranten Sleepvertisement für FancyFennel™ hatte ich mich knapp zwei Wochen zuvor dazu hinreißen lassen, eine Großpackung von dem Zeug zu kaufen. Und mein Vater dachte aus pädagogischen Gründen gar nicht daran, mir bei der Dezimierung der Teebeutel zu helfen. Er rührte FancyFennel™ nicht an, weil er von Anfang an gegen meinen SmartPort gewesen war. Deshalb hatte ich mir diesen auch Cent für Cent selbst zusammensparen müssen. Kein Kino, kein Billard, nichts. Kurz nach meinem siebzehnten Geburtstag konnte ich mir den Internet-Chip endlich einsetzen lassen, wenn auch nur die günstigste, werbefinanzierte Variante. Endlich war ich mein peinliches Smartphone los. Ich hatte mich kaum noch getraut, in der Öffentlichkeit zu telefonieren, weil ich das Gefühl hatte, von allen Seiten angestarrt zu werden.
Ein SmartPort war ohnehin viel besser. Man hatte ihn immer bei sich, musste ihn niemals aufladen, konnte ihn nicht vergessen und er wurde einem nicht geklaut. Klar wäre es noch toller, sich einen werbefreien Port leisten zu können, aber man sah mir ja von außen nicht an, welches Modell ich trug. Und für den Premium-Chip hätte ich das Geld auch in zwanzig Jahren nicht zusammensparen können. Als tatsächlich störend empfand ich diese Werbung aber ohnehin nicht. Und die meisten meiner Freundinnen hatten einen werbefinanzierten Chip. Wir machten uns oft darüber lustig, von welch absurden Produkten wir nachts so träumten. Womit wir wieder bei den Massen an Fencheltee waren, die ich nun auszutrinken hatte.
Aber ich beschwerte mich nicht, denn andere waren da viel schlimmer dran. Der Chip meiner Freundin Sandra zum Beispiel war ganz offensichtlich auf einen Mann kalibriert worden, bevor er ihr eingesetzt wurde, denn sie träumte nicht nur von schicken Anzügen oder schnellen Autos, sondern hatte auch seit Wochen den Drang, sich sündhaft teures Rasierwasser zuzulegen. Und auf eine Neukalibrierung musste sie erst einmal wieder lange sparen, da NeuroLink eine Haftung für solche Fälle ausgeschlossen hatte – schließlich war der Chip ja streng genommen gar nicht kaputt.
Ich fand die Sleepvertisements eigentlich ganz lustig und war vor allem immer froh, wenn ich keine Albträume hatte. Seit ein paar Wochen häuften sich bei mir diffuse Träume von Sprengstoffattentätern und abgeriegelten Städten. Mehr als einmal war ich mitten in der Nacht aus dem Schlaf hochgeschreckt.
Ich zuckte zusammen, als ich Pas Schlüssel im Türschloss hörte.
Sofort ärgerte ich mich darüber, dass ich mir keine Strategie überlegt hatte, wie ich ein Gespräch mit ihm überhaupt beginnen sollte. Ich wurde sehr nervös als sich sein vertrauter weißer Haarschopf in den Flur schob. Auf seinem Gesicht lag ein breites Lächeln, auf der linken Hand balancierte er die Styroporbehälter vom Asia-Imbiss. Noch bevor er etwas sagen oder auch nur die Sachen ablegen konnte, stieß ich hervor: »Du bist nicht mein Vater. Mein Vater war ein Mörder! Wie konntest du mich so anlügen?«
Er starrte mich ungläubig an. Die Behälter krachten zu Boden und heiße Wan-Tan-Suppe spritzte auf den abgewetzten Dielenboden.
LIZ