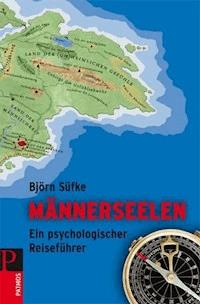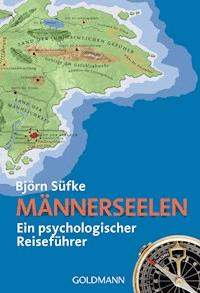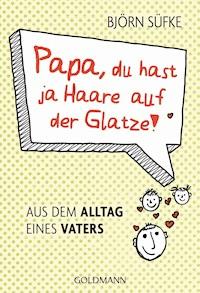
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie wird man ein guter Vater? Muss man Kindern früh Grenzen setzen oder geht Spielzeugklau beim reichen Nachbarskind als Notwehr durch? Björn Süfke zeigt auf humorvolle Weise, dass Vatersein das größte Abenteuer im Leben eines Mannes ist. Seine pointierten Familiengeschichten sind so liebevoll wie schonungslos, und ergeben ein großes Mutmach-Buch für alle Väter. Denn ein Papa kann eben vieles ersetzen – aber nichts kann einen Papa ersetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Wie wird man ein guter Vater? Muss man Kindern früh Grenzen setzen oder geht Spielzeugklau beim reichen Nachbarskind als Notwehr durch? Björn Süfke zeigt auf humorvolle Weise, dass Vatersein das größte Abenteuer im Leben eines Mannes ist. Seine pointierten Familiengeschichten sind so liebevoll wie schonungslos, und ergeben ein großes Mutmach-Buch für alle Väter. Denn ein Papa kann eben vieles ersetzen – aber nichts kann einen Papa ersetzen.
Autor
Björn Süfke ist Diplom-Psychologe. Er hält regelmäßig Vorträge und bietet Fortbildungen zu verschiedenen Männerthemen an. Privat ist er passionierter Fan von zwei Fußballvereinen und drei Kindern. Er lebt mit seiner Familie in Bielefeld.
Außerdem von Björn Süfke im Programm
Männerseelen
Männer
Björn Süfke
Papa,du hast ja Haareauf der Glatze!
Aus dem Alltag eines Vaters
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe April 2017
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Cover: Uno Werbeagentur, München
Covermotiv: FinePic®, München
JE · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-15741-8V003
www.goldmann-verlag.de
lnhalt
Vorwort: Willkommen, Überforderung!
1. Die Atombombe
2. Apfel, mehr!
3. Vertrauen
4. Kinderlieder
5. 2,21 Kinder
6. Emotionale Instabilität
7. Man ist so alt, wie man sich fühlt
8. Was Tiere und Kinder so denken
9. Die sieben Sinne
10. Die Wahrheit über Schlaf und Sex
11. Weibliche Intuition
12. »Wohin sitzt Mama?« und andere große Fragen
13. Verliebt
14. Restzweifel
15. Grenzen
16. Andere Kinder haben auch schöne Mütter
17. Nur keine Abwechslung, bitte!
18. Wie meine Tochter ihren ersten Klienten therapierte
19. Die besseren Hälften
20. Der Jason Bourne des Essens
21. Dankbarkeit
22. Finstere Miene
23. Wunsch und Glauben
24. Durchschnittliche Eltern
25. Perfekte Kommunikation
26. Mein Sohn liebt mich sehr
27. Nichts als die Wahrheit
28. Krieg der Chromosomen
29. Ich liebe Euch alle!
30. Tohmannah
31. Kommunikationsprobleme
Schlusswort: Es reicht!
Das Schöne am Kinder-Haben ist die Überforderung. Die unablässige und vor allem endlose Überforderung. Man kann es auch »Herausforderung« nennen – heutzutage wird ja gerne alles positiv formuliert. Ich persönlich halte das mit der »Herausforderung« jedoch für eine Beschönigung. »Herausforderungen« erlebe ich bei der Arbeit oder beim Einrichten meines neuen Smartphones. Letztlich bin ich aber für meine Arbeit einigermaßen gut ausgebildet. Und wenn ich tatsächlich mal so gar nicht weiterweiß, verweise ich halt an einen Kollegen. Beim Smartphone frage ich einfach einen Freund von mir, der irgendetwas mit IT studiert hat. Aber wenn sich nachts um 3 Uhr das zweijährige Kind erbricht, den Kopf hält und schreit wie am Spieß, kann ich es ja schlecht bitten, sich direkt ans Jugendamt zu wenden. Oder sollte ich vielleicht meinen IT-Freund anrufen und fragen: »Du, Arne, der Junge ist heute beim Kindergeburtstag von der Schaukel gefallen. Hat der jetzt lebensgefährliche Hirnblutungen oder schlicht zu viele Süßigkeiten intus?«
Als Vater erlebt man zudem das zweifelhafte Vergnügen, dass einem diese Überforderung gesellschaftlich nicht bloß zugestanden wird. Sie wird von einem geradezu erwartet. Das nervt. Oft genug fühlt man sich wie ein Verkäufer an der Wursttheke, der die drei wartenden Kunden mit einem freundlichen »Wer ist als Nächster dran?« begrüßt, und plötzlich wenden sich alle drei zur Seite, weil sie eigentlich lieber von der Kollegin bedient werden möchten. Allerdings bietet sich uns Vätern dadurch auch eine wunderbare Chance: Man könnte endlich einmal etwas tun, bei dem man nicht schon von vornherein weiß, wie es geht.
Genau solche Aufgaben sind ja äußerst selten geworden. Denn heute ruft man für jedes Problem den Fachmann: Der Steuerberater regelt das Finanzielle, die Wäsche kommt in die Reinigung. Manche Menschen stellen nicht einmal mehr ihre Möbel selbst hin, das macht die Feng-Shui-Beraterin. All das hat unbestreitbare Vorteile: Man kann etwa – so wie ich – ein Vierteljahrhundert lang fast täglich Auto fahren, ohne auch nur den blassesten Schimmer zu haben, wie eine Zündkerze aussieht. Oder wo genau eigentlich die Keile an einem Keilriemen sitzen. Wenn einen diese Fragen nämlich so gar nicht interessieren, ist das durchaus angenehm.
Allerdings macht dieser Spezialisierungswahn das Leben auch langweilig. Und genau deshalb ist die Überforderung der Elternschaft so toll: Endlich darf man mal etwas tun, was man nicht schon kann! Man darf mal etwas wirklich Neues lernen, sich entwickeln, vielleicht sogar menschlich weiterentwickeln – statt immer nur besser und besser zu werden. Und das nicht so freizeitmäßig im Wochenendseminar, »Achtsamkeitsübungen für Topmanager« oder »Outdoor-Survival für Bürokräfte«, sondern bei der wichtigsten Aufgabe überhaupt auf diesem Planeten: ein Kind auf einen Weg vorzubereiten, auf dem man selber ständig stolpert.
Es kursieren ja im Moment unzählige Bücher, die uns Männern erklären wollen, was ein Mann so wissen muss: Wie man eine Krawatte bindet, wie man einen Drachen baut, welcher Bundeskanzler wann und weswegen abdanken musste. Allerlei Wichtigkeiten und Nichtigkeiten eben. Was allerdings in all diesen Büchern fehlt, ist eine verständliche Anleitung, wie man eine Atombombe entschärft. Genau das aber scheint mir für den gemeinen Wald- und Wiesen-Mann von elementarer Bedeutung zu sein. Quasi täglich sind im abendlichen Fernsehprogramm Konfliktsituationen zu beobachten, in denen der männliche Held in die Verlegenheit kommt, eine Atombombe entschärfen zu müssen, um die Welt vor dem Bösen zu retten. Und ich habe noch nie erlebt, dass bei diesen Gelegenheiten eine Frau des Weges kommt, dem Helden auf die Schulter klopft und beruhigend sagt: »Lass mal, ich mach das schon!«
Seit der Geburt meiner Tochter Hannah fühle ich mich für diese offensichtlich urtypisch-männliche Aufgabe deutlich besser gerüstet. Die wesentlichen Grundkompetenzen und Handlungsschritte beim Entschärfen einer Atombombe sind nämlich denen beim Zu-Bett-Bringen von Hannah überaus ähnlich.
Zunächst einmal gilt es, die Ruhe zu bewahren und die Situation mit kühlem Kopf zu analysieren:
Wie viel Zeit ist noch auf der Zünderuhr?
Hat das Kind vielleicht noch Hunger oder eine volle Windel?
Ist das Licht zu hell?
Lauern noch irgendwo Feinde, die einem in die Quere kommen könnten?
Gibt es andere Hindernisse auf dem Weg zur Rettung der Welt – der großen ganzen oder aber der kleinen familiären?
Sind alle diese Fragen geklärt, geht es an die eigentliche Aufgabe. Aber Moment! Liegt auch das nötige Werkzeug parat? Kuscheldecke, Schnuller oder ersatzweise ein gut gewaschener kleiner Finger? Ist das zu bearbeitende Objekt günstig positioniert, gibt es also unverbauten Zugang zu allen relevanten Teilen?
Dann die Entscheidungsfindung: In-den-Armen-Wiegen oder Über-den-Kopf-Streicheln, Im-Stubenwagen-Schuckeln oder lieber Finger-zum-Nuckeln-in-den-Mund-Stecken? Das sind dann so Fragen, mit denen ein Mann völlig allein dasteht – nur mit sich und seiner Intuition. Denn die Frau an seiner Seite ist zwar hochintelligent, schön und auch sonst bezaubernd, liegt aber bewusstlos im Flugzeugcockpit oder erschöpft im Wochenbett.
Also gut, der Finger soll es richten. Vorsichtig vor den Mund führen. Anbieten, aber nicht drängeln – so ein Bombenbaby ist sehr empfindlich, insbesondere wenn es schon seit über zwei Stunden nicht mehr geschlafen hat.
Da! Wunderbar! Hannah nimmt den Finger und fängt an zu nuckeln. Das war also schon mal goldrichtig! Durchatmen. Jetzt bloß nicht in Hektik verfallen. Schön nuckeln lassen, bis sich die Nuckelstärke sukzessiv verringert. Dann die Fingerentfernung vorbereiten: Den Puls möglichst beruhigen, auf gleichmäßige Atmung achten. Biathlet müsste man sein, die können so was, die haben das trainiert. Biathleten sind wahrscheinlich von Natur aus die perfekten Väter … Den Finger unendlich langsam herausziehen. Bei wieder einsetzender Nuckelaktivität Aktion sofort abbrechen und regungslos verharren! Meditationsmeister wäre auch nicht schlecht, aber egal, vorsichtig den Finger wieder kommen lassen. Auf Lippenhöhe mit einem kurzen, sanften Ruck den Kontakt trennen. Reaktion abwarten. Und immer auf den Puls achten, die Atmung ruhig und gleichmäßig. Dann aufstehen. Langsamer, viel langsamer! Gleichmäßiges Schritttempo auf dem Weg ins Kinderzimmer. Ungefähr so wie am Morgen nach einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Party, wenn man versucht, den Weg vom Bett zum Apothekenschränkchen möglichst schmerzfrei zurückzulegen.
Endlich das Niederlegen in den Stubenwagen – der mit Abstand anspruchsvollste und damit gefährlichste Teil des Unterfangens. Vor allem beim Herausziehen der Kopfstützhand ist hier noch mal vollste Konzentration gefragt. Jetzt bloß kein Übermut, wo das Ziel so dicht vor Augen ist. Aber Hannah regt sich nicht, ganz still liegt sie da.
Geschafft!
In diesem Moment erwacht die hochintelligente, schöne Frau im Cockpit, erfasst blitzschnell die Dimension der soeben vollbrachten Rettungstat und kommt herübergeeilt. Welch anmutige Bewegungen, welch gut sitzende Frisur! Langer, leidenschaftlicher Kuss! Nun ja, eventuell fällt dieser Teil beim Wochenbett-Szenario weg …
Aber es gibt durchaus noch weitere Parallelen zwischen den Atombombenfilmen und der Einschlafzeremonie. So stellt sich etwa kurz nach der erfolgreichen Bombenentschärfung in aller Regel heraus, dass die Bombe nur eine Attrappe war und die richtige Atombombe in neunzig Sekunden drei Kilometer entfernt explodieren wird. Wenn ich Hannah hingelegt habe und ihr zusehe, wie sie sich genüsslich in ihre Bettdecke kuschelt, dann, in diesem Moment – und zwar immer in exakt diesem Moment – ertönt ein ohrenbetäubendes Klingeln, der Anrufbeantworter schaltet sich in Düsenjet-Lautstärke ein, und irgendein entfernter Bekannter brüllt Belanglosigkeiten aufs Band, gerne auch mit der Bemerkung: »Na ja, Ihr bringt wahrscheinlich gerade die Kleine ins Bett!« Dieser Sinn für schlechtes Timing bei sämtlichen unserer Freunde und Verwandten fasziniert mich immer wieder.
Aber gut, was ich einmal geschafft habe, schaffe ich auch ein zweites, drittes und viertes Mal. Das muss man einfach sportlich sehen, sozusagen als Übung für den Atombomben-Ernstfall, der uns Männern ja jederzeit begegnen kann.
Wenn Sie selbst sich also von so einer Atombombenentschärfung überfordert fühlen – vielleicht weil Ihre Kinder schon groß sind oder problemlos von allein einschlafen –, dann machen Sie sich die Sache nicht unnötig schwer. Überwinden Sie Ihren männlichen Stolz und rufen Sie ganz einfach: »Ist hier irgendwo ein junger Vater?« Sie werden sehen, Ihr kleines Problem ist im Nullkommanix gelöst.
»Ei-schörn-schen«, »Ei-schörn-schen«!
Ich könnte es tausendmal am Tag hören, wie mein Sohn »Eichhörnchen« sagt. Abends beim Aufräumen lege ich das Bilderbuch mit den Eichhörnchen immer ganz oben auf den Bücherstapel, damit ich auch am nächsten Tag mit meinem Sohn »Ei-schörn-schen« angucken und vor allem hören darf.
Es ist nicht nur diese wundervolle Art, wie er es ausspricht. Mich rührt schon allein, dass er sich Worte wie »Segelboot«, »Schmetterling« oder eben »Eichhörnchen« merkt, bevor er vernünftig »Teller« oder »Tasse« sagen kann. Das Verschrobene daran, dieser Hang zum Komplizierten! Mein Sohn!
Ich erlebe das Sprechenlernen als echte Bereicherung. Wo man bisher nur etwas hineingegeben hat, kommt jetzt etwas Eigenständiges heraus. Das ist überaus spannend. Lange Zeit sah das Bilderbücher-Angucken so aus: Tom zeigte auf etwas, das ich dann benennen musste. Stundenlang ging das so. Ich beschäftige mich ja wirklich gerne mit meinem Sohn, aber manchmal bin ich beim dreiundneunzigsten Mal »Das ist eine Katze« dann doch eingenickt und wurde erst durch hartnäckige »Da, da!«-Rufe wieder wach. Jetzt zeige ich auf bestimmte Gegenstände oder Tiere, und Tom sagt »Ball«, »Maus«, »Fanten« (für Elefanten) – oder eben »Ei-schörn-schen«. Bei jedem Treffer strahlt Tom, und ich strahle mit.
Der ganze Alltag wird so interessanter. Gestern stand Tom in der Schlange beim Bäcker neben einem gleichaltrigen Mädchen, das ihn neugierig musterte. Tom war voll auf die Brötchenauslage fokussiert und drehte sich erst nach einer knappen Minute zu dem Mädchen um. Nun ist Tom keiner, der andere Menschen grundlos anlächelt. Auch gestern hatte er wieder seinen typischen durchdringend-skeptischen Blick drauf. Er schaute dem Mädchen in die Augen und sagte trocken: »Hallo, ich Tom!« Da das Mädchen nicht reagierte, sagte er noch einmal, nun deutlich lauter: »Hallo, ich Tom!« Und zur Sicherheit noch: »Guuun Tag!« Das Mädchen begann zu weinen. Die Mutter guckte mich etwas beschämt an und schob eilig den Kinderwagen nach draußen. Tom schaute dem Mädchen irritiert nach. Ich weiß, ich weiß, als erwachsener Mann sollte man nicht lachen, wenn kleine Kinder weinen, aber einige von Toms verbalen Skurrilitäten sind schon zu Running Gags geworden, die Katharina und ich uns abends auf dem Sofa erzählen. Manchmal geben wir diese Anekdoten auch voller Stolz anderen Leuten preis – ob diese sie nun hören wollen oder nicht. »Was ist das folgende Geräusch?«, frage ich dann meine Kollegen morgens vor der Kaffeemaschine: »Baum-baum-baum-baum-baum-baum-baum-baum …« Meine Kollegen zucken dann höflich und müde mit den Schultern, und ich sage freudestrahlend: »Familie Süfke fährt mit dem Auto durch eine Allee!«
Aber das Sprechen hat auch Nachteile. Parallel dazu entwickelt sich nämlich der Wille. Viele Leute behaupten ja, der Wille sei von Anfang an da, aber ohne sprachliche Ausdrucksfähigkeit eben nicht so gut erkennbar. Mein Eindruck ist, dass der kindliche Wille anfangs sehr unspezifisch ist und lediglich die momentane Lage als grundsätzlich gut oder schlecht bewertet. Er ist noch nicht wirklich an bestimmte Dinge gebunden. Zehn oder zwölf Monate alte Kinder zeigen gerne in der Gegend herum und sagen: »Da, da!« Wenn man ihnen dann jenen Gegenstand brav aushändigt, auf den sie gezeigt haben, spielen sie gelegentlich eine halbe Stunde lang voller Begeisterung damit. Genauso wahrscheinlich aber ist es, dass sie ihn achtlos fallen lassen.
Mit der Sprache werden die Dinge für das Kind klarer, fassbarer. »Apfel, mehr!«, sagt Tom neuerdings beim Spazierengehen, da ich immer einige Apfelstückchen als Notfallsnack dabeihabe. Wenn die Apfelstücke alle sind und ich ihm ein Stück Banane anbiete, das von seinem Tag in der KiTa übrig geblieben ist, reagiert Tom wie ein Restaurantgast, der Zanderfilet bestellt hat und nun ein saftiges Rumpsteak serviert bekommt. Er mustert die Banane, berührt sie vorsichtig und sagt dann höflich, aber bestimmt: »Nein! Apfel, mehr!«
Man kann Tom also nicht mehr so leicht für dumm verkaufen. Das bereitet uns zunehmend Probleme bei den Mahlzeiten. Da Tom leider nicht wie wir übrigen Menschen über ein Sättigungszentrum im Gehirn verfügt – vermutlich aufgrund eines seltenen und kaum erforschten Gendefekts –, läuten wir das Ende einer Mahlzeit immer dadurch ein, dass wir auf Toms leeren Teller zeigen und bedauernd gucken. Dann sage ich deutlich und betont: »Finito!«, und streiche zur Bestärkung zweimal mit der flachen Hand von links nach rechts durch die Luft – das international anerkannte Zeichen für »Schluss, aus, es gibt nichts mehr!«.
In letzter Zeit klappt das nicht mehr so gut. Tom schaut sich meine Vorstellung nur noch interessiert an, wartet seelenruhig mein »Finito!« ab und sagt dann voller Begeisterung: »Kühl-schank!« Dabei strahlt er vor Freude, als hätte er gerade die Lösung für ein Problem gefunden, unter dem wir alle schon seit langer Zeit leiden, nämlich dem eklatanten Mangel an Nahrungsmitteln auf unserem Esstisch.
Dennoch: Ich als Psychologe, als notorischer Kommunikationsjunkie, bin natürlich sehr stolz, dass Tom ausgerechnet beim Sprechen so tolle Fortschritte macht. Aber das Leben ist paradox. Irgendwann wird sich seine Eloquenz genau gegen die wenden, die ihm seine sprachlichen Gene geschenkt und von Geburt an ununterbrochen mit ihm geredet haben. Früher oder später wird er Katharina und mir Löcher in den Bauch fragen. Er wird argumentieren, bis uns keine Erwiderungen mehr einfallen. Er wird in der KiTa intime Details aus unserem Familienleben ausplaudern – erst gedankenlos, dann bewusst und strategisch.
Das Schlimmste daran ist: Ich werde mit diesem Problem allein sein. Von der besten Mutter vom Siegfriedplatz ist diesbezüglich nämlich keine große Hilfe zu erwarten. Zwar findet auch sie es unheimlich süß, wenn Tom »Hoppe hopp, Arbeiter!« vor sich hin singt (für »Hoppe hoppe Reiter!«). Gleichzeitig hat sie aber schon deutlich signalisiert, dass sie Tom zu mir schicken wird, sollte sein Diskutierbedürfnis ausufern. »Von mir hat er dieses ständige Gequatsche schließlich nicht!«, sagt sie und hält das Thema damit für erledigt. Ehrlich: Sie ist die beste Frau der Welt, aber sie meint das wirklich ernst!
Ich werde also die Diskussionen zu führen haben. Die Fragen beantworten, auf die ich auch keine Antworten habe. Die Grenzen erläutern und die Strafen aussprechen. Ich werde kind- und altersgemäß, einfühlsam und konsequent, verständlich und geduldig argumentieren müssen. Ausgerechnet ich! Tom ist noch keine zwei Jahre alt, und ich komme jetzt schon ziemlich ins Schlingern, wenn es darum geht, das letzte und klärende Wort zu haben.
Neulich etwa saßen wir im Wohnzimmer, ich tippte etwas in meinen Laptop, während Tom immer wieder seine Puppe Anna ins Bett brachte. Er legte sie zärtlich hin, summte ein Schlaflied, um ihr schließlich ruckartig das Kissen unter dem Kopf wegzuziehen. Irgendwann verlor er das Interesse an diesem sadistischen Schlafritual und wandte sich den Kabeln meines Laptops zu. Ich sagte: »Nein, Tom!« Er guckte mich interessiert an und zog am USB-Kabel. Freundlich nahm ich seine Hand weg, erklärte ihm die Gefahren elektrischen Stroms und informierte ihn über die Empfindlichkeit technischer Geräte im Allgemeinen und meines Laptops im Speziellen. Tom nahm seinen Blick keine Sekunde von mir, wartete das Ende meines Vortrags ab und haute dann plötzlich und kräftig auf die Tastatur.
Verärgert legte ich den Laptop zur Seite und gab Tom in etwas strengerem Ton zu verstehen, dass er die Finger von meinem Computer zu lassen habe. Da er mit dieser Aufforderung sichtlich unzufrieden war, schob ich zur Besänftigung noch eine Abwandlung des beliebten Kinderreims hinterher: »Schere, Laptop, Kabel, Licht sind für kleine Kinder nicht!« Tom schaute mich nun mit funkelnden Augen an. Der Zeigefinger seiner rechten Hand schoss nach vorne und richtete sich bedrohlich auf mein Gesicht. »Mund!«, rief er und seine Augenbrauen zogen sich beängstigend dicht zusammen. Dann stockte er, so als ringe er nach Worten, während sich sein Zeigefinger fast in meine Wange bohrte. »Mund!«, wiederholte er schließlich, jetzt eher triumphierend als ärgerlich. Dann strich er mit der Hand vor meiner Nase zweimal von links nach rechts: »Mund finito!«
Ich denke in den letzten Wochen viel über das Thema »Vertrauen« nach. Das mag damit zu tun haben, dass ich mit gebrochenem Bein in einem Krankenhausbett liege und auf die Hilfe anderer, vollkommen fremder Menschen angewiesen bin. Es ist schon ein komisches Gefühl, dieses Ausgeliefertsein. Wobei wir Männer ja gerne von einem »komischen Gefühl« sprechen, wenn uns etwas in Wahrheit zu Tode ängstigt. So liege ich jetzt schon seit fünf Tagen in diesem Krankenhaus und schwitze immer noch jede Nacht Blut und Wasser, ob man mich hier einfach verrotten lässt. Ich bin auch im Nachhinein nicht mehr so sicher, ob das mit der Privatversicherung und dem Anrecht auf ein Einzelzimmer wirklich eine gute Idee war.
Manchmal wache ich nachts um 4 Uhr auf und muss feststellen: Die Knochen mögen wohl durcheinandergewirbelt worden sein, aber die Verdauung funktioniert prächtig wie eh und je. Da muss man dann Vertrauen in die Technik haben, in diese kleine, fragile Klingel aus der Zeit der Punischen Kriege, die über dem Bett baumelt. Und die Nachtschwester muss tatsächlich auf ihrem Platz sitzen und nicht zu einer Besprechung mit dem diensthabenden Arzt in die Wäschekammer verschwunden sein.
Genauso einsam und hilflos, wie ich mich im Krankenhauszimmer fühle, muss es meinem Sohn Tom jeden einzelnen Tag seines Lebens ergehen. Wenn er nämlich morgens in seinem Kinderbettchen erwacht, umgeben von schier unüberwindbaren Gitterstäben und eingewickelt in einen Schlafsack, aus dem sich auch der große Houdini nicht hätte befreien können. Ich selbst mit meinem gebrochenen Bein könnte ja theoretisch noch zum Klo oder zur nächsten Vorratskammer humpeln, wenn es hart auf hart kommt. Tom hingegen würde ohne seine Eltern in diesem furchtbaren Gitterbett hilflos dehydrieren. Dennoch spricht er jeden Morgen, wenn er sich erst einmal berappelt hat, ruhig und gelassen den immer gleichen Satz in sein Babyphon: »Papa, Tom spielen!« Dabei klingt er so, als würde er in einem Fünf-Sterne-Hotel den Zimmerservice rufen.
Das alles zeigt einem doch, wie wichtig es ist, den Menschen um sich herum vertrauen zu können. Zum Beispiel meiner Frau. Wenn ich mal zwei Tage auf einer Lesereise unterwegs bin, ist es doch sehr beruhigend zu wissen, dass Katharina dem Jungen abends ein Foto von mir zeigt und so etwas sagt wie: »Guck mal, Tom, das ist Papa! Papa ist arbeiten, er verdient gerade dein Abendessen!« Und nicht etwa: »Guck mal, Tom, das ist dein treuloser Vater, der uns schon wieder allein lässt, nur um seine dusseligen Bücher zu verkaufen!«
Mir persönlich fällt das mit dem Vertrauen eher schwer. Ich bin mehr der »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser«-Typ. Dass ich in diesem Punkt als Vater an mir würde arbeiten müssen, war mir von Anfang an schmerzlich bewusst. Ich versuche daher, Tom schon frühzeitig Vertrauen entgegenzubringen. Niemals kontrolliere ich ihn, wenn er etwas in den Mülleimer in der Küche schmeißen will oder soll. Und bin damit eigentlich immer gut gefahren, denn alle Essensreste und Bananenschalen und Popel sind wohl tatsächlich im Mülleimer gelandet und nicht etwa in der Waschmaschine oder dem Brotbackautomaten. Gut, beim Sortieren der Wäsche kann man sich noch nicht hundertprozentig auf ihn verlassen: Er schmeißt gerne die dunkle und die helle Wäsche in ein- und dieselbe Tonne. Außerdem ist mein Lieblingshemd seit Monaten spurlos verschwunden. Aber gut, gerade in solchen Situationen gilt es, das Vertrauen in den Jungen zu bewahren und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Zumal man selbst beim Essen durchaus Absprachen mit Tom treffen kann. Neulich rührte er mittags seinen Blumenkohlauflauf nicht an und verlangte stattdessen eine Banane. Weil wir blumenkohltechnisch weder vor noch zurück kamen, bot ich ihm ein kleines Stück Banane an, wenn er dafür anschließend auch etwas Blumenkohl essen würde. Katharina verließ kopfschüttelnd die Küche, im Gehen murmelte sie noch: »Er ist dreiundzwanzig Monate alt, Björn, nicht dreiundzwanzig Jahre!«
Ich gebe zu, dass ich das für einen kurzen Moment vergessen hatte. Das geht mir bei der Arbeit auch oft so. Ich präsentiere dann meinen Klienten »vernünftige Lösungen«, von denen ich so begeistert bin, dass ich übersehe, dass die Menschen genau deswegen bei mir sind, weil sie mit »vernünftigen Lösungen« gelegentlich ihre Schwierigkeiten haben.
Ich stellte mich also innerlich darauf ein, dass Tom in Windeseile die Banane verschlingen würde, um dann in ein »Banane, mehr!«-Mantra zu verfallen. Aber weit gefehlt: Mein überaus vertrauenswürdiger Sohn hielt erfreut seine Banane in der rechten Hand, um sich mit der linken sogleich ein großes Stück Blumenkohl in den Mund zu schieben.
Diese Episode ermutigte mich, schon frühzeitig mit der Verkehrserziehung zu beginnen. Zumal Kinder ja nichts so sehr lieben, wie miteinbezogen zu werden, mitentscheiden, mitbauen, mitbacken, einfach am Erwachsenenleben teilnehmen zu dürfen. Als Erstes brachte ich Tom bei, »Grün« zu sagen, wenn die Fußgängerampel auf Grün umschaltet – was er mittlerweile mit erstaunlicher Verlässlichkeit tut, selbst wenn ich ihn nicht mehr explizit dazu auffordere.
So war es auch am letzten Montag an der Ampel direkt vor dem Buchladen. Ich gucke dort regelmäßig nach neuen oder auch älteren Schätzen aus der Welt der Belletristik, die ich mir kaufen oder zum Geburtstag wünschen könnte, um sie dann aus Zeitmangel nicht zu lesen. Mein Blick blieb dabei an einem Roman von Sven Regener hängen, »Der kleine Bruder« – vermutlich weil ich selbst ein kleiner Bruder bin oder aber weil Katharina schon jetzt, siebzehn Wochen nach Hannahs Geburt, immer wieder von einem »kleinen Brüderchen für die Kinder« spricht. Auch habe ich neulich gelesen, dass »Der kleine Bruder« der dritte Teil von Regeners »Herr Lehmann«-Trilogie ist, oder genau genommen der zweite Teil, der aber als Drittes veröffentlicht wurde, da als Zweites der erste Teil herauskam, nachdem zuallererst das Ende der Geschichte erschienen war. Das ist auch wieder so eine Vertrauenssache: Wenn man heutzutage ein Buch kauft, insbesondere wenn es Bestandteil einer Trilogie ist, kann man nie so genau wissen, ob das nun der Anfang, die Mitte oder das Ende der Geschichte ist, was man da in den Händen hält. Man muss schon dem Autor vertrauen, dass er es prinzipiell gut mit einem meint und sich nicht einfach für seine kommerziell erfolglosen Frühwerke am gemeinen Leser rächen will. So wie man ja auch viel, viel Gottvertrauen braucht, wenn man am Samstagabend – »Grün!«, rief es in diesem Moment aus dem Kinderwagen laut und deutlich und gleich darauf noch einmal: »Grün!«, sodass ich meine Gedankenwelt hinter mir ließ und die Straße überquerte.
Alle Zeugen gaben zu Protokoll, dass es sehr geistesgegenwärtig gewesen sei, den Doppel-Kinderwagen mit einem Schwung nach vorne zu schieben, kurz bevor mich der kleine Fiat Punto frontal erfasste. Ich selbst erinnere mich nicht. Ich weiß nur noch, was ich sah, als ich schon auf dem Boden lag, unmittelbar bevor ich das Bewusstsein verlor: Es war ein Lastwagen der Firma Freenet, der schräg vor uns langsam in eine Einfahrt einbog. Im dichter werdenden Nebel um mich herum hörte ich noch Toms Stimme aus dem Kinderwagen, seine zarte, unschuldige Stimme, die fröhlich ausrief: »Grün, grün, Laster grün, Papa, Papa, tuck, Laster grün!«
Kinderlieder sind meistens ziemlich doof. Das muss man mal klar sagen. Nehmen wir das bekannte »Zeigt her Eure Füße«, dessen ausgesprochen hanebüchener Text lautet:
Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh’
Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu
Sie waschen, sie waschen, sie waschen den ganzen Tag
Sie waschen, sie waschen, sie waschen den ganzen Tag
Was will uns der Autor damit sagen? Warum soll da jemand seine Füße und Schuhe zeigen? Sollen die Füße gewaschen werden? Waschfrauen reinigen ja eigentlich keine Körperteile, nicht einmal Schuhe, sondern Kleidungsstücke. Und warum sollen wir ihnen unbedingt zusehen?
Offenbar nehmen die Dichter von Kinderliedern ihre Zielgruppe einfach nicht ernst. Ich sehe buchstäblich vor mir, wie der Verfasser von »Zeigt her eure Füße« übernächtigt und verkatert aus dem Fenster starrt und verzweifelt einen Reim auf »Schuh« sucht. Sein Blick fällt auf eine Gruppe agiler Waschfrauen. Er kritzelt »Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu« auf den Zettel und schließlich noch zweimal »Sie waschen, sie waschen, sie waschen den ganzen Tag«. Eilig gibt er die Arbeit ab und geht wieder in die Taverne.
Nun ist das einfältige »Zeigt her eure Füße« noch harmlos im Vergleich zu brutalen, gewaltverherrlichenden Liedern wie »Auf einem Baum ein Kuckuck saß«:
Auf einem Baum ein Kuckuck saß
…
Da kam ein junger Jägersmann
…
Der schoss den armen Kuckuck tot
…
Und als ein Jahr vergangen war
…
Da war der Kuckuck wieder da.«
…
Das Ganze wird übrigens mehrfach unterbrochen durch ein vollkommen pietätloses, geradezu fröhliches «Simsalabimbambasaladusaladim«.
Da frage ich mich schon, warum jeder Film, in dem ein angedeuteter Zungenkuss vorkommt, erst »ab sechzehn Jahren« freigegeben ist, während man ein- bis zweijährige Kinder mit Liedern beschallt, in denen Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, lustvoll hingerichtet werden. Zunächst habe ich angenommen, das Ganze sei eine Hymne der bolivianischen Freiheitsbewegung oder des Vietcong nach dem Motto: »Wir sind niemals zu besiegen, wir kommen immer zurück!« Aber das Lied stammt aus dem Bergischen Land.
Mein Sohn Tom jedoch liebt Kinderlieder – wie doof oder pädagogisch zweifelhaft sie auch sein mögen. Als er knapp achtzehn Monate alt war, konnte er »Backe, backe Kuchen« inklusive sämtlicher Zutaten korrekt vortragen. Das vermittelt vielleicht einen Eindruck davon, wie oft wir dieses Lied vorher für ihn singen mussten. Toms Lieblingsbuch ist eine 150 Seiten dicke Liederfibel mit allen bekannten und weniger bekannten Volksliedern für Kinder. Wenn Tom mit diesem Buch in der Hand zu mir kommt, weiß ich, dass ich mir für die kommenden zwei Stunden nichts vornehmen sollte.
Dabei ist es eindeutig das gesungene Wort, das Tom fasziniert. Klassik oder Papas moderne Electronic Music findet Tom zwar lustig, hält sie aber nicht für würdig, sich eingehender damit zu beschäftigen. Die Texte hingegen prägt sich Tom genauestens ein und lässt sie gerne in seine Alltagskommunikation einfließen. Sage ich etwa zu ihm: »Tom, komm Hände waschen!«, antwortet er in der Regel mit »Zeigt her eure Füße«. Ist in den Radionachrichten vom chinesischen Exportwachstum die Rede, bietet uns Tom die inhaltlich dünne Geschichte von den »Drei Chinesen mit dem Kontrabass« dar. Erinnere ich ihn an einem heißen Tag daran, seinen Sonnenhut aufzusetzen, dreht er sich fröhlich zu mir um, räuspert sich kurz und intoniert ein wunderschönes »Mein Hut, der hat drei Ecken«. Dann läuft er wieder los. Leider ohne Sonnenhut.
Weniger angemessen als die inhaltliche Auswahl seiner Gesangseinlagen ist Toms Gespür für den passenden Augenblick. Vor Kurzem saßen wir mit meiner Familie anlässlich des fünfundsechzigsten Geburtstags meiner Mutter in einem vornehmen Restaurant. Tom zeigte sich von den Künsten des renommierten Küchenchefs nicht sonderlich angetan, aß aber dennoch ohne größere Beschwerde sowohl die Wachteleier als auch Loup-de-mer-Pastetchen und Kaviarkräcker. Die beste Mutter vom Siegfriedplatz und ich warfen uns erleichterte Blicke zu. Wir wissen nur zu genau, dass das süßeste und pflegeleichteste Kind der Welt zu einer Hyäne werden kann, wenn die Nahrungsaufnahme nicht zu seiner vollsten Zufriedenheit verläuft.