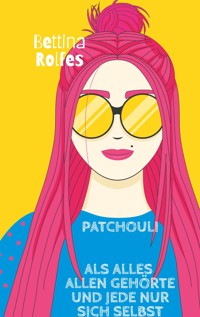
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 70er Jahre, eine bröckelnde Villa im Ruhrgebiet. Thea ist neunzehn und neu in der Stadt. Sie kommt vom Land, doch jetzt will sie es wissen und bald schwimmt sie mit im Strom der wilden 70er. Sie geht auf Demos, reist nach Mexiko, probiert magic mushrooms, entdeckt die Frauenbewegung, jobbt in einer Fernseherfabrik, schmeißt ein Klavier aus dem Fenster, zieht in eine Landkommune und wieder zurück... Ein Roman über die Hoffnungen, Träume und Irrwege einer Generation. Übermütig, poetisch, unterhaltsam.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieser Roman ist ein Werk der Fiktion. Handlung und handelnde Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären rein zufällig.
Für Felix und alle, die dabei waren.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Bahnhofstraße 54
Der Hirschkäfer wird zum Hirsch
Hausversammlung
Let’s spend the night together!
Wo soll ich dich beerdigen?
Wo geht`s hier zum Blocksberg?
Alpenüberquerung mit Sechsfüßer
Paare
Die Eifersuchtsgruppe
Im Blaumann zu Frida Kahlo
Quiere hongos?
Drei
Going to San Francisco?
Etwas Besseres als den Tod finden wir überall
Alles gehörte allen und jede nur sich selbst
Planetengetriebe und weiße Ware
Patchouli
Wenn die Nacht am tiefsten ist…
Jochens Geheimnis
Metal beings & magic places
Der Sommer mit Diego
Horst geht kaputt, Giovanna trägt Orange
Linksradikales Schrauberkombinat
Ende September
Prolog
Vor einigen Jahren, vielleicht ist es länger her, als es mir vorkommt, hauste ich mit einem Haufen wilder Gesell:innen in einer bröckelnden Villa. Sie stand in einer kleinen Stadt an der Ruhr. Vor dem Haus verliefen die Schienen der Straßenbahn, mit der man in eine große Stadt fahren konnte. An der gegenüberliegenden Straßenseite hielt ein Bus, der in eine andere große Stadt fuhr. Oder man lief ein paar Schritte weiter und fuhr mit der S-Bahn in eine dritte große Stadt. Endlich war ich mittendrin im Herzen der Hölle – oder zumindest in einem ihrer vielen Vorhöfe. Und genau das war es, wonach ich mich nun zwanzig verschlafene Jahre lang gesehnt hatte. Denn ich kam vom Land. Dass mein Zimmer alle zehn Minuten vom Bremsen und Anfahren der Straßenbahnen so sehr vibrierte, dass die Teetassen fast vom Tisch hopsten und von Zeit zu Zeit ein Bröckchen Stuck von der Decke herabrieselte, störte mich nicht weiter. Das war doch tausendmal besser als der unverstellte Blick auf die Hinterteile muhender Kühe.
Hinter dem Haus begann das Hüttengelände und wenn gerade Abstich war, färbte sich der Himmel feuerrot, ganz gleich, ob es zwei Uhr nachts oder zehn Uhr vormittags war. Auch das gefiel mir. Ich fühlte mich, als ob ich mein Zelt am Rand eines Vulkans aufgeschlagen hätte. Dass es ab und zu auch so roch wie in der Vorhölle – geschenkt. Was war das bisschen Schwefel schon gegen den Gestank von Gülle, der im November wochenlang über dem düsteren, bösen Dorf hing, aus dem ich kam.
Wohngemeinschaften kannte ich nur aus den Gesprächen der älteren Schüler, die ich in der Pausenhalle meiner Schule aufgeschnappt hatte. Das musste etwas ziemlich Wildes sein, wo Langhaarige den ganzen Tag Hasch rauchten. Und auch sonst jede Menge verbotener Dinge taten. Und davon gab es viele, denn der größte Teil der interessanten Dinge war verboten, dort, wo ich herkam. Denn ich kam nicht einfach nur vom Dorf, sondern aus einem katholischen Dorf.
Was für Sünden es so gab, hatte ich schon im Alter von sechs Jahren erfahren, als ich zur Vorbereitung auf die erste Beichte anhand des Beichtspiegels im Gebetbuch mein Gewissen erforschte. Seitenweise waren da Sünden aufgelistet, und dazu musste ich ja auch noch die Erbsünde rechnen, die ich schon vor meiner Geburt begangen hatte. Von da an bekam ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich Jesus am Kreuz sah, schließlich war er auch für meine Sünden gestorben. Dabei war ich eigentlich gern in der Kirche. Ich mochte den Geruch von Weihwasser und altem Holz und liebte es, wenn der Pastor die Weihrauchschiffchen schwenkte und würzige Rauchschwaden durch die Kirche waberten. Beim Erntedankfest im Herbst führte er die Prozession durch die Felder an, gefolgt von der singenden, Fahnen schwenkenden Gemeinde und segnete den wogenden Weizen und die kräftigen Runkelrüben. An Fronleichnam war das ganze Dorf geschmückt mit bunten Fähnchen mit Hirten und Heiligen und vor den Geschäften waren kleine Altäre aufgebaut. In goldenen Gewändern zog der Pastor durchs Dorf, unter einem ebenfalls golddurchwirkten Baldachin, der von vier starken Männern getragen wurde.
Wenn ich in Gefahr war, schickte ich ein Stoßgebet zum Himmel, in schwierigen Momenten stand mir ein Engel zur Seite, und wenn ich etwas verloren hatte, half der heilige Antonius. Nur vor dem Teufel musste man sich in Acht nehmen, aber den konnte man leicht an seinem Pferdehuf erkennen.
Es war also nicht so, dass ich mich als Kind gelangweilt hätte. Die Kirche bot eine Menge Spektakel und Nervenkitzel und auch mit den anderen Kindern hatte ich viel Spaß. Wir waren frei, zogen durch Wälder und Felder, gruben nach Schätzen, stiegen in die Kronen der höchsten Bäume, gründeten Banden, führten Kriege, retteten aus dem Nest gefallene Vögelchen, fingen Frösche und stapften durch hüfthohe Schneewehen. Doch irgendwann verlor das Landleben schlagartig seinen Reiz.
Meine Eltern hatten inzwischen einen Fernseher und die Bilder von den Kriegen in aller Welt drangen bis in unser Wohnzimmer, wo wir auf einer trapezförmigen, lila bezogenen Wohnlandschaft die Tagesschau verfolgten. Sie waren modern und hatten den 50-er Jahre-Mief mitsamt der Cocktailsessel und Nierentische schon vor Jahren auf die Müllkippe befördert beziehungsweise ihrer Putzfrau geschenkt. Jetzt kämpften sich in unserem Wohnzimmer amerikanische Soldaten durch den vietnamesischen Dschungel, standen im Sumpf, führten Kriegsgefangene ab. Bomben wurden aus Flugzeugen abgeworfen und ich blickte in die angstvollen Augen vietnamesischer Kinder.
Langsam dämmerte mir, dass es noch eine andere Welt gab – und die hatte auch mit der Musik zu tun, die meine Eltern aus Amsterdam mitgebracht hatten. Uns Kindern überreichten sie bunte Plastikeimer mit belgischen Bonbons, dann packten sie die Platten aus. Es war eine englische Band, die in den Niederlanden riesige Erfolge feierte. Auf dem Cover waren langhaarige junge Männer abgebildet, und wir Kinder sahen mit großen Augen zu, wie unsere Eltern die dicken, harten Schallplatten auf den Plattenspieler legten, der kindersicher hoch oben im Regal stand. Sie drückten eine Taste, dann fuhr der Tonarm zur Seite, senkte sich auf die Platte, es knisterte kurz und eine wilde, fremde Musik erklang. Während meine Eltern tanzten, stopfte ich mir ein belgisches Bonbon nach dem anderen in den Mund, und als die Platte vorbei war, lag der Teppich voller Bonbonpapier, meine Zähne klebten vom Karamell, und ich fühlte mich wie im Himmel. Mein Englisch reichte nicht aus, um die Texte zu verstehen, genau genommen konnte ich noch gar kein Englisch, aber die Musik, die Stimmen, die Klänge und Rhythmen begeisterten mich. Diese Musik war anders als alles, was ich zuvor gehört hatte.
Ein Jahr später begann mein großer Bruder, sich wie die Männer auf dem Plattencover die Haare wachsen zu lassen. Bei ihm fanden meine Eltern das nicht so lustig. Mein Vater hatte schon öfter Bemerkungen über Langhaarige, Gammler und ähnliches Gesindel gemacht und meinem Bruder dabei lange Blicke zugeworfen, aber eines Sonntags platzte ihm dann beim Mittagessen der Kragen.
„Willst du nicht mal wieder zum Friseur gehen, Johannes?“, fragte er, während er ein Stück Entenbrust in die Soße tunkte und in den Mund schob.
Johannes ließ den Pony tief ins Gesicht fallen und knurrte: „Nein.“
Er war inzwischen fünfzehn und der Ansicht, dass seine Frisur nur ihn etwas anging. Innerhalb von wenigen Sekunden war mein Vater auf hundertachtzig und brüllte:
„Mein lieber Sohn, über eines sei dir bitte im Klaren: Solange du deine Füße unter meinen Tisch hältst, hast du zu tun, was ich dir sage. Eine Beatlesfrisur gibt es hier nicht.“
Johannes stand wortlos auf und sprach wochenlang nicht mehr mit unserem Vater. Sobald er von der Schule kam, verschanzte er sich in seinem Zimmer und hörte laute Musik. Seine Haare wurden immer länger. Mein Vater hatte sich schon aufgeregt, als ihm der Pony in die Augen hing, aber bald hatte er eine richtige Matte. Die langen Haare waren eine Kriegserklärung.
Für Kinder mochte das Landleben schön sein, aber für Jugendliche war es eine Qual. Es gab kein Kino, kein Jugendzentrum, kein Café, keine Kneipe, keine Konzerte, keine Disco, es gab gar nichts außer den grünen Wiesen und der guten Luft. Ich spürte, dass es woanders auf der Welt richtig abging, aber ich musste hier auf dem Dorf versauern.
Zudem hatte sich mein Vater wieder mal eine Freundin zugelegt. Diesmal war es eine seiner Praxishilfen, eine 22-jährige Blondine. Meine Eltern hatten sich schon immer ausgiebig gestritten, aber nun wurde es von Woche zu Woche schlimmer. Ich konnte es kaum erwarten, endlich die Schule zu beenden. Dann würde ich so schnell wie möglich das Weite suchen.
Bahnhofstraße 54
Den Studienplatz hatte mein Vater mir zum Abitur geschenkt. Nun ja, nicht ganz, aber im Prinzip lief es darauf hinaus. Es war ein Studienplatz in Medizin. Er war der Ansicht, ich wäre die geborene Ärztin, und er als Zahnarzt hätte mich zwar lieber als seine Nachfolgerin gesehen, konnte aber akzeptieren, dass ich das ablehnte, und als Ärztin würde ich immerhin in der Branche bleiben.
Mein Notendurchschnitt war eher mittelmäßig, aber mein Vater hatte sich gleich nach der Abifeier ans Telefon gehängt und mit seinem besten Freund Walter telefoniert, der von Beruf Anwalt war. Walter hatte sich erkundigt und uns den Fachmann für Studienplätze genannt, mein Vater hatte eine Stange Geld auf den Tisch gelegt, Walter hatte Klage erhoben und nun konnte ich als Nachrücker mein Studium beginnen. Mir schwebte vor, als Hausärztin Gutes für die Menschheit tun. Oder in der dritten Welt Menschenleben zu retten. Aber vor allem wollte ich so schnell wie möglich das gottverdammte Dorf hinter mir lassen. Und so war ich meinem Vater um den Hals gefallen, hatte ein paar Sachen in meinen Rucksack gestopft und weg war ich. Doch zwei Wochen nach Semesterbeginn gab es keine kleinen Wohnungen, Apartments oder Plätze in Wohnheimen mehr.
Die ersten drei Nächte hatte ich in einem möblierten Zimmer bei einer alten Dame verbracht, wo ich auf keinen Fall bleiben wollte. Nur wusste ich nicht, wohin. Die Vorlesungen hatten schon begonnen und ich musste mich anstrengen, mitzukommen. Nur mit Glück konnte ich noch einen Platz im Biologie-Praktikum ergattern, und da stand ich dann mit Schere und Petrischale in der Hand und hatte eigentlich schon genug.
Es waren Frösche. Etwa zwanzig Frösche, die in einer hellblauen Plastikwanne um ihr Leben schwammen. Wir sollten einen Frosch aus der Wanne nehmen, ihn mit einer Schere dekapitieren, also den Nervenstrang zwischen Hirn und Wirbelsäule durchtrennen, den Frosch damit töten und ihn anschließend an ein Metallgestell hängen, um seine Muskelreflexe zu testen.
„Mach ich nicht“, sagte ich.
„Warum nicht?“, fragte der Assistent, der wie alle anderen Anwesenden, ich inklusive, einen weißen Kittel trug. Auf manchen Kitteln zeigten sich schon erste Blutflecken.
Ich sollte einen Frosch nehmen und mit der Schere in sein Gehirn schneiden, damit er dann tot war. Angewidert wandte ich mich ab.
„Und Sie wollen Ärztin werden?“, fragte der Assistent. „Da müssen Sie noch ganz andere Sachen machen.“
„Lass man, dann mach ich das“, sagte Marjan. Sie war meine Rettung. Sie killte den Frosch, hängte ihn an die Apparatur und setzte ihn unter Strom, woraufhin sich sein schöner langer Beinmuskel zusammenzog. Ich führte Protokoll.
Nach dem Praktikum gingen wir in der Mensa essen. Auf einem Fließband, das direkt aus der Küche kam, rollten Plastiktabletts mit verschiedenen Vertiefungen und aufgestellten Schalen heran. Es gab Gemüsebrühe, Kartoffelpüree, rote Bete und Brisoletten, was seltsame graue Klopse waren, die möglicherweise Schweinefleisch enthielten, worauf mit einem Schild hingewiesen wurde. Zum Nachtisch dann ein Plastikbecher mit waldmeistergrünem Wackelpudding. Beim Essen erklärte Marjan mir die politischen Verhältnisse in ihrer Heimat. Ihr Vater war Kommunist und die Familie war aus dem Iran in die Tschechoslowakei geflohen, sie war in Brünn aufgewachsen, von dort war die Familie dann nach Bochum gezogen. Der Schah von Persien ... Ja, von dem hatte ich schon gehört, wenn auch vorwiegend aus den Illustrierten, die im Wartezimmer meines Vaters auslagen.
Nach dem Essen schlenderten wir durch die Eingangshalle und wurden mit Flugblättern sämtlicher politischen Gruppierungen versorgt. Die Annonce hing am Schwarzen Brett: Wohngemeinschaft hat Zimmer frei, und ich rief gleich an.
„Bahnhofstraße 54“, rief eine fröhliche junge Stimme ins Telefon. Sie kam von weither und zwitscherte wie eine muntere Lerche, die hoch oben in einem Baum sitzt und sich den frischen Wind durchs braune Federkleid wehen lässt.
„Guten Tag“, sagte ich schüchtern, „ich habe gehört, also eigentlich gelesen, also hier ist ein Anschlag am schwarzen Brett. Sie haben ein Zimmer frei?“
„Ja, am besten kommste mal vorbei. Heute so um sechs, geht das?“
Dann erklärte sie mir noch, welchen Bus ich nehmen sollte, und so stand ich gegen sechs mit klopfendem Herzen vor der bröckelnden Villa und starrte durch die schmiedeeiserne Rosette der Haustür in den dunklen Flur. Es regnete. An der Klingel standen etwa zehn Namen, ich zögerte noch, schließlich war ich zu früh, und so putzte ich mit dem Finger den Sand von der Scheibe, um einen Blick ins Innere werfen zu können. Ein düsterer Hausflur, in dem ein paar alte Kleiderschränke standen, davor eine leere Bierkiste, eine Garderobe mit mindestens zwanzig Mänteln und Jacken, darunter grobe Mengen Stiefel und Schuhe. Eine Treppe führte in den ersten Stock.
Ich sah auf meine Uhr. Es war fünf vor sechs. Die Kälte kroch mir in die Knochen. Ich fühlte mich wie in der Zahnarztpraxis meines Vaters, wenn ich auf dem Behandlungsstuhl saß und darauf wartete, dass er mir mit einem Haken in den maroden Backenzähnen herumstocherte.
In meinem Inneren waren faulende, schlechte, böse Gegenden, das hatte ich schon mit sechs Jahren im Religionsunterricht gelernt. Auch wenn mein Glaube in den letzten Jahren zu einem Rest aus Aberglauben und Stoßgebeten im allerhöchsten Notfall zusammengeschrumpft war (bitte lieber Gott, mach, dass Mama nichts merkt!!!), der wie ein Häufchen Kehricht in einem Winkel meiner Seele herumstand – die Schuldgefühle waren geblieben. Mit meinen Eltern hatte ich mich noch nie verstanden, aber sie sich miteinander auch nicht. Im Gegenteil. Sie hatten mir vorgeführt, dass ein Ehekrach auch ein ganzes Jahrzehnt oder eine ganze Generation währen konnte.
Aber es musste noch etwas anderes geben, ein freies, wildes Leben. Irgendwo brannte ein Feuer, an dem die Menschen sich wärmten, und das vermutete ich im Inneren des düsteren Hauses.
Endlich war es sechs und ich drückte auf die Klingel. Der Regen lief mir inzwischen in den Nacken. Es dauerte. Ich klingelte erneut. Es dauerte weiter. Endlich fiel ein schwacher Lichtstrahl in den dämmrigen Flur und ich hörte in den Tiefen des Hauses eine Tür quietschen. Ein Bärtiger schlurfte in Cordhose, dunkelrotem Pullover und Hausschuhen zur Tür.
„Guten Tag, ich wollte zu ... also ich hatte angerufen, wegen dem Zimmer“, stotterte ich.
„Ja, das ist jetzt schlecht“, knurrte er und starrte mich durch seine Nickelbrille unwirsch an.
„Aber die Frau hat gesagt, ich soll um sechs kommen.“
„Ne Frau? Weißt du auch noch, wie die hieß?“
Ich schüttelte den Kopf. Mir war zum Weinen. Mir war kalt. Er konnte mich doch jetzt nicht wieder wegschicken.
„Wahrscheinlich die Marion. Was macht die denn auch immer? Die ist doch gar nicht da.“ Er seufzte tief, überlegte lange. „Aber du kannst ja mal reinkommen.“
Ich folgte ihm in die Küche, wo auf der Ablage neben dem Herd ein enormer Spülberg gen Decke ragte. Wortlos starrten wir ihn an. Er schien ebenso verdattert zu sein wie ich.
„Ich kann ja mal einen Tee kochen“, sagte er schließlich, nahm einen fleckigen Wasserkessel, füllte frisches Wasser ein, zündete eine Gasflamme an und setzte ihn auf den Herd.
Ich sah mich um. Es war ein Durcheinander sondergleichen. Auf dem großen Eichentisch standen jede Menge benutzter Tassen und voller Aschenbecher. Teeflecken, ein Marmeladenglas und Brotkrümel ließen auf die Reste des Frühstücks schließen, auf einem ramponierten Sofa lag eine auseinander gefaltete Zeitung, die es wohl nicht mehr bis auf den Stapel geschafft hatte, der neben dem Sofa aus dem ochsenblutfarbenen Dielenboden wuchs. In den Ecken tummelten sich Staubmäuse. An den ockergelben Wänden prangten Plakate mit den Konterfeis von Marx, Engels und Lenin, darunter der Schriftzug: "Alle reden vom Wetter. Wir nicht." Ich kam aus dem Staunen nicht heraus.
„Dass die auch nie spülen“, schimpfte der Bärtige. „Wer ist überhaupt dran? Wahrscheinlich wieder die Marion, die spült echt nie“, grummelte er, schlurfte zu einem der beiden eichenen Küchenschränke, an dem ein DINA4-Zettel mit einer handgeschriebenen Tabelle klebte.
„Putzen, Einkauf, Klo, Spülen...“, las er und fuhr mit dem Finger die Zeilen nach, „kann doch nicht sein, ich hab doch letzte Woche erst ... hm“, lachte er trocken. „Son Mist ... kannst mir ja helfen.“
Und eh ich mich versah, wurde ich zum Spüldienst eingeteilt. Er holte aus den Tiefen des anderen Schrankes ein paar halbwegs saubere Geschirrtücher hervor, band sich eine Schürze um, räumte das Spülbecken leer, ließ heißes Wasser einlaufen und legte los. Während ich abtrocknete, fragte er mich aus und ich erfuhr alles Nötige zu dem frei werdenden Zimmer. Streng genommen war es noch gar nicht frei, aber die Frau, die es bewohnte, eine gewisse Antonia, sei nun schon seit sechs Wochen in Griechenland und sie habe von da aus angerufen und gesagt, sie würde dann ausziehen und man könne ja ihre Sachen auf den Dachboden stellen. Er legte kurz den Spüllappen beiseite und zeigte mir das Zimmer.
Es ging direkt neben dem Eingang vom Flur ab, und als er die quietschende alte Fächertür öffnete, schlug mir ein penetranter Gestank nach Hasenstall entgegen – mit den Gerüchen von jeder Art Viehzeug kannte ich mich schließlich aus. Ich blinzelte in das Halbdunkel, in das spärliches Licht von der Straßenlaterne fiel. Der Bärtige, der sich inzwischen als Franz vorgestellt hatte, tastete sich ins Innere des Zimmers und knipste eine Stehlampe an.
„Pass auf “, sagte er, „nicht dass der Hase wegläuft!“ – und wirklich, da hoppelte ein kleiner grauer Hase über die Bastmatten. Natürlich hatte er schon jede Menge Köttel hinterlassen, aber das schien niemanden groß zu stören.
„Die Antonia will die Matten nachher wegtun“, sagte Franz entschuldigend, „und der Hase kommt dann aufs Land. Wir müssen den jetzt füttern, solange sie weg ist.“
Viel konnte ich im Halbdunkel nicht erkennen, aber es gab zwei große hohe Fenster mit hölzernen Fensterläden, die Decke war mit einer Stuckrosette verziert und die Wände schienen mit ungestrichener Raufaser tapeziert zu sein.
„Okay“, sagte ich, „nehm ich.“
Franz lachte wieder trocken.
„Dann müssen wir erstmal gucken, ob wir dich nehmen.“
Ich guckte vermutlich ziemlich blöd aus der Wäsche, denn dass ich mich hier gegen mehrere Bewerber durchsetzen musste, hatte ich mir so nicht vorgestellt. Während ich weiter abtrocknete und das Geschirr auf dem Tisch zu kunstvollen Gebilden stapelte, erklärte er mir das Verfahren. Normalerweise würden sie nur jemanden nehmen, den jemand kennt. Darum wisse er auch nicht, warum die Marion mich herbestellt hätte. Aber da ich nun schon mal hier sei, könne ich ja über Nacht bleiben und morgen könne man dann weitersehen. Obwohl ich ihn nur von der Seite sehen konnte, bemerkte ich, dass sein Blick bei den Worten „über Nacht“ ein seltsames Flackern bekam. Aha, dachte ich, zuerst muss ich meine Qualitäten im Abtrocknen unter Beweis stellen – und dann auch noch im Bett???
Plötzlich klopfte jemand ans Fenster. Die Scheiben waren vom vielen Wasserdampf beschlagen, draußen war es inzwischen stockfinster, und Franz putzte ein Stückchen frei.
„Fränzchen, hab keine Angst, hier ist kein Einbrecher, ich bins!“, rief eine kraftvolle Männerstimme.
„Der Horst!“, knurrte Franz, öffnete widerwillig das Fenster und ein junger Mann, der aussah, als käme er geradewegs aus den Wäldern Kanadas, angetan mit kariertem Wollhemd, Jeans, Wanderschuhen, Bart, Lockenkopf, Rucksack, stieg zum Fenster herein.
„Kannst du nicht normal zur Tür reinkommen wie andere Leute auch?“, meckerte Franz, aber Horst lachte nur, schlug ihm zur Begrüßung auf die Schultern, schüttelte den Regen ab und packte den Rucksack aus. Ein riesiges Brot, ein Becher Margarine der billigsten Sorte, ein 1000-Gramm-Glas Marmelade, ein enormes Stück eingeschweißter Käse, ein Pfund schwarzer Tee.
Kurz darauf traf ein weiterer Mitbewohner ein, Onno, der Ostfriese, ein kleiner stämmiger Mann mit schulterlangen Haaren und rotem Vollbart, der ihm bis auf die gelbe Öljacke fiel.
„Wo ist eigentlich die Marion“, fragte Franz. „Hat die Thea herbestellt, ist aber gar nicht da.“
„Ich hab die vorhin in der Stadt getroffen“, erwiderte Horst. „Die muss heute Überstunden machen. Kommt später.“
Plötzlich wusste ich, woran Franz mich erinnerte. An einen Hirschkäfer. Die metallische Brille, der dunkle Bart und die mürrische Art, all das fügte sich zu einem Bild zusammen. Er passte überhaupt nicht in die Stadt. Er war ein Bewohner des Unterholzes.
Sie kamen überein, dass ich dann hier übernachten könne, es seien ja jede Menge Betten frei, das von Jule, das von Franziska und natürlich auch das von Antonia. Mir war das ganz recht. Dann musste ich nicht in das möblierte Zimmer zurückkehren, in dem ich die letzten Nächte verbracht hatte.
Horst deckte den Abendbrottisch. Vier Brettchen, vier Messer, vier Teebecher. Franz bestand darauf, dass wir erst den alten Käse aufaßen, und so bestrich ich mein Brot mit Margarine und säbelte mit dem stumpfen Messer ranzigen alten Gouda aufs Brot.
„Kannste denn auch kochen?“, fragte Franz mit vollem Mund.
„Der Franz!“, spottete Horst. „Der denkt auch immer nur ans Essen!“ Dann sprang er auf und schnitt noch eine Scheibe Brot von dem frischen Laib, mit der Brotmaschine, die auf einem Tischchen neben dem Küchenschrank stand. Den Krümeln nach zu urteilen, die sich unter der Maschine auf dem Boden häuften, mussten hier schon Hunderte von Broten geschnitten worden sein.
Der Hirschkäfer wird zum Hirsch
Am Abend wurde der Hirschkäfer zum Hirsch. Stolz schritt er durch sein Revier aus zwei mit braunem Kord bezogenen Matratzen an den gegenüberliegenden Wänden. Der Raum war bis in Brusthöhe mit Schilfmatten verkleidet, wie man sie in Gärten und auf Balkonen als Sichtschutz verwendet. Zwischen den Matratzen ging es über einen ausgetretenen Strohteppich in den Wintergarten, wo es noch kälter war als im Rest des Hauses, aber geheizt wurde grundsätzlich nur von Mitte Oktober bis Mitte April, hatte er mir erklärt, und es war erst der zehnte Oktober.
Er hatte mich in sein Zimmer eingeladen, mir einen Tee eingeschenkt und spielte mir seine Platten vor. Crosby, Stills, Nash and Young. Auf den ersten Blick sah das Plattencover aus wie ein chamoisfarbenes Familienfoto aus dem 19. Jahrhundert. Ein paar junge Männer standen vor einer alten Scheune. Auf den zweiten Blick waren es völlig bekiffte langhaarige Hippies in ihrer Landkommune.
„Gefällt dir die Musik?“, fragte er.
„Ja, ist super“, sagte ich. Es war kalt. Der Hirsch zündete eine Kerze an. Sein Bart schimmerte jetzt und seine Augen glänzten. Sein roter Pullover sah so wollig warm aus, dass ich mich am liebsten an ihn geschmiegt hätte. Inzwischen war es zwei Uhr. Wir lagen uns gegenüber, er auf der rechten Matratze, ich auf der linken, zwischen uns ein Meter abgetretene Strohmatten. Die Platte war zu Ende und er ging in den Wintergarten, um eine neue aufzulegen. Für einen Moment war es ganz still in dem großen Haus. Alle anderen schliefen oder waren nicht da. Wir waren allein. Ich hörte, dass er sich räusperte.
„Wenn du willst, kannst du ja hier schlafen.“, sagte er von nebenan. „Ich hab ja zwei Matratzen und eine Decke hab ich auch noch.“
„Okay.“
Als wir beide dann auf unseren Matratzen lagen, jeder für sich eingemummelt in einen winterlichen Schlafanzug und eine dicke Decke, er hatte die Brille abgenommen, das große Licht, eine Korblampe, gelöscht und nur die Kerze brannte noch, murmelte er mit belegter Stimme:
„Wenn dir immer noch kalt ist, kannste ja zu mir kommen.“
Einen bärtigen Mann hatte ich noch nie geküsst. Er war langsamer, zärtlicher, wärmer und bald zitterte ich nicht mehr vor Kälte, sondern vor Erregung. Im Gegensatz zu den Achtzehnjährigen, mit denen ich im Bett gewesen war, hatte er es nicht eilig. Er drängte mich zu nichts, nicht einmal, als sein Steifer unübersehbar an meinen Oberschenkel tippte. Ich steckte noch immer in dem pastellfarbenen Frotteepyjama, den ich von meiner Tante zum Geburtstag bekommen hatte. Er stand kurz auf, um noch eine Platte aufzulegen, eine amerikanische Folksängerin, und genierte sich kein bisschen für die Beule in seiner blauen Trikothose. Als er zurückkam, zog er mir vorsichtig das Oberteil meines Pyjamas aus, schob die Hand in meine Hose und berührte meine Scham so vorsichtig wie eine Knospe. Die flaumigen Häute wurden unter seinen Fingern zu einer stolzen Blüte.
„Willste lieber Kaffee oder lieber Tee?“, lispelte er am nächsten Morgen. Ich saß in der Küche, und er machte mir Frühstück. Er stand am Herd, der Wasserkessel kochte. Heute trug er einen blauen Shetlandpullover, der ihm ausnehmend gut stand.
„Lieber Kaffee“, sagte ich und er kochte mir einen himmlischen Kaffee und ein butterweiches Ei, dann fuhren wir zusammen in die Stadt. Er hatte einen olivgrünen VW-Bus. Herbstsonne schien durch die Blätter der Königsallee, im Radio lief laute Rockmusik. Vor einer roten Ampel küssten wir uns. Er fuhr zur Arbeit und brachte mich vorher zur Uni.
Als ich ausstieg, kam er kurz aus dem Auto und umarmte mich.
„Das mit dieser Nacht, äh...“ Er stockte und ich fragte mich, was jetzt wohl kam.
„Das bleibt unter uns, oder?“
„Klar“, erwiderte ich.
„Denn die Franziska, also meine Freundin, die kommt heute Nachmittag wieder. Und heute Abend ist Hausversammlung, da solltest du kommen, weil du ja einziehen willst. “
Ich musste schlucken. Das war also die freie Liebe. Doch als er abfuhr und noch einmal hupte und mir zuwinkte, fand ich es okay, so wie es war. Es war eine schöne Nacht gewesen und eigentlich empfand ich auch jetzt kaum mehr als Sympathie für ihn. Doch die hatte sich zumindest eingestellt. Ich beschloss, ihn wieder wie einen Hirschkäfer zu sehen und ging in die Cafeteria, um mir vor der Anatomie-Vorlesung noch einen Kaffee zu holen.
Hausversammlung
Außer den drei Männern wohnten noch drei Frauen im Haus: Marion, Jule und Franziska. Mit Marion hatte ich ja schon telefoniert und sie sah genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte: eine fröhliche, freundliche Frau Mitte zwanzig mit braunen Augen, langen braunen Haaren und Hippiekleid, die Sozialarbeiterin von Beruf war und praktischerweise gleich gegenüber im Haus der Jugend arbeitete. Franz' Freundin, die auch noch Franziska hieß, war am Nachmittag aus München zurückgekommen. Sie hatte lange, dunkelblonde Haare, eine Nickelbrille auf der Nase und ihre blauen Augen blickten nicht immer in die gleiche Richtung. Sie hatte einen leichten Silberblick. Aber ich war erleichtert, als sie mich herzlich begrüßte. Anscheinend wusste sie von nichts und ich hoffte, dass die anderen auch dichthielten. Wobei ich nicht sicher war, ob überhaupt jemand etwas von Franz und mir mitbekommen hatte. Ich hatte einen anstrengenden Tag in der Uni gehabt und fragte, ob ich mir ein Brot schmieren dürfe. Natürlich durfte ich. Franz bot mir seine Wurst an und Onno seinen Tilsiter. Wurst und besondere Käsesorten – also alles außer eingeschweißtem Gouda – waren Privatbesitz, und während wir noch auf Jule warteten, erklärte Onno mir die Haushaltskasse. Grundnahrungsmittel wie Milch, Mehl, Zucker, Brot, Tee, Gouda oder Zwiebeln wurden von der Gemeinschaftskasse bezahlt. Was darüber hinausging, musste jeder selbst finanzieren und in dem großen orangenen Schrank in der Ecke wurden die privaten Vorräte gelagert. Im Kühlschrank lagen die gemeinsamen Nahrungsmittel offen herum, was privat war, war in Kunststoffdosen verpackt. Und da gab es dann auch noch eine Wurstgemeinschaft, eine große Dose, die Franz, Franziska und Marion zusammen gehörte.
„Sollen wir nicht langsam anfangen? Ist schon halb acht!“, sagte Franziska, aber ihre Frage blieb unbeantwortet im Raum stehen. Marion hockte vor dem Kühlschrank und suchte nach Essbarem, Franz stand am Küchenschrank, löffelte einen Joghurt und erzählte Marion, die sich von Zeit zu Zeit umdrehte und einen Kommentar abgab, von seiner neuen Arbeitsstelle. Horst, der gegenüber von Franziska am großen Eichentisch saß, drehte sich eine Zigarette nach der anderen und pfiff dabei leise vor sich hin. Fünf waren schon fertig. Onno schien als einziger den Anlass der Zusammenkunft nicht vergessen zu haben und traf schon mal Vorbereitungen. Er suchte in dem neu gewachsenen Spülberg nach Tassen, spülte sie ab und setzte Teewasser auf.
„Sind denn alle da?“, fragte Marion von unten. Sie kniete noch immer suchend vor dem Kühlschrank, öffnete nun ein Glas mit Leberwurst und roch daran.
„Ist das von dir?“, fragte sie Franz.
„Ja, kannste nehmen. Sind natürlich nicht alle da. Jule fehlt noch, dabei hab ich die extra angerufen.“
In dem Moment klingelte das Telefon. Es stand im ersten Stock und Onno stapfte knurrend die Treppe hinauf.
„Petra fragt, wann Jule kommt“, brüllte er kurz darauf herunter. Allgemeines Gelächter, die Stimmen überschlugen sich, ein Scherz jagte den anderen. Über Jule war offenbar gut Scherze machen. Anscheinend kam sie immer zu spät, war ständig in Eile.
„Na, dann können wir ja anfangen, sie muss gleich kommen“, verkündete Onno, als er wieder in die Küche kam. Er stellte an jeden Platz eine Tasse, warf ein paar Teelöffel auf den Tisch und schüttete Tee ein. So zögernd, als ob sie gerade jetzt in die anregendsten Gespräche der Woche vertieft wären, setzten sich nach und nach alle hin, gaben Zucker, Milch oder beides in ihre Tassen, rührten kurz um, reichten den Löffel weiter. Teeduft erfüllte den Raum. Ein letztes Löffelklirren, ein erstes Teeschlürfen, dann wurde es plötzlich still. Alle starrten woanders hin.
Horst betrachtete die beiden hohen, alten Fenster, deren weiße Farbe abzublättern begann. Marion ließ ihren Blick an der Herdwand hin und her schweifen, vom Elektroherd zum Gasherd, zur breiten, technisch längst überholten Waschmaschine mit separater Schleuder und blieb bei der schmuddeligen Spüle hängen, an deren Wasserhahn nun der braune Teestrumpf hing und dampfte und tropfte. Franz betrachtete seine Fingernägel. Franziska hatte die Ellenbogen aufgestützt, das Kinn auf die Hände gelegt und blickte genervt an die Decke. Einen Moment war es so still, dass nur noch der ferne Geräuschteppich der Straße zu hören war. Ein Bauch gluckste. Jemand kicherte. Die beiden großen Küchenschränke, einer zur Rechten, einer zur Linken der Tür, standen wie stumme, mächtige Zeugen an ihrem Platz. Onno sah von einem zum anderen, strich sich über den roten Bart, nahm einen kurzen Schluck und wandte sich an Franz.
„Wann will sie denn einziehen?“
„Zum 15. Oktober.“
„Ist denn die Antonia dann schon raus?“
„Die hat gesagt, spätestens am zwanzigsten ist sie raus. Und Thea übernimmt wohl das Sofa, und die Sessel will sie auch haben.“
Da war Franziska plötzlich ganz Ohr.
„Also, das find ich aber ’ne Schweinerei. Kaum bin ich ’ne Woche weg, macht ihr hinter meinem Rücken schon mal alles klar.“
„Aber Franzi, nun mal sachte!“ Das war Horst.
„Nee, find ich Scheiße, ich komm wieder und werd einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Bisher haben wir es immer so gemacht, dass wir das zusammen besprechen, ob jemand Neues einzieht.“
„Oder nicht“, witzelte Horst.
„Genau“, bekräftigte Franziska, „oder eben nicht.“
Mir wurde mulmig. Ob sie doch etwas wusste?
Jemand hantierte an der Haustür. Ein Schlüssel wurde ins Schloss gesteckt, der Straßenlärm wurde laut und verstummte wieder. Behängt mit Taschen, Schals und Tüchern stürzte Jule herein, abgekämpft wie eine Schiffbrüchige, die es unter Aufbietung all ihrer Kräfte doch noch ans Ufer geschafft hat.
So schnell sie sich bewegte, so langsam sprach sie.
„Tut mir leid, woll“, stieß sie außer Atem hervor. „Hab den Bus verpasst und musste trampen.“ Sie zog sich das Tuch aus dem Gesicht, ein großes, gewebtes wollenes Tuch, das sie um Kopf und Schulter geschlungen hatte und lächelte. „Gibt’s denn noch Tee?“
Keiner sagte ein Wort. Endlich stand Marion auf und holte eine Tasse für sie. Franz setzte ein grimmiges Gesicht auf. „Kannste denn nicht einmal pünktlich kommen?“ Er schien fast zu platzen. „Nicht ein einziges Mal?“ Er wollte noch weiter ausholen und setzte sich gerade auf, doch Onno unterbrach ihn.
„Petra hat angerufen, ruft um zehn noch mal an.“
„Oh, die Petra!“ Jule freute sich. „Wann denn?“
Ihre muntere Laune brachte Franz noch mehr in Rage. „Jetzt haben wir extra wegen dir die Hausversammlung erst um sieben Uhr angesetzt statt um sechs, und wann kommt Frau Wolter? Um acht.“
Jule sah auf ihre Uhr. „Viertel vor acht.“ Sie stand noch immer im Mantel da, die Taschen in der Hand, als ob sie unschlüssig wäre, ob sie auf der Stelle wieder gehen sollte. Ihre dunklen Augen funkelten gefährlich in dem fahlen, fast grauen Gesicht. „Ja und? Was kann ich dafür, wenn ich den Bus verpasse?“
„Das sind die Richtigen“, knurrte Franz, „reißen sich das schönste Zimmer im Haus unter den Nagel und sind dann nie da.“
Jetzt reichte es Jule. Mit einem Ruck knallte sie ihre Taschen, die anscheinend mit Büchern gefüllt waren, auf die Holzdielen. „Und was geht dich das an? Wenn du nicht immer so meckern würdest, wäre ich vielleicht auch öfter da.“ Ihre Stimme brach, Tränen des Zorns traten in ihre Augen.
„Franz, jetzt hör doch auf.“ Marion legte ihm die Hand auf den Arm. Ärgerlich zog er ihn weg. „Ist doch wahr“, beharrte er, „und geputzt haste sicher schon ’n halbes Jahr nicht mehr.“
„Das ist ja wohl die Höhe. Meinste, ich komm extra von Wuppertal her, um deinen Dreck wegzumachen? Wenn ich nicht da bin, putz ich auch nicht. Das ist ja wohl die Höhe!“ Heulend rannte sie aus der Küche, knallte die Tür hinter sich zu und stampfte die Treppe hinauf, Marion hinterher.
Derweil wurde Franz von den anderen ins Gebet genommen.
„Hömma, kannste nich mal ’n bisschen freundlicher sein? Kann ja sein, dass sie nie da is, aber in so nem Ton würd ich mir das auch nicht sagen lassen.“ Horst rauchte schon die dritte Zigarette. Onno und er warfen sich genervte Blicke zu.
Nach zehn Minuten Hin und Her ging Franz reumütig nach oben und entschuldigte sich. Kurz darauf kamen sie fröhlich schwatzend die Treppe heruntergehopst, Jule schmierte sich schnell eine Schnitte und setzte sich neben Franziska. Die beiden flüsterten miteinander und ich wunderte mich, warum plötzlich so eine angespannte Stimmung im Raum lag.
„Das ist nicht wahr!“ Franziska war empört.
„Doch“, bekräftigte Jule.
Franziska rückte von Franz ab, der warf Jule einen bösen Blick zu und knurrte:
„Du hast das doch die ganze Zeit gewusst, also was soll das jetzt? Das ist zwei Monate her. Außerdem warst du ja auch mit Gregor im Bett, als Antonia in Holland war. Tu man nicht so scheinheilig.“
Antonia, das war doch die Frau, in deren Zimmer ich einziehen würde. Soweit ich das bisher verstanden hatte, musste Gregor ihr Freund sein.
„Du hast das gewusst und mir nichts gesagt?“ Franziska rückte jetzt auch von Jule ab. „Tolle WG. Ihr seid ja bald genauso verlogen wie meine Eltern“, erklärte sie im Ton tiefer Enttäuschung und fuhr dann Jule an: „Und du hast mit Gregor?“
„Ja und?“, entgegnete Jule und schüttelte ihre volle dunkelblonde Mähne in den Nacken. „Ist doch wohl meine Sache. Ich kenn Gregor schon seit dem Proseminar, und dann ist es eben passiert.“





























