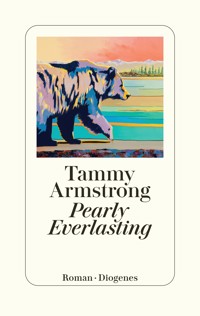
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kanada, 1934: Das Mädchen Pearly Everlasting, zu Deutsch Silberimmortelle, ist fünfzehn und in einem Holzfällercamp mitten im Wald aufgewachsen – zusammen mit dem Bären Bruno, der seit ihrer Geburt ein Teil der Familie ist. Doch dann beschuldigt man Bruno, einen Mann getötet zu haben. Der Bär wird weggebracht, niemand weiß, wohin. Verzweifelt und entschlossen macht Pearly sich zu Fuß auf den Weg durch die tief verschneite kanadische Landschaft, um Bruno zu suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tammy Armstrong
Pearly Everlasting
Roman
Aus dem kanadischen Englisch von Peter Torberg
Diogenes
Die Dinge sind entweder so, wie sie sind, oder nicht. Die Farbe des Tages. Das Gefühl, ein Kind zu sein. Das Gefühl von Salzwasser auf den sonnenverbrannten Beinen. Manchmal ist das Wasser gelb, manchmal auch rot. Aber die Farbe, die es in der Erinnerung hat, hängt immer vom jeweiligen Tag ab. Ich will dir die Geschichte nicht so erzählen, wie sie sich zugetragen hat, sondern, wie sie mir in Erinnerung geblieben ist
Charles Dickens
Den Bärenflüsterern gewidmet, die sich, allen Widrigkeiten zum Trotz, ihre Zuversicht bewahren. Das hier ist für euch.
ZUERST
New Brunswick, 1918
Woran erinnere ich mich als Allererstes? Vielleicht an die Graupel, die gegen die beiden kleinen Glasscheiben der Hütte klapperten – mal von Osten, mal von Westen –, oder an das Holzfeuer, das in den dunklen Wintermonaten die ganze Zeit brannte. Das Feuer heizte unser Zimmer auf und überzog alles mit fettiger Asche. Oder erinnere ich mich an das Knarzen der Rotzedern, die aneinandergedrängten Kronen vom Sturm verfilzt? Vielleicht auch an das Platschen des Regens auf den Dachschindeln oder an die Kojoten, die nachts ihre Lieder jaulten, während Eulen aus dem Geäst der windzerzausten Wildnis riefen, ohne Angst vor den widerhallenden Antworten.
Ein wenig von alldem wird mich geformt haben, während ich meine ersten Lebensmonate in einem Weidenkorb unter einem Elchfell verschlief. Er war damals auch schon dabei – mein Bruder Bruno –, an meinem Rücken zusammengerollt, die blasse Schnauze an meinem Hals, eine seiner Pfoten mit den langen Krallen stets auf meinen Rippen.
Ein Heulen, wenn der Wind auffrischt
Der ein oder andere redet vielleicht noch über uns, unten im Tal. Ich schätze, wir sind zu einer dieser Geschichten geworden, die man sich in Winternächten zwischen den Radiosendungen erzählt. Aber ich bin nun schon so lange hier oben auf dem Greenlaw Mountain, ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich meinen Bruder Bruno und mich in diesen Geschichten überhaupt wiedererkennen würde. Kurz nach meiner Geburt im Holzfällercamp 33 geschahen jedenfalls merkwürdige Dinge, und man vermutete damals schon, dass mein Leben nicht den üblichen Verlauf nehmen würde. Zunächst einmal kam ich mit langen Fingernägeln zur Welt; solchen Nägeln, mit denen man gut in Baumstümpfen kratzen und Schlafhöhlen buddeln kann. Jeden Abend, wenn ich schlief, schnitt meine Mutter sie zurück, und jeden Morgen waren sie wieder da – gelb und sichelförmig und fester als am Tag zuvor –, bis sie nach einem Monat wuchsen, wie sie das bei einem Baby tun sollten.
Außerdem tauchte ein Landstreicher von Draußen im Camp auf, nannte sich einen jeteur de sorts, einen Meister der Flüche, wollte unsere Schicksale weissagen und damit ein paar Münzen verdienen. Wir hatten zwar kein Geld, aber meine Mutter lud ihn in unsere Hütte ein und bot ihm einen Becher Tee an.
Der Landstreicher warf einen Blick in den kleinen Weidenkorb, in dem ich schlief, und sagte: »Die hier, mit den Murmeltierhänden? Die wird was zu sehen kriegen im Leben.« Er beugte sich vor und betrachtete mich eingehend. »Todsicher, die wird Old Jack zu sehen kriegen. Von Angesicht zu Angesicht.«
Meine Mutter hatte mich hochgenommen und an sich gedrückt. Old Jack, das war etwas, worüber die Holzfäller sprachen, wenn sie aus den Augenwinkeln einen Schatten sahen – ein Flackern, ein Heulen, wenn der Wind auffrischte, sodass es den Wald kribbelte. Er ist in den Bäumen, ist niemals stumm. Er ist im Wind, ist ringsherum. Ein Geschöpf, das man eher spürte als sah, das über einen Gebirgskamm springen und mühelos einen Fluss überqueren konnte. Manchmal legte es einem merkwürdige Dinge vor die Tür. Vom Teufel berührt, ritt Old Jack seine Schindmähre heim.
»Jeder weiß«, schickte meine Mutter den Landstreicher davon, »dass es Old Jack gar nicht gibt.«
Bevor er ging, gab sie ihm noch einen Beutel Brot mit auf den Weg, denn die jeteurs de sorts konnten zwar jemanden mit einem Fluch belegen, aber auch ihre Sünden bereuen. Man konnte sie also noch retten.
Und schließlich brachte mein Vater, der Koch unseres Camps, ein schreiendes, noch blindes Bärenjunges mit nach Hause. Mit der Zeit würden die Menschen um uns herum den Bären als meinen Bruder ansehen, er würde den weiteren Verlauf meines Lebens bestimmen, auch wenn er dafür nicht viel konnte. Manche mögen sagen, ein Baby und ein Bärenjunges haben nichts miteinander zu schaffen, aber wenn sie die Welt durch unsere Augen sehen könnten, dann würden sie mit Sicherheit anders darüber denken.
Ich kenne weder mein noch Brunos genaues Geburtsdatum, aber ich weiß, dass er zur Welt kam, wann Bären nun mal zur Welt kommen: im Januar in einem Bau unter einer Tanne, neben einem geborstenen Findling, durch den sich eine glitzernde Ader zog. Ich kam im Februar zur Welt, auf einem Bett aus Tannenzweigen, als die tiefen Schneewehen und Eisplatten unter Nebelbänken schmolzen. Ein falscher Frühling, so nannte es meine Mutter. Man konnte ihm nicht trauen.
In jener ungewöhnlichen Tauwetterwoche vor all diesen Jahren bemerkte ein Rodungstrupp, der Unterholz und Windbruch schnitt, dass die Pferde vor einem Felsen scheuten. Ein schwaches Geräusch drang aus ihm heraus, wie die Schreie eines Babys. Beim Abendessen erzählten die Männer meinem Papa davon, halb im Scherz – da schlafe wohl Old Jack unten in einer Baumhöhle. Wie die anderen Tiere auch war Old Jack im Herbst zwischen den letzten Pflanzen, zwischen Augentrost und Wicken abgetaucht. Und nun war er wieder da, erschreckte Pferde, wirbelte Zapfenschuppen und Nadeln auf und gab so die Höhlen der Winterschläfer preis.
Mein Vater war Koch, aber er kannte sich auch gut in der Natur aus. Er dachte gleich an einen Bären; Pferde scheuen vor allem, was mit Bären zu tun hat. Selbst solchen im Winterschlaf. Nein, meinten die Männer. Bären rühren sich nicht im Winter. Als nach dem Essen aufgeräumt war, ging mein Vater los, um selbst nachzuschauen. Er fand eine Lücke im mehligen Schnee, am Fuß einer hageren Tanne – ein Atemloch, das erkennen ließ, wo ein Tier tief in seinem Bau schlief und atmete und auf den richtigen Frühling wartete. Von dort kamen die Schreie. Er grub mit dem Schneeschuh, bis er auf Farn stieß, wie er üblicherweise den Eingang zu einem Bau verdeckt. Mit seinem Beil schnitt er einen Schössling und bohrte damit tief, tief hinein in das Wurzelgewirr, bis er auf etwas Weiches stieß. Er griff in das Loch und zog ein einzelnes Bärenjunges heraus. Nicht größer als zwei Äpfel nebeneinander. Keine Spuren von der Mutter, nicht hinein, nicht hinaus. Damals wurden Bären gejagt, so wie man hundert Jahre zuvor die Wölfe gejagt hatte, bis es nur noch Geschichten über sie gab, auch wenn die Männer ab und an behaupteten, einen Wolf bei den wilden Hunden gesehen zu haben, die knapp außer Sichtweite lebten.
Schreiend, zahnlos und blind, so kam Bruno in die schwere Wolljacke meines Vaters gewickelt ins Camp. Und von dem Augenblick an, als mein Vater ihn neben mich in den Weidenkorb legte, suchte Bruno meine Nähe. Es wäre zu grausam gewesen, ein solches verwaistes Geschöpf einfach verhungern zu lassen, sagte mein Vater. Meine Schwester Ivy tanzte um ihn herum und bettelte, er möge Bruno in ihre Hände legen. Und die Waldarbeiter kamen scheu herein und hofften, mit ihren groben Knöcheln über seinen Schopf streichen zu dürfen.
Also wiegte Mama uns beide auf ihrem Schaukelstuhl mit der Korblehne. Neben ihr flackerte die Flamme der Petroleumlampe im Windzug und warf lange Zerrschatten an die rauen Wände. Und in diesem Stuhl stillte sie uns beide und sagte: »Das hier ist dein Bruder, und das hier ist deine Schwester.«
Es gibt ein einziges Foto aus dieser Zeit. Aufgenommen hat es die Liederfängerin – eigentlich hieß sie Loretta –, die unsere Lieder und Balladen sammelte. Lieder, die von Familie zu Familie weitergegeben worden waren, auf den Seelenverkäufern bei der Überfahrt nach Kanada, durch das Hochland und die Fremde, und die hier in den Holzfällercamps lebendig gehalten wurden. Im Grenzland von New Brunswick. Die Liederfängerin und ihre Begleiterin Ebony kamen, um mich und Bruno zu sehen, denn es ging das Gerücht von einem Camp zum anderen um und kehrte zwischen den Bäumen zurück, dass hier eine Frau tief im Wald lebte und wilde Tiere nährte. Um von Draußen zu uns zu kommen, mussten sie erst mit der Eisenbahn fahren und dann über schwer zugängliche, einspurige Forststraßen wandern, die links und rechts von fast zwei Meter hohem Schnee gesäumt waren. Die Geschichte von Bruno und mir muss ihnen wohl ein wenig unwirklich vorgekommen sein, eher Märchen als Wahrheit, wie sie da zwischen Birken und Kiefern unterwegs waren und unserem geheimnisumwobenen Camp näher kamen.
Noch zehn Meilen, fünf Meilen, gleich hinter dem schlimmsten Abschnitt des Weges, wo der Boden teils mit Ästen und Planken belegt war, damit die Pferde nicht im Schlamm ausrutschten, kamen sie an den Rand unserer Rodefläche. In der Entfernung waren scharfe, tiefe Geräusche zu hören: Axtschläge, Schlittenglocken, Hammerschläge auf Spaltkeilen, und dann schrie vielleicht ein Mann: »Witwenmacher!« Und ein Baum zitterte und neigte sich ganz leicht, bis er dann wirklich umstürzte; erst langsam, dann mit sausender Macht, riss die Äste von Nachbarbäumen riss, und krachte in einer Wolke aus Nadeln, Zweigen und Schnee auf den Waldboden.
Aus den Geschichten kannten sie den Weg: gleich jenseits der Fällungen. Camp 33. Die Hütte, ein kleiner Anbau am Küchenhaus, wo ein Fenster leuchtete, blass wie das Licht, das manchmal vor einem Sturm zu sehen ist. Ich stelle mir vor, wie sie unter dem grobkantigen Vordach standen. Wie die Liederfängerin zweimal klopfte und wartete, während Regentropfen auf die Holzbohlen prasselten, auf die Mama Hinkelkästchen für Ivy gemalt hatte. Vielleicht stand die Liederfängerin auf der Zwei und der Fünf und Ebony sauber auf der Zehn. Es war Ivy, die an jenem Tag unsere Tür öffnete und die beiden Frauen vor sich sah. Sie musterte sie eingehend, trat dann beiseite und ließ sie ein.
Ich stelle mir vor, wie die beiden Frauen auf unserer Schwelle stehen und ihre Augen sich ans dunkle Drinnen gewöhnen. Das enge Zimmer vom weichen Licht der Petroleumlampen erhellt und vom heruntergebrannten Feuer, das Augen bernsteinfarben glühen ließ. Die Wände bedeckt mit vergilbten Bildern aus Kalendern und Cowboymagazinen, Trockenblumen und Kräuter, die über den Fenstern hingen, dann die Betten – zwei Tröge voller Tannenzweige, darüber bunte Flickendecken. Eine Holzbank. Ein Stuhl mit Flechtsitz. Unser Anbau war in seiner Kargheit typisch für ein Holzfällercamp, wenn auch seine Bewohner keineswegs typisch waren.
Wahrscheinlich war die Liederfängerin überhaupt nicht auf diesen Augenblick vorbereitet. Die lange Reise, das Wetter, Mama auf einem Schaukelstuhl neben dem Feuer. In unserem Zimmer hielt sich die Nachmittagsdämmerung, und das Licht vom Fenster verlieh Mamas zarter Gestalt mit den bloßen Brüsten einen Heiligenschein: ein Kind an der einen Brust und an der anderen, genau wie es die Gerüchte behauptet hatten, ein Bärenjunges; es beäugte die Frauen, die näher kamen, hörte aber nicht auf zu nuckeln.
Sicher stockte Ebony kurz der Atem. »Himmel«, mag sie geflüstert haben.
Ivy wird gedankenverloren zu Mamas Füßen gesessen haben, während eine erschöpfte Fliege in den schweren Vorhangfalten summte. Vielleicht hielt sie eine Stoffpuppe hoch, eine Umkehrpuppe. In einem Moment ein Rotkäppchen, dann ein Großmutterwolf mit Brille und Zähnen.
»Schau«, sagte sie womöglich und zog mit dem Wolf am Hosenbein der Liederfängerin. »Schau.«
Ich sah es ein einziges Mal, das Foto von Mama und Bruno und mir. Die Liederfängerin erzählte Draußen von uns, über das Leben im Wald. Aufnahmen von Brunos Schreien und Mamas Wiegenliedern sind durch die Welt gewandert, in Gegenden, von denen ich nichts weiß. Ich hatte noch keinen Namen, als Bruno zu uns kam, aber meine Eltern und alle Waldarbeiter beratschlagten bereits, wie ich heißen sollte. Es war die Liederfängerin, die bei ihrem ersten Besuch Pearly Everlasting vorschlug, Silberimmortelle, den Namen einer Pflanze, die gern neben glänzenden Dingen wächst. Sie hatte sich wegen ihrer Freundlichkeiten ein wenig in Mama verliebt und schickte mir von ihrem Haus in Smoke River, fünfzig Meilen entfernt, einen Löffel aus Bern zu, der Bärenstadt in der Schweiz, mit einem silbernen Bären am Griff, dazu eine Schale, in die unsere Namen und das Geburtsdatum eingraviert waren:
Alle wach im Morast
Bruno und ich wuchsen also gemeinsam heran, auf umgegrabenem Land, auf behauenem, zersägtem und verbranntem Land. Auf Land, das zerteilt und ausgehöhlt worden war, gerodet, vermessen und zerstampft, als man vergeblich versuchte, den Ort zu zähmen – und ihm so kleine Auferstehungen abzwang. Doch wenn die Arbeit in den Sommermonaten aussetzte, zogen wir zurück in unsere Hütte auf dem Greenlaw Mountain.
Wir seien Greenlawer Adel, sagte Mama stets, denn schon immer hatte es dort oben eine Frau gegeben, wenn auch nicht immer einen Mann, die starben manchmal zu schnell oder zogen weiter, aber eine Frau, eine Frau hatte schon immer dort auf dem Berg gelebt. Meine achte Urgroßmutter Burunild Slaywrock war mit ihrer Sammlung aus Kräutern und Salben von Draußen gekommen – aus den schottischen Highlands – und auf den Berg gezogen und hatte ihn nie wieder verlassen. Mama sagte, sie sei von einem König geehrt worden, der im Kampf gestürzt war. Ein starker Mann hatte den geharnischten König unter seinem in der Schlacht gefallenen Pferd hervorgezogen und zu Oma Slaywrock getragen. Sie hatte seine gebrochenen Knochen gerichtet, und er hatte ihr im Gegenzug ein Geschenk gemacht: eine goldene Doppelhornhalskette, das sie vor dem Bösen beschützen sollte. Es war von Generation zu Generation weitergereicht worden und gehörte nun Mama. Ihr einziger Schmuck, und sie trug ihn voller Stolz. Der König gab Oma Slaywrock und ihren sechs Töchtern freies Geleit in ein Kanada, das damals noch viele andere Namen trug. In den Wäldern lernte meine Großmutter die Mi’kmaq-Frauen kennen und freundete sich mit ihnen an, und schon bald entdeckten sie, dass sich einige ihrer Heilkräfte glichen. Meine uralte Großmutter zeigte ihnen ein wenig von ihrem Wissen, und die Frauen lehrten sie ihre Sprache und die Heilwirkung von Pflanzen, die ihr unbekannt waren – Mama nutzte noch manche davon bei Verletzungen im Camp. Doch die Namen dieser Heilpflanzen darf ich nicht preisgeben, das steht mir nicht zu.
Jedes Jahr im August kamen wir vom Greenlaw Mountain herunter und zogen zu Papa in die Camps. Wenn die Männer neue Pferdeställe, Schlafbaracken und ein Kochhaus errichteten, bauten sie auch für uns eine Hütte mit einem niedrigen Dach aus Brettern, die einen Rahmen aus eingekerbten Stämmen bedeckten, welche mit Axt und Keil geschlagen und mit Moos verfugt worden waren. Aus den übrig gebliebenen Hölzern bauten die Männer Bruno und mir ein Baumhaus und Bruno eine Kiste für den Winterschlaf. Umgeben von zweihundert Baumstümpfen, Klafterholz, Schlitten, Schneeschuhen, Sägen, Äxten und Wetzsteinrädern lebten wir stets in der Nähe eines Flusses, wo die Männer die Stämme sägten, zogen, stapelten und herumwuchteten, die dann im Frühling flussabwärts geflößt wurden. Um all diese Camps heulte ein beständiger Wind. Er konnte einen Mann begleiten oder ihn vor sich herjagen. Einmal fragte ich Papa: »Warum ist es hier so windig?«
»Da wollen wohl wieder Wölfe unser Haus umpusten«, sagte er, drückte mir einen Melassekeks in die Hand und schob mich zur Küche hinaus.
Die Männer kamen von überallher, um in den Camps zu arbeiten, und die meisten hofften, in Papas Camp zu landen, denn er war der bekannteste Koch in der ganzen Gegend. Es waren stille Männer, gebrochene, über und über tätowierte, welche, die während des Krieges in New York Schiffe kalfatert, Getreide im südlichen Saskatchewan gedüngt oder das Holz für Melassefässer geschlagen hatten, die dann nach Barbados verschifft wurden. Männer, die Dampfmaschinen bedient hatten, in Sägemühlen und Eishäusern, Männer, die aus Dörfern kamen, welche nach siamesischen Zwillingen benannt waren und nach wilden Schweinen. Männer aus schwedischen Weilern und polnischen Pfarreien, aus versteckten Tälern und tiefen Fjorden, aus rauchgeschwärzten Hütten mit zu vielen Kindern. Männer aus der Provinz. Seemänner. Les Canadiens. Les bûcherons. Skogshuggare. Drwal. Nujatejo’tasit.
Viele brauchten mehrere Tage und Wochen, um zu den Wanderbossen zu gelangen, die sie wie Pferde aus den zerlumpten Reihen holten und in die Camps brachten. Manche mussten eine alte Milchkuh verkaufen, um per Versand Stiefel bestellen zu können. Manche Bosse nahmen ein Pferdegeschirr auseinander, warfen die Teile in ein Fass mit Altöl und ließen dann einen Grünschnabel alles herausfischen und wieder zusammenfügen. War die Crew dann angeheuert, schleppten die Männer in wilden Haufen Satteltaschen, Seesäcke und Vorratskisten mit sich, ein jeder beladen mit seiner Habe aus Wolldecken, Socken, Handschuhen, Stopfnadeln, Äxten und Pokerkarten. Sie alle folgten dem Boss immer tiefer hinein in die dunklen Wälder. In den Winter- und Frühlingsmonaten wurden wir im Camp zu einer behelfsmäßigen Familie. Wir alle, mit unserer ramponierten Freundlichkeit, gaben aufeinander acht, denn unser Überleben hing davon ab.
Papa hatte nicht als Koch angefangen. Bis zu seinem elften Lebensjahr hatte er mit seinem Großvater in einem alten Farmhaus gelebt, dessen Obergeschoss im Winter verriegelt war, weil dann das Hirschfleisch aus dem Herbst dort lagerte. »Arm wie die verfluchten Kirchenmäuse«, sagte Papa immer. Und dann, als sein Großvater starb, wurde er auf die Straße gescheucht wie ein alter Hund. Ein Nachbar oder jemand vom Amt, er wusste nicht mehr wer, hatte ihn in einen grob verhauenen Karren gesetzt, war mit ihm die Straße entlanggefahren und hatte den Nachbarn zugerufen: »Könnt ihr nicht einen Burschen für die Arbeit brauchen?«
Die meisten hatten gesagt: »Nein, nein, ich brauch keinen Burschen.«
»Und ihr kennt auch niemanden, der einen braucht?«
»Nee, tut mir leid.«
Schließlich kam Mr. Beecher, ein Milchfarmer, heraus und sagte, er könne jemanden brauchen. Papa blieb drei Jahre dort und arbeitete auf der Farm mit, zupfte Vogelmiere für die Schweine, hackte Holz und holte am Abend die Kühe in den Stall. Außerdem war er gut im Melken und im Hüten der fünfzig Schafe. Zweimal die Woche buk Mrs. Beecher. Papa stopfte sich auf dem Weg in die Scheune die Taschen voll; er hatte all seine Aufgaben vor Einbruch der Dunkelheit zu erledigen, weil die Beechers nicht wollten, dass er mit einer Laterne hantierte. Aber wenn er im Haus war, dann erlaubte Mrs. Beecher, dass er ihr beim Vorbereiten in der Küche zuschaute, und da lernte er ein paar Dinge übers Backen.
Die Burschen auf den Farmen ringsherum waren meist recht grobe Kerle – Waisenkinder und Zurückgelassene mit ihren namenlosen Stimmungen, unauslotbaren Wutanfällen und Kränkungen. Das machte diese Ecke der Provinz gefährlich. Als sie älter wurden, legten sie sich an den freien Samstagabenden miteinander an. Zerschlagene Flaschen, Taschenmesser und Fäuste. Es war keine Welt, zu der Papa gehören wollte. Schließlich holte ein entfernter Onkel, ein Waldarbeiter, ihn von Beechers Farm. Ein paar Monate später heiratete Papa und wurde Koch in einem Holzfällercamp. Nach Ivys Geburt schloss er sich den Sawdust Fusiliers an.
Und so fand er sich eines Tages im Baum des Königs wieder. 1916 wurde Papa auf der Justicia, einem Transportschiff der White Star Line, nach England gebracht. Dort blieb er für ein Jahr. Die Regierung hatte berechnet, dass für jeden Soldaten fünf Bäume benötigt würden: Einen für die Unterkunft, einen für Essens- und Munitionskisten, zwei für Gewehrschäfte und einen für den eigenen Sarg. Papa arbeitete auf den Pflanzungen der Clock Case Plantation am Rande des Windsor Great Park, im Wald rings um Schloss Windsor. Es gab dort viele uralte Eichen, die schon eine Königin namens Elizabeth I. hatte pflanzen lassen. Ein Baum, den die Sawdust Fusiliers fällten, war die Eiche »Wilhelm der Eroberer«. Er stand unter dem Schlafzimmerfenster des Königs und hatte einen Durchmesser von elf Metern. Und da es keine Säge gab, die lang genug war, um den Baum zu fällen, höhlten die Sawdust Fusiliers den Stamm aus und schufen so ein Loch, das groß genug war, damit ein Mann von innen die Säge ziehen konnte. Papa war der Mann, der in den Baum des Königs geschickt wurde.
Im Camp stand Papa jeden Morgen um vier Uhr auf und kochte, denn die Männer erwachten im Schein der Sterne und kehrten erst des Nachts mit ihnen wieder zurück. Er schickte seinen Hilfskoch in die Schlafbaracke, um zunächst die Fuhrleute zu wecken, damit sie die Pferde einspannten, dann stand er beim ersten Schein vor der Tür, hämmerte mit einem kaputten Flößerhaken gegen eine alte Eisenstange und brüllte: »Alle wach im Morast!« Meistens arbeitete er bis acht Uhr abends und setzte sich erst hin, wenn die letzte Pfanne mit Salz glatt geschrubbt war.
Wenn ich nachts mit Bruno und Ivy in meinem Bett aus Zweigen lag, stellte ich mir immer vor, wie all die am Lagerplatz aufgestapelten Baumstämme den Fluss hinunter zu den Sägewerken trieben, wo sie zu Brettern gesägt und zu all jenen Dingen verarbeitet wurden, die den Menschen von Draußen gefielen: Klaviere und Gewürzfässchen und Betten. Machten sie sich Gedanken über uns, hier in den Wäldern, wo Old Jack bei Nacht die Hirsche aufscheuchte und Verletzungen oft genug dazu führten, dass ein Mann in Leinwand gewickelt ins Camp zurückgebracht wurde? Stellten sie sich vor, dass dort ein Mädchen und ihr Bär lebten, fernab, im Schatten der Fichten, die zu hoch waren, als dass man den Horizont hätte sehen können?
Ganz von Licht durchzogen
Im Herbst 1928 suchten uns Krankheiten und Verletzungen heim. Ansell, ein vierzehnjähriger Holzfäller, wurde gleich zu Beginn der Saison vom Blitz getroffen. Seine Aufgabe war es, die gefällten Stämme von Astansätzen zu befreien, damit sich die Pferde nicht daran verletzten. Die Männer auf den Rodeflächen arbeiteten schnell, denn die Wespen hatte waren hoch in die Bäume geflohen. Ein sicheres Zeichen, sagten sie, dass böses Wetter aufzog. Eines Tages, als Ansell an einer Fichte arbeitete, verdüsterte sich der Himmel. Sein Atem im Rhythmus der Arbeit. Seine Axt, die von seinem Rücken aus ihrer natürlichen Bahn folgte, bereit, erneut in die blassen Muskeln des Holzes zu beißen. In dem Augenblick ließ eine Bö den Himmel gerinnen, und ein Blitz schlug ihn zu Boden – die Axt hoch über dem Kopf. Der Blitz durchfuhr ihren Stiel und entfloh durch die Sohle von Ansells rechtem Stiefel. Alle konnten sehen, wo er entlanggefahren war, weil er eine dunkle Spur auf Ansells Haut zurückließ. Blitzblüten. Merkwürdige Narben, die sich auf Gesicht und Hals auffächerten und verästelten.
»Hat es wehgetan?«, fragte ich ihn einmal.
»Nein«, antwortete er. »Nicht so, wie du meinst. Es hat auf einer anderen Ebene wehgetan, eher, als würde ich dabei zuschauen. Und dann … dann war ich jemand anderes.«
Auch einige der Männer behaupteten, Ansell sei ein anderer geworden. Manche meinten, er spüre Stürme aufziehen. Das war an sich noch nichts Besonderes. Jeder der Männer spürte, wenn sich das Wetter änderte. Schlecht verheilte Knochenbrüche, Arthritis, geschwollene Gelenke – all das machte wetterfühlig. Aber Ansell bemerkte die Veränderungen noch vor den Tieren. Bevor die Krähen ihr Rufen einstellten. Bevor die Pferde mit den Hufen scharrten und zurück in ihren Schuppen wollten. Die Männer bekamen schnell mit, wie viel Zeit zwischen Ansells Vorhersagen und dem Wetterumschwung verging, und die Vorhersagen beschränkten sich nicht aufs Wetter. Ein paar Wochen nach dem Blitzschlag, als die Fächerung auf seinem Gesicht noch rot hervorstand, fing er an, Verletzungen vorauszusagen. Da reichte es den Männern mit Ansells Gerede. Man munkelte in der Schlafbaracke, er habe sich der Hexerei zugewandt. Man munkelte auch, er habe schon immer gehext und der Blitz habe diese Fertigkeit oder den Fluch, abhängig davon, wer da gerade munkelte, nur noch verstärkt.
Verhext zu werden war tief in den Vorstellungen der Männer verwurzelt, je nachdem, wo die Männer herkamen, hatte jeder sein ganz eigenes Verständnis von Vorzeichen, seinen Aberglauben und seine Amulette. Als Ansell eines Morgens aus seiner Koje kroch, stieß er sich den Kopf an einem Hühnergott, der an einem provisorischen Balken über ihm baumelte. In einer anderen Nacht ertappte er einen Mann dabei, wie der eine aufgeklappte Schere auslegte, die Klingen wie zu einem bösen Fingerzeig direkt auf Ansell gerichtet. Dann wieder fand er kleine, aus Eberesche gefertigte Kreuze in seinen Jackentaschen. Und zu diesen befremdlichen Talismanen kam noch das Gefühl, die ganze Welt wäre ihm feindlich gesinnt. Krähen und Häher griffen ihn kreischend an. Er hatte den Eindruck, schon seine Stimme allein könnte die Pferde scheu machen oder die Bäume zum Bersten bringen.
Nachdem Ansell sich erholt hatte, dachte Mama, es würde ihm guttun, eine Weile dieses und jenes zu erledigen, was so anfiel: Gestrüpp aufschichten, Wegeheu ausbringen, Brennholz hacken, doch er streifte nur in sich gekehrt durchs Camp und wich den anderen Männern aus. Sein Gedächtnis, so hieß es, ließe ihn oft im Stich oder sei überdeutlich, genau wie bei Benoît Boudreau, dem Gestellsäger, der mit einer Handvoll Orden aus dem Krieg zurückgekehrt war – »Sind nur Bänder und billiges Blech, Pearly« – und der allein am ruhigsten war.
In jenem Herbst hatte Ivy damit begonnen, Bruno in alte Nachthemden, Kappen und Schals zu kleiden. Sie hatte ein ganzes Heft voll mit Zeichnungen von Bruno in diesen Kostümierungen. Einmal legte sie Bruno eine rote Fliege von Papa um, er hatte sie mal für ein Foto getragen, das die Liederfängerin von ihm in der Küche gemacht hatte.
Die Fliege machte mich wütend, und ich schrie sie an: »Er is doch kein Spielzeug, Ivy!«
»Ist. Stimmt doch, oder, Mama? Er ist kein Spielzeug.«
»Das stimmt, Ivy. Pearly Everlasting, achte drauf, wie du sprichst.«
Ich stürmte zur Hütte hinaus, Bruno dicht hinter mir. Aber von da an schlenderte er mit dieser Fliege im Camp herum. Wenn ich sie ihm abnehmen wollte, wich er mir aus und schnappte mit der Schnauze in die Luft wie eine Schildkröte. Eines Tages hatten Bruno und ich beide entzündete Augen und blieben für uns, oben im Baumhaus. Wenn Bruno schlechte Laune hatte, erklomm er den Baum allein und verbrachte den Tag auf dem Bauch liegend auf einem Ast, ungeachtet der wütenden Pferdebremsen und des Zikadenlärms um ihn herum. Um das mit der Fliege wiedergutzumachen, hatte Ivy mir ein Kostüm gebastelt, indem sie ein abgeworfenes Geweih mit einem Lederriemen an einem alten Hut mit Ohrenklappen befestigt hatte. Dazu schwärzte ich mir mit einem halb verkohlten Stück Holz die Augen und malte mir senkrechte Linien über den Mund, als ob er zugenäht wäre. Wir spielten oben im Baumhaus gerade mit den kleinen Schwertern, die Thankful Robinson uns geschnitzt hatte, einer der Fuhrleute. Bruno ließ seines, das zerkaut und voller Kerben war, über die Holzbrüstung fallen, und es landete direkt vor Ansells Füßen. Wir sahen, wie er es aufhob und nach oben schaute. Wir kauerten uns hin, damit er uns nicht entdeckte, doch dann brüllte Bruno, ich kicherte, und meine Geweihstangen schauten über die Brüstung, also rief ich: »Ahoi, Bursche!«
Ansell lächelte zum ersten Mal seit langer Zeit und fragte: »Untersucht ihr da oben die Schwerkraft?«
»Was ist das?«
»Was ist was?«
»Schwerkraft. Eine Waffe?«
Ansell schüttelte müde den Kopf.
»Bist du ganz allein da unten?«, fragte ich.
»Ziemlich allein in letzter Zeit, ja«, rief er zurück, und seine Stimme stockte ein wenig.
»Willst du raufkommen? Wir haben Augenrot, aber sonst …«
»Wenn ich komme, zerfleischt der Bär mich dann?«
»Nicht, wenn du ihm seinen Anteil an deinen Keksen gibst.«
»Und was ist sein Anteil?«
Ich dachte einen Augenblick nach und rief: »Er drei, du einen.«
»Ganz schön happig, was?«
»Sind nun mal die Regeln.«
»Also gut, wenn er mich dann in Ruhe lässt.«
Ansell kam herauf und gab Bruno seinen ausgemachten Anteil, dann erzählte er uns von seiner Heimat, dort, wo die Stürme über das Hochland zogen. Les-Suêtes-Winde, so nannte er sie. Stürme, die gern etwas umwarfen. Sie konnten eine Scheune aus dem Lot schieben oder auf den Nachbaracker versetzen. Sein Großvater, sagte Ansell, hatte ein Suête-Seil an einem geschmiedeten Eisenring befestigt und vom Scheunentor zur Veranda gespannt. Daran band er sich fest, um nicht weggepustet zu werden, wenn er von da nach dort ging.
»So ’n Quatsch«, sagte ich, und Bruno stand auf und setzte sich auf Ansells Fuß, um so seine Zweifel kundzutun.
»Fahr doch hin, und schau’s dir selbst an«, sagte Ansell.
Ich versprach ihm auf der Stelle, dass wir das eines Tages tun würden. »Es gibt keinen Sturm, der Bruno ins Meer pusten kann«, sagte ich. »Is nich … ähm … Das ist nicht möglich.«
Wir sprachen nicht ein einziges Mal über das Narbengeflecht auf seinem Gesicht. Ich fragte mich, ob es stimmte, was die Männer über Ansell sagten, er habe Old Jacks Weg gekreuzt, dabei konnte ich die Spuren dieses Übergriffs deutlich erkennen. In den Nachtwinden, im unheimlichen Loch unter der Treppe, versank Old Jacks Schatten und verzog sich in alle Winkel der Nacht, aber Ansell schien dieses Dunkel nicht in sich zu tragen, wie ich das bei manch anderem gespürt hatte. Ich war neugierig, ob sich Ansell nach dem Blitzschlag anders fühlte in seiner Haut. Bruno war jedenfalls ganz vernarrt in ihn. Er schob sich seitlich an ihn heran und schnupperte in der Luft, als glömme tief in Ansell womöglich noch etwas wie ein schlecht gelöschtes Feuer. Ansell war so statisch aufgeladen, dass Brunos Fell knisterte und Funken sprühte, wann immer sich die beiden zu nahe kamen.
Die ganze Zeit über hatte Papa draußen Kleinholz gemacht – weiße Birke, rote Kernbuche – und uns scheinbar nicht beachtet, aber er hatte doch gelauscht. Als es dämmerte und Ansell wieder zu Boden kletterte, pfiff Papa nach ihm, damit er in die Küche käme. Am nächsten Tag wurde Ansell ganz offiziell Küchenhelfer. Papa lernte normalerweise nicht gern Helfer an; immer waren es solche Burschen, die keine Fragen stellten, wenn sie es hätten sollen, oder Fragen stellten, wenn sie es hätten besser wissen müssen. Ansell war anders. Er arbeitete hart und vergaß nie, die Kuhbohnen über Nacht einzuweichen. Und weil Papa mal im Baum des Königs gesteckt und nichts mit Aberglauben und Hexerei am Hut hatte, kam Ansell langsam wieder zur Ruhe. Papa erlaubte sogar, dass er sich in der hinteren Ecke des Kochhauses seine Bettstatt ausrollte, gleich neben der kleinen Tür, die zur Waldsenke hinausging. Und alle bemerkten, dass Ansells Haut, die ganz von Licht durchflossen gewesen war, nach und nach blasser wurde. Ich fand, er war das Schönste, was ich je gesehen hatte.
Gleich nach Ansells Unfall war ich am Sonntag zur Schlafbaracke gegangen, um zu sehen, ob mir jemand mein Häutemesser schärfen würde, aber alle behaupteten, es sei noch scharf genug für meine Zwecke. Wenn ich lang genug drängelte, schärften sie es zum Schein, danach war es stumpfer als zuvor. Thankful Robinson griff sich mein kleines Messer und sah die Klinge hinab. Bruno gab er einen Apfel, und wir beide schauten ihm zu, wie er sich auf seinen dicken, felligen Hintern hockte und ihn wie eine Teetasse zwischen den Pfoten hielt.
»Weißt du, Pearly Everlasting«, sagte Robinson, »schätze, da ham wir Old Jack auf seiner Schindmähre gesehen.«
»Wirklich?«
Robinson nickte und ein paar der anderen Männer ebenfalls.
»Ja. Das muss was von Draußen sein. Springt nem Holzfäller, zack, auf den Rücken, weißt du? Schmeißt ihn zu Boden, dass ihm die Luft wegbleibt.«
»Genau wie’s bei dem jungen Burschen war«, fügte Toby Tobique hinzu, einer der Roder, der einen Gang hatte wie ein Cowboy.
»Ja, wie bei unserem Ansell«, fuhr Robinson fort. »Man sagt, wenn Old Jack mit nem Rechen vor deinem Haus steht, bleibt deine Familie am Leben, aber wenn er mit nem Besen auftaucht, könnt’s gut sein, dass jemand krank wird. Er kann Stürme heraufbeschwören und –«
»Genau wie der junge Bursche.«
»Ja, genau wie unser Ansell. Und er reitet auf seiner Schindmähre übers Land und mitten durch unsre Träume. Denk dran, wenn du und Bruno da draußen im Wald seid, Miss Pearly«, sagte Robinson und gab mir mein noch immer stumpfes Messer zurück.
Und ich wusste, dass irgendwo da draußen, jenseits unserer kleinen Hütte, Old Jacks Husten wie Löffelgeklapper, sein ächzendes Stöhnen ertönte. Einem Wildschwein gleich wühlte er im Boden, verstreute die Knochen der Männer und grub sich tief zu den Toten vor. Die Spuren fanden sich überall, wenn wir durch die alten Fällungen streiften, die ruhelos dalagen, wegen alldem, was vergangen war: eine Gabel, rostige Milchdosen, eine zahnlose Zweimannsäge – Jammersäge nannten sie unsere Leute. Ich hatte immer Angst, dass Bruno zu tief grub und ein paar dieser Knochen aus ihren Ruhestätten holen würde. Von allen, die ich kannte, war Ansell Old Jack am nächsten gekommen. Er hatte ihn kommen sehen, sah ihn vielleicht immer noch kommen.
Am Abend erzählte ich Mama, was die Männer gesagt hatten. Ich bat, sie solle unseren Rechen und unseren Besen verstecken, aber sie lachte nur.
»Old Jack ist doch nur ein Märchen, Pearly. Die Männer haben dich auf den Arm genommen.«
Ein paar Wochen später fand der heisere Winter in unser Camp. Im Dezember hielten uns die Stürme fest im Griff. Bruno war aufgewacht und trotzig auf Krawall aus. Er kletterte um die Herdstelle herum, wo der Kochtopf hing, und steckte den Kopf hinein auf der Suche nach Suppe. Wenn ich spätabends das Buchstabenschreiben übte, kletterte er die Stuhllehne hinauf und schlug mir das Buch aus der Hand, manchmal zerfetzte er dabei eine Seite. Mama regte sich fürchterlich auf.
»Ist doch komisch, ein Bär, der im Winter dauernd aufwacht«, sagte sie.
Sie ertappte mich nie dabei, wie ich um Brunos Winterkiste schlich, aufs Dach klopfte und rief: »Zweiauge, schläfst du?« Ich schaffte diese langen Monate einfach nicht ohne ihn.
Ende Dezember waren alle entweder krank oder erholten sich davon. Ivy konnte vor lauter Ohrenschmerzen nachts nicht schlafen. Papa rollte ein Stück Birkenrinde zusammen und blies ihr Tabakqualm ins Ohr, der sich wieder herauskringelte. Ich hatte einen rasselnden Husten und Bruno auch. Mama verabreichte uns einen Trank aus geschwefelter Melasse. Bruno wollte mehr. Sie gab mir Beinwelltee und Balsam-Tannensalbe gegen den Splitter, den ich mir eingezogen hatte und der nicht heilen wollte, aber Bruno leckte sie immer wieder ab. Um ihn abzulenken, gab ich ihm kleine Brotkugeln. Nachts zum Einschlafen schwenkte Mama ihre goldene Doppelhornkette über meinem entzündeten Splitter und Brunos Rotznase und Ivys schmerzendem Ohr und sang: »Hovela, hovela, kavela streck. Es morres a fri is alles aveck.« Eine Art Zauberspruch, den sie von einem Holzfäller aus Lunenburg gelernt hatte, der schließlich zu Gott fand und die Wälder verließ.
Ein jaulender März und noch immer von Stürmen eingesperrt. Wir stopften Lumpen um die Fenster gegen den Wind. Im März gab es immer drei Sorten Schnee: Stintschnee, Rotkehlchenschnee und Grasschnee. Der erste Schnee brachte die Stinte mit, die den Crooked Deadwater hinaufschwammen, als das Eis darin brüchig wurde. Papa schickte Ansell los, der sie mit Netzen fing, und die Männer aßen die gebratenen Fische im Ganzen, Gräten und alles. Mit dem zweiten Schnee kehrten die Rotkehlchen und ihre Regenlieder zurück und der dritte bedeckte den Boden gerade noch so, dass die frostigen Winde nicht das zarte neue Gras darunter vereisten.
Mama stopfte Socken und erzählte uns Geschichten über die verlorenen Jungen. Der Junge mit dem Schwanenflügel als Arm. Der Junge mit den Eselsohren. Und der Junge, der im Bauch eines Wals lebte. Erzähl uns von dem verschluckten Jungen, Mama. Erzähl uns von dem Jungen, der einen Flügel hat, wo sein Arm sein soll. Der Wind klopfte drängend an die Tür, Mama zupfte sich ein Haar aus und nähte es in die Spitze von Papas Socke, damit er stets den Weg zurück aus dem Wald fand. Ununterbrochen hatte sie etwas zu tun. Ein Reihstich in dunkler Farbe. Hinein. Hinaus. Hindurch. Ihr Stopfei hatte die Farbe eines Zaunkönigs. Wann immer sie es ablegte, um eine Socke zu wechseln, tobte Bruno um ihre Füße herum und jagte die Knäuel vor sich her. Trotz alledem strickte Mama, als habe man ihr als Kind Spinnweben gefüttert und als sei es ganz einfach, durch diese fadendünne Welt zu spazieren.
Im Frühling wurden wir wieder gesund, dafür verlor ich Milchzähne. Und jedes Mal nahm Papa den Zahn und fragte, ob er ihn hinauswerfen solle, um mein Tier herauszufinden. Wenn er ihn hinauswarf und ein Fuchs holte ihn sich, dann würde ich ein Fuchskind werden und im Dunkel besser sehen können. Ich wollte, dass er ihn Bruno zum Fressen gab, damit ich Bärenzähne bekam, aber Mama sagte, das sei alles Unfug.
Wenn Ansell am Abend mit den Aufgaben in der Küche fertig war, erzählte Papa Geschichten. Stets war darin von Old Jack die Rede, der auf seiner Schindmähre nachts zwischen den Camps unterwegs war und nach jenen lauschte, die er vielleicht im Schlaf mitnehmen konnte.
»Klippklapp, klippklapp, wo steigt er von der Mähre ab?«, fragte Papa.
Er behauptete, ihn einmal gesehen zu haben – eine geschmeidige braune Gestalt mit langem, gespaltenem Schwanz und einem Männerkopf mit Hörnern. Dazu Zähne wie ein Hecht. Old Jack tat mächtige Sprünge – zwanzig Fuß und mehr – und verschwand unter entsetzlichem Geschrei im Wald. Bis man ihn gewahr wurde, war er schon fort, ohne eine Spur zu hinterlassen. Old Jack, sagte Papa, sei so stark, dass er Felsen durchbrechen und sich tief in den Boden eingraben konnte. Er könne auf dem Land oder im Wasser leben. Eines Nachts habe Old Jack einen toten Goldzeisig vor der Hüttentür abgelegt. Ein Geschenk. Eine Warnung.
»Wegen Ansell, weil –?«, setzte ich an.
»Kein Wort mehr über Old Jack«, unterbrach uns Mama. »Er ist in seinem Schlafloch, wo er hingehört.«
Manchmal, in den langen Nächten, in denen Bruno seinen und meinen Schatten zu fressen versuchte, schlief ich schlecht. In diesen Nächten kam Mama mit einem Parfümflakon aus rot funkelndem Glas zu uns. Sie drückte auf den kleinen Pumpknopf und sprühte ein wenig über uns; es roch nach Holzrauch und Schutz und weit entfernten Orten. In anderen Nächten lauschte ich nach der Schindmähre, die durch die vom Frost knarzenden Bäume zog. Klippklapp, klippklapp, wo steigt er von der Mähre ab? Ich lauschte nach Old Jacks langen Nägeln, die an unserer Tür kratzten. Die ganze Nacht über hörte ich es vor dem Fenster schnaufen. Ich hörte etwas vorbeieilen, dann hörte ich nur noch die Nacht.
Dunkle Form entwuchs dem blauen Baumschatten
Es war einfach Pech, dass unser Campboss eine doppelseitige Lungenentzündung bekam, als das Wetter endlich besser wurde. Er musste in die Stadt gebracht werden, und das Unternehmen schickte Heeley O. Swicker als neuen Boss zu uns. Swicker war ein Gauner mit Schweinenacken und einem von Silber durchzogenen Bart um den kräftigen Unterkiefer. Er stolzierte durchs Camp mit dem Gang einer Katze. Manche behaupteten, er sei so gemein, dass er eine doppelte Reihe Zähne hätte. Nie ohne eine Zigarre im Mundwinkel. Meist umgab ihn eine stinkende Qualmwolke, und wenn er sprach, dann in einem merkwürdigen, schleppenden Tonfall, der ihn als jemanden von Draußen kennzeichnete.
Zu Beginn der neuen Saison gab das Unternehmen dem Boss das Geld, um das Camp zu betreiben, die Männer zu versorgen und Gewinn zu machen. Ein Campboss war vor allem mit denjenigen beschäftigt, die die Drecksarbeiten machten, stritt sich mit den Vorarbeitern, plante neue Wege zu den Fällplätzen und sorgte dafür, dass nichts aus dem Ruder lief und niemand zu lange einen Groll hegte. Doch als Swicker auftauchte, änderte sich das schnell. Er war ein Großmaul. Er hatte Ansichten. Am glücklichsten war er, wenn er über die Männer herziehen und jedermanns niedere Instinkte wecken konnte. Den Mi’kmaq war nicht zu trauen. Die Iren waren faul. Die Akadier durchtrieben mit Worten. Die Illegalen aus Maine mürrisch bei schlechtem Wetter. Und die Québécois nichts als widerwärtige Rosstäuscher. Er beklagte sich über jeden, dessen Muttersprache nicht Englisch war. Namen, die er nicht für englisch genug hielt, sprach er falsch aus. Er wusste, wer nicht lesen konnte, wer stotterte oder schüchtern war, und er legte Wert darauf, sie deswegen zu piesacken. Papa musste häufig Streitereien schlichten, denn die Männer merkten genau, wo Swicker einsparte – billigere Nahrungsmittel, höhere Tagesquoten, was die Arbeit gefährlicher machte, beengtere Quartiere. Einiges davon ließen sie ihm durchgehen, aber sie würden sich nicht ewig bis aufs Blut ausquetschen lassen, und sie sorgten dafür, dass Swicker es wusste.
Eines Nachmittags spielte ich draußen mit Bruno. Ich hatte einen Regenschirm – die meisten Rippen schon lange gebrochen und die schwarzen Flügel durchlöchert –, den Ivy und ich abwechselnd auf der Schulter kreisen ließen und damit durchs Camp stolzierten. Währenddessen machte Bruno einige rasante Drehungen, als würde er seinen eigenen Schwanz jagen wollen. Er schüttelte den Kopf hin und her, kräuselte die Oberlippe bis an die Nasenspitze hoch und griff uns ein paarmal zum Schein an, machte kehrt und verschwand in die entgegengesetzte Richtung. Schließlich schnappte er sich den Regenschirm, rollte sich zu einem Ball zusammen und kullerte den matschigen Hügel hinunter, bis er mit Schwung gegen die Hütte oder gegen mich krachte.
Nachdem er seinen Trick einige Male vollführt hatte, setzte Bruno sich unter eine große Pappel, und zwar so, dass seine dunkle Form dem blauen Schatten des Baums entwuchs. Ich ertappte Swicker dabei, wie er uns aus der Tür des Werkstattschuppens beobachtete. Die anderen Campbosse hatten uns all die Jahre in Frieden gelassen, solange Bruno sich benahm und in den kältesten Monaten in seiner Winterkiste blieb, doch der hier hatte andere Pläne.
»Na, mit dem ist ja nicht gut Kirschen essen, oder, Schätzchen?«, sagte er, als Bruno sich den Matsch aus den Ohren schüttelte.
Meine Kopfhaut spannte. Swicker war aalglatt und klang nach etwas, wofür ich noch keine Worte hatte, aber ich wusste, dass wir nicht mehr sicher waren. Meine kindliche Überzeugung, dass nichts sich verändern würde, war ein Irrtum: Der Rest unseres Lebens würde nicht einfach so weitergehen. Und noch während ich das dachte, brannte schon die Scham in mir. Wie ich da stand, sah ich zum ersten Mal, was er sah: eine zerlumpte Besitzlose, spindeldürr, mit einem kaputten Regenschirm, inmitten einer Wüstenei aus Unkraut, zertrampelter Erde, einem Haufen Baumstümpfe. Zum ersten Mal sah ich die Armut, die uns brandmarkte. Ich wusste, dass es gegen die Regeln verstieß, dennoch versuchte ich, Swickers Blick standzuhalten, doch dann kam eine Bö auf und ich musste mich abwenden. Als ich wieder hinschaute, war Swicker verschwunden.
Etwa eine Woche später, als er bei Black Sturgeon war und Telegramme an die Zentrale des Unternehmens schickte, sprach ihn ein Mann aus Boston an, der mit einer Tierschau herumzog. Der Mann hatte bei der Liederfängerin von Bruno gehört und im Saloon in der nächsten Stadt eine ungefähre Adresse von uns erhalten. Prompt bot er Swicker fünfzig Dollar für Bruno. Der schlug ein und zog die Hälfte der Summe in gebrauchten Scheinen zwischen den dicken Fingern des Mannes hervor. Allerdings versäumte es Swicker, uns von seiner Übereinkunft in Black Sturgeon zu informieren. Ein paar Tage später kam der Mann aus Boston mit einem Halsband ins Camp, das einem Setter gepasst hätte, und einer Möbelkiste, die hinter dem Sitz des Versorgungsschlittens rumpelte. Er trug einen schäbigen, schlechtwetterfarbigen Sonntagsanzug, stieg vom Trittbrett und strich die Falten glatt. Swicker klopfte dreimal an unsere Tür und unterbrach den Unterricht.
Aus Angst, wir könnten uns wieder erkälten, öffnete Mama die Tür nur einen Spalt. Das Camp war leer, auch Papa und Ansell waren fort. Sie waren auf Schneeschuhen zu den Fällplätzen gegangen, hatten einen Schlitten voller Essen gezogen und noch mehr davon in Kiepen bei sich getragen. Sie hatten schon früh aufbrechen müssen, um Feuer zu machen und alles aufzutauen.
Swickers Stimme klang rau, als er sagte: »Tut mir leid, aber der Bär kommt morgen weg, Eula.«
Mama sah ihn unverwandt an. Nach einer Weile sagte sie: »Mr. Swicker, es tut mir leid, aber dieser kleine Bär ist mir ans Herz gewachsen, den verkaufe ich Ihnen ebenso wenig wie eins meiner eigenen Kinder.«
Swicker schubste mit dem Schuh ein wenig Schnee weg. Widerspruch war er nicht gewohnt, und offensichtlich konnte er nicht mit Frauen umgehen. »Also, ein Holzfällercamp ist doch kein Ort für einen verfluchten Bären.«
Bruno, der neugierig war, wer zu Besuch kam, hatte sich aus seiner Dynamitkiste herausgearbeitet und schleppte sein Hirschfell zur Tür. Bruno war klein für einen Schwarzbären – eher ein Schäferhund als ein Bär. Er versteckte sich hinter Mamas Bein und lehnte sich an, bis ihr Knie fast nachgab. Dann knabberte er am Saum ihrer Schürze und drückte seine Schnauze in ihre rissige Handfläche.
Der Mann aus Boston räusperte sich. »Ich dachte, die Sache ist abgemacht, Swicker.«
»Klar ist sie das«, entgegnete der und spuckte auf einen sauberen Flecken Schnee unter unserem kleinen Fenster. Er wischte sich mit dem Handrücken über den Bart, dann hakte er blitzschnell seine Finger unter Brunos Lederhalsband und riss Bruno zu sich. »Gib ihn schon her!«
Mama baute sich vor der Tür auf und umklammerte Bruno mit ihren dünnen Armen, bis er anfing zu quieken und sich in ihr Hauskleid verkrallte. »Diesen Bären kriegen Sie nicht!«, sagte Mama. »Das haben Sie gar nicht zu entscheiden.«
Swickers krumme Nase war rot vor Kälte, sein Atem dampfte, und nun widersetzte sich ihm auch noch diese dürre Frau in einem verblichenen Kleid und einer zerschlissenen Strickjacke. Er streckte die Pranken aus, packte Bruno und zerrte ihn aus Mamas Armen. Dann geschah alles ganz schnell. In seiner Panik holte Bruno nach Swickers Gesicht aus und zog ihm fünf scharfe Linien über die Wange.
»Verflucht noch mal!«, zischte Swicker.
Krähen flatterten von einer kahlen Esche auf und färbten den Himmel dunkel. Swicker fuhr sich über die blutige Wange. Seine Augen wirkten tief vor Schmerz.
Mama nahm ihre Halskette mit dem Doppelhorn ab und gab es Swicker. »Nehmen Sie das hier, und lassen Sie mir meinen kleinen Bären, Mr. Swicker. Bitte.«
Die halbe Rundung des Bands schwang in Swickers Hand und reflektierte das Licht. Er fuhr mit dem Finger über den strahlenden Halbkreis und ließ den Schmuck dann in die Brusttasche plumpsen, wo er seine Zigarren aufbewahrte.
»Danke. Aber der da muss trotzdem weg.« Mit einem fiesen Grinsen riss er Bruno von Mama fort, und Bruno schrie wieder.
Gerade noch rechtzeitig kamen Papa und Ansell zurück. Sie waren fertig mit der Essensausgabe und wunderten sich, was der ganze Lärm sollte. Mama weinte und flehte Swicker an, uns in Ruhe zu lassen. Bruno tobte, als würde man ihn in Stücke reißen. Seine langen Krallen suchten Halt und kratzten an Mamas Schlüsselbeinen.
Papa schob sich zwischen Mama und Swicker. Er hielt Bruno rittlings zwischen seinen Knien fest. »Warum willst du unseren Bären stehlen, Swicker?«
Da ließ sich der Mann aus Boston vernehmen, sprach erst von den fünfundzwanzig Dollar, der Hälfte der versprochenen Summe für den Bären. Er wies auf den Schlitten und erinnerte alle daran, welche Mühe er auf sich genommen hatte, um ins Camp zu kommen, zu dieser Jahreszeit ein ungeheuer gefährliches Unterfangen. Alles, was er wolle, sagte er, sei, den Bären mitzunehmen und wieder zu verschwinden.
»Stimmt das alles, Swicker?«, fragte Papa. Bruno war an Papas Beinen ruhig geworden und leckte sich eine Vorderpfote, die er sich bei dem Streit verletzt hatte.
Swicker sah Bruno an, als handle es sich bei dem Bären um das Schlimmste, was ihm seit Langem begegnet war. »Der Bär ist verkauft. Das Wetter wird stürmisch, der Mann bleibt heute Nacht hier und nimmt das Vieh da morgen mit. Sperr es solange in die Baracke.« Dann spuckte er einen klebrigen, tabakbraunen Batzen in den Schnee.
Mama trat zu Papa. »Das ist nicht recht, Swicker. Das ist mein Bär!«
Papa schaute zwischen den beiden hin und her. Er würde in jedem Camp Arbeit finden, aber nicht alle Campbosse wären mit einer Frau, zwei Kindern und einem kleinen Schwarzbären einverstanden. Also traf er eine Entscheidung. Er hielt den Mund, sah Mama an und übergab Bruno an Swicker.
»Ein abgekartetes Spiel, hm, Swicker?« Auch Papa spuckte in den Schnee. »Hat sich noch immer gelohnt. Bring ihn doch selber in die Baracke«, sagte er und drehte sich zu Mama um. Ich stand mit Ivy Hand in Hand da, während mein Zwillingsbruder an diesen Mann übergeben wurde, der über unser Leben herrschte. Ich machte meinem Zorn Luft, schob mich an allen vorbei, starrte Swicker wütend ins dumpfe, runde Gesicht und sagte: »Wenn Sie meinen Bruder mitnehmen, bringe ich Sie um.«
Swicker und der Mann aus Boston lachten. »Na, das ist mir ja eine kleine Wilde«, sagte Swicker.
Papa führte mich in die Hütte, wo ich immer noch fauchte.
Swicker zerrte Bruno, der kreischte und spuckte, zur Schlafbaracke hinüber. Er schlug die Tür hinter ihm zu und sperrte sie ab. Bruno kratzte mit seinen Krallen an der Tür, kam aber nicht tief genug, um entkommen zu können. Swicker und der Mann aus Boston waren noch nicht allzu weit weg, als Bruno ausrastete. Wenn er aufgeregt war, biss er sich zur Beruhigung meist in eine Pfote. Das hatte er wohl auch in der Baracke versucht, aber ohne Erfolg, und nun tobte er noch mehr; er schleuderte sich durch den Raum und warf Töpfe und Klafterholz um. Ich musste so sehr weinen, dass ich das Gefühl hatte, ich würde in einem Kopfschmerz hausen. Den ganzen Tag ging das mit Bruno so, nur manchmal bellte er trocken und lauschte und wartete darauf, dass Mama ihn holte. Doch die blieb in der Hütte und betrauerte den Verlust ihres kleinen Bären.
Mama behielt uns den ganzen Nachmittag über in ihrer Nähe. Aber die Stunden müssen sich angefühlt haben, als löse sich ihr Herz vom Körper ab – Stich für Stich. Ivy rieb ihr Gänseschmalz auf die Stellen, an denen Bruno sie verletzt hatte, an den Schultern und am Hals, der nun ohne Grandma Slaywrocks Doppelhornkette nackt wirkte. Mamas Tränen durchnässten ihr Kleid auf den Oberschenkeln, bis die Haut um ihre Augen violett und wund war.





























