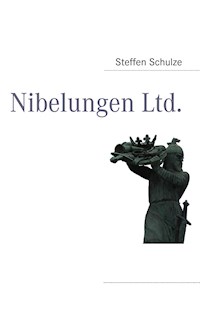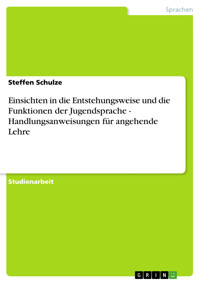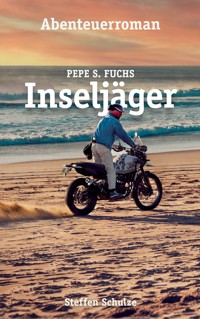
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein gemeinsamer Urlaub auf den Seychellen. Die Chance für Kommissarin Beate Jäger und den Militärpolizisten Pepe S. Fuchs, endlich ihren Beziehungsstatus zu klären. Doch die Reise steht unter keinem guten Stern. Erst wird Pepe als Leibwächter seines Erzfeindes nach Istanbul abkommandiert. Den Einsatz überlebt er nur knapp. Dann geraten er und Beate im vermeintlichen Inselparadies in einen blutigen Machtkampf. Die Regierung, ein ominöser Religionsführer, Rebellen und skrupellose fremde Mächte kämpfen um die Vorherrschaft. Als auch noch ein verheerender Sturm aufzieht, scheinen nicht nur die Inseln dem Untergang geweiht zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pepe S. Fuchs – Inseljäger: Ein gemeinsamer Urlaub auf den Seychellen. Die Chance für Kommissarin Beate Jäger und den Militärpolizisten Pepe S. Fuchs, endlich ihren Beziehungsstatus zu klären. Doch die Reise steht unter keinem guten Stern.
Erst wird Pepe als Leibwächter seines Erzfeindes nach Istanbul abkommandiert. Den Einsatz überlebt er nur knapp. Dann geraten er und Beate im vermeintlichen Inselparadies in einen blutigen Machtkampf. Die Regierung, ein ominöser Religionsführer, Rebellen und skrupellose fremde Mächte kämpfen um die Vorherrschaft. Als auch noch ein verheerender Sturm aufzieht, scheinen nicht nur die Inseln dem Untergang geweiht zu sein.
Steffen Schulze ist gebürtiger Niederlausitzer, der seit 2000 im Thüringischen Eisenach wohnt. Bücher schreibt er aus Leidenschaft in seiner Freizeit. Dabei bezeichnet er seine Werke eher als Abenteuergeschichten, denn als Krimis oder Thriller.
»Ich schreibe praktisch seit der Schulzeit, zuerst nur für die Schublade. 2007 bin ich dann auf den Selfpublishing-Verlag Books on Demand aufmerksam geworden und habe mich getraut, Im Bann des Jonastal und somit meine Version über den Sinn und Zweck der geheimen, unterirdischen Anlagen und Tunnel nahe Arnstadt zu veröffentlichen.
Für Der Motorradpfarrer und die Millionenbeichte fand ich sieben Jahre später mit dem Highlights Verlag erstmals einen professionellen Partner. Da sich der Highlights Verlag auf Motorrad-Krimis spezialisiert hatte, brauchte ich anschließend für meine Reihe um den Militärpolizisten Pepe S. Fuchs ein neues Verlagshaus. Das fand ich mit dem Principal Verlag 2016 und mein Feldjäger Pepe bekam eine neue Heimat. Seitdem ist er immer wieder auf der Jagd nach Dieben, Mördern, feindlichen Agenten, Hexen und Motorradrockern.
Solange es mir Freude macht und die Schreiberei nicht in Stress ausartet, mache ich einfach weiter, denn Ideen habe ich noch genug...«
Für die beste Ehefrau von allen!
Ein großes Dankeschön an die aufmerksamen Testleser und Testleserinnen: Kugelschrauber-Petra, Gepäck-André und Uboot-Maik!
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Allein. Er war allein unterwegs. Völlig unbeabsichtigt. Und mit einem beklemmenden Gefühl. Die Gruppe hatte er schon seit geraumer Zeit aus den Augen verloren. Aus Unachtsamkeit. Er hatte nicht aufgepasst. So etwas war ihm noch nie passiert. Im Gegenteil. Wenn andere, denen dieser Fehler unterlaufen war, für immer verschwunden geblieben waren, hatte er dafür kein Mitleid gehabt. Und nun war er es, der sich nur noch auf sich selbst verlassen konnte. Dabei wusste er, dass die Gruppe auf niemanden wartete, dass wegen einem Einzelnen die Gemeinschaft nicht in Gefahr gebracht wurde. Dieses eiserne, ungeschriebene Gesetz wurde von allen respektiert. Selbst schuld, wenn man nicht aufpasste. Er konnte nicht sagen, wie es dazu gekommen war, dass er den Anschluss verloren hatte. In einem Moment war er Teil der Gruppe, im nächsten schon nicht mehr.
Mit seinen zwei Metern Größe und seiner Fitness musste er sich eigentlich keine Sorgen machen. Eigentlich. Uneigentlich waren es gewalttätige Zeiten. Überfälle, Mord und Totschlag waren eher die Regel als die Ausnahme. Zu allem Überfluss lud sein Äußeres auch nicht gerade zum Freundlichsein ein. Die spitzen, eng stehenden Zähne und die hervortretenden Augen verliehen ihm nur ein eher wenig Sympathie vermittelndes Aussehen. Das war nicht seine Schuld. Aber er musste damit leben.
Seit etlichen Minuten schon hörte er Geräusche hinter sich. Verfolgte ihn jemand? Er lauschte, sein Puls ging hoch. Da war doch was!
Bloß nicht umdrehen. Das war ein Zeichen von Schwäche, offenbarte die gefühlte Angst. Richtung und Geschwindigkeit beibehalten. Sich normal verhalten. Aber was war in dieser feindlichen Umgebung, in diesen gewalttätigen Zeiten schon normal? Sein Herz schlug jetzt rasend schnell. Er bekam seine Gedanken kaum noch geordnet. Der Fluchtimpuls übernahm. Er beschleunigte, gegen besseres Wissen. Hastig, konfus. Alle paar Sekunden schlug er einen Haken, wurde unvermittelt wieder langsamer, blieb fast stehen. Ganz sicher, da war jemand. Sein Verfolger schien ein geübter Jäger zu sein. Und ein geduldiger. Er zeigte sich nicht. Noch nicht. Oder waren es mehrere? Nur einem Angreifer die Stirn zu bieten, war schon schwer genug. Mehr als drei würden sein sicheres Todesurteil sein. Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass er von einem Einzelgänger verfolgt wurde? Verschwindend gering. Wenn ein Angreifer auf Begleiter verzichtete, dann konnte er sich seiner Sache mit Recht sicher sein. Oder er war sehr dumm. Doch die Dummen überlebten nicht lange.
Wo waren nur die anderen? Wodurch hatte er sie denn eigentlich verloren? Nur ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, der fatale, der tödliche Folgen haben konnte. In der Gruppe war er relativ sicher. Allein hatte er kaum eine Chance. Selbst wenn er seinem direkten Verfolger entkommen konnte, gab es unzählige andere, die nur zu gern dessen Platz einnahmen.
Seine Sicht verschwamm, der Pulsschlag wurde heftiger. Die Bedrohung war noch nicht zu sehen, aber deutlich zu spüren. Sein Blut begann zu kochen, vibrierte durch seinen Körper wie Öl in einer Hochdruckleitung. Allmählich wurde es auch dunkler. Und kälter. Nicht mehr lange und auch der letzte Lichtschimmer würde von der unwirtlichen Umgebung aufgesogen werden. Dann gab es keinen Schutz mehr.
Sein Verfolger war jetzt ganz nah, zog enger werdende Kreise um ihn, außerhalb seines Sichtfeldes. Von überall hörte er ihn. Selbst sein eigenes dämonenhaftes Aussehen, seine hässliche Fratze schreckte den Angreifer nicht ab. Sein weit vorstehendes Rostrum, eine Verlängerung des Schädelknochens und Markenzeichen der Stachelhaie, ließ ihn missgebildet und extrem hinterhältig erscheinen. Was gewöhnlich ausreichte, um Gegner zu vertreiben. Nicht jedoch dieses Mal.
Der Angriff kam wie aus dem Nichts. Brutal, gnadenlos, tödlich. Er konnte hören, wie sein Hirnschädel unter dem ungeheuren Druck des zahnbewehrten Kiefers zerbarst. Wie kleine, lange Spikes bohrten sich Haizähne in ihn hinein. Dann wurde es für immer dunkel. Ein Zahn des Killers hielt nicht Stand, zersplitterte in kleine Stücke. Wie in einer Schneekugel stoben die Zahnbeinpartikel durch den aufgewirbelten Ozean und mischten sich mit Blut und Geweberesten. Langsam entfernte sich das größte Zahnstück von dem sich im Fressrausch windenden Angreifer. Es trudelte dem Ozeanboden zweitausend Meter tiefer entgegen. Schon auf dem Weg nach unten begannen die ersten chemischen Reaktionen. Im Wasser gelöstes Vernadit, ein hauptsächlich aus Mangan und Sauerstoff bestehendem Mineral, lagerte sich an den Zahn an und baute einen festen Panzer um ihn herum. Der Klumpen setzte sanft auf dem Meeresboden auf, mitten in einem unendlichen Feld gleicher Gebilde. Dort blieb er für die nächsten hundert Millionen Jahre liegen.
2
»Er kommt nicht. Ich habe es dir ja gleich gesagt. Er hat kalte Füße gekriegt. Der geht nie und nimmer eine feste Beziehung ein! Dazu ist er nicht geschaffen.«
»Doch! Er kommt!«, antwortete Beate Jäger und verschränkte die Arme vor der Brust.«
»Versuch ihn noch mal anzurufen!«
»Ach, das mache ich doch nicht alle paar Minuten.«
Manchmal konnte sie ihre ältere Schwester Carola glatt auf den Mond schießen. Jetzt zum Beispiel. Wenn da nur nicht der nagende Zweifel gewesen wäre, die quälende Ungewissheit, denn tief in ihrem Inneren war Beate nicht halb so davon überzeugt, dass Pepe S. Fuchs am Abfluggate erscheinen würde, wie sie ihrer Schwester gegenüber tat. Ja, er hatte es hoch und heilig versprochen. Zwar hatten sie sich eine gute Woche lang nicht gesprochen oder geschrieben, aber das war in ihrer Beziehung nicht ungewöhnlich. Abflugtag und -zeit standen fest. Da hatte es nichts weiter zu besprechen gegeben. Also wo blieb der Kerl? Hatte Pepe tatsächlich kalte Füße bekommen? Ein wenig konnte Beate das nachvollziehen, denn eigentlich war der gesamte Urlaub eine blödsinnige Idee gewesen. Zwei Wochen tagtäglich mit ihrer Familie zusammen zu sein, das würde eine ganz neue Erfahrung für Beate werden. Sie lebte allein und traf sich nur ab und zu unverbindlich mit Pepe. Oder mit anderen, wenn ihr danach war. Ihr Job als Kriminalkommissarin ließ ohnehin keine richtige Beziehung zu. Das redete sie sich jedenfalls ein. Und der Kollegenkreis schien ihr recht zu geben. Die wenigsten waren glücklich verheiratet. Etliche hatten schmerzhafte Trennungen hinter sich, unter denen nicht nur die Kinder, sondern auch die Bankkonten der Beteiligten gelitten hatten. Häuser und Autos waren verkauft und Besuchsregeln aufgestellt worden. Das wollte sich Beate nicht antun. Sie war zufrieden mit ihrem Leben, so wie es war. Oder etwa nicht? Geistesabwesend kaute sie auf ihrer Unterlippe – bis sie Blut schmeckte.
»Na klar kommt Onkel Pepe mit! Er hat es doch versprochen!«
Natürlich musste Angelika ihren Senf dazugeben. Beates elfjährige Nichte hatte eigentlich immer das letzte Wort und zu allem etwas zu sagen. Ihre neunmalkluge Art konnte einem gehörig auf den Wecker gehen. Trotzdem würde Beate für sie durchs Feuer gehen. Und Pepe auch. Faktisch hatten sie das bereits getan. Als die Kleine und ihre Eltern in Südfrankreich in Schwierigkeiten geraten waren. Wenn Pepe und sie nicht zu Hilfe geeilt wären, hätte dieser Urlaub böse geendet. Das wussten alle. Ohne groß darüber zu reden. Die gemeinsame Reise auf die Seychellen war auch ein Dankeschön dafür. Ein großzügiges dazu. Obwohl sie die Mittel dafür ebenfalls dem Frankreichabenteuer zu verdanken hatten.
Angelika kam zu Beate herübergelaufen. Ihre Zöpfe wippten bei jedem Schritt auf und ab. Sie hüpfte auf Beates Schoß, nahm sie in den Arm und drückte sie ganz fest. Also glaubte selbst die kleine Göre nicht, dass Pepe auftauchen würde. Na, prima. Beate schluckte, als müsste sie mühsam etwas herunterschlucken.
»Frank, musst du schon wieder Bier trinken? Du hast gesagt, du willst dir ein Kreuzworträtselheft kaufen. Dafür hast du doch extra deinen teuren Kugelschreiber mitgenommen.«
Beate war froh, dass Frank nun die Aufmerksamkeit ihrer Schwester auf sich zog. Der Arme hatte es auch nicht leicht. Er lehnte sich in seinem Hawaiihemd, den kurzen Hosen, den ausgeleierten Sandalen und der frisch geöffneten Dose ans Schaufenster und wischte sich mit dem Unterarm Schaum vom Mund.
»Ich muss nicht. Aber ich will«, antwortete er, legte den Kopf in den Nacken und setzte die Büchse erneut an, um drei tiefe Schlucke hintereinander zu nehmen. »Schließlich habe ich Urlaub. Das Kreuzworträtsel läuft nicht weg. Das mach ich am Strand. Und du bist einfach nur neidisch auf meinen Drehgriffel aus Aluminium und Messing. Vielleicht versuchst du es auch mal mit Entspanntheit und Ruhe.«
Das letzte Wort ging in einem gewaltigen Rülpser unter.
»Mann, Dad, jetzt hör auf! Mit dir kann man aber auch nicht weggehen!«, schloss sich Angelika der Tirade ihrer Mutter an und sprang von Beate herunter.
Frank winkte nur ab und ließ sich auf den freien Sitz neben Beate fallen. Fast hatte sie befürchtet, dass er den Platz seiner Tochter auf ihrem Schoß hatte einnehmen wollen. Er beugte sich weit zu ihr herüber.
»Er kommt schon noch, dein Lover.«
Der Ausdruck »Lover« ließ Beate das Gesicht verziehen. Und Franks feuchter Bieratem. Sie stand auf, wischte sich die Finger an ihrer Jeans ab und sagte knapp: »Ich geh mal auf die Toilette.«
»Händewaschen nicht vergessen!«, rief Frank ihr laut hinterher. Dann setzte er grinsend die Bierbüchse erneut an.
Der Sanitärbereich des Flughafens machte einen schmuddeligen Eindruck. Er war nicht wirklich dreckig, aber grau und trostlos. Von hunderttausenden, wenn nicht Millionen Passagieren abgenutzt. Als ob jeder, der die Toilette benutzte, ein Quäntchen Farbe mitnahm. Es roch beißend nach Desinfektionsmitteln mit einer starken Note Urin. Und Erbrochenem. Beate hatte gelesen, dass etwa sechzig Millionen Fluggäste jedes Jahr hier durchgeschleust wurden. Das waren über 160.000 pro Tag. Und jeder von ihnen musste aufs Klo. Mindestens einmal pro Aufenthalt. Ein leichter Schauder durchlief Beate. Sie gab sich peinlichst Mühe, nicht mehr zu berühren als unbedingt nötig. Ein Blick in den trüben Spiegel ließ sie kurz innehalten. Warum war Pepe noch nicht hier? Hatte er sie über? Kaum vorstellbar. Sie war ein echter Volltreffer. Für Mitte dreißig war sie verdammt gut in Form. Fast alles war noch straff und faltenfrei. Beate legte ihre Hände an die Wangen, zog die Haut zurück und beugte sich weit nach vorn zum Spiegel, so dass ihn ihre Nasenspitze beinahe berührte. Als nächstes streckte sie ihre Brüste vor, stupste erst die eine, dann die andere an und sah zufrieden zu, wie sie auf ihre ursprüngliche Position zurückwippten. Auch ihr Hintern konnte sich sehen lassen. Mit einer Drehung, auf die eine balinesische Tempeltänzerin stolz gewesen wäre, betrachtete sie ihre Kehrseite im Spiegel.
Oder war sie Pepe zu viel ausgewichen? Mehr als einmal hatte sie gespürt, dass der Oberfeldwebel eventuell etwas mehr wollte als die gelegentlichen Treffen. Beate strich sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht. Ihre kurzen Haare sahen mal wieder so aus, als wäre sie eben erst aus dem Bett gestiegen. Nach einem verschwitzten Alptraum. Oder heißem Sex. In der Richtung konnte sie sich bei Pepe nicht beklagen. Wenn der richtig in Fahrt kam, dann gab es kein Halten mehr. Und sonst? Man konnte ihm blind vertrauen. Wenn es hart auf hart kam, dann konnte sich Beate keinen Besseren an ihrer Seite vorstellen. Als Militärpolizist hatte er eine ähnliche Ausbildung wie Beate durchlaufen. Wenn sie einen Fall diskutierten, dann wussten sie sofort, worüber der andere redete. Eigentlich war er der perfekte Partner. Nur, warum war er noch nicht hier? Na warte! Als ob sie auf einen Boxsack eindrosch, schoss Beates rechte Hand in ihre Umhängetasche. Im dritten Anlauf erwischte sie ihr Handy. Genauso viele Versuche benötigte sie, um Pepes Nummer zu wählen. Er ging nicht ran.
»Mistkerl!«, sagte sie laut und stopfte das Telefon zurück in die Tasche. Dann betrat sie die nächste freie Kabine und schlug die Tür hinter sich zu. Plötzlich fiel alle Wut von ihr ab. Sie setzte sich auf den geschlossenen Klodeckel und starrte an die Tür. Ihre Schultern fielen nach unten und sie fing an zu weinen.
»Was ist denn mit dir? Hast du geheult?«
Am liebsten wäre Beate nach dieser Begrüßung wieder umgekehrt. Dabei hatte sie sich genau im Spiegel studiert und ihre rotgeweinten Augen weggeblinzelt.
»Halt die Klappe«, antwortete sie stattdessen und nahm Frank die Bierbüchse weg. Es schien schon die zweite zu sein, so voll, wie sie noch war. Gerade richtig. Beate trank gierig, verschluckte sich halb, musste husten. Ein Rinnsal lief ihr Kinn hinunter. Das war ihr egal. Mit dem Ärmel wischte sie sich das Bier vom Kinn und setzte die Büchse erneut an. Bis sie leer war.
Zwanzig Minuten später wurde ihr Flug zum Boarding aufgerufen. Alle sprangen auf und suchten ihre Handgepäckstücke zusammen. Die Schlange vor dem Schalter war keine. Eher ein Schlangennest. Die Leute standen dicht gedrängt in einem Haufen, um ja nicht auf dem Flughafen zurückgelassen zu werden. Keine Spur von Pepe. Beate blieb demonstrativ sitzen. Sie hatte das Bier etwas zu schnell getrunken und fühlte, wie sie müde wurde. Frank neben ihr zappelte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie er immer wieder zu Carola hinübersah. Und dass die mit den Schultern zuckte. Angelika war längst auf den Beinen. Sie hatte sich ihren pinken Rucksack umgeschnallt und lief aufgeregt hin und her. Als nur noch drei Leute vor dem Boarding-Schalter standen, erhob sich auch Carola. Langsam kam sie auf Beate zu. Die riss mit fahrigen Fingern ihre Handtasche auf und kramte erneut ihr Handy hervor. Sie brauchte eine Ewigkeit, um das Display zu entsperren. Dann drückte sie die Schnellwahltaste und wartete. Pepe ging wieder nicht ran.
»Beatchen. Vergiss ihn. Lass uns einsteigen. Sonst fliegen die noch ohne uns«, sagte Carola leise.
Fast hätte Beate etwas erwidert, was ihr hinterher sicher leidgetan hätte. Ein ausgesprochenes Wort konnte man nicht mehr zurücknehmen. Auch wenn man sich noch so sehr dafür entschuldigte, würde es nicht einfach aus dem Gedächtnis des Gegenübers verschwinden. Besonders nicht aus dem von Carola. Trotzdem. Sie hasste den Namen Beatchen.
»Lass mich in Ruhe«, antwortete sie tonlos und schluckte das, was ihr wirklich auf der Zunge lag, herunter. Dann stand sie auf, atmete tief durch und trottete hinter ihrer Schwester her.
Im Flugzeug saß sie neben Angelika. Sie überließ der Kleinen den Fensterplatz. Angie war zappelig und neugierig, schaute sich alle Prospekte interessiert an, blies die Kotztüte auf und tippte sich routiniert durch das Multimediasystem. Dabei plapperte sie unaufhörlich. Beate hörte nicht zu. Sie nickte ab und zu oder gab einen unbestimmten Brummlaut von sich. Und sie drehte sich alle naselang um. Stierte den Gang hinunter, hoffte wider besseren Wissens, dass Pepe lächelnd den Gang entlanggehastet kam und sich für seine Verspätung entschuldigte. Tat er nicht. Als das Flugzeug losrollte, beugte sich Beate über ihre Nichte und starrte aus dem Fenster. Kam er über das Flugfeld gerannt, wild mit den Armen fuchtelnd? Nein, kam er nicht.
Als sie in der Luft waren, bestellte sich Beate einen Tomatensaft. Und einen Wodka. Und dann noch einen. Und einen dritten hinterher.
»Tante Bea, du schnarchst!«
»Was? Wer? Ich?«
Im ersten Moment wusste Beate nicht, wo sie war und wer mit ihr redete. Anscheinend hatte der Tomatensaft auf zehntausend Meter Höhe eine stärkere Wirkung als auf dem Erdboden.
»Wir sind gleich da. Und dir läuft ein Spuckefaden aus dem Mund«, deutete Angelika auf ihren eigenen Mundwinkel. »Das ist total ekelig!«
Schnell wischte sich Beate mit der Schulter über die Lippen. Die fühlten sich heiß und angeschwollen an.
»Wir landen jeden Moment, Tante Bea. Du hast fast den ganzen Flug verschlafen.«
Wirklich? Hatte sie nicht nur kurz gedöst? Beate riss die Augen weit auf, kniff sie wieder zusammen, um sie aber sofort wieder zu öffnen. Dann musste sie herzhaft gähnen, was ihr ein saftiges Knacken im Innenohr einbrachte.
»Ich war auf der Toilette. Das ist schon ein bisschen gruselig«, plapperte Angelika weiter. »Anstehen musste ich auch. Alle Klos waren besetzt. Und stell dir vor, aus dem einen kamen gleich zwei Leute raus. Weißt du, was der Mile High für ein Club ist? Die haben gesagt, dass sie da jetzt Mitglied wären. Und laut gelacht.«
»Äh, also, naja …«
Beate wurde rot und sah sich hilfesuchend nach Carola und Frank um. Die waren nirgends zu sehen. Nicht, dass die zwei auch gerade dem Club beitraten. Beate biss sich auf die Zunge, um nicht laut loszulachen. Angelika sah sie immer noch mit großen fragenden Augen an.
»Okay. Wenn sich zwei Menschen ganz doll liebhaben«, begann sie stotternd. »So wie deine Mama und dein Papa. Dann küssen sie sich. Und streicheln sich. Und so weiter. Und wenn sie das in einem Flugzeug machen, dann sagt man, dass sie dem Mile-High-Club beigetreten sind.«
Beate redete immer schneller und war froh, als endlich alles heraus war.
»Na, das glaube ich nicht«, entgegnete Angelika und ließ sich schwer in ihren Sitz fallen. »Aus der Toilette kamen nämlich zwei Männer.«
Das Ertönen des Anschnallzeichens erlöste Beate.
3
Oberfeldwebel Pepe S. Fuchs hatte gleich ein ungutes Gefühl, als ihn Major Frankfurt in sein Büro zitierte. Mittlerweile hatte Pepe feine Antennen für die Stimmungen des Alten entwickelt. Die hatten sich seit seinem Mali-Einsatz, der beinahe in einer Katastrophe geendet hätte, nur noch stärker ausgebildet.
Pepe stutzte. Die Tür zum Büro des Majors war geschlossen. Das war sie sonst nie. Im Gegenteil. Frankfurt prahlte damit, dass er immer ein offenes Ohr für seine Untergebenen habe und die ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit aufsuchen könnten. Nur heute nicht. Pepe strich sich mit der rechten Hand über seine Glatze, atmete tief durch und klopfte. Fünf Sekunden lang passierte nichts. Was ebenfalls ungewöhnlich war. Schon hob er die Hand, um erneut, dieses Mal energischer, anzuklopfen, als ein scharfes »Herein!« ertönte. Das war doch nicht die Stimme von Frankfurt? Pepe drückte die Klinke herunter, öffnete die Tür und blieb sofort verdutzt stehen. Automatisch zuckte seine rechte Hand an die Stelle, an der sich normalerweise sein Pistolenhalfter befand. Er griff ins Leere. Glücklicherweise. Hätte er eine Handfeuerwaffe getragen, wäre er mit gezogener Pistole eingetreten und hätte wahrscheinlich geschossen. Denn nicht nur Major Frankfurt hatte sich bei Pepes Eintreten von seinem Stuhl erhoben, auch Oberbootsmann Candy Schulze war aufgestanden. Nur kurz. So, dass es nicht wie eine offene Beleidigung wirkte und trotzdem Geringschätzung ausdrückte. Mit Schulze verband Pepe eine weit zurückreichende, intensive Feindschaft. Zum ersten Mal war er in Afghanistan auf den Agenten des Militärischen Abschirmdienstes, des Geheimdienstes der Bundeswehr getroffen.
Schulze war damals ein junger, unerfahrener, aber über alle Maßen ehrgeiziger Unteroffizier gewesen, dem die Karriere über alles ging, selbst über die sprichwörtlichen Leichen. So auch bei einem gemeinsamen Einsatz im Hinterland des Hindukusch, der katastrophal aus dem Ruder gelaufen war. Pepe litt noch immer unter den Nachwehen. Die permanenten Schmerzen in seinem Oberschenkel erinnerten ihn allerdings auch daran, was für ein Glück er gehabt hatte. Während er mit einer schlecht verheilten Schusswunde davongekommen war, hatten zwei seiner Kameraden ihr Leben verloren. Und alles, weil Schulze den Einsatz schlecht vorbereitet und zwielichtigen Quellen vertraut hatte.
Nach dem Afghanistaneinsatz hatten sich ihre Wege noch mehrmals gekreuzt. Und jedes Mal hatte Schulze eine äußerst undurchsichtige Rolle gespielt. Auch zuletzt in Mali.
»Fuchs! Kommen Sie rein und setzen Sie sich«, sagte Frankfurt übertrieben fröhlich. Das Lächeln in seinem Gesicht hätte auch einer Werbefigur für Zahnpasta gut gestanden.
»Ich muss Sie ja nicht vorstellen.«
Nein, das musste er bei Gott nicht.
Schulze und Frankfurt hatten längst wieder Platz genommen, während Pepe noch immer in der Tür stand. Am liebsten hätte er auf dem Absatz kehrtgemacht. Doch er riss sich zusammen. Langsam, jede Bewegung mit Bedacht ausführend, schloss er die Tür hinter sich. Dann ging er in gleichem Tempo zu dem zweiten noch freien Stuhl, der gegenüber Frankfurts Schreibtisch stand, und setzte sich, Schulze lediglich einen flüchtigen Blick zuwerfend.
Major Frankfurt hatte seine großen Hände schulterbreit vor sich auf der Tischplatte liegen. Dazwischen lag eine einsame geschlossene Aktenmappe. Die Beschriftung auf dem Kopf stehend konnte Pepe nicht lesen. Den Stempel STRENG GEHEIM schon. Ansonsten war der Schreibtisch des Alten wie üblich penibel aufgeräumt. Keine persönlichen Gegenstände. Neben dem Telefon, auf dem eine hektisch blinkende Lampe einen entgangenen Anruf anzeigte, stand eine Tasse als Stifthalter. »Keine Panik! Wenn du den Schuss gehört hast, warst du nicht das Ziel!«, war darauf zu lesen. Scharfschützenhumor.
»Fuchs«, setzte Frankfurt an, musste sich aber sofort räuspern. Kurz verschwand sein falsches Lächeln, um sofort wieder von Ohr zu Ohr zu reichen. Es sah verdächtig nach einem Gesichtsmuskelkrampf aus. »Herr Oberfeldwebel, was sind die Aufgaben der Feldjäger der Bundeswehr?«
Was war das denn für eine Frage? Pepe überlegte krampfhaft, ob er den Major in letzter Zeit irgendwie verärgert haben könnte. Seit seiner Rückkehr aus Mali hatte er sich die größte Mühe gegeben, unter dem Radar zu bleiben. Direkt, nachdem sein Krankenschein abgelaufen war, hatte er Urlaub eingereicht. Den hatte Frankfurt auch nur allzu gern bewilligt. Eigentlich war Pepe im Moment außer Dienst. In vier Tagen ging sein Flieger auf die Seychellen. Sein erster gemeinsamer Urlaub mit Beate. Den wollte Frankfurt ja wohl nicht wieder streichen. Aber solche Kleinigkeiten zählten für den Major nicht, wenn die Lage ernst war. Und anscheinend war sie sehr ernst, sonst würde er nicht dieses süffisante Dauergrinsen im Gesicht tragen. Außerdem wäre auch Schulze sonst nicht hier. Der Oberbootsmann saß wie eine Statue neben Pepe und zeigte keinerlei Regung. Er schaute hinter Frankfurt aus dem Fenster, als wäre die gegenüberliegende Kasernenfassade das Interessanteste, das er seit Jahren zu sehen bekommen hatte. Bei Pepes kurzem Blick auf ihn, hatte er festgestellt, dass Schulze der Afrikaaufenthalt ebenfalls nicht gut bekommen war. Sein Gesicht wirkte grau, die Augen eingefallen. Außerdem schienen die Geheimratsecken größer geworden zu sein. Genau wie sein Bauchumfang.
Jetzt klopften Frankfurts zehn Finger nacheinander auf den Tisch. Als würde er ein kompliziertes Klavierstück anstimmen. Aus seinen Gedanken gerissen, antwortete Pepe daraufhin zackig: »Die Aufgaben der Feldjäger reichen vom militärischen Verkehrsdienst über Personenschutz und Zugriffsdurchsuchungen bis hin zum Einsatz von Sprengstoff-und Drogenspürhunden. Die Feldjäger unterstützen die Aufklärung von Straftaten gegen die Bundeswehr und sichern Großschadensereignisse wie Abstürze militärischer Luftfahrzeuge ab – all dies weltweit, also überall, wo die Bundeswehr im Einsatz ist.«
Die Frage wurde Pepe nicht zum ersten Mal gestellt. Vor allem der Zivilbevölkerung war nicht klar, dass die Bundeswehr eine eigene Polizeieinheit unterhielt und was deren Aufgabe war. Daher hatte er den offiziellen Passus der Webseite der Streitkräfte auswendig gelernt.
»Sehr richtig«, entgegnete Frankfurt. »Und für Punkt Nummer zwei benötigen wir Sie.«
In Gedanken ging Pepe die Definition noch mal durch.
»Personenschutz?«
»Personenschutz«, bestätigte der Major. »Sie werden Oberbootsmann Schulze zu einem Treffen der Marinegeheimdienste der NATO nach Istanbul begleiten.«
»Aber ich habe Urlaub! In vier Tagen geht mein Flieger!«
Schulze atmete verächtlich ein und nach einer kurzen Pause wieder aus.
»Fuchs, wir schaffen das«, sagte Frankfurt und wandte sich dann an den Oberbootsmann. »Wie besprochen. Oberfeldwebel Fuchs wird Sie heute Nachmittag zum Fliegerhorst Holzdorf begleiten.«
»Danke, Herr Major«, entgegnete Schulze und stand auf. Dann verabschiedete er sich mit einem kurzen Kopfnicken von Frankfurt und verließ, ohne Pepe eines Blickes zu würdigen, das Büro.
Kaum fiel die Tür hinter ihm wieder ins Schloss, verschwand das Grinsen aus Frankfurts Gesicht. Er bewegte den Unterkiefer nach links und rechts, bis ein deutliches Knacken zu hören war.
»Tut mir leid, Fuchs«, sagte er und Pepe nahm ihm das ab. »Das da«, klopfte er auf die Dokumentenmappe, »ist eine große Sache in Istanbul. Und es gibt die klare Anweisung von oben, dass wir den Oberbootsmann begleiten sollen.«
Frankfurt strich über den Aktendeckel, wobei die letzten Buchstaben des Stempels verwischten. Mit etwas Fantasie war jetzt SO GEMEIN zu lesen. Hatte Frankfurt feuchte Handflächen?
»Und warum ich?«
»Fachkräftemangel. Noch konnten wir Feldwebel Gehricke nicht nachbesetzen. Und Razgatlıoğlu ist hier unabkömmlich.«
Automatisch drehten sich beide zur Tür um, als erwarteten sie, dass der Hauptgefreite wie ein gerufener Flaschengeist erscheinen würde. Tat er nicht.
»Außerdem ist bekannt, dass Sie und Schulze eine gemeinsame Vorgeschichte habe.« Frankfurt beugte sich über den Schreibtisch und senkte seine Stimme. »Inoffiziell sollen sie nicht nur die Person Schulze schützen, sondern den Oberbootsmann auch im Auge behalten. Seit Mali ist er quasi auf Bewährung.«
»Warum nimmt er dann an dem Treffen teil?«
»Fachkräftemangel«, antwortete Frankfurt ein zweites Mal. »Außerdem ist Schulze gut vernetzt. Die Bundeswehr verfügt über keinen separaten Marinegeheimdienst. Der Bereich fällt in die Expertise des Oberbootsmanns. So dumm, wie es klingt: Sie hatten keinen anderen.«
»Wie lange dauert der Einsatz?«
»Vier Tage. Einen für die Anreise. Zwei vor Ort. Einen für die Abreise. Sie sind pünktlich für Ihren Urlaubsflieger wieder zurück. Und jetzt gehen Sie packen. Schulze holt Sie in zwei Stunden ab.«
»Jawohl, Herr Major!«
Pepe sprang auf, salutierte und verließ im Stechschritt das Büro. Die Tür knallte so laut hinter ihm, dass das Echo noch sekundenlang durch den Kasernenflur hallte.
Exakt zwei Stunden später stand Pepe im Dienstanzug, auch »Ausgehuniform« genannt, an der Wache. Das korallenrote Barett mit dem Lorbeer umkranzten preußischen Gardestern und der nicht unumstrittenen Übersetzung von lateinisch suum cuique, Jedem das Seine, saß exakt ausgerichtet auf seiner Glatze. Zum langärmligen hellblauen Diensthemd hatte er sich den anthrazitfarbenen Langbinder umgelegt. Die Bügelfalten seiner grauen Uniformhose waren messerscharf. Die schwarzen Socken, neu und ungetragen, steckten in auf Hochglanz polierten schwarzen Halbschuhen. An der hellgrauen Uniformjacke prangten sämtliche Kennzeichen und Abzeichen, die sich Pepe in seiner langen Laufbahn erworben hatte. Auf den Schultern die beiden nach oben zeigenden Winkel, das Rangabzeichen für seinen Oberfeldwebeldienstgrad. Auf dem Kragenspiegel zwei orangefarben unterlegte Balken. Dazu die Schützenschnur Stufe Gold, erlangt nach erfolgreichem Wertungsschießen mit der Pistole Heckler & Koch P30. Über der rechten Brusttasche prangte das bronzefarbene Tätigkeitsabzeichen der Feldjäger. Die linke Tasche zierten vier Bandschnallen: zuerst die Meritorious Service Medal der NATO, gefolgt vom Thüringer Verdienstorden, den Pepe für die Rettung des Bundespräsidenten am Fuße der Wartburg erhalten hatte. Daneben die ISAF-Einsatzmedaille für seinen Einsatz in Afghanistan. Zum Schluss das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Bronze. Darunter prangte sein Namensschild in weißer Schrift auf schwarzem Grund.
Kurz hatte Pepe darüber nachgedacht, auch das komplette Schwarzzeug, bestehend aus einem schwarzen Koppel mit schwarzem Pistolenholster, Handschließentasche, inklusive Rettungsmehrzweckstock, anzulegen.
Rettungsmehrzweckstock, kurz RMS, war eine verharmlosende Bezeichnung für den schweren Schlagstock, mit dem die Feldjäger in revoltierenden Menschenansammlungen schmerzhaft für Ruhe und Ordnung sorgen konnten.
Am Ende hatte er seine Pistole mit zwei Ersatzmagazinen im Marschgepäck verstaut. Sie ruhte sicher in dem olivgrünen Seesack, der neben ihm auf dem Bürgersteig stand. Pepe hatte die Hände hinter seinem Rücken verschränkt, die Füße schulterbreit auseinander gestellt und schaute frei geradeaus. Eine gute Viertelstunde lang.
Dann raste ein von oben bis unten mit Schlamm bespritzter Wolf-Geländewagen auf den Kaserneneingang zu. Kurz vor der Schranke riss der Fahrer das Lenkrad herum und kam parallel dazu zu stehen. Durch die eingerissene Verdeckplane hindurch sah Pepe Oberbootsmann Candy Schulze am Steuer sitzen. Der Geheimdienstmann trug einen abgewetzten Feldanzug. An manchen Stellen sah der Tarnfleckaufdruck so verwaschen aus, dass er nicht mehr als solcher zu erkennen war.
»Fuchs, wo wollen Sie denn hin?«, rief Schulze über den Lärm des Dieselmotors hinweg. »Zum Abschlussball?«
Pepe wurde rot, Wut stieg sofort in ihm auf. Er hatte einfach vorausgesetzt, dass zu einem so hochoffiziellen Treffen die Kleiderordnung höchst formell sein würde.
»Na, macht ja nichts. Wir haben keine Zeit! Die Mühle läuft mit Mühe und Not hundert. Steigen Sie ein, sonst verpassen wir noch unseren Flieger!«
Tief durchatmend warf Pepe seinen Seesack auf die Rücksitzbank und stieg ein. Er hatte die Beifahrertür noch nicht zugeschlagen, da gab Schulze schon Gas. Hektisch riss er die Tür zu.
Im Inneren des Geländewagens war es laut. Selbst wenn Pepe versucht hätte, mit Schulze zu reden, hätte der kein Wort verstanden. Zum einen brüllte der Motor unter voller Last und zum anderen ließ der Fahrtwind die eingerissene Plane des Verdecks lautstark knattern. Ihm war es ganz recht. Er verschränkte die Arme vor der Brust und schaute aus dem Fenster. Unwillkürlich wanderten Pepes Gedanken zurück zu seinem letzten Besuch auf dem Fliegerhorst Holzdorf. Der war nicht nur ihm in unangenehmer Erinnerung geblieben. Pepe war gespannt, ob die großflächigen Verwüstungen spurlos beseitigt worden waren.
Für lange Autobahnetappen war der Wolf nicht gedacht. Schulze hatte Probleme, an Steigungen die Lastwagen zu überholen. Immer wieder fuhren Drängler dicht hinter ihnen auf, gaben Lichthupe und, als sie endlich neben ihnen waren, eindeutige Handzeichen. Den Oberbootsmann interessierte das wenig, denn statt dem Verkehr galt der Hauptteil seiner Aufmerksamkeit seinem Telefon. Alle paar Minuten überprüfte er, ob Nachrichten eingegangen waren, und beantwortete sie einhändig. Genauso oft sah sich Pepe unter der Hinterachse eines vorausfahrenden LKW einschlagen. Er hatte schweißnasse Hände und seine Finger hatten bereits zehn tiefe Druckstellen in seinem Sitz hinterlassen. Als Schulze wieder einmal nur Zentimeter vor der Stoßstange eines Sattelaufliegers abbremste, fragte Pepe durch zusammengepresste Lippen: »Soll ich lieber fahren?«
»Wie bitte?«, fragte Schulze zurück, ohne von seinem Handy aufzusehen.
»Ob ich lieber fahren soll? Dann können Sie in Ruhe telefonieren«, brüllte Pepe zurück.
»Um Himmelswillen nein«, antwortete Schulze. »Ich kenne Ihre Fahrkünste. Wir wollen doch heil ankommen.«
Kamen sie. Obwohl Pepe schon beinahe nicht mehr damit gerechnet hatte.
Das Gelände des Militärflughafens Holzdorf war flach und weitläufig, dicht von Bäumen umstanden. Von der Zufahrtsstraße konnte man sich keinen Eindruck von der Größe der Anlage machen. Erst der ausrangierte Hubschrauber am Haupttor gab einen ersten Hinweis auf die Nutzung des Areals als Flugplatz. Nur wenn man genau hinsah, konnte man den aufgeforsteten Teil erkennen, der die Folgen von Pepes letztem Aufenthalt wettmachen sollte.
Wieder fuhr Schulze mit Vollgas bis an die Schranke, dieses Mal ohne kurz vor dem Schlagbaum zur Seite zu schleudern. Der Wachhabende trat mit einem leichten Kopfschütteln aus dem Wachgebäude. Pepe machte sich ganz klein in seinem Sitz, was ihm aufgrund seiner geringen Körpergröße nicht besonders schwerfiel. Die Chancen, dass der Soldat auch bei seinem zurückliegenden Besuch hier Dienst getan hatte, waren zwar verschwindend gering, trotzdem ging er lieber auf Nummer sicher.
Schulze händigte dem Mann ein Schriftstück aus. Der las das Schreiben gründlich, salutierte anschließend und reichte den Zettel zurück. Dann gab er seinem Kameraden im Pförtnerhäuschen mit einem Nicken zu verstehen, die Schranke zu öffnen.
Auf dem Kasernengelände riss sich Schulze zusammen. Nur unwesentlich schneller, als die Geschwindigkeitsbegrenzung es zuließ, rollten sie an mehreren Betonwohnblöcken nach DDR-Bauart vorbei. Danach bogen sie in Richtung des eigentlichen Flugfeldes ab. Die Fahrt dauerte mehrere Minuten. Erleichtert registrierte Pepe, dass sie auf einen Businessjet zuhielten. Eine Bombardier Global 6000 der Flugbereitschaft der Luftwaffe. Somit würden sie wenigstens stilgerecht nach Istanbul reisen und Pepe war in seiner Ausgehuniform passend gekleidet. Allerdings hielt seine Freude nur kurz an. Schulze umkurvte das elegante Geschäftsflugzeug und steuerte einen Airbus A400M Atlas an. Der riesige Transporter wartete mit heruntergelassener Heckklappe und sich drehenden Propellern anscheinend auf Frachtgut. Nicht ungewöhnlich. Holzdorf wurde aktuell zu einem der größten Logistikstandorte der Bundeswehr ausgebaut.
Allerdings würden heute keine Fahrzeuge oder Fallschirmjägereinheiten den gigantischen Laderaum füllen. Das wurde Pepe in dem Moment klar, als Schulze neben der Laderampe anhielt und ein Crewmitglied mit Helm auf sie zugerannt kam.
»Da sind sie ja endlich!«, brüllte der Soldat über den Lärm der Flugzeugmotoren hinweg. »Wir haben schon die Startfreigabe! Aufsitzen!«
Schulze winkte nur ab. Pepe, dem die Autofahrt noch in den Knochen steckte, brauchte einen Moment, um sich aus dem Wolf zu hieven und seinen Seesack rauszuzerren. Das ging dem Lademeister anscheinend nicht schnell genug. Er packte Pepe an den Schultern und schob ihn in Richtung Flugzeug. Dabei riss er ihm versehentlich die Schützenschnur samt Schulterklappe von der Uniformjacke.
Der Laderaum des Airbus A400M bot über einhundert Soldaten Platz. Alternativ auch drei Transportpanzern M113 oder zwei Raupenbaggern. Heute diente er nur dazu, Oberbootsmann Schulze und Oberfeldwebel Fuchs aufzunehmen. An den beiden Bordwänden reihten sich Sitze aus Segeltuch dicht aneinander. Der Lademeister schnallte erst Schulze auf der linken, dann Pepe auf der rechten Seite fest. So mussten sie wenigstens nicht miteinander reden. Was Pepe weniger gut gefiel, war, dass beim Straffziehen der Gurte seine Bandschnallen von der Uniformjacke rissen. Sie fielen nicht nur auf den Metallboden und verschwanden auf Nimmerwiedersehen in den Schlitzen der Bodenbeplankung, sondern sie hinterließen auch einen hässlichen Dreiangel im Uniformstoff. Ehe sich Pepe darüber aufregen konnte, schloss sich die große Heckklappe mit einem hydraulischen Summen. Nur einen Wimpernschlag später ging ein Ruck durch die Maschine und der große Flieger setzte sich in Bewegung. Der Lademeister hatte offenbar nicht übertrieben mit der Aussage, dass sie spät dran waren.
Pepe schluckte seinen Ärger hinunter und schloss die Augen. Zu sehen gab es aus dem fensterlosen Laderaum ohnehin nichts. Schulze ihm gegenüber war wieder mit seinem Handy beschäftigt. Also beherzigte Pepe sein eigenes Motto: Schlaf und iss, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet. Die Vier-sieben-acht-Methode funktionierte bei ihm immer. Vier Sekunden lang einatmen, sieben Sekunden die Luft anhalten und acht Sekunden ausatmen. Kaum war der Airbus in der Luft, war Pepe tief und fest eingeschlafen.
Drei Stunden später setzte das Flugzeug unsanft auf der den Diplomatenflügen vorbehaltenen Landebahn 05/23 des Flughafens Istanbul-Atatürk auf. Das Gerüttel riss Pepe aus einem traumlosen Schlaf. Er ahmte ein kräftiges Schlucken nach, bis schließlich der Druckausgleich in seinen Ohren gelang. Dann stand auch schon der Lademeister vor ihm und half ihm beim Abschnallen. Die Ladeluke senkte sich bereits. Durch die Öffnung wehte ein strenger Geruch nach Kerosin, Abgasen und verbranntem Reifengummi herein.
Pepe stand auf, gähnte herzhaft, streckte sich und begutachtete den ausgerissenen Stofffetzen über seine Brusttasche. Frustriert stupste er den Dreiangel mit seinem Zeigefinger an. Dann packte er seinen Seesack und verließ das Flugzeug über die Laderampe. Draußen goss es in Strömen. Schulze hatte wieder, oder noch immer, sein Telefon am Ohr. Pepe konnte nicht verstehen, was er sagte, allerdings verrieten ihm die Körpersprache und der Tonfall des Geheimdienstlers, dass es alles andere als ein harmonisches Gespräch war.
Da sich die Rampe wieder schloss, suchte Pepe unter den Tragflächen des Airbus Schutz vor dem sintflutartigen Regen. Trotzdem war er bereits durchgeweicht bis auf die Unterwäsche. Seine teuren Lederschuhe boten ein Trauerspiel. Die über die Landebahn laufenden Sturzbäche überspülten seinen Spann, Wasser drang ungehindert ein, schmatzte und schwappte bei jedem Schritt. Zu allem Überfluss rollte die Transportmaschine an und ließ Pepe und Schulze sprichwörtlich im Regen stehen.
»Wie geht’s denn jetzt weiter?«, fragte Pepe gereizt.
Schulze hob nur den Zeigefinger, drehte sich zur Seite und brüllte irgendetwas in sein Handy. Dann steckte er es in die Beintasche seiner Uniformhose und antwortete knapp: »Wir werden abgeholt.«
»Wann?«
»Gleich.«
Es dauerte noch gute zwanzig Minuten, bis sich ihnen ein Wagen näherte. Der dichte Regen war nicht nur nass, er nahm ihnen auch die Sicht. Sie hörten das Fahrzeug erst, bevor sie es sahen. Dem Fahrer ging es wohl ebenso. Keine fünf Meter vor ihnen quietschten plötzlich die Bremsen des Wagens. Der Opel Kadett, der in Deutschland schon längst ein H-Kennzeichen verdient hätte, schlingerte und hielt direkt auf Pepe zu. Wahrscheinlich, weil er ihn durch die dichte Gischt nicht sehen konnte. Mit einem beherzten Satz wich der zur Seite aus, sprang in die Höhe, wurde trotzdem vom vorderen Kotflügel erwischt und schwang sich mit einem Stoß gegen die Hüfte auf die nasse Motorhaube, bis er mit dem Rücken gegen die Windschutzscheibe krachte. Der eigene Schwung zwang ihn in eine Seitwärtsrolle, die ihn vom Opel herunter wieder auf den Füßen landen ließ. Den rechten Ärmel seiner Uniformjacke leider nicht. Der hatte sich im Scheibenwischer verheddert. Der durchweichte Stoff riss sauber an der Naht ab, als wäre die Jacke aus Papier geschneidert.
»Lassen Sie doch den Quatsch!«, brüllte Schulze und riss die Beifahrertür auf.
Pepe taumelte erst nach links, dann nach rechts und musste sich am Wagendach abstützen, bevor er zu seinem Seesack trat. Als er ihn aufhob, fuhr ein stechender Schmerz durch seine lädierte Hüfte. Die Zähne zusammenbeißend, lief er zum Opel hinüber, öffnete die Tür hinter dem Fahrer, warf den Seesack mit Schwung hinein und kletterte hinterher.
Ihr Chauffeur war ein junger, drahtiger uniformierter Mann mit einem unglaublich wuscheligen schwarzen Haarschopf und einem bleistiftdünnen Schnauzbart. Pepe konnte seinen Dienstgrad nicht erkennen. Mehr als ein Onbaşı, ein Gefreiter, war er schon aufgrund seines Alters und des Haarschnitts wohl nicht. Aber er war freundlich. Er redete ohne Punkt und Komma auf Schulze ein, und zwar in einer Mischung aus Türkisch, Englisch, Russisch und Deutsch. Schulze ließ ihn gewähren und antwortete nur kurz angebunden: »Fahr!«
Die schroffe Ansage störte den Gefreiten nicht. In einem Fahrstil, der dem Schulzes nicht unähnlich war, kurvte er über den Flugplatz. Dabei winkte der Scheibenwischer fröhlich mit Pepes Uniformärmel, bis der sich endlich vom Wischerblatt löste und in der Gischt verschwand.
Pepe war das erste Mal in Istanbul. Daher bedauerte er, dass das Wetter so schlecht war und die Sicht gegen Null ging. Nachdem sie den Flughafen verlassen hatten, fuhren sie auf einer sechsspurigen Straße direkt am Marmarameer entlang. Leider ließ sich das Ufer nur erahnen. Trotz des dichten Verkehrs am späten Nachmittag kamen sie zügig voran. Nach einer knappen halben Stunde überquerten sie auf der Brücke der Märtyrer des 15. Juli den Bosporus und gelangten in den asiatischen Teil der Stadt. Erst jetzt drehte sich Schulze zu Pepe um.
»Der fährt uns direkt in die Selimiye-Kaserne«, sagte er. »Keine Chance! Da schlafen wir nicht!«
»Selimiye, Selimiye«, bestätigte der Fahrer, begleitet von heftigem Kopfnicken. Allerdings sprach er das Wort etwas anders aus als Schulze.
»Nix Selimiye! Du fahren zu Sanasaryan Han, kapito?«
»Sanasaryan Han? Niet, niet, mucho teuer, yes! Befehl Selimiye!«
»Ich scheiß auf deinen Befehl! Wir sind klitschnass und dreckig und werden bestimmt nicht in einem Schlafsaal mit dreißig anderen Kerlen übernachten«, schnauzte Schulze zurück.
Und zum ersten Mal, seitdem sie sich kannten, stimmte Pepe dem Oberbootsmann zu einhundert Prozent zu. Schulze zeigte auf seine Schulterklappen und wiederholte lautstark: »Nix Selimiye! Du fahren zu Sanasaryan Han, kapito?«
Schließlich gab der Gefreite klein bei. Er wendete den Kadett in einer halsbrecherischen Aktion und sie überquerten ein zweites Mal die Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Marmarameer.
Das Sanasaryan-Han-Hotel gehörte zur Marriott-Gruppe und lag mitten in der Altstadt, wenige Minuten von der Blauen Moschee entfernt, etwas versteckt in einer ruhigen Gasse. Ein rundlicher Concierge, den Pepe ausnahmsweise mal überragte, begrüßte Schulze überschwänglich, wie einen Verwandten, den er lange nicht gesehen hatte. Sein freundliches Lächeln vertiefte die Lachfältchen um seine Augen.
»Na, da sind Sie ja«, sagte der Mann, dessen Alter Pepe schwer schätzen konnte. Entweder ein gut gehaltener Sechziger oder intensiv gelebter Vierziger.
Dann schob er Schulze einen unbeschrifteten Umschlag zu. Der steckte ihn, ohne hinzusehen, in die rechte, noch nasse Beintasche seiner Uniformhose. Aus der linken holte er ein anderes, prall gefülltes, triefendes Kuvert und reichte es dem Concierge. Auch der würdigte den Umschlag keines Blickes und ließ ihn lächelnd unter dem Tresen verschwinden. Dann tippte er eifrig auf der Tastatur seines Rechners und reichte ihnen schließlich zwei Schlüsselkarten.
»Die Sanasaryan Han Suite, wie üblich«, sagte er und fügte mit einem Seitenblick auf Pepe hinzu. »Zwei Schlafzimmer.«
Erst wollte Pepe fragen, ob das nicht Probleme bei der Spesenabrechnung geben würde. Doch am Ende war es ihm egal. Schließlich wurde die Kreditkarte des Geheimdienstmannes belastet, nicht seine.
Die Suite war größer als Beates Wohnung in der Eisenacher Innenstadt. Und luxuriöser ausgestattet. An einen kleinen Salon schlossen sich zwei Schlafzimmer und ein großes Bad an. Der Salon war mit dickem Teppich ausgelegt. Der von zwei bequem aussehenden Sofas flankierte Couchtisch quoll über vor Köstlichkeiten: Obst, Schokolade und Sekt. Gegenüber nahm ein Flachbildfernseher die halbe Wand ein. Staunend sah sich Pepe um. Er traute sich nicht, den Teppich mit seinen durchnässten und verdreckten Schuhen zu betreten. Schulze hatte weniger Skrupel.
»Ich nehme das große Zimmer«, sagte er, während er schon wieder telefonierte.
Pepe zuckte nur mit den Schultern. Er trat sich die Schuhe von den Füßen, stellte seinen Seesack vorsichtig auf dem hellgrauen Fußboden ab und ging ins Bad. Hier sah er sich zum ersten Mal im Spiegel und erschrak. Zum einen über seinen abgekämpften Gesichtsausdruck und zum anderen über den Zustand seiner Uniform. Die war selbst für den Altkleidercontainer nicht mehr geeignet.
»Ich muss nochmal weg«, hörte Pepe Schulze durch die geschlossene Badezimmertür rufen. »Bestellen Sie sich etwas aufs Zimmer. Wir sehen uns morgen um Null Siebenhundert.«
4
Pepe schreckte hoch. Sein Herz schlug schnell. Warum? Nachdem er gestern Abend geduscht und gut gegessen hatte, allein und im Hotelzimmer, hatte ihm sein schlechtes Gewissen zugesetzt. Pepes offizielle Mission war es, Schulze als Personenschützer zur Seite zu stehen. Inoffiziell sollte er den Oberbootsmann im Auge behalten und alle verdächtigen Aktivitäten melden. Beides hatte er ignoriert, es sich stattdessen in einer viel zu teuren Luxussuite gut gehen lassen. Kurz hatte Pepe überlegt, sich auf die Suche nach Schulze zu machen. Schnell war ihm jedoch klargeworden, dass das in einer Stadt mit über fünfzehn Millionen Einwohnern ein sinnloses Unterfangen war. Vielleicht hätte der Concierge gewusst, wohin Schulze unterwegs war oder mit wem er sich treffen wollte. Aber bei dem freundschaftlichen Verhältnis, das die beiden augenscheinlich pflegten, hatte Pepe bezweifelt, dass ihm der Mann Schulzes Aufenthaltsort verraten hätte. Pepe hatte sich erst beruhigt, als er den Oberbootsmann hatte zurückkommen hören. Vor zirka einer Stunde. War er etwa nicht allein gewesen?
Ein Schrei. Aus dem Nachbarzimmer. Spitz, durchdringend, dann abrupt endend. Unmöglich festzustellen, ob Schulze ihn ausgestoßen hatte. Jemandem wurde der Mund zugehalten oder er wurde auf andere Art und Weise plötzlich zum Schweigen gebracht. Im Nu war Pepe heraus aus dem Bett. Kurz nach Mitternacht, zeigte die Uhr des Radioweckers. Seine Pistole lag auf dem Nachttisch. Zugreifen, Durchladen und Entsichern passierten in einer fließenden Bewegung. Barfuß und nur mit Boxershorts bekleidet, leise einen Fuß vor den anderen setzend, schlich Pepe zur Tür. Die Pistole im Zweihandgriff legte er sein Ohr an das Türblatt und lauschte. War das ein schweres Atmen? Ein Stöhnen? Pepe wechselte die Pistole in die linke Hand. Da die Tür rechts angeschlagen war und sich nach innen öffnete, blieb ihm keine andere Wahl. Ganz leicht legte er die Finger seiner rechten Hand auf die Türklinke und nahm die Pistole hoch. Dann atmete er tief ein, stieß die Tür auf, machte einen Ausfallschritt, fiel auf sein linkes Knie herunter und packte gleichzeitig seine Waffe mit beiden Händen. Was er sah, verschlug ihm kurz den Atem. Schulze lag mitten im Zimmer auf dem Rücken. Nackt. Seine Unterschenkel hatte er hochgelegt. Einer lag auf dem leergeräumten Couchtisch. Schokolade klebte ihm am Schenkel und Weintrauben waren kunstvoll auf seinem fülligen Oberkörper verteilt. Der andere Schenkel ruhte auf dem Sofa. Dazwischen lugte das Gesicht einer grinsenden Frau hervor. Ihr krauser Schopf erweckte den Eindruck, als ob der Oberbootsmann eine besonders beeindruckende Schambehaarung hatte. Eine zweite, ebenfalls dunkelhäutige Schönheit hockte auf dem Gesicht des Oberbootsmann. Ihr Minirock bedeckte seinen Kopf komplett. Denn im Gegensatz zu Schulze waren die beiden Frauen bekleidet, trugen eine Art Uniform, die Pepe spontan keiner Armee der Welt zuordnen konnte. Die Dame auf Schulzes Gesicht feixte breit und legte den Zeigefinger auf ihre knallrot geschminkten Lippen. Unter ihr wurde Schulze unruhig. Er ruderte mit den Armen, wollte sich offensichtlich aufsetzen und schauen, warum die Frauen aufgehört hatten, das zu tun, wofür er wahrscheinlich sie und auch den Concierge bezahlt hatte. Rückzug. Pepe sicherte seine Pistole und schloss die Tür hinter sich. Plötzlich verspürte er das dringende Bedürfnis, Beate anzurufen. Tat es jedoch nicht, mitten in der Nacht.
Pünktlich um sieben Uhr morgens stand Pepe wieder im tadellos aufgeräumten Salon der Suite. Schulze ebenso. Angezogen. Keine Spur von den beiden Damen. In der dunkelblauen Ausgehuniform mit der weißen Schirmmütze sah der Oberbootsmann bedeutend besser aus als ohne. Auf den ersten Blick wunderte sich Pepe, dass Schulze noch geradestehen konnte, bei den vielen Orden und Abzeichen, die seine Brust schmückten. Wenn sich Pepe nicht irrte, hatte der Oberbootsmann sogar ein Schwimmabzeichen Bronze angesteckt.
Pepe selbst war zwangsläufig zum Tarnfleck-Feldanzug gewechselt. Seine Uniform war nicht mehr zu gebrauchen gewesen. Selbst wenn er sie einigermaßen sauber und trocken bekommen hätte, wäre der fehlende Ärmel wohl doch aufgefallen.
»Da sind Sie ja!«, begrüßte Schulze ihn. »Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Es wird ein anstrengender Tag.«
»Ja, danke«, antwortete Pepe und versuchte, im Gesicht seines Gegenübers zu lesen, ob ihm der nächtliche Damenbesuch etwas von seiner Stippvisite erzählt hatte. Es gelang ihm nicht. Entweder war Schulze ein verdammt guter Schauspieler, was in Geheimdienstkreisen sicherlich nützlich war, oder er war tatsächlich völlig ahnungslos.
»Sie hätten gestern den Feldanzug anziehen sollen und heute die Ausgehuniform.«
»Ach was«, antwortete Pepe.
»Egal. Nichts wie los. Der Fahrer wartet schon auf uns.«
»Was ist mit Frühstück?«
»Holen wir uns unterwegs. Ich muss eh noch bei jemandem vorbeischauen.«
»Ab jetzt komme ich mit.«
»Wie bitte?«
Schulzes Augen verengten sich zu Schlitzen und eine tiefe Furche bildete sich auf seiner Stirn.
»Ich bin Ihr Personenschützer. Ab jetzt begleite ich Sie.«
Nur langsam glättete sich Schulzes Stirnfalte wieder. Mit zuckendem Mundwinkel sagte er schließlich: »Okay. Jetzt aber flinke Füße.«
Der Regen hatte aufgehört. Als sie aus dem Hotelfoyer traten, roch die Luft frisch, mit einer Note nach exotischen Gewürzen. Pepe war sich sicher, dass sich das schnell wieder ändern würde, wenn das hier übliche Verkehrschaos einsetzte und Millionen von Autos, Rollern, Motorrädern und Lastwagen ihre Abgase in die Umgebung bliesen. Doch aktuell genoss er es, frei durchatmen zu können.
»Das war ja klar«, sagte Schulze, als er den Kadett in zweiter Reihe mit laufendem Motor warten sah. »Die wollen uns demütigen, uns zeigen, was sie von uns halten. Daher schicken sie uns den allerletzten Mistkarren, den sie finden konnten. Ich wette, der Opel ist nicht mal Teil des regulären Fuhrparks, sondern gehört irgendeinem Soldaten. Wahrscheinlich ist es sogar das Privatfahrzeug des Gefreiten.«
»Und wer sind die?«, wollte Pepe wissen.
»Der JİTEM, der Geheimdienst der türkischen Gendarmerie. Der, den es offiziell gar nicht gibt.«
»Warum sollten sie uns demütigen wollen?«
»Da gibt es viele Gründe. Denken Sie nur an die vielen Türken, die lieber in Deutschland leben. Unsere permanenten Abwertungen der Türkei. Dann diese ganzen Abkommen, damit sie uns Flüchtende vom Hals halten, wofür die EU sie mit viel Geld besticht. Spannungen zwischen unseren Staaten sind doch nicht zu übersehen. Außerdem gehen gerade Dinge im Hintergrund ab, von denen Sie keine Ahnung haben. Und das ist auch gut so. Vielleicht ist es gar nicht so falsch, dass Sie ihre Handfeuerwaffe dabeihaben.« Schulze nickte zu Pepes Pistolenhalfter an seinem Koppel. Dann lief er zu dem Kadett hinüber und stieg wieder auf der Beifahrerseite ein.
Pepe folgte ihm und setzte sich auf den Platz hinter dem Fahrer. ›Außerdem gehen gerade Dinge im Hintergrund ab, von denen Sie keine Ahnung haben‹, wiederholte er im Geiste für sich. Was für ein wichtigtuerischer Armleuchter. Von dem angeblichen türkischen Geheimdienstarm hatte er auch noch nie gehört, auch wenn das nichts zu bedeuten hatte. Gerade in letzter Zeit war das Agentenmetier in einer gründlichen Umbruchphase. Nach dem Fall der Berliner Mauer hatten sich die Geheimdienste der Welt zum ersten Mal umorientieren müssen. Die Feindbilder Nummer eins waren keine souveränen Staaten mehr, sondern fundamentalistische Vereinigungen. Doch nun hatte sich das Bild erneut gewandelt. Die Menschheit tänzelte ganz nah am Abgrund eines weiteren Weltkrieges entlang. Und falls es dazu kommen sollte, davon war Pepe fest überzeugt, würde es keine Gewinner, keine jährlichen Siegesparaden mehr geben. Dann würde die Menschheit aufhören zu existieren.
Ihr Fahrer begrüßte sie mit einem freundlichen Wortschwall, den Pepe ausblendete. Stattdessen versuchte er, die Fahrt zu genießen und die Atmosphäre Istanbuls in sich aufzusaugen. Obwohl sie noch im europäischen Teil der Stadt unterwegs waren, wirkte sie exotisch und fremd. Wie eine moderne Version von Tausendundeiner Nacht. Kurz hatte er gehofft, sie würden die Fähre über den Bosporus nehmen. Doch leider wählte der Gefreite, großzügig die Hupe des Opel nutzend, wieder die sechsspurige Schnellstraße und den Weg über die Brücke. Im asiatischen Stadtteil Üsküdar beugte sich Schulze zu dem Gefreiten hinüber und flüsterte ihm etwas zu. Darauf schüttelte der energisch den Kopf, worauf Schulze eindringlicher wurde und erneut auf seine Rangabzeichen klopfte. Der wenig dezente Hinweis wirkte auch beim zweiten Mal. Weit ausholend, als würde er einen Vierzigtonner steuern, riss der Gefreite das Steuer herum. Mit quietschenden Reifen und quer über die rechten beiden Fahrstreifen schießend, begleitet von einer Hupkakophonie der geschnittenen Verkehrsteilnehmer, bogen sie in eine enge Gasse ab.
Die Straße führte steil bergab und war gespickt mit hohen Bremsschwellen. Der Kadett hob mehrfach ab, als sie mit unverminderter Geschwindigkeit darüber hinwegdonnerten. Pepe wurde hochgehoben und schlug mit dem Kopf gegen den Dachhimmel. Hektisch tastete er nach einem Sicherheitsgurt, fand aber keinen. Bei jeder Landung schlug die Federung hart durch und versetzte den betagten Opel in bedenkliche Schwingungen. Mehr als einmal schrammten sie nur knapp an geparkten Fahrzeugen vorbei. Ein Seitenspiegel musste daran glauben. Vor einem vierstöckigen würfelförmigen Haus stieg der Gefreite voll in die Bremse. Dann zeigte er mit verkniffenem Gesichtsausdruck auf die Haustür und sagte: »Da!«
Schulze stieg sofort aus. Die Tür noch in der Hand, sagte er zu Pepe, und zwar in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete: »Sie bleiben hier. Ich bin gleich wieder da!«
Im Laufschritt lief er auf die Tür zu und klingelte Sturm. Nach wenigen Sekunden beugte er sich zur Sprechanlage. Dann drückte er die Haustür auf und verschwand im Inneren des Wohnblocks.
»Wer wohnt hier?«, fragte Pepe den Fahrer und nestelte an seinem Türgriff herum. Das Mistding klemmte, ließ sich nicht entriegeln.
»Ich nicht wissen.«
»Kannst du das nicht googeln?«
»Daten nix aktuell. Hier viele Afrikaner. Illegal.«
Pepe riss jetzt mit aller Kraft an dem Griff und brach ihn ab.
Erschrocken hob er den Plastikrest hoch und schaute darüber hinweg zu dem Haus, in dem Schulze verschwunden war. Der blassrosa Anstrich, der stark abblätterte, stammte aus besseren Zeiten. Die vielen Fenster waren wohl schon länger nicht geputzt worden, machten sonst aber immerhin einen ganz passablen Eindruck. Auf zwei Balkonen trocknete Wäsche. Musik war zu hören. Trommeln und Rasseln.
»Afrikaner?«, fragte Pepe und rückte auf die Beifahrerseite.
»Bessere. Von Insel. Im Meer. Mit Muschi-Kokosnuss. Weit weg. Und andere.«
Dass in der Gegend besser gestellte Leute wohnten, glaubte Pepe sofort. Gegen die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge war ihr Opel eine richtige Schrottkarre.
»Was macht der Kerl denn hier?«, fragte Pepe mehr sich selbst und tastete nach dem Türgriff auf der Gegenseite. Vergebens. Der fehlte auch.
»Ich nicht wissen«, antwortete der Gefreite unbeteiligt.