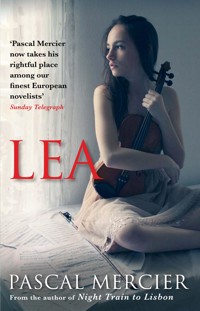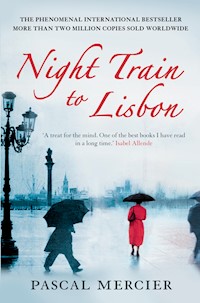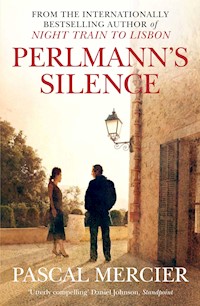SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
""Perlmanns Schweigen" ist ein selbstreflexiver, philosophisch-analytischer Kriminal- und Abenteuerroman in bester artistischer Tradition." FAZ
Der angesehene Sprachwissenschaftler Philipp Perlmann trifft sich mit einer Gruppe von berühmten Kollegen in einem Hotel an der ligurischen Küste. Konfrontiert mit den hohen Erwartungen der anderen, zieht er sich so sehr in sich zurück, dass er bald in eine ausweglose Situation gerät, die ihn sogar an den Rand eines Mordes treibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1115
Veröffentlichungsjahr: 2009
4,5 (62 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
I – Das russische Manuskript
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
II – Der Plan
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
III – Die Nachricht
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Copyright
Buch
Ein Hotel an der ligurischen Küste im Spätherbst. Philipp Perlmann, ein angesehener Sprachwissenschaftler, erwartet eine Gruppe von berühmten Kollegen zu einem Forschungsaufenthalt. Umstellt von den hohen Erwartungen der anderen, wird Perlmann von der Einsicht überwältigt, daß ihm seine beruflichen Gewißheiten völlig abhanden gekommen sind. Diese Erfahrung macht die anderen für ihn zu bedrohlichen Gegnern. Verschanzt in einem entlegenen Zimmer des Hotels, flüchtet er sich in das Übersetzen eines russischen Textes, der von Selbstvergewisserung und der erzählerischen Aneignung handelt. Durch diese Flucht nach innen gerät Perlmann mit jedem Tag mehr in eine ausweglose Situation, die ihn schließlich in einen Strudel von Lügen und an den Rand eines Mordes treibt.
Ein psychologischer Roman par excellence, der den Leser durch raffinierte Komposition und einen großen Spannungsbogen von der ersten bis zur letzten Seite in Atem hält.
Autor
Pascal Mercier, geboren 1944, ist in Biel aufgewachsen. Er hat Indologie, Anglistik, Philosophie und Philologie in London und Heidelberg studiert. Er war einige Jahre als Dolmetscher tätig und wurde später Dozent für Linguistik. Seit 1993 hat er eine Professur für Philosophie an der FU Berlin inne. Für sein Romanwerk wurde er mit dem Marie Luise Kaschnitz-Preis 2006 ausgezeichnet.
Pascal Mercier bei btb
Der Klavierstimmer. Roman (72654)
Nachtzug nach Lissabon. Roman (73436)
Die Anderen sind wirklich Andere. Andere.
I
Das russische Manuskript
1
Philipp Perlmann war es gewohnt, daß die Dinge keine Gegenwart für ihn hatten. An diesem Morgen jedoch war es schlimmer als sonst. Gegen seinen Willen ließ er die russische Grammatik sinken und blickte zu den hohen Fenstern der Veranda hinüber, in denen sich eine schräg gewachsene Pinie spiegelte. Dort drinnen, an den Tischen aus glänzendem Mahagoni, würde es geschehen. Sie würden ihn, der vorne saß, erwartungsvoll ansehen, und dann, nach einer gedehnten, unerträglichen Stille und einem atemlosen Stocken der Zeit, würden sie es wissen: Er hatte nichts zu sagen.
Am liebsten wäre er sofort wieder abgereist, ohne Angabe eines Ziels, ohne Erklärung, ohne Entschuldigung. Für einen Moment war der Impuls zur Flucht heftig wie ein körperlicher Schmerz. Er klappte das Buch zu und blickte über die blauen Umkleidekabinen hinweg auf die Bucht, die vom gleißenden Licht eines wolkenlosen Oktobertages durchflutet wurde. Weglaufen: Am Anfang müßte es wunderbar sein, es käme ihm vor wie ein schneller, kühner Schritt durch alles Gefühl der Verpflichtung hindurch hinaus in die Freiheit. Aber die Befreiung wäre nicht von Dauer. Das Telefon zu Hause würde immer von neuem klingeln, und irgendwann würde seine Sekretärin unten stehen und läuten. Er könnte nicht auf die Straße gehen, und Licht dürfte er auch nicht machen. Die Wohnung würde zum Gefängnis. Natürlich konnte er statt nach Frankfurt auch an irgendeinen anderen Ort fahren, nach Florenz vielleicht, oder Rom, dort wäre er unauffindbar. Aber jeder solche Ort wäre jetzt nichts anderes als ein Ort des Untertauchens. Blind und taub ginge er durch die Straßen, um dann im Hotelzimmer zu liegen und auf das Ticken des Reiseweckers zu horchen. Und irgendwann würde er sich doch stellen müssen. Er konnte nicht für den Rest des Lebens verschollen bleiben. Schon allein Kirstens wegen nicht.
Er könnte mit keiner überzeugenden Erklärung aufwarten. Den wahren Grund zu nennen wäre unmöglich. Und selbst wenn er den Mut dazu aufbrächte: Es würde wie ein schlechter Scherz klingen. Es bliebe der Eindruck des Willkürlichen, Mutwilligen. Die anderen müßten sich verhöhnt vorkommen. Gewiß, diese Leute würden das Ganze selbst in die Hand nehmen. Aber ich wäre erledigt. Für so etwas gibt es keine Entschuldigung.
Schuld an alledem war das wunderbare Licht, in dem die stille Wasserfläche jenseits der Kabinen aussah wie Weißgold. Dieses Licht hatte Agnes einfangen wollen, und deshalb hatte er dem Drängen von Carlo Angelini schließlich nachgegeben. Dabei war er ihm unsympathisch, dieser drahtige, sehr wache Mann mit dem gewinnenden Lächeln, das eine Spur zu routiniert war. Sie hatten sich zu Beginn des Vorjahres am Rande einer Konferenz in Lugano kennengelernt, als Perlmann noch lange nach Sitzungsbeginn im Flur am Fenster gestanden hatte. Angelini hatte ihn angesprochen, und Perlmann war nicht unglücklich über diesen Vorwand gewesen, nicht in den Saal gehen zu müssen. Sie waren in die Cafeteria gegangen, wo Angelini ihm von seiner Funktion bei Olivetti erzählt hatte. Er war fünfunddreißig, eine Generation jünger als Perlmann. Das Angebot von Olivetti hatte er erst vor zwei Jahren angenommen, nachdem er einige Jahre Assistent an der Universität gewesen war. Er hatte die Kontakte des Konzerns zu den Universitäten zu pflegen und konnte das ganz in eigener Regie tun, wobei ihm ein großzügiges Budget zur Verfügung stand, denn seine Tätigkeit wurde als Teil der Öffentlichkeitsarbeit verbucht. Sie hatten eine Weile über maschinelles Übersetzen gesprochen, es war ein Gespräch wie viele gewesen. Doch plötzlich war Angelini sehr lebhaft geworden und hatte ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, zu einem sprachwissenschaftlichen Thema eine Forschungsgruppe zusammenzustellen: eine kleine, aber intensive Sache, eine Handvoll erstklassiger Leute, die sich für ein paar Wochen an einem angenehmen Ort zusammensetzten, natürlich alles auf Kosten des Konzerns.
Perlmann fand damals, daß der Vorschlag viel zu schnell kam. Zwar hatte Angelini erkennen lassen, daß Perlmann für ihn kein Unbekannter war; aber persönlich kannte er ihn doch erst seit knapp einer Stunde. Vielleicht aber mußte man solche kühnen Vorstöße wagen, wenn man Angelinis Aufgabe hatte. Im Rückblick kam es Perlmann vor, als habe ihn sein Gefühl schon damals gewarnt. Er hatte auf den Vorschlag ohne Enthusiasmus reagiert, eher lahm; aber immerhin hatte er gesagt, seiner Ansicht nach müßten in einer solchen Gruppe Leute aus unterschiedlichen Disziplinen vertreten sein. Es war eine hingeworfene Bemerkung gewesen, nicht durchdacht und ohne ernsthaften Gedanken an eine Verwirklichung. Seinem Eindruck nach war alles genügend im Unbestimmten und Unverbindlichen geblieben, und er hatte es plötzlich eilig gehabt, in den Konferenzraum zu kommen.
Er hatte das Gespräch vergessen, bis einige Wochen später ein Brief von Angelini kam und kurz darauf ein Anruf aus der Zentrale von Olivetti in Ivrea. Perlmanns Vorschlag, hieß es da nun plötzlich, habe in der Firma großen Anklang gefunden, besonders natürlich bei einigen Kollegen aus der Forschungsabteilung, aber auch von der Direktion sei die Idee gut aufgenommen worden. Besonders angetan sei man von der Möglichkeit, auf diese Weise ein Vorhaben fördern zu können, das einerseits etwas mit den Produkten der Firma zu tun habe, andererseits aber weit darüber hinausreiche, indem es ein Thema von allgemeinem Interesse, sozusagen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, aufgreife. Er, Angelini, schlage vor, die Sache im kommenden Jahr in Santa Margherita Ligure durchzuführen, einem Badekurort unweit von Rapallo am Golf von Tigullio. Sie hätten dort schon öfter Tagungen abgehalten und nur gute Erfahrungen gemacht. Am günstigsten für das geplante Unternehmen, sagte er, seien die Monate Oktober und November, da sei es noch mild, aber es seien kaum noch Touristen da, es herrsche eine stille, beschauliche Atmosphäre, genau das Richtige also für eine Forschungsgruppe. In allen anderen Dingen habe Perlmann als der Leiter völlig freie Hand, insbesondere natürlich bei der Auswahl der Leute.
Perlmann biß sich auf die Lippen und spürte einen hilflosen Ärger in sich aufsteigen, als er an jenes Gespräch zurückdachte. Er hatte sich von der sonoren, sehr sicheren Stimme am anderen Ende überrumpeln lassen, und das ohne den geringsten Grund. Diesem Carlo Angelini war er nicht das mindeste schuldig. Er war damals froh darüber gewesen, daß er ihm half, die Konferenz zu schwänzen; im übrigen aber war er ein Fremder, dessen Ehrgeiz ihn nun wirklich nicht zu kümmern brauchte, ganz zu schweigen von irgendwelchen Wünschen der Firma Olivetti. Gewiß, er hatte in dem Gespräch noch keine Zusage gegeben. Ganz nüchtern betrachtet hätte er danach immer noch nein sagen können. Aber er hatte den entscheidenden Moment verpaßt, den Moment, in dem es ganz natürlich gewesen wäre zu sagen: Da ist ein Mißverständnis entstanden, so war es damals nicht gemeint, es tut mir leid, aber das paßt wirklich überhaupt nicht zu meinen sonstigen Plänen, ich bin jedoch sicher, daß es eine ganze Reihe von Kollegen gibt, die Ihren Plan sehr gerne verwirklichen würden, ich werde über Namen nachdenken. Statt dessen hatte er versprochen, sich die Sache zu überlegen. Und statt einfach eine angemessene Frist verstreichen zu lassen und dann abzusagen, hatte er die Karte geholt. Agnes und er hatten darüber gesessen und sich ausgemalt, was man von dort aus leicht erreichen könnte, Pisa zum Beispiel und Florenz, aber auch Bologna, das sie besonders mochten. Italien im Winter, das war eine Lieblingsidee von Agnes, sie hatte haufenweise Pläne fürs Fotografieren, vielleicht würde sie es sogar einmal mit Farbfotografie probieren, über die sie sonst erhaben war, wie auch immer, auf jeden Fall möchte ich versuchen, das Licht des Südens einzufangen, wie es im Winter ist, und das ist die Gelegenheit, findest du nicht auch? Der Agentur werde ich das schon schmackhaft machen, ich werde ein bißchen reden müssen, aber schließlich werden sie mich ziehen lassen. Vielleicht kann ich sogar eine Serie daraus machen: <Das winterliche Licht des Südens>. Wie fändest du das? Zwar waren Oktober und November noch nicht Winter, aber er wollte nicht pedantisch sein, und etwas von ihrer Begeisterung war damals auch auf ihn übergesprungen. Es war grotesk, dachte er und preßte die Fingerspitzen auf die Augen, aber er hatte sich damals tatsächlich vor allem in der Rolle desjenigen gesehen, der Agnes auf ihrer Fotoreise begleiten würde, getragen und beschützt von ihrer Fähigkeit, für sie beide die Gegenwart zu erobern. Es kam ihm heute unglaublich vor, aber so war es gewesen: Aus dieser Vision, dieser Träumerei heraus hatte er schließlich zugesagt, hatte seine Beurlaubung beantragt und die ersten Einladungsbriefe geschrieben. Als dann zehn Monate später mit Agnes’ Tod alles einstürzte, war es zu spät gewesen, die Dinge rückgängig zu machen.
Agnes hatte recht gehabt: Das Blau des Himmels war hier auf seltsame Weise durchsichtig, als gäbe es im Hintergrund zusätzlich zur Sonne noch eine weitere, unsichtbare Beleuchtungsquelle. Der Raum, der die Bucht überwölbte, bekam dadurch eine verhüllte, geheimnisvolle Tiefe, eine Tiefe, die etwas versprach. Kennengelernt hatte er dieses Blau und dieses Licht, als die Eltern damals mit ihm nach Italien fuhren. Er war erst dreizehn und hatte noch keine Worte dafür, aber die südlichen Farben waren tief in ihn hineingesunken – wie tief, das merkte er erst richtig, als der Zug bei Göschenen den Gotthard-Tunnel verließ und die Welt aussah wie ein Bild in Grautönen. Seitdem war das südliche Licht für ihn das Ferienlicht, das Licht, welches das Leben war im Unterschied zur Arbeit. Das Licht der Gegenwart. Aber es war eine Gegenwart, die stets nur eine mögliche Gegenwart blieb, eine, die man leben könnte, wenn man nicht nur in den Ferien hier wäre. Jedesmal, wenn er es sah, kam es ihm vor, als würde ihm dieses Licht nur gezeigt, um ihm vor Augen zu führen, daß er sein wirkliches, alltägliches Leben nicht in der Gegenwart lebte. Und weil es immer nur das Ferienlicht blieb, verwob sich sein Anblick mit der Empfindung von etwas Vorübergehendem, von etwas, das nicht festzuhalten war und das einem, kaum war es in Reichweite gekommen, auch schon wieder genommen wurde. Immer mehr war es für ihn zu einem Licht des Abschieds geworden, und manchmal haßte er es, weil es ihm eine Gegenwart vorgaukelte, die es vielleicht gar nicht gab.
Er starrte mit schmerzenden Augen auf die Lichtfläche hinaus, die jetzt von einem Motorboot durchschnitten wurde. Worauf es ankäme, dachte er, wäre dies: den Schein dieses Lichts alles sein zu lassen, die ganze Wirklichkeit, und nichts dahinter zu suchen. Das Licht nicht als ein Versprechen zu erleben, sondern als die Einlösung eines Versprechens. Als etwas, bei dem man angekommen war, nicht etwas, das immer neue Erwartungen weckte.
Davon war er jetzt weiter entfernt denn je. Gegen seinen Willen glitt sein Blick erneut hinüber zur Veranda. Die rötlich glänzenden Tische mit den geschwungenen Beinen waren in der Form eines Hufeisens angeordnet, und an die Stirnseite hatte Signora Morelli einen besonders bequemen Sessel mit einer hohen, geschnitzten Lehne hinstellen lassen.«Wer hier sitzen darf, muß dafür ja auch etwas leisten», hatte sie lächelnd gesagt, als sie ihm gestern abend den Raum zeigte.
Zum drittenmal an diesem Vormittag schlug er die russische Grammatik auf. Aber es gelang ihm nicht, etwas aufzunehmen, es war, als gäbe es keinen Weg von draußen nach drinnen – als sei er mit einemmal blind für Zeichen und Bedeutungen. So war es schon gestern auf der Reise gewesen, einer Reise, die zu einem einzigen quälenden Kampf gegen den Widerwillen geworden war. Auf der Fahrt zum Flughafen hatte er die Leute in der S-Bahn beneidet, die kein Reisegepäck bei sich hatten, Leute mit bleichen, mürrischen Montagsgesichtern, die jetzt nicht nach Genua fliegen mußten. Später dann hätte er mit den Angestellten des Flughafens tauschen mögen, und den gerade gelandeten Fluggästen, die ihm aus seiner Maschine entgegenkamen, blickte er lange nach, jedem einzelnen von ihnen. Die hatten es hinter sich. Es war ein regnerischer, windiger Vormittag, die Autos fuhren mit Licht, Dezemberstimmung Mitte Oktober, ein Wetter, das die Vorfreude auf einen Flug in den Süden hätte steigern können. Doch ihm erschien nichts erstrebenswerter, als in Frankfurt zu bleiben. Er dachte an die stille Wohnung, wo überall Agnes’ Fotografien hingen, und es war ihm danach, sich darin einzuschließen und lange Zeit für niemanden erreichbar zu sein.
Er saß schon eine Weile im Warteraum beim Flugsteig, als er plötzlich noch einmal hinausging und seine Sekretärin anrief. Es war ein Anruf ohne ersichtlichen Grund, er wiederholte Dinge, die sie längst besprochen hatten, die Sache mit der Post und wie sie sonst in Verbindung bleiben würden. Frau Hartwig wußte nicht, was sie sagen sollte, ihre Ratlosigkeit war hörbar.«Ja, natürlich, Herr Perlmann, ich werde es genau so machen wie verabredet. »Dann erkundigte er sich, eigentlich eine Zumutung in diesem Moment, nach ihrem Mann und ihren Kindern. Dieses zur Unzeit geäußerte Interesse berührte sie peinlich, und schließlich entstand eine längere, verlegene Pause, bis er sagte:«Also dann», und sie:«Ja, gute Reise.»Er war als letzter an Bord gegangen.
Im Flugzeug hatte er sich Mühe gegeben mit sich selbst. Er sagte sich, daß dies zwar der gefürchtete Anreisetag war, aber immerhin noch ein Tag, der ihm allein gehörte und aus dem er etwas für sich machen konnte. Auf dem freien Platz neben sich legte er die russische Grammatik zurecht. Dann wartete er auf die magische Wirkung des Starts – darauf, daß im Augenblick des Abhebens alles in Fluß geriete und leichter erschiene. An einem solchen Tag war man schnell in den Wolken, es gab bange Momente trotz Erfahrung, und plötzlich dann tauchte man auf, in einen tiefblauen, transparenten Himmel hinein, einen Dom aus reinem Ultramarin, unter einem das blendend helle Wolkenmeer mit seiner widerstandslosen Kompaktheit, aus dem vereinzelte Formationen herausragten, kleine weiße Gebirge mit gestochen scharfen Rändern, die in ihm den Eindruck vollkommener Stille hervorzurufen pflegten. Ich bin entkommen, dachte er dann regelmäßig und genoß das Gefühl, daß alles, was ihn eben noch umklammert gehalten hatte, seine Macht verlor und lautlos hinter ihm versank, ohne daß er etwas dazu hätte tun müssen. Gestern jedoch war all dies ausgeblieben, das Ganze kam ihm matt und langweilig vor, Fortbewegung mit dröhnenden Motoren, weiter nichts. Zwar war es draußen wie immer; aber er fühlte sich wie in einem Werbefilm der Fluggesellschaft, tausendfach gezeigt und ohne Echtheit, ohne Gegenwart. Er zog den Schieber über das Fenster, verzichtete auf das Essen und versuchte, sich in die Grammatik zu vergraben. Doch seine gewohnte Konzentration ließ ihn im Stich. Er starrte die Kästchen und Übungssätze stets von neuem an, aber es griff einfach nicht. Als die Maschine dann zum Sinkflug ansetzte, wurde er durch den sanften Wechsel im Motorengeräusch und im Körpergefühl heftiger aufgeschreckt als durch den Knall einer Explosion. Jetzt war es soweit. Es überfiel ihn eine Empfindung des Unwiderruflichen, Unumkehrbaren. Als beim Aussteigen jemand aus Versehen gegen ihn stieß, mußte er eine Weile die Augen schließen und sich festhalten, bevor es ihm gelang, ruhig weiterzugehen.
In Genua hatte flaches, totes Wetter geherrscht. Graue, schmutzig wirkende Wolkenbänke ließen nur ein mattes, nichtssagendes Licht durchscheinen. Die Dinge waren in aufdringlicher Weise einfach nur sie selbst, sie hatten keine Bedeutung und keinen Glanz. Die Industrieanlagen, an denen der Flughafenbus entlangfuhr, waren häßlich, es schien keine einzige intakte Fensterscheibe zu geben, und er fragte sich, wie es auf einem derart verwahrlosten Gelände überhaupt zu dem vielen Rauch kommen konnte, dessen grelles Weiß an Gift denken ließ. Die wenigen Menschen im Bahnhof, so kam es ihm vor, bewegten sich träge in einer fremden Zeit, die mit beklemmender Langsamkeit floß. Die rauchenden Angestellten am Fahrkartenschalter machten keine Anstalten, ihn zu bedienen. Selbst dem Taxifahrer schien nicht viel am Geschäft zu liegen. Erst nachdem er den Schwatz mit dem Kollegen beendet hatte, ließ er sich herbei zu fragen, welchen Weg er nehmen solle.«Den kürzesten», hatte Perlmann wütend gesagt.
Bevor es soweit war, daß das Flugzeug für den Rückflug abhob, mußten vier Wochen, fünf Tage und dreieinhalb Stunden vergehen. Perlmann starrte auf die rötlichen Steinplatten der Hotelterrasse. Das war wie ein riesiges Gebirge aus gegenwartsloser Zeit, das sich in dem Maße höher türmte, als sein Wunsch, es möge doch schon soweit sein, brennender wurde. Es war, als sei der Wunsch mit dem Gebirge auf geheimnisvolle Weise verbunden und besitze die magische Fähigkeit, es höherzuschichten. Und da der Wunsch jedesmal, wenn er ihn klar vor Augen hatte, noch heftiger wurde und insgesamt ins Unendliche zu wachsen drohte, hatte Perlmann den Eindruck, jener ersehnte Moment werde niemals kommen, weil es keine Möglichkeit gab, all die tote Zeit zu übersteigen, die vor ihm aufragte wie eine bedrohliche Wand. Der einzige Ausweg bestünde darin, den Wunsch zum Schweigen zu bringen und innen still zu werden. Dann trüge sich das Gebirge von selbst ab, und wenn die innere Stille vollkommen wäre, erschiene die Zeit wie eine Ebene, über die er mühelos zu jenem fernen Moment gelangen könnte.
Er wollte sich endlich die verschiedenen Ausdrücke einprägen, die es im Russischen für das deutsche müssen gab. Er ging die Liste durch und vergaß jede Zeile sofort wieder. Es half nichts, sich weiter in den Schatten zu setzen, und auch an der Sonnenbrille lag es nicht. Dabei war das Erlernen einer fremden Sprache etwas, was er beherrschte. Eigentlich das einzige. Auch war es das einzige, was ihn wirklich zu fesseln vermochte. Bei dieser Tätigkeit hatte er das Gefühl, daß es mit seinem Leben voranging und er sich entwickelte. Und manchmal, wenn sich ein fremder Satz, ein bisher unzugänglicher Text plötzlich erschloß, war ihm, als könne er einen Hauch von Gegenwart erhaschen.
Wenn er nur etwas davon auch in der wissenschaftlichen Arbeit spüren könnte. Es kam ihm seltsam vor, aber er wußte nicht mehr, ob es jemals so gewesen war. Jedenfalls lag es dann weit zurück, in einer Zeit, als er die Lähmung, die ihn nun schon so lange quälte, noch nicht gekannt hatte. Er hatte inzwischen das Gefühl, gar nicht mehr richtig zu wissen, wie das war: wissenschaftlich zu arbeiten. Es war keine Schreibhemmung, da war er sich sicher. Das hatte er nie gekannt, und die Fähigkeit zur flüssigen, treffenden, gelegentlich brillanten Formulierung stand ihm, das spürte er, auch jetzt noch zur Verfügung. Es war etwas anderes, etwas im Grunde viel Einfacheres und zugleich etwas, was er nicht hätte erklären können, sich selbst nicht und noch viel weniger anderen, vor allem nicht Kollegen: Es war ihm der Glaube an die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Tätigkeit abhanden gekommen-dieser Glaube, der ihn früher in Bewegung gesetzt hatte, durch den die tägliche Disziplin möglich geworden war und der die damit verbundenen Entsagungen hatte sinnvoll erscheinen lassen.
Es war nicht durch eine Schlußfolgerung oder Bilanzierung, daß ihm dieser Glaube verlorengegangen war, und der Verlust hatte nicht die Form einer inneren Feststellung. Er fand einfach nicht mehr in die Konzentration zurück, in das Gefühl der Ausschließlichkeit, aus dem heraus seine wissenschaftlichen Arbeiten bisher entstanden waren. Das bedeutete nicht, daß er nun die Unwichtigkeit seiner Forschungen, oder gar der Forschung überhaupt, verkündet hätte als ein weltanschauliches Urteil. Nur fand er den Weg zum Schreibtisch immer seltener. Die Blicke aus dem Fenster wurden immer länger, der teure Stuhl schien von Monat zu Monat unbequemer zu werden, und immer öfter kamen ihm die Bücher auf der großen Schreibtischplatte wie plumpe Gegenstände vor, welche die beruhigende Leere störten.
Seit das so geworden war, blickte er auf die Wissenschaft wie durch eine Wand aus Glas, die ihn zu einem bloßen Zuschauer machte. Etwas wissenschaftlich herausfinden: Er hatte einfach keinerlei Bedürfnis mehr danach. Das Interesse am methodischen Untersuchen, am Analysieren und Entwickeln von Theorien, bisher eine Konstante, ein unbefragtes, selbstverständliches Element in seinem Leben und in gewisser Weise dessen Gravitationszentrum – dieses Interesse war ihm ganz und gar abhanden gekommen, und zwar so vollständig, daß er nicht mehr sicher war zu verstehen, wie das einmal hatte anders sein können. Wenn jemand von einer neuen Idee sprach, einem ersten Einfall, so konnte er manchmal noch zuhören; aber nur für kurze Zeit, und die Ausarbeitung interessierte ihn dann schon nicht mehr, kam ihm vor wie vergeudete Zeit.
Manchmal versuchte er sich einzureden, daß alles an jenem klaren, weißen, schrecklichen Tag im Januar begonnen hatte, als er Agnes zum letztenmal gesehen hatte, so entsetzlich, so unwiderruflich still. Er hätte sich dann als einen sehen können, der immer noch unter Schock stand, als einen nur langsam Genesenden. Das hätte der Sache die Spitze genommen.
Aber es stimmte nicht. Zwar stellte er verwundert und auch beunruhigt fest, daß er vergessen hatte, wann genau es angefangen hatte. Aber es war lange davor gewesen, da war er sich ganz sicher. Es waren kleine Veränderungen in der Art gewesen, wie er gefühlsmäßig auf die Dinge reagiert hatte, die mit dem Beruf zusammenhingen, Gefühlsschattierungen, winzige Änderungen in der Tönung, die sich über die Monate und Jahre zu etwas Einschneidendem aufsummiert hatten, das dann eines Tages in aller Klarheit ins Bewußtsein getreten war. Der Beginn lag in einer Zeit, als er, von außen betrachtet, auf der Höhe seiner Produktivität war und niemand auf die Idee gekommen wäre, daß hinter dieser Fassade etwas zu bröckeln begann und auf lautlose Weise zerfiel.
Er hatte zu vergessen begonnen. Nicht so, daß es einem anderen aufgefallen wäre. Es gab keine Lücken im Gefüge der wissenschaftlichen Routine. Aber ihm selbst fiel zunehmend auf, daß ihm Fragestellungen verlorengingen, vor allem solche, die noch nicht eingeschliffen waren und noch nicht zum festen rhetorischen Bestand des Fachs gehörten – die neuen und interessanten Fragestellungen also, die gerade deshalb, weil sie noch nicht so gut verankert waren, stetige Aufmerksamkeit erfordert hätten. Er war, wenn er zufällig in seinen Unterlagen blätterte, überrascht, was er da fand, und erschrocken, daß er es einfach vergessen hatte.
Das Schlimmste war: Er war sicher, daß es sich nicht um etwas Vorübergehendes handelte, um eine Krise, von der man wissen konnte, daß sie vorbeigehen würde, wenn auch nicht wann und auf welche Weise. Es fühlte sich bedrohlich an, aber er wußte, daß das, was da mit ihm geschah, unumkehrbar war und unentrinnbar. Hinter dem Gefühl der Bedrohung, das fand er erst allmählich heraus, gab es in guten Momenten das befreiende, fast beglückende Staunen darüber, daß sich in ihm etwas entwickelte, und zwar etwas im Zentrum, im Kern seines Lebens. Aber diese hin und wieder durchschimmernde Empfindung milderte die Angst in keiner Weise. Es gab gewissermaßen keine Berührung zwischen den beiden Empfindungen, sie liefen unverbunden nebeneinander her. Und es erging ihm merkwürdig mit diesem Gefühl, nach dem er immer öfter zu greifen versuchte, das sich aber als unstet und unzuverlässig erwies: Er war sich nie sicher, ob es eine echte Empfindung war oder eine, die er in sich heraufbeschwor und gewissermaßen erfand, um etwas zu haben, an dem er sich festhalten konnte, wenn die gespürte Veränderung ihn zu sehr ängstigte.
Als er wieder ins Buch sah und sich abfragte, stellte er fest, daß er nur ein einziges russisches Wort für müssen behalten hatte. Er gab auf und griff zum anderen Buch, das er aus dem Zimmer mitgenommen hatte, als er beschloß, die letzten freien Stunden auf der Terrasse des Hotels zu verbringen. Es war Robert Walsers Jakob von Gunten, ein Buch, das ihm gestern morgen vor dem Regal plötzlich wie der ideale Begleiter erschienen war, obgleich er es seit vielen Jahren nicht mehr in der Hand gehabt hatte und die Erinnerung an die Titelfigur und das Institut Benjamenta blaß und vage geworden war. Er war auf der Reise mehrmals kurz davor gewesen, es aufzuschlagen, hatte dann aber jedesmal eine sonderbare, unerklärliche Scheu empfunden, die seiner Neugierde im Wege stand. Als ob in dem Buch etwas über ihn stünde, das er lieber nicht wissen wollte.
Der erste Satz verschlug ihm den Atem: Man lernt hier sehr wenig, es fehlt an Lehrkräften, und wir Knaben vom Institut Benjamenta werden es zu nichts bringen, das heißt, wir werden alle etwas sehr Kleines und Untergeordnetes im späteren Leben sein. Wie betäubt blickte Perlmann dem Kellner nach, der dem rothaarigen Mann am Schwimmbecken auf einem silbernen Tablett ein Getränk brachte. Es vergingen Minuten, bevor er den Mut fand weiterzulesen, widerstrebend und gleichzeitig fasziniert von diesen erschütternden Sätzen, die mit gespenstischer Leichtigkeit hingeschrieben waren. Und dann, nach wenigen Seiten, kam eine Stelle, die er empfand, als schlüge ihn jemand ins Gesicht: Herr Benjamenta fragte mich, was ich wolle. Ich erklärte ihm schüchtern, daß ich wünsche, sein Schüler zu werden. Darauf schwieg er und las Zeitungen.
Der letzte Satz, nein, er durfte nicht dastehen. Er war in seiner Harmlosigkeit ein Satz, den man nicht aushalten konnte. Perlmann legte das Buch weg. Nur langsam nahm das Pochen seines Bluts ab. Er begriff nicht warum, aber der Bericht des Zöglings Jakob schien in gewissem Sinne von ihm selbst zu handeln. Auf einmal war er ganz sicher, daß der Text, der zustande käme, wenn es ihm gelänge, seine eigene Not in Sätze zu fassen, einen verwandten Ton hätte. Es müßten Sätze von ebenbürtiger Eindringlichkeit sein und genauso schneidend, wollten sie wirklich einfangen, wie es ihm nun schon seit Jahren ging, wenn er den Hörsaal betrat.
Lampenfieber war es nicht. Es war nicht die Angst, plötzlich ins Publikum oder vor sich aufs Pult zu starren und alles vergessen zu haben. Unter dieser Vorstellung hatte er früher gelitten, aber das war seit langem vorbei. Es war etwas anderes, etwas, das er erst nach langer Zeit und mit einem stillen Erschrecken erkannt hatte: das ganz präzise Gefühl, daß er nichts zu sagen hatte. Im Grunde fand er es albern, daß er jede Woche von neuem unter den erwartungsvollen Blicken der Studenten den Mittelgang des Hörsaals hinunterging. Beinahe mit jeder Stufe wuchs die Empfindung, daß er ihnen die Zeit stahl.
Er schlug dann die Notizen auf und fing an zu reden, routiniert und flüssig, er war bekannt dafür, frei sprechen zu können wie gedruckt. Die Studenten mochten ihn, oftmals kamen nachher mehrere nach vorne zum Pult und wollten mehr wissen. Das war besonders schlimm. Während der Vorlesung hatte ihn der leere Raum zwischen Pult und Bänken geschützt, hatte gewirkt wie ein Wandschirm, hinter dem er sein fehlendes Interesse, diesen Makel, verbergen konnte. Wenn die Studenten dann vor ihm standen, fühlte er sich schutzlos und hatte Angst, sie könnten ihm ansehen, daß er nicht mehr dabei war. Er flüchtete sich in einen beflissenen Eifer, holte viel zu weit aus, füllte noch einmal eine Tafel und versprach, beim nächstenmal die entsprechenden Bücher mitzubringen. Nicht selten waren es seine eigenen, die er den Studenten in die Hand drückte wie Bestechungsgeschenke. Sie fühlten sich ernst genommen, verstanden. Ein engagierter Professor. Sie hatten das Bedürfnis, ihn auch persönlich kennenzulernen und luden ihn zu ihrem Stammtisch ein.
Die ersten Gäste von auswärts trafen ein, um im Hotel zu Mittag zu essen. Perlmann nahm die Bücher und ging aufs Zimmer. Beim Schließen der Tür fiel sein Blick auf den Preisanschlag, und er zuckte zusammen. Das Zimmer kostete an die dreihundert Mark pro Tag. Für eine einzige Person belief sich der Aufenthalt also auf fast zehntausend Mark, die großen Mahlzeiten nicht gerechnet. Mal sieben. Gut, für die Firma Olivetti war das vermutlich kein Betrag, und Angelini würde schon wissen, was er tat, wenn er sie im teuersten Hotel des Orts unterbrachte. Vielleicht hatte er auch einen Rabatt ausgehandelt. Trotzdem hielt Perlmann das Gesicht unter den glänzenden Wasserhahn aus Messing und wusch sich danach lange die Hände. Er wäre von sich aus nie in einem solchen Hotel abgestiegen, selbst wenn Geld für ihn keine Rolle gespielt hätte. Er wußte einfach, daß er hier nicht hingehörte. Und er begann zu schwitzen, wenn er an sein schäbiges Heft aus schwarzem Wachstuch dachte, das alles war, was er dagegenzusetzen hatte, eine lose Sammlung von Aufzeichnungen, die er zudem schon lange nicht mehr angesehen hatte. Er kam sich vor wie ein Hochstapler, beinahe wie ein Dieb.
Das war der Grund, warum in keiner Fassung seiner Fluchtgedanken der Vorsatz fehlte, die Rechnung für sein Zimmer selbst zu begleichen. Zwar wäre das unter diesen Umständen eine Demonstration. Die anderen würden daran erkennen können, daß nicht höhere Gewalt ihn zu diesem Schritt gezwungen hatte, sondern daß sein sonderbares Handeln etwas mit seiner Einstellung zur Gruppe zu tun haben mußte. Und das war ihm unangenehm: Es lief seinem Bedürfnis zuwider, möglichst wenig von sich preiszugeben und möglichst alles im dunkeln zu lassen. Aber er wollte nichts schuldig bleiben; wenigstens in dieser Hinsicht wollte er die Dinge wieder in Ordnung bringen.
Zögernd öffnete er den Handkoffer und begann, die Bücher sorgfältig auf dem Schreibtisch aufzubauen. Er hatte sich schwergetan, als er vorgestern abend endlich darangegangen war, eine Auswahl zu treffen. Deutlicher noch als sonst war ihm dabei zu Bewußtsein gekommen, daß er seit längerem keine wissenschaftlichen Vorhaben mehr hatte. Wie sollte man in einer solchen Lage entscheiden, was mitzunehmen war und was nicht. Eine ganze Weile hatte er dagesessen und mit dem kühnen Gedanken gespielt, ohne alle Fachbücher hinzufahren, nur mit einigen Romanen. Aber so befreiend die Vorstellung auch war, das konnte er nicht riskieren. Für den Fall, daß sie ihn hier im Zimmer besuchten, mußte er eine Fassade aufbauen, eine Tarnung. Worauf es ankam, war, unerkannt zu bleiben mit seiner Not. Schließlich hatte er eine Reihe von Büchern eingepackt, die im Laufe der letzten Monate eingetroffen und ungelesen liegengeblieben waren. Es waren Bücher, die sich jeder anschaffen würde, der in diesem Fach tätig war. Er hatte es vor sich selbst noch nicht gewagt, mit solchen Routinekäufen aufzuhören, obwohl ihn das Geld zu reuen begann – eine Empfindung, über die er erschrak, denn seit der Schulzeit war es ihm immer eine Selbstverständlichkeit gewesen, daß für Bücher keine Summe zu schade war.
Der Schreibtisch war breit genug für die Bücher, und wenn man sie nach hinten an die Wand schob, mit schweren Bänden an den Seiten, war das Ganze stabil, und es blieb genügend Platz zum Schreiben. Den Computer mitzubringen, das kleine Gerät mit dem riesigen Speicher für all die ungeschriebenen Texte, das hatte er nicht fertiggebracht; es wäre ihm als der Gipfel der Verlogenheit vorgekommen. Perlmann legte Bleistifte, ein Lineal und seinen besten Kugelschreiber auf die Glasplatte, dazu einen Stoß weißer Blätter. Morgen früh mußte er unbedingt zu arbeiten beginnen. Ich habe keine Ahnung, was. Aber ich muß anfangen. Um jeden Preis.
Das sagte er sich nun schon seit Monaten. Und doch war es nicht dazu gekommen. Statt dessen hatte er viele Stunden am Tag weiter an seinem Russisch gearbeitet. Das verband ihn mit Agnes. Unterstützt von Musik, die sie beide liebten, hatte er sich in einen inneren Raum zurückgezogen, in dem auch sie am Tisch saß und ihn wie gewohnt abfragte, lachend, wenn sie wieder einmal schneller begriff als er. Darüber war die Fachliteratur liegengeblieben und hatte sich auf einer Ablage zu stapeln begonnen, griffbereit und doch nie angerührt, eine stetige Mahnung. Auf dem Schreibtisch lagen fast nur noch die Sprachbücher. Nur wenn er Kollegen zu Besuch hatte, bei denen die Gefahr bestand, daß sie das Arbeitszimmer betraten, arrangierte er die große Unordnung eines Wissenschaftlers mitten in der Arbeit, mit Bergen von aufgeschlagenen Büchern und Manuskripten. Es war jedesmal ein Kampf zwischen Angst und Selbstachtung, und es war immer die Angst, die siegte.
Zwischendurch hatte es regelmäßig Korrespondenz wegen der Forschungsgruppe gegeben. Anfragen wegen praktischer Einzelheiten waren zu beantworten und offizielle Bestätigungen zu schreiben gewesen. Er hatte das in seinem Büro in der Universität erledigt. Zu Hause hatte nichts an den unaufhaltsam näher rückenden Aufbruch erinnert, und er war routiniert geworden, geradezu virtuos, daran nicht zu denken.
Für seine Vorlesungen benutzte er seit langem schon alte Manuskripte, die ihm fremd geworden waren, und bisweilen war er sich dabei vorgekommen wie sein eigener Pressesprecher. Kam dann eine unerwartete Zwischenfrage aus dem Publikum, die ihn in Bedrängnis brachte, so verschaffte er sich eine Atempause, indem er mit gezielter Langsamkeit Dinge sagte wie:«Wissen Sie, das ist so:...», oder:«Das ist eine gute Frage...»Es waren entfremdete Formeln, die er früher niemals gebraucht hätte, und er haßte sich für sie. In den Seminaren lebte er von der Hand in den Mund und verließ sich auf sein Gedächtnis. Er war ein Routinier, er dachte und reagierte schnell, und wenn es sein mußte, weil er nichts Substantielles mehr auf der Hand hatte, konnte er ein rhetorisches Feuerwerk abbrennen. Studenten waren damit immer noch zu beeindrucken. Im Alltag des Lehrbetriebs, das dachte er fast jedesmal beim Verlassen des Übungsraums, würde seine Tarnung halten.
Doch dies hier war etwas ganz anderes. In weniger als drei Stunden kamen Leute an, denen man nichts vormachen konnte, Leute, die nicht mit derartigen Empfindungen zu kämpfen hatten, ehrgeizige Leute, die an die Rituale der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und an die Situation fortwährender Konkurrenz gewöhnt waren. Sie kamen mit neuen eigenen Arbeiten, mit dicken Manuskripten, mit Projekten und Perspektiven, und sie brachten hohe Erwartungen an die anderen mit, und eben auch Erwartungen an ihn, Philipp Perlmann, den prominenten Linguisten. Diese Erwartungen machten sie für ihn zu einer Bedrohung, sie wurden dadurch zu seinen Gegnern, ohne daß sie davon etwas ahnen konnten. Menschen wie sie besaßen ein sehr feines Gespür für alles, was mit der sozialen Wirklichkeit ihrer Wissenschaft zu tun hatte, sie registrierten mit seismographischer Genauigkeit, wenn etwas nicht stimmte. Sie werden merken, daß ich nicht mehr dabei bin. Daß ich nicht mehr zu ihnen gehöre. Und früher oder später in diesen fünf Wochen würde es herauskommen: Ausgerechnet er, der Leiter der Gruppe, der Regisseur des Ganzen, würde mit leeren Händen dastehen – wie einer, der seine Schulaufgaben nicht gemacht hatte. Sie würden ungläubig reagieren, es würde ein stiller Skandal. Gewiß, eine Fassade von Freundlichkeit würde bestehen bleiben; aber es würde eine Freundlichkeit sein, die tötete, weil derjenige, dem sie galt, die Gewißheit hatte, daß sie ein bloßes Ritual war, das die stillschweigende Ächtung nicht zu mildern vermochte.
Es war jetzt kurz nach eins. Perlmann hatte einen flauen Magen; aber die Vorstellung, unten in dem vornehmen Speisesaal zu sitzen und mit Besteck aus Silber zu essen, war unerträglich. Und auch sonst ekelte ihn der Gedanke an Essen. Es kam ihm in diesem Augenblick vor, als könnten Flauheit und Hunger so groß werden, wie sie wollten: Essen würde er erst wieder auf dem Heimflug, an jenem Punkt in der Zeit, der in so entsetzlich weiter Ferne lag.
Er legte sich aufs Bett. Brian Millar war jetzt in Rom. Seine Maschine aus New York war heute früh dort gelandet, und jetzt traf er sich mit dem italienischen Kollegen, um den Plan für die linguistische Enzyklopädie zu besprechen. Er würde erst am späten Nachmittag nach Genua weiterfliegen. Also noch ein paar Stunden Aufschub bis zu dieser Begegnung. Auch bei Laura Sand würde es später Nachmittag werden, sie mußte zuerst mit dem Zug von Oxford nach London fahren und flog dann über Mailand. Es mußte alles ziemlich anstrengend für sie sein, denn sie war eben erst von ihren Tieren in Kenia zurückgekommen. Ob sie sich treu blieb und auch hier ganz in Schwarz ankam? Adrian von Levetzov hatte sich für den frühen Nachmittag angekündigt; in seiner gespreizten, barocken Art hatte er etwas von einem Direktflug Hamburg-Genua geschrieben. Frau Hartwig hatte über den scharfen Kontrast lachen müssen, in dem sein vornehmes Briefpapier zu Achim Ruges abgerissenem Zettel stand, auf dem er quer über mehrere Kaffeeflecke hinweg mitteilte, er müsse noch die Arbeit in seinem Bochumer Labor für die Zeit seiner Abwesenheit organisieren und könne nicht sagen, ob er Dienstag oder erst Mittwoch komme. Wann Giorgio Silvestri sich in der Klinik in Bologna freimachen konnte, war ungewiß, er wollte auf jeden Fall versuchen, zum Abendessen hier zu sein. Perlmann war sich nach dem Telefongespräch unsicher gewesen, ob er seine verrauchte Stimme mochte oder nicht. Angelinis Hinweis auf ihn war sehr zurückhaltend gewesen, und er wußte eigentlich nicht genau, warum er ihn eingeladen hatte. Vielleicht einfach, weil Agnes gesagt hatte, Sprachstörungen bei Psychosen, das müsse doch interessant sein.
Die erste würde Evelyn Mistral sein. Der Zug aus Genf sollte um halb zwei in Genua ankommen. Er werde es nicht bereuen, hatte ihm ihr Chef geschrieben, als er sie an seiner Stelle vorschlug, weil er selbst sich einer Operation unterziehen mußte. Man werde in der Entwicklungspsychologie noch viel von ihr hören. Die Liste ihrer Veröffentlichungen war für jemanden, der erst neunundzwanzig war, beeindruckend. Aber der Stapel ihrer Sachen, den Frau Hartwig ihm auf den Schreibtisch gelegt hatte, war ungelesen geblieben. Das einzige, was er von ihr kannte, war ihre Stimme am Telefon, eine unerhört helle Stimme mit einem abgeschliffenen spanischen Akzent.
Die Höflichkeit gebot, daß er als der Gastgeber unten auf sie wartete. Aber es dauerte fünf weitere, bleierne Minuten, bis er sich schließlich erhob. Als er zum Sessel hinüberging, um die Jacke zu holen, stolperte er über den leeren Handkoffer. Er wollte ihn zumachen und wegstellen, da bemerkte er Leskovs Text, der halb verborgen in einer Seitentasche steckte, ein dickes Typoskript in russisch, eine schlechte Fotokopie in einem ungewöhnlichen Papierformat, vom Transport an den Ecken eingeknickt und auch sonst zerknittert. Der Text hatte dem Brief beigelegen, in dem Leskov mitteilte, er habe keine Ausreisegenehmigung erhalten und hätte nun ohnedies nicht kommen können, da seine Mutter plötzlich schwer erkrankt sei. In dem Text gehe es um das, woran er gerade arbeite, hatte er geschrieben, und er hoffe, auf diese Weise wissenschaftlich mit ihm in Verbindung bleiben zu können. Es war eine Schmeichelei, ihm diesen Text zu schicken, hatte Perlmann gedacht, so weit war er mit dem Russischen noch längst nicht. Er hatte ihn weggelegt und vergessen. In die Hand gefallen war er ihm erst wieder am Sonntagabend beim Packen. Es ist Unsinn, hatte er gedacht; aber der Gedanke, einen russischen Text bei sich zu haben, hatte ihm irgendwie gefallen, es war etwas Exotisches und dadurch Intimes, und so hatte er ihn am Ende doch eingesteckt, zusammen mit dem russischen Taschenwörterbuch.
Als er ihn jetzt in der Hand hielt, kam ihm der Text plötzlich als etwas vor, mit dem er sich gegen die anderen abgrenzen und verteidigen konnte. Sich diesen Text zu erschließen, es wenigstens zu versuchen, das war doch ein Vorhaben für die kommenden Wochen. Es war etwas, in das er sich in der freien Zeit zurückziehen konnte, ein innerer Bezirk, in den die anderen nicht einzudringen vermochten und aus dem heraus er sich gegen ihre Erwartungen wehren würde, eine innere Festung, in der er unverwundbar war durch ihr Urteil. Wenn er sich darin aufhielt, und es erschloß sich ihm ein russischer Satz nach dem anderen, so mochte es ihm sogar gelingen, dem großen Gebirge der Zeit einige Momente der Gegenwart abzutrotzen. Und wenn er dann, nach den verbleibenden zweiunddreißig Tagen, wieder am Flugzeugfenster saß und die Schleife genoß, in der die Maschine über dem Meer hochstieg, so konnte er sich sagen, daß er nun viel besser Russisch konnte als vorher, so daß er diese Zeit doch nicht gänzlich verloren hatte.
Perlmann nahm den Text und das Wörterbuch, und als er die Treppe hinunterging und Signora Morelli zunickte, war sein Schritt leichter als in den Tagen zuvor. Er setzte sich unter dem Säulenvorbau des Eingangs in einen Korbsessel und betrachtete die Überschrift, die Leskov von Hand in großen, sorgfältig gemalten Buchstaben hingeschrieben hatte: O ROLI JAZYKA V FORMIROVANII VOSPOMINANIJ. Er brauchte nur einmal nachzuschlagen, dann hatte er es: ÜBER DIE ROLLE DER SPRACHE IN DER BILDUNG VON ERINNERUNGEN.
Das kam ihm bekannt vor. Richtig, darum war es auch damals bei ihrem Gespräch in St. Petersburg gegangen. Er sah sich mit Vasilij Leskov an einem Fenster des Winterpalastes stehen und auf die gefrorene Neva hinausblicken. Agnes’ Tod lag erst zwei Monate zurück, und es war ihm überhaupt nicht danach gewesen, zu einem Kongreß zu fahren. Aber als er die Einladung zu dieser Sache seinerzeit erhalten hatte, war Agnes sofort Feuer und Flamme gewesen, dann können wir doch unser Russisch ausprobieren, und nun war er gefahren, weil es ihm trotz des Schmerzes das Gefühl gab, mit ihr verbunden zu sein. Leskov und er waren beide nach Sitzungsbeginn im Foyer des Konferenzgebäudes sitzen geblieben und waren so ins Gespräch gekommen, es war, dachte er, ähnlich gewesen wie damals mit Angelini. Leskov war ihm am Anfang gar nicht sympathisch gewesen, ein schwerer, etwas schwammiger Mann mit groben Gesichtszügen und Glatze, begierig, mit Kollegen aus dem Westen zu sprechen, und deshalb in seinem Verhalten beflissen, beinahe unterwürfig. Er redete wie ein Wasserfall, und Perlmann, der lieber seine Ruhe gehabt hätte, fand ihn zuerst aufdringlich und lästig. Doch dann hatte er aufgehorcht: Was dieser Mann in manchmal antiquiertem, aber beinahe fehlerfreiem Deutsch über die Rolle von Sprache für das Erleben, vor allem das Erleben von Zeit, sagte, fing an, ihn zu fesseln. Er beschrieb Erfahrungen, die Perlmann seit langem vertraut waren, ohne daß es ihm gelungen wäre, sie so treffsicher, nuanciert und zusammenhängend zu beschreiben wie dieser Russe, der mit dem feuchten Pfeifenstiel zwischen den klobigen Fingern ständig in der Luft herumfuchtelte. Sehr bald spürte Leskov Perlmanns wachsendes Interesse, er war glücklich darüber und schlug vor, ihm etwas von der Stadt zu zeigen.
Er führte ihn quer durch die Stadt zum Winterpalast. Es war ein klarer, sonniger Vormittag Anfang März, Perlmann erinnerte sich vor allem an die Häuser in einem hellen, verwaschenen Ocker, das von der Sonne zum Leuchten gebracht wurde, in seiner Erinnerung bestand ganz St. Petersburg aus dieser Farbe. Leskov neben ihm zeigte viel, erklärte viel, ein Mann in einem abgewetzten, grünen Lodenmantel, mit Pelzmütze und Pfeife, der sich mit schwerfälligen, umständlichen Schritten fortbewegte, mit den Armen rudernd und ein bißchen schnaufend. Perlmann hörte oft nicht zu, seine Gedanken waren bei Agnes, die sich immer wieder vorgenommen hatte, zum Fotografieren hierherzufahren, am liebsten im Sommer während der weißen Nächte. Manchmal blieb er stehen und versuchte, einen Ausschnitt seines Gesichtsfeldes mit ihren Augen zu sehen, ihren Schwarzweiß-Augen, denen es nur um Licht und Schatten gegangen war. Auf diese Weise, dachte er, als er jetzt in dem Text blätterte, war eine merkwürdige assoziative Verbindung zwischen Agnes und diesem Russen entstanden: Leskov als Fremdenführer auf Perlmanns imaginärem Spaziergang mit Agnes durch St. Petersburg.
Die Stunden im Winterpalast dann, in der Eremitage, schufen eine sonderbare Intimität zwischen den beiden Männern. Perlmann verriet seinem Begleiter, der ihm ja doch sehr fremd war, daß er dabei war, Russisch zu lernen, worauf Leskov über das ganze Gesicht strahlte und sofort Russisch weiterredete, bis er merkte, daß Perlmann in keiner Weise folgen konnte. Leskov kannte die Bilder, die hier versammelt waren, sehr genau, er wies auf manches hin, was man sonst bei einem ersten Rundgang nicht bemerken würde, und von Zeit zu Zeit sagte er etwas Einfaches auf russisch, langsam und deutlich. Perlmann verlebte diese Stunden in einer Stimmung, in der sich die Wirkung der Bilder und die Freude über verstandene russische Sätze mit dem Schmerz darüber mischten, daß er all das Agnes nicht mehr würde erzählen können, daß er ihr nie mehr irgend etwas würde erzählen können.
Er hatte der Versuchung widerstanden, aus dieser Stimmung heraus von Agnes zu sprechen; was ging das diesen Russen an. Erst als sie von der anderen Seite des Flusses, von der Peter-Pauls-Festung aus auf den Winterpalast blickten, fing er davon an, ausgerechnet jetzt, da die frühere Intimität in der schneidend kalten Luft verflogen war. Es geschah gegen seinen Willen, und er war wütend, als er sich zu allem Überfluß auch noch davon sprechen hörte, wie schwer es ihm seither falle, in der Wissenschaft weiterzumachen. Zum Glück begriff Leskov seine Äußerungen nicht in ihrer vollen Bedeutung. Er erwiderte nur, das sei doch ganz natürlich nach einem solchen Verlust, und fügte beinahe väterlich hinzu, das werde sich bestimmt wieder geben. Und dann, aus der erneut entstandenen Intimität heraus, erzählte er ihm, daß er als Dissident im Gefängnis gewesen war. Er sagte nicht, wie lange, und auch sonst erzählte er keine Einzelheiten. Perlmann wußte nicht, wie er auf diese Mitteilung reagieren sollte, und es entstand für einen Moment eine unbehagliche Pause, die Leskov schließlich beendete, indem er ihn am Oberarm faßte und mit unpassender, künstlicher Munterkeit vorschlug, sie sollten doch du zueinander sagen. Perlmann war froh, daß Leskov danach bald nach Hause mußte, um nach seiner alten Mutter zu sehen, bei der er wohnte, und daß er ihn nicht etwa einlud mitzukommen. Auf die Einladung nach Santa Margherita, die Perlmann ihm wenige Wochen danach schickte, hatte er mit einem überschwenglichen Brief geantwortet: Er werde umgehend eine Ausreisegenehmigung beantragen. Vor drei Monaten dann war die deprimierte Absage gekommen, der dieser Text beigefügt war.
Den ersten Satz verstand Perlmann auf Anhieb. Im zweiten kamen zwei Wörter vor, die ihm noch nie begegnet waren; aber eigentlich war klar, was sie bedeuten mußten. Der dritte Satz war ihm von der Konstruktion her undurchsichtig, aber er las weiter, über eine Reihe unbekannter Wörter und Wendungen hinweg bis zum Ende des ersten Absatzes. Von Satz zu Satz wurde er aufgeregter, und jetzt war es bereits wie ein Fieber. Ohne den Blick vom Blatt zu nehmen, suchte er in der Jackentasche nach einem Bonbon. Dabei bekam er die Schachtel Zigaretten zu fassen, die er gestern bei der Ankunft auf dem Flughafen gekauft hatte. Zögernd legte er sie auf den Bistrotisch zum Wörterbuch und nahm sie dann wieder in die Hand. Es war gestern wie unter Zwang geschehen, daß er sie gekauft hatte, und genau in dem Moment, als ihn das Gefühl überfallen hatte, daß er nun unwiderruflich hier angekommen war – daß es nun keine Lücke mehr gab, weder im Raum noch in der Zeit, die ihn vom Beginn dieses Aufenthalts trennte, und daß damit nicht mehr die geringste Möglichkeit übrigblieb, daß es vielleicht doch nicht dazu käme. Es war ihm wie eine Niederlage vorgekommen, als er die Packung entgegennahm, und er hatte, als er sie einsteckte, die dumpfe Empfindung eines drohenden und unaufhaltsamen Unheils gehabt.
Es war seine alte Marke, die er bis vor fünf Jahren geraucht hatte. Die freudige Aufregung über den unerwarteten Erfolg beim Lesen von Leskovs Text verfärbte sich und verschmolz mit der prickelnden Angst vor dem Verbotenen, als er jetzt mit zittrigen Fingern eine Zigarette zwischen die Lippen steckte. Das trockene Papier fühlte sich auf unheilvolle Weise vertraut an. Er ließ sich Zeit. Er konnte es immer noch sein lassen, sagte er sich mit klopfendem Herzen. Aber sein Selbstvertrauen, das spürte er überdeutlich, lief aus wie durch ein Leck.
Er merkte, daß er kein Feuer hatte, und war erleichtert über diesen Aufschub. Für einen Moment gewann er etwas Selbstvertrauen zurück. Er nahm die Zigarette aus dem Mund und dachte an den Urlaubstag damals auf der Klippe, im Wind. Agnes und er hatten sich angesehen und dann gleichzeitig ihre brennenden Zigaretten ins Meer geworfen, die vollen Schachteln hinterher, und sie hatten über die pathetische Geste gelacht. Ein gemeinsamer Sieg, ein glücklicher Tag.
Plötzlich stand der Terrassenkellner neben ihm und hielt ihm ein brennendes Streichholz hin. Ein Gefühl der Wehrlosigkeit ergriff Besitz von ihm. Die Dinge entglitten ihm. Er tat seinen ersten Zug seit fünf Jahren und bekam sofort einen Hustenanfall. Der Kellner warf ihm einen überraschten und besorgten Blick zu und entfernte sich. Der zweite Zug war schon leichter, es kratzte noch, aber es war bereits ein vollständiger Zug. Jetzt rauchte er in langsamen, tiefen Zügen, mit halbgeschlossenen Augen. Das Nikotin begann, durch den Körper zu strömen. Er verspürte einen sanften Schwindel, gleichzeitig fühlte er sich leicht und ein bißchen euphorisch. Freilich war es eine Euphorie, die mit dem Eindruck des Künstlichen einherging, dem Gefühl, daß dieser Zustand in ihm entstand, ohne ihm eigentlich anzugehören, ohne wirklich sein eigener zu sein. Und dann auf einmal fiel alles in sich zusammen, und ihm wurde jämmerlich schlecht.
Hastig drückte er die Zigarette aus und ging mit unsicheren Schritten hinüber zum Schwimmbecken, wo er sich auf einem Liegestuhl ausstreckte und die Augen schloß. Er fühlte sich erledigt, noch bevor irgend etwas begonnen hatte. Nach einer Weile wurde er ruhiger, er war erleichtert, daß nichts mehr pulsierte und sich drehte, und allmählich glitt er in einen Halbschlaf. Er erwachte erst, als über ihm eine sehr helle Stimme mit spanischem Akzent auf englisch sagte:«Entschuldigen Sie die Störung, aber der Kellner sagte mir, Sie seien Philipp Perlmann. »
2
Sie hatte ein strahlendes Lachen, wie er es noch niemals gesehen hatte, ein Lachen, in dem die ganze Person aufging und das jeden Widerstand brechen würde. Er richtete sich auf und blickte in ein ovales Gesicht mit hochstehenden Backenknochen, weit auseinanderliegenden Augen und einer breiten Nase, fast ein orientalisches Gesicht. Das blonde Haar fiel gerade herunter auf ein weißes, schief sitzendes T-Shirt, es war unfrisiertes, lebendiges Haar, ein bißchen wie Stroh.
Perlmann hatte einen trockenen Mund und fühlte sich noch etwas wacklig, als er sich erhob und ihr die Hand gab.
«Sie müssen Evelyn Mistral sein», sagte er,«es tut mir leid, ich muß einen Moment eingenickt sein. »Als erstes eine Entschuldigung.
«Aber das macht doch nichts», lachte sie,«hier ist es ja wirklich wie im Urlaub.»Sie zeigte auf die hohe Fassade des Hotels mit den gemalten Giebeln über den Fenstern, den türkisfarbenen Fensterläden und den Wappen in den Farben verschiedener Nationen.«Das ist alles so schrecklich mondän, hoffentlich lassen sie mich mit meinem Koffer überhaupt rein!»
Es war ein uralter, zerkratzter Koffer aus schwarzem Leder, mit hellbraunen Kanten, die an einigen Stellen eingerissen waren, und mitten auf den Deckel hatte sie einen grellroten Elefanten geklebt. Einen solchen Koffer könnte auch Kirsten mit sich herumschleppen, das würde zu ihr passen. Überhaupt erinnert sie mich irgendwie an meine Tochter, obwohl sich die beiden gar nicht ähnlich sehen.
Sie war im Zug erste Klasse gefahren und war auf jungmädchenhafte Art beeindruckt. Man komme sich so wichtig vor, meinte sie, so gut sei sie von einem Schaffner noch nie behandelt worden. Daraufhin hatte sie sich im Speisewagen ein üppiges Mittagessen geleistet. Im Lokalzug von Genua nach Santa Margherita hatte es keine Erstklaßwagen gegeben, und es war ihr ganz komisch vorgekommen, plötzlich wieder in einem schäbigen Zweite-Klasse-Abteil zu sitzen. Wie schnell man doch korrumpiert werde!
Perlmann nahm den Koffer und begleitete sie zum Empfang. Sie ging leicht in ihrem verwaschenen Khaki-Rock, fast tänzelte sie ein wenig in den flachen, hellroten Lackschuhen, und doch hatte ihr Gang auch etwas Zögerndes, Linkisches. Sie wurde von Signora Morelli begrüßt, die, wie gestern auch, ein dunkelblaues, sportlich geschnittenes Kleid und dazu ein weinrotes Halstuch trug, was ihr das Aussehen einer Chefstewardeß gab, ein Eindruck, der dadurch verstärkt wurde, daß sie ihr Haar zu einer strengen Frisur aufgesteckt hatte. Evelyn Mistral redete italienisch, wobei sie die Vokale wie im Spanischen kurz und herb aussprach, in scharfem Kontrast zu Signora Morellis gedehntem Singsang. Während sie sich, an die Theke gelehnt, einschrieb, spielten ihre Füße mit den roten Schuhen. Einmal lachte sie laut auf, und da hatte ihre Stimme wieder die Helligkeit, die Perlmann vom Telefon her in Erinnerung hatte.«Bis später», sagte sie zu ihm, als der Page den Koffer nahm und ihr zum Lift vorausging.
Perlmann ging langsam über die weitläufige Terrasse zurück zum Schwimmbecken. Jetzt war auch der rothaarige Mann von heute morgen wieder dort. Perlmann erwiderte seinen leutseligen Gruß mit einer knappen Handbewegung und setzte sich auf der anderen Seite in einen Liegestuhl. Er überließ sich einem Gefühl, das eigentlich nur die Abwesenheit von Angst war. Zum erstenmal seit seiner Ankunft stemmte er sich nicht gegen die Dinge, die ihn umgaben: die schräg gewachsenen Pinien, die auf die Uferstraße hinausragten; die Fahnen entlang der Balustrade; den roten Smoking des Kellners; den Geruch von Pinienharz und den Rest von sommerlicher Hitze in der Luft. Jetzt war es ihm möglich zu sehen, daß der Wein an der Pergola rötlich wurde. Agnes hätte das als erstes gesehen.
«Sie haben mir ein phantastisches Zimmer gegeben», sagte Evelyn Mistral, als sie das Badetuch auf den benachbarten Liegestuhl fallenließ.«Dort oben, das Eckzimmer im dritten Stock, ein Doppelzimmer mit antiken Möbeln, ich glaube, der Schreibtisch ist aus Rosenholz. Und dann diese Aussicht! So habe ich noch nie gewohnt. Aber der Preis, man darf gar nicht daran denken! Wie soll man sich das bloß verdienen? Jedenfalls hat man an einem solchen Schreibtisch keine Ausrede, nicht zu arbeiten!»
Sie hatte ihren Bademantel ausgezogen und stand am Beckenrand. Der leuchtendweiße Badeanzug aus einem Stück betonte ihre Bräune, ein Braun mit einem gelblichen Schimmer. Mit einem Kopfsprung war sie im Wasser, blieb lange untergetaucht und schwamm dann in dem großen, nierenförmigen Becken ein paarmal hin und her. Das Wasser spritzte kaum, die Bewegungen ihres ruhigen, fast trägen Freistils waren elegant und standen im Gegensatz zu ihrem linkischen Gang. Zwischendurch schwamm sie zu ihm hinüber und legte die Arme auf den Beckenrand.«Warum kommen Sie nicht auch rein? Es ist herrlich!»Dann schwamm sie weiter.
Perlmann schloß die Augen und versuchte, dieses Bild festzuhalten: das glänzende Wasser auf ihrem Lachen; das nasse blonde Haar. Es war auch jetzt nicht anders als sonst: Nie gelang es ihm, die Gegenwart zu erleben, während sie stattfand; stets kam er zu spät mit seinem Erwachen, und dann blieb nur noch der Ersatz, die Vergegenwärtigung, in der er aus lauter Verzweiflung zum Virtuosen geworden war.
So unerwartet wie vorhin, als er ihm Feuer gegeben hatte, stand mit einemmal der Kellner über ihm und reichte ihm Leskovs Text, das Wörterbuch und die Zigaretten.
«Jemand anderes möchte jetzt dort sitzen», sagte er und zeigte hinüber zu den Säulen. Dann suchte er in der Tasche seines Smokings und überreichte Perlmann ein Heftchen Streichhölzer mit der Aufschrift GRAND HOTEL MIRAMARE.
Perlmann legte die Sachen neben sich auf den Boden und sah zu Evelyn Mistral hinüber, die sich jetzt mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken treiben ließ. Das lange Haar, das in dem blauen Wasser brünett aussah, lag wie ein unordentlicher Fächer um ihr Gesicht. Sie hatte die Augen geschlossen, auf den hellen Wimpern schimmerten Wassertröpfchen, und wenn sie aus einem Schattenstreifen wieder in die Sonne glitt, zuckten ihre Lider. Wie früher, wenn er einen Eindruck hatte festhalten wollen, zündete sich Perlmann eine Zigarette an. Das Inhalieren und die Empfindung gesteigerter, ein bißchen gepreßter Lebendigkeit, die dann eintrat, ließ die Illusion entstehen, als könne er das Unmögliche ertrotzen: den Augenblick so lange anzuhalten, bis es ihm gelungen war, sich ihm aufzuschließen und ihm dadurch Tiefe zu geben. Wieder spürte er Schwindel, aber die Empfindung überschritt nicht mehr die Grenze zur Übelkeit, und als die Zigarette zu Ende war, zündete er eine weitere an.
Als Evelyn Mistral aus dem Wasser kam und sich abtrocknete, fiel ihr Blick auf Leskovs Text am Boden.«Ach, Sie können Russisch», sagte sie. Dann kniff sie die Augen zusammen.«Das ist doch Russisch, oder? Das würde ich auch gern können. Wann haben Sie es gelernt? Und wie?»
Perlmann konnte sich nachher nicht erklären, warum er in diesem Augenblick zusammenzuckte, als sei er bei etwas Verbotenem ertappt worden.
«Eigentlich kann ich es gar nicht», sagte er und legte Text und Wörterbuch auf die andere Seite des Liegestuhls, wie um ihr Platz zu machen.«Nur ein paar Wörter. Der Text hier – das ist mehr ein Scherz, den sich jemand erlaubt hat.»Eben lag das Wörterbuch mit der Rückseite zu ihr. Die dunklen Spuren vom vielen Blättern hat sie nicht sehen können.
Was er sonst noch für Fremdsprachen könne, fragte sie, als sie nachher eine seiner Zigaretten paffte.
«Ein bißchen kann ich auch Ihre Sprache», sagte er auf spanisch.
«Aber dann darfst du nicht Sie zu mir sagen», lachte sie.«Usted, das ist viel zu förmlich. Unter Kollegen sagt man das nicht. Und überhaupt sagt man im Spanien nach Franco eher du.»
Danach blieben sie bei Spanisch. Perlmann gefiel ihre spanische Stimme, vor allem die Kehllaute und die Art, wie sie aus dem d am Ende eines Worts einen stimmlosen Laut machte, ähnlich dem englischen th. Es war lange her, daß er Spanisch gesprochen hatte, und er machte viele Fehler. Aber er war froh über diese Sprache. Mit Englisch gelangen ihm schon seit langem keine neuen Erfahrungen mehr, keine Erfahrungen befreiender Fremdheit. Englisch bot ihm nicht mehr die Möglichkeit, sich in einer fremden Sprache umzudichten.
Sie konnte wenig damit anfangen, als er über dieses Thema sprach. Ihr Verhältnis zu Fremdsprachen war nüchterner, praktischer. Gut, sie hatte auch Spaß daran; aber als er von der Möglichkeit sprach, in einer fremden Sprache ein anderer zu werden, obwohl man doch im wesentlichen dasselbe sagte wie in der eigenen, da war sie nur noch eine höfliche Zuhörerin, und Perlmann kam sich vor wie ein Mystiker. Und als er laut überlegte, ob das spanische tú intimer sei als das englische you in Verbindung mit dem Vornamen, oder dasselbe, und wie sich beide, was Intimität betraf, zum deutschen Du verhielten, sah sie ihn zwar neugierig an, aber das Lächeln, das ihren Blick begleitete, ließ erkennen, daß das für sie eher ein Spiel war als eine ernsthafte Frage. Sein Monolog kam ihm plötzlich albern vor, auch kitschig, und er brach ihn abrupt ab, um sie nach ihrer Arbeit zu fragen.
Was jemand sich vorstellen könne, sei nicht unabhängig davon, was er sagen könne, und so sei es auch mit dem, was jemand wollen könne, sagte sie. Immer mehr konzentriere sie sich in ihrer Arbeit mit Kindern auf diesen Zusammenhang zwischen Phantasie, Willen und Sprache; darauf, wie das innere Spiel mit Möglichkeiten in dem Maße raffinierter und einflußreicher werde, als sich die sprachliche Ausdrucksfähigkeit entwickle; und darauf, wie diese Verfeinerung der Phantasie durch Sprache zu einer immer reicheren Ausgestaltung des Willens führe.
Sie umfaßte, während sie sprach, ihre angezogenen Knie mit beiden Händen. Nur manchmal, wenn ihr eine nasse Strähne ins Gesicht rutschte, löste sie die verschränkten Finger. Ihr Gesicht war sehr ernst und konzentriert, während sie nach den passenden Worten, den genauen Sätzen suchte. Auch jetzt gefiel Perlmann dieses Gesicht. Aber je mehr sie in Fahrt geriet, desto weiter weg rückte es. Und als sie dann von den Kapiteln eines Buches sprach, die sie hier zur Diskussion stellen wolle, kam es ihm sehr weit entfernt und fremd vor. Er dachte an sein schäbiges Heft aus schwarzem Wachstuch, das er schon so lange nicht mehr aufgeschlagen hatte, und es gelang ihm nur mit Mühe, das Bild von karierten Seiten abzuschütteln, die bis zur Unleserlichkeit vergilbt waren. Er fürchtete sich vor dem Moment, da sie die Gegenfrage nach seiner eigenen Arbeit stellen würde, und fragte deshalb immer weiter, beklommen ob der Verlogenheit seines Eifers und doch jedesmal froh, wenn sie auf eine weitere Frage hin erneut ausholte.
Als Adrian von Levetzovs Name fiel, fuhr Perlmann zusammen.«Den hatte ich ganz vergessen», murmelte er tonlos, und an Evelyn Mistrals Blick konnte er ablesen, daß sein Gesicht eine Angst verriet, die er um jeden Preis hatte verbergen wollen. Hastig erhob er sich aus dem Liegestuhl, knickte dabei mit dem Fußgelenk ein und begann, humpelnd zum Eingang zu laufen. Als er am Kellner vorbeikam, der einen Tisch abräumte, zwang er sich zu ruhigeren Schritten, unsicher, ob es wegen des Stechens am Knöchel war oder ob es dem Wunsch entsprang, gegen die Angst und Beflissenheit anzukämpfen.