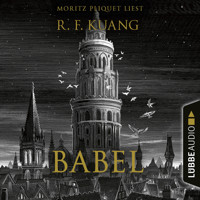Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Gibt es UFOs? Für die Besatzung des Space Shuttles INTREPID ist die Antwort klar, als man ein solches im Erdorbit sichtet. Etwas, das sich niemand aus der Crew sich je hätte vorstellen können. Commander James DeHaney erhält den Auftrag, einen Erstkontakt herzustellen. Eine Aufgabe, die die Frauen und Männer des Shuttles auf eine Mission schickt, die sie weit in die Vergangenheit der Erde führt, 10 000 Jahre vor ihrer Zeit. In eine Zeit, in der in Ägypten die Pyramiden erbaut werden. Und in eine Zeit, in der eine furchtbare Klimakatastrophe droht. Verzweifelt nimmt die Crew der INTREPID den Kampf gegen die drohende Gefahr auf und geht auch der Frage nach, wieso viel früher als von allen Wissenschaftlern gedacht der Pyramidenbau stattfinden konnte. Aber über allem steht die Frage: Wie können sie wieder in ihre eigene Zeit, ins 21. Jahrhundert, zurückkehren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 704
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Danksagung
Weitere Atlantis-Titel
H. D. Klein
Phainomenon
Phainomenon (altgriechisch): das Erscheinende, das was sich zeigt; das unmittelbar Gegebene
Kapitel 1
Martha sah sich ungeduldig nach ihrem Mann um, der in einem Liegestuhl saß und in einer Illustrierten blätterte. »Robert!«
Er reagierte nicht auf ihren Anruf. Stattdessen schien er gerade in diesem Moment einen besonders interessanten Artikel in seiner Lektüre gefunden zu haben. Er lehnte sich entspannt zurück und hielt dabei umständlich die Zeitung in einer Hand. Mit der anderen tastete er vorsichtig nach seinem Glas Bier, das er in einem Halter an der Stuhllehne abgestellt hatte.
Robert wusste genau, was Martha von ihm wollte. Eigentlich erstaunte es ihn, dass es so lange gedauert hatte, bis sie ihn deswegen ansprach, denn seit fast einer Stunde unterhielt sie sich mit ihrer gemeinsamen Tochter, die Tausende von Kilometern entfernt an irgendeinem luxuriösen Pool in irgendeinem exotischen Land lag. Da die beiden fast jeden Tag miteinander Kontakt aufnahmen, würde ihnen bald der Gesprächsstoff ausgehen und dann musste er als Grund dazu herhalten, die Verbindung und damit den täglichen Tratsch zu verlängern.
»Robert, hörst du? Juliane ist auf den Philippinen!«
Und wenn schon, dachte er und bemühte sich, seine gespielte Konzentration auf die Zeitung möglichst echt aussehen zu lassen. Heute war sie auf den Philippinen, morgen auf den Bahamas und übermorgen sonst wo. Heute fuhr sie ein blaues Auto, morgen ein rotes. Sie konnte es sich leisten, schließlich war sie nach ihrer Scheidung von einem bekannten amerikanischen Arzt mit einem kleinen Vermögen in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. Kleines Vermögen! Robert blieb mit seinen Gedanken an dieser untertriebenen Bezeichnung hängen. Zehn Millionen Dollar und ein Penthouse in New York. Und das Häuschen in Key Biscane. Und wahrscheinlich dazu noch ein monatlicher Scheck in beträchtlicher Höhe. Und was machte die Göre damit? Ihr fiel nichts Besseres ein, als sich jeden Tag an einen anderen Strand zu legen. In diesem Alter! Ihm wäre an ihrer Stelle alles andere in den Sinn gekommen, als sich untätig in der Sonne rösten zu lassen.
Er verzog das Gesicht und versuchte, seine Gedanken wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Er war ungerecht, ermahnte er sich. Was sollte sie denn sonst machen? Etwa arbeiten? Blödsinn! Mit zehn Millionen Dollar auf dem Konto würde er ebenfalls keinen Finger rühren. Auch wenn es seiner Meinung nach nicht unbedingt schicklich war, sich mit 37 Lebensjahren so ausschließlich dem Nichtstun hinzugeben. Irgendwie blieb ein schlechter Nachgeschmack.
Robert rekelte sich vorsichtig, um Martha nicht auf sich aufmerksam zu machen.
Außerdem konnte er sich nicht beschweren, schließlich hatte seine Tochter mit ihrer extravaganten Heirat und der lukrativen Scheidung einen großen Teil zu seinem jetzigen bequemen Leben beigetragen. Er konnte vorzeitig in den Ruhestand gehen und wohnte zudem mit Martha in ihrem geräumigen Haus in der Nähe von Frankfurt. Zusätzlich besaßen sie den kleinen Bungalow in Hanglage im Taunus, wo sie sich gerade aufhielten.
Alles war in Ordnung. Es könnte eigentlich nicht besser sein, wenn nicht …
Er schielte zu Martha hinüber, die immer noch eifrig mit ihrer Tochter sprach.
Es war das Ding auf ihrem Kopf. Man nannte es Cyberfon. Ein Telefon mit integriertem Bildschirm. Man setzte es wie einen Helm auf und konnte damit die audiovisuellen Eindrücke des Senders nahezu real miterleben. Und natürlich umgekehrt.
Martha hatte das neuzeitliche Telefonieren zu ihrem Hobby erkoren. Sie lief nur noch mit dieser grässlichen Haube herum und erlebte die Realität sozusagen im realen Cyberspace. Selbst wenn sie nicht telefonierte, behielt sie den Helm auf und schaltete lediglich die kleine externe Kamera ein, um sich zur Orientierung ihre Umgebung auf den Bildschirm zu holen. Robert hatte es aufgegeben, sie auf diese Unhöflichkeit ihm gegenüber hinzuweisen. Er kannte die Antwort darauf inzwischen auswendig: »Wenn du mit mir nie in Urlaub fährst, muss ich jede Gelegenheit nutzen, mir diese herrlichen Welten ansehen zu können!« Es gab mittlerweile Cybertheken, die über alle möglichen Themen und Informationen aller Länder der Erde verfügten, die man sich bequem auf den Rundumschirm eines Cyberfons legen lassen konnte. Alles war Cyber heutzutage. Cyber-TV, Cybermovies, Cyberspiele, Cybermuseen, Cybersports, Cybernews. Dabei war Robert neuen Entwicklungen gegenüber nicht unaufgeschlossen – warum auch? Er hatte als ehemaliger Ingenieur selbst am Fortschritt mitgearbeitet, für ihn war es verständlich, dass sich die Menschen an neuer Technik begeisterten.
Aber doch nicht seine Martha! Und vor allem nicht in diesem ungezügelten Ausmaß, das schon fast einem Religionsersatz gleichkam. Ständig hatte sie ihre »Cibes« auf dem Kopf, wie das Cyberfon in der modernen Umgangssprache bezeichnet wurde. Inzwischen hatte sie sich sogar daran gewöhnt, manche Haus- oder Handarbeiten »blind« auszuführen. Selbst beim Staubsaugen hatte sie die Cibes angelegt und orientierte sich nur ab und zu über die kleine Außenkamera. Dass ihre Frisur durch das ständige Tragen litt, störte sie nicht. Noch vor wenigen Monaten wäre alleine schon das Aufsetzen von einfachen Kopfhörern eine Zumutung gewesen.
»Robert, jetzt komm doch mal her! Du musst dir den Strand und die Palmen ansehen!«
»Ja, ja, ich komm ja schon!« Er stemmte sich widerstrebend aus dem Liegestuhl hoch und warf die Zeitung missmutig auf den kleinen Tisch vor sich. Nicht, dass ihn Strand und Palmen sonderlich interessiert hätten, aber er tat es seiner Tochter zuliebe, die letztendlich für alle Kosten und Gebühren des Cyberfons aufkam.
Er holte tief Luft, nachdem er sich neben seiner Frau niedergelassen hatte, und setzte das Zweitgerät auf. Im Stehen hätte er mit ernsten Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, denn jede unbedachte Kopfbewegung desjenigen, der die Bilder sendete, konnte beim Empfänger ernstliche Gleichgewichtsstörungen auslösen und damit konnte die Übertragung einen ungewollten Balanceakt bewirken.
Kaum hatte er die Cibes übergestülpt, hatte er das Gefühl, eine Zeitreise ausgeführt zu haben. Die grüne Wiese und die Bäume des Taunus waren wie weggewischt. Das Geräusch von donnernder Brandung und im Wind wiegende Palmen umgaben ihn. Die Übertragung war so perfekt, dass er meinte, das salzige Meer zu schmecken und die warme Brise zu spüren. Für einen Augenblick glaubte er sogar, den Duft von Hibiskusblüten und eine Mischung von Sonnenöl und Kokosnuss zu riechen.
Direkt vor sich erblickte er die rot lackierten Fußnägel seiner Tochter, die sich frech auf und ab bewegten.
»Hallo, Kleines, wie geht es dir?«
»Hi, Dad! Natürlich fantastisch, das siehst du doch, oder?«
Dad! Jetzt war er schon zu einem amerikanischen Serienvater mutiert. Aber das brachte wohl die fremde Kultur mit sich, in der sie lebte.
»Es ist einfach herrlich hier! Habt ihr nicht Lust, mich zu besuchen? Ich denke, ich bleibe noch eine ganze Woche hier!«
»Das ist sehr lieb von dir gemeint«, sagte Robert schnell, um Martha zuvorzukommen, weil er nicht sicher war, ob sie nicht spontan zusagen würde. »Aber ich fürchte, daraus wird nichts. Du weißt doch, dass mir das Fliegen nicht gut bekommt!« Das war natürlich eine Lüge, mit der er sich in den letzten Jahren immer wieder vor jeder größeren Reise drückte. Er wollte nicht, dass seine Tochter alles bezahlte, obwohl die Kosten für einen Flug für sie nicht der Rede wert waren, aber er verspürte nicht die geringste Lust, seine eigene kleine Welt zu verlassen.
»Außerdem kann ich ja mit diesen Dingern alles genauso gut von hier erleben, auch wenn ich nichts von dir sehe.«
Sie verstand seine versteckte Anspielung sofort und ein helles Lachen klang laut in seinen Ohren. »Moment, auch das kann ich dir frei Haus liefern!«
Die Palmen wackelten, und Robert hielt sich verkrampft an seinem Stuhl fest, als seine Tochter ihre Cibes abnahm und sie mit den beiden Objektiven der Kamera vor sich auf den Tisch legte. »Na, wie sehe ich aus?«
Sie hätte sich wenigstens etwas anziehen können, dachte Robert, als er auf ihren braun gebrannten und entblößten Oberkörper blickte. Er hörte Martha neben sich entrüstet sagen: »Aber Kindchen!«
»Prima, schön braun bist du geworden«, lenkte er ab. Von ihrem Gesicht konnte er nicht viel sehen, da es von einem großen Sonnenhut und einer noch größeren Sonnenbrille weitgehend verdeckt war.
Um die Peinlichkeit zu überspielen, forderte er sie scherzhaft auf, ihnen etwas vom Hotel oder der Umgebung zu zeigen. Zu seinem Leidwesen ging sie sofort auf seinen Vorschlag ein und nahm ihre Cibes vom Tisch. Robert schloss entsetzt die Augen, als auf seinem Bildschirm die heftigen Bewegungen in einem wirren Streifenteppich aufflackerten. Vorsichtshalber machte er sie auch während der ausführlichen Besichtigungstour nicht wieder auf, die im Anschluss folgte. Entspannt lauschte er der erklärenden Stimme seiner Tochter, die von fremd klingenden und exotischen Hintergrundgeräuschen untermalt wurde. Es dauerte nicht lange und er war eingeschlafen.
Vier Stunden später befanden sie sich auf dem Weg zurück nach Frankfurt. Nach der herbstlichen Abenddämmerung war es rasch dunkel geworden, und Robert hatte das computergesteuerte Lenksystem des Chryslers aktiviert. Ohne menschliche Beeinflussung glitt der luxuriöse Wagen elegant über die enge Landstraße. Natürlich war auch der Wagen ein Geschenk ihrer Tochter. Irgendwie musste sie uns gegenüber ein schlechtes Gewissen haben, dachte Robert, als sein Blick über die matt leuchtenden Armaturen wanderte. Dabei hatte sie gar keinen Grund dazu. Sie war schon von klein auf sehr selbstständig gewesen, hatte ihre Ausbildung als medizinische Genassistentin mit Auszeichnung hinter sich gebracht und viel Freizeit für ihre Weiterbildung aufgewendet. Sie selbst hatte eine sichere Anstellung bei Bayer abgelehnt und war stattdessen der Einladung eines amerikanischen Konzerns in die USA gefolgt, wo sie bald ihren zukünftigen Mann kennengelernt hatte. Danach hatte sich nicht nur ihr Leben merklich verändert. Dieses Auto, dessen automatischer Steuerung er fasziniert zusah, war nur eine der vielen Veränderungen in Roberts Leben. Er fragte sich, ob es eine Verbesserung war, denn wie so oft in der letzten Zeit überkam ihn das Gefühl, absolut überflüssig zu sein.
Er brauchte ein Hobby, redete er sich ein. Oder er legte sich ein Haustier zu. Mit irgendwas musste er sich beschäftigen, sonst würde er noch zum Säufer.
Mit einem Seufzer steckte er die halb volle Bierdose in die Halterung und warf einen Blick auf seine schlafende Frau, die in einer ungemütlichen Haltung halb auf dem Beifahrersitz lag und mit offenem Mund leise schnarchte. Ihre Cibes hielt sie wie ein kleines Kind fest an sich gepresst.
Vielleicht sollten sie doch eine Reise unternehmen, dachte er. Aber nicht mit dem Flugzeug. Und auch nicht mit dem Auto. Martha würde sonst nur wieder mit dem Helm neben ihm sitzen und ihm erzählen, wie schön es anderswo auf der Welt sei.
Eine Fahrt mit einem Schiff auf der Mosel vielleicht, mit anderen Menschen …
Robert hob den Kopf zum Rückspiegel, als ihm der Bordcomputer ein Fahrzeug meldete, das sich noch in einiger Entfernung hinter ihnen befinden musste. Merkwürdigerweise war nichts zu sehen. Im nächsten Moment erlosch das dezente türkise Blinken am Armaturenbrett. Wahrscheinlich war das Fahrzeug abgebogen.
Mit einem Schiff auf der Mosel! Er schüttelte den Kopf. Martha würde die Idee nicht gefallen. Für sie musste es mindestens die Karibik sein. Oder wenigstens die Kanarischen Inseln. Oder das Mittelmeer. Die griechischen Inseln vielleicht. Damit könnte er sich ebenfalls anfreunden. Zuerst mit dem Zug nach Italien und von dort eine Kreuzfahrt über das Ägäische Meer.
Wieder fing das längliche türkise Licht mit der Aufschrift »Fahrzeug nähert sich von hinten« leicht an zu glimmen. Gleichzeitig setzte für einen Moment der Motor aus. Ein leichtes Rücken ließ Marthas Kopf nach vorne nicken. Robert überflog die Anzeigen für den Motor, aber alle Lichter zeigten ein beruhigend grünes Leuchten. Auch das Motorgeräusch, sofern man bei diesem Wagen überhaupt noch von einem Geräusch sprechen konnte, hörte sich absolut normal an. Keinerlei Anzeichen von einer Störung.
Robert setzte sich auf und wartete ab. Als ehemaliger Ingenieur war er gegenüber unerklärlichen Unregelmäßigkeiten zu misstrauisch, um den Aussetzer als einmaliges Vorkommnis abzutun. Das Warnlicht für die Fahrzeugannäherung war wieder erloschen. Vielleicht ein Computerfehler? Wenn ja, dann wäre das der denkbar ungünstigste Zeitpunkt dafür. Das nächste Dorf war mindestens noch zwölf oder dreizehn Kilometer entfernt. Nicht, dass das hier ein großes Problem gewesen wäre, denn mithilfe seines Handys oder Marthas Cibes würde es keine Viertelstunde dauern, bis ein Pannenwagen bei ihnen eintreffen würde, aber er hatte keine Lust, sich die abfälligen Kommentare eines Mechanikers über die Technik importierter Luxuslimousinen anhören zu müssen. Ganz abgesehen davon käme bei einem Computerausfall nur ein Abschleppen des Wagens infrage und das wäre ihm sehr unangenehm.
Wieder ein kleines Rucken. Oder bildete er sich das nur ein? Die Scheinwerfer strahlten gleichmäßig den von einem leichten Regen nassen Asphalt an, der wie ein schwarzes Band unter dem Wagen verschwand.
Unsicher lehnte er sich zurück. Gerade als er beschlossen hatte, die Automatik abzuschalten und manuell weiterzufahren, blinkte das türkise Licht auf, um gleich darauf wieder zu erlöschen. Dann gingen alle Lichter aus, auch die Scheinwerfer. Und der Motor. Schlagartig war alles dunkel um ihn herum. Mit einem lauten Fluch packte er fest das Lenkrad und trat mit ganzer Kraft auf das Bremspedal. Ohne die Servolenkung und die hydraulischen Bremshilfen hatte er das Gefühl, als müsste er einen Eisenbahnwaggon mit der Hand aufhalten. Dazu kam noch, dass er im ersten Moment absolut nichts von seiner Umgebung sehen konnte. Erst nach einigen Sekunden war eine Orientierung an den blass schimmernden Leitpfosten an der Straße möglich. Mit einem befreienden Aufatmen und weichen Knien brachte er den schweren Wagen mit einem ungefährlichen letzten Rutscher auf der nassen Straße zum Stehen.
Neben ihm im Dunkeln schreckte seine Frau aus dem Schlaf hoch.
»Was … Robert, wo bist du? Was ist denn? Wo sind wir?«
»Beruhige dich, ich bin hier. Neben dir im Auto. Irgendetwas muss mit der Stromzufuhr sein. Der Motor läuft nicht mehr.« Er ärgerte sich mehr über die Folgen des Totalausfalles als über die Ursache selbst. Es musste doch möglich sein, eine Notbatterie in diesem rollenden Ungetüm unterzubringen, die ein bisschen Licht erzeugte, um in einem Fall wie diesem wenigstens noch etwas von der Straße zu erkennen. Diese Situation mitten in der Nacht war auf jeden Fall lebensgefährlich gewesen.
»Gib mir bitte die Taschenlampe aus dem Handschuhfach! Ich geh mal nachsehen. Wahrscheinlich hat sich ein Kabel an der Batterie gelöst.«
Marthas Cibes fielen auf den Fahrzeugboden, als sie sich nach vorne beugte, um an das Fach zu gelangen.
Robert tippte missmutig den Schalter für die Pannenblinkleuchte an. Natürlich tat sich auch hier nichts. Er glaubte nicht an ein gelockertes Kabel. Der Wagen war fast neu und wahrscheinlich würde alles fest an seinem Platz sitzen. Eher lag der Fehler am Bordcomputer und das würde bedeuten, dass sie ums Abschleppen nicht herumkamen.
»Steig besser aus! Nicht dass noch jemand auf den unbeleuchteten Wagen auffährt und du noch drinnen sitzt!«
»Wenn du meinst«‚ sagte sie und reichte ihm die Taschenlampe. »Aber wenn jemand vorbeikommt, dann hat der doch sein Licht an und müsste uns sehen …«
»Ja, ja, müsste er. Trotzdem …« Er beugte sich nach vorn und entriegelte die Motorhaube. Gott sei Dank ging das mechanisch, dachte er, als er das charakteristische Knacken hörte. Endlich etwas, das ohne den verdammten Computer funktionierte.
Vorsichtig öffnete er die Seitentür und stieg aus. Frische, feuchte Luft umgab ihn. Es roch etwas modrig. An den Bäumen raschelten kraftlose Blätter und von den nassen Ästen fielen unentwegt einzelne Tropfen auf die dicke Laubschicht. Der Strahl der Taschenlampe verlor sich zwischen den nahen Stämmen. Auch auf dem nassen Asphalt wurde das Licht kaum reflektiert. Dafür blendete der helle Lack des Wagens umso mehr, als Robert nach vorne ging und die Motorhaube öffnete.
»Zieh dir deine Jacke an!«, rief er Martha zu, als er das Öffnen der Beifahrertür hörte. »Es ist frisch hier draußen!«
Er stützte sich auf den Rand der Kühlerhaube und leuchtete den Batteriekasten an, der sich direkt unter ihm befand. Er sah genauso aus, wie er ihn sich vorgestellt hatte: neu, sauber, trocken, ohne Anzeichen eines Defektes oder eines lockeren Kabels. Also musste er wohl die weiße Schutzkappe entfernen, um letzte Gewissheit zu erlangen. Mit einem Seufzer legte er die Taschenlampe auf die breite Hutze des Luftfilters und suchte nach den Klammern, die die Kappe festhielten. Er wusste schon jetzt: Eine davon würde er leicht finden und sie würde problemlos zu lösen sein, die zweite war hundertprozentig irgendwo am Rand versteckt und nur zu öffnen, wenn man dazu bereit war, seine Fingerkuppe zu opfern oder sich wenigstens eine Schramme einzuhandeln.
»Robert!« Marthas Stimme klang ängstlich. »Da kommt was!«
Er griff schnell nach der Taschenlampe. Wahrscheinlich war das der Wagen, den ihm der Bordcomputer vorhin mehrmals angezeigt hatte. Vielleicht war es besser so. Bevor er sich hier in der Einöde den Kopf über einen unwahrscheinlichen Defekt an der Batterie zerbrach, konnten sie hoffentlich mit dem Fremden mitfahren und den Chrysler zurücklassen. Große Ambitionen, seine Ingenieursfähigkeiten unter Beweis zu stellen, hatte er sowieso nicht. Warum auch? So würde es viel bequemer sein.
Er trat neben den Wagen auf die Straße und schwenkte mit der Lampe hin und her. Nach der Art der Lichter, die rasch auf sie zukamen, musste es ein großer Lastwagen sein, denn sie befanden sich hoch über der Straßenoberfläche. Außerdem waren sie sehr unregelmäßig an der Front des Fahrzeugs angebracht. Er erkannte drei sehr helle Lichtflecke in der Mitte und unzählige kleine weit außerhalb des vermeintlichen Zentrums. Eigentlich schon so weit außerhalb, dass sie über die Seitenbegrenzung der Straße hinausragten. Das konnte nicht sein. Oder doch?
Ein Schwertransport!, schoss es ihm durch den Kopf. Jetzt, um diese Zeit? Aber warum nicht? Logischerweise wurden die meisten sperrigen Güter nachts transportiert, wenn weniger Verkehr herrschte. Aber wieso hier auf dieser gottverdammten engen Landstraße?
Er kniff die Augen zusammen und versuchte, die Entfernung abzuschätzen. Die Ladung musste sehr hoch sein. Wenn ihn seine Sinne nicht täuschten, eigentlich in Baumwipfelhöhe. Das konnte nicht sein. Zu hören war auch nichts. Jetzt war der Transport stehen geblieben. Robert vermisste das vertraute Abblasen der Luftdruckbremsen. Alles war ganz ruhig. Dafür spürte er einen kaum wahrnehmbaren Luftzug, der aus der Richtung des merkwürdigen Gefährts kam.
»Robert, was ist das?« Martha ging mit vorsichtigen Schritten um den Chrysler herum und stellte sich hinter ihn.
»Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ein großer Lastwagen mit einem Kran hintendrauf oder so etwas«‚ antwortete er mit sachlicher Stimme, um sie zu beruhigen. Er spürte, irgendetwas war hier nicht in Ordnung.
Martha spähte über seine Schulter. »Warum fährt er nicht weiter und bleibt dort stehen?«
»Weil … ich weiß es nicht.« Ihm fielen alle möglichen Erklärungen ein. Vielleicht überlegte der Fahrer, wie er am besten an ihrem Wagen vorbeikam. Oder ob er besser zurücksetzen sollte. Nein, das war unwahrscheinlich. Jeder normale Mensch würde zunächst heranfahren, um sich zu informieren. Vielleicht haben die etwas zu verbergen? Robert sah sich in seiner wildesten Fantasie schon einem illegalen Transport von atomaren Brennstäben gegenüber und ihr blöder Chrysler stand wie ein Wachturm unbeleuchtet am Straßenrand. Und er schwenkte auch noch wie ein Verrückter eine Taschenlampe und machte sie auf sich aufmerksam!
Er senkte den Arm und fasste einen Entschluss.
»Also, ich gehe jetzt dorthin und frage, ob sie uns mitnehmen! Du bleibst hier und wartest auf mich!«
»Robert, ich weiß nicht. Bleib lieber hier, das Ding ist mir unheimlich!«
Gerade als er sie mit einer scherzhaften Bemerkung beruhigen wollte, kam Bewegung in das »Ding«. Zuerst schwenkte einer der drei Scheinwerfer nach unten. Dann schoben sich alle Lichter mit einem Ruck nach oben. Auf der Straße bildete sich ein blauer Lichtkreis ab, der nun langsam auf sie zukam.
»Das gibt es doch nicht …«, keuchte Robert, als er im nächtlichen Dunkelgrau eine riesige schwarze Silhouette wahrnahm, die mindestens dreißig Meter über dem Boden schwebte. Undeutlich erkannte er darin die Form einer lang gestreckten Ellipse, mit einer Andeutung einer schmalen Wulst im oberen Drittel. Die Enden an beiden Seiten standen weit über den darunterliegenden Straßenrand hinaus. Er schätzte die Breite des unheimlichen Objekts auf etwa vierzig Meter, wenn nicht sogar mehr. Trotz der jetzt beschleunigten Annäherung war keinerlei Motorengeräusch zu hören. Lediglich ein leichter Luftzug stellte eine Verbindung zur Realität und zu einer dreidimensionalen Bewegung her.
Unwillkürlich rutschten sie beide um die Kante des Chryslers und gingen hinter der aufgestellten Motorhaube in Deckung.
»Das ist ein UFO, nicht wahr«‚ stellte Martha hinter ihm nüchtern fest. »So etwas, das aus dem Weltraum kommt!«
»Blödsinn! Es gibt keine UFOs«, antwortete Robert unwirsch. Er beobachtete besorgt den kreisrunden Lichtpegel, der genau auf sie zukam. Es musste eine andere Erklärung für diesen lautlosen Flugapparat geben, nur welche? Im Moment beschäftigte ihn jedoch mehr die Frage, ob ihnen eine Gefahr drohte, denn ohne Zweifel hatten die Insassen sie entdeckt und steuerten genau auf sie zu. Robert sah sich unruhig nach allen Seiten um. Vielleicht wäre es besser, wenn sie in den Wald flüchteten. Dort konnten sie sich auf jeden Fall besser verstecken. Hier auf der freien Straße standen sie wie auf einem Präsentierteller.
»Wir verschwinden besser von hier.« Er bemühte sich, ruhig zu sprechen. »Los, in den Wald! Aber vorsichtig, gleich neben der Straße geht es steil runter.«
Martha tastete sich an der Motorhaube entlang zum Straßenrand. Robert warf noch einen letzten Blick auf das herannahende Flugobjekt und wollte gerade seiner Frau folgen, als der Lichtkegel mit einem Satz auf sie zuraste. Martha, die sich schon einige Schritte in den Wald hineingewagt hatte, flüchtete mit einem ängstlichen Kiekser wieder zurück hinter die Motorhaube, wo sie heftig mit ihrem Mann zusammenstieß, der sich erschrocken auf den Asphalt geworfen hatte.
Für einen endlos lang erscheinenden Moment spürten sie förmlich den harten Lichtfleck, der sie umgab. Gleich darauf war er jedoch schlagartig verschwunden. Robert drehte sich im Liegen herum und sah ihn die Straße hinunterrasen. Darüber hing die schwarze Silhouette wie ein riesiger Raubvogel, der in der Nacht nach einer Beute suchte. Nach einigen Hundert Metern schwenkte er nach links über den Wald und erhellte die Baumkronen in einem gespenstisch blauen Lichtschweif.
Robert war unfähig, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. Er hatte nichts gespürt außer diesem kaum wahrnehmbaren Luftzug, der eher von einer elektrischen Statik herzurühren schien.
Es gab keine UFOs, redete er sich ein. Das musste irgendein Geheimprojekt sein. Ein neuartiger Antrieb, der nachts getestet wurde oder eine Art lautloser Hubschrauber mit schallgedämpften Rotorblättern. Aber wieso hatte er dann keinerlei Luftverdrängung gespürt? Bei dieser Geschwindigkeit, die das Fluggerät in den letzten Sekunden erreicht hatte, müsste sogar die aufgestellte Motorhaube starke Verwindungen gezeigt haben, aber sie hatte ruhig und aufrecht gestanden. Es schossen ihm alle möglichen technischen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts durch den Kopf, aber er fand keine Erklärung für dieses Phänomen.
Das Objekt war nun über den Baumwipfeln verschwunden, als hätte es nie existiert.
»Also, für mich war das ein UFO!«, erklärte Martha mit fester Stimme. Unbeeindruckt von dem Vorfall erhob sie sich und zupfte nasse Blätter von ihrem Rock. »Auch wenn du sagst, so etwas gebe es nicht. Und jetzt nehme ich meine Cibes und rufe Hilfe herbei! Ich habe keine Lust, noch länger hier in der Einöde festzusitzen und mich vor fliegenden Schatten in den Dreck zu werfen!«
Robert stand ebenfalls auf, öffnete die Tür des Chryslers und griff nach der Bierdose. Er bemerkte, dass seine Hände zitterten.
Unmöglich! UFOs gab es nicht. Wenn doch, musste es von dieser Welt sein. Und sie waren unfreiwillig Zeuge davon geworden. Wahrscheinlich liefen in geheimen Stellen schon die Drähte heiß.
»Sag nichts von einem UFO! Das glaubt uns sowieso keiner!«, rief er ins Wageninnere hinein.
»Wieso nicht? Ich hab’s doch gesehen!« Martha tastete im Dunkeln nach ihren Cibes.
»Mein Gott, weil … wenn du der Pannenhilfe so etwas erzählst, halten die dich doch für verrückt und kommen erst gar nicht!« Er lehnte sich an den Wagen und trank das Bier aus. Verrückt! Einfach verrückt! Jetzt, einige Minuten nach dem Vorfall, kam es ihm wie ein schlechter Traum vor. Vielleicht war es ein modifiziertes Luftschiff gewesen. Eine Art moderner Zeppelin.
Erneut überfiel ihn der Gedanke, dass es sich um ein geheimes Projekt handeln könnte und sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Vielleicht wäre es besser, von hier so schnell wie möglich zu verschwinden und den Wagen zurückzulassen. Er sah sich rasch um. Unmöglich. Der einzige Weg, den sie in der Nacht einigermaßen vernünftig begehen konnten, war die Straße. Sonst gab es nur dunklen Wald und feuchte Wiesen.
In diesem Moment fingen die Pannenblinkleuchten des Chryslers mit einem leisen Klicken wieder an zu arbeiten.
Robert stürzte ins Wageninnere.
Martha blickte ihn überrascht an. »Ich habe noch niemanden erreicht!«, sagte sie entschuldigend.
»Brauchst du auch nicht«‚ antwortete er atemlos, zog die Codekarte am Armaturenbrett heraus und steckte sie gleich wieder in den Schlitz für die Zündung. Mit einem sanften Singen startete der Motor. »Er geht wieder. Jetzt nix wie weg von hier!«
Robert schaltete die Leitsteuerung aus und beschleunigte den Wagen heftig mit auf dem Laub durchdrehenden Reifen.
»Sachte, sachte …«, beruhigte er sich selbst. Er aktivierte das Navigationssystem und zog den kleinen Monitor auf dem beweglichen Arm zu sich heran, um ihre Position zu bestimmen. Bad Homburg war nicht weit weg, aber sie befanden sich noch auf einer kleinen Landstraße am Fuße des Herzberges. Selbst wenn sie schnell vorankamen, würde es bestimmt noch eine Viertelstunde dauern, bis sie die ersten Häuser des nächsten Dorfes erreichten. Robert spähte durch die Seitenscheibe ins Dunkel, das teilnahmslos an ihnen vorbeihuschte. Da war nichts, redete er sich ein. Und keiner wollte was von ihnen. Einfach nur weiterfahren und ruhig bleiben. Er warf einen Blick auf seine Frau, die ihren futuristischen Helm auf dem Kopf hatte. Überall Aliens, dachte er belustigt.
»Die Cibes lass ich auf«, sagte Martha, die sein Grinsen bemerkt hatte. »Wenn das UFO wieder auftaucht, nehme ich alles auf und sende es an unsere Mailbox nach Frankfurt. Dann können wir beweisen, was wir gesehen haben!«
»Gute Idee«‚ meinte er und ging nicht weiter darauf ein. Ihn beschäftigte der unerklärliche Ausfall der Stromversorgung des Autos. Es musste mit dem Erscheinen des Objektes zu tun gehabt haben. Aber was könnte so einfach aus der Entfernung den Motor oder die Batterie beeinflusst haben? Unwillkürlich suchte er wieder die dunkle Umgebung und den Himmel ab, aber es war nichts zu entdecken. Oder doch? Einen halben Kilometer vor ihnen blitzte etwas auf. Oder war es Einbildung gewesen? Robert drosselte die Geschwindigkeit.
»Da vorne war was, nicht wahr?«, sagte Martha mit der stoischen Ruhe eines Jägers, der auf das Erscheinen des Wildes am Rande einer Lichtung wartete. Ihm war unverständlich, wie gelassen sie das alles aufnahm. Gleichzeitig bestätigte sie ihm mit ihrer Bemerkung, dass auch sie etwas gesehen hatte. Seine Gedanken begannen zu rasen. Sollte er nicht besser umkehren? Ihn erfasste die unangenehme Vorstellung, dass dieses Objekt hinter ihnen her war. Gleichzeitig erschien es ihm lächerlich. Jetzt war nichts mehr zu sehen, aber soweit er sich an die Strecke erinnern konnte, mussten sie gleich in eine lang gestreckte Kurve einbiegen …
Im nächsten Augenblick trat er entsetzt auf die Bremse. Dort hing es in der Luft! Unmittelbar vor ihnen! Keine zehn Meter über der Straße. Blaues Licht erhellte den dunklen Asphalt und die angrenzenden Bäume. Und das Ding war riesig groß!
Kapitel 2
Robert kam langsam wieder zu sich, als er eine energische Stimme neben sich hörte.
»He, Mann! Aufwachen! Mein Gott, muss der besoffen sein!« Der Polizist rüttelte Robert an den Schultern. »Christian, komm doch mal her, wir müssen unseren Freund hier an die frische Luft befördern!«
Der Angesprochene kam um den Chrysler herum und bückte sich, um nach Roberts Beinen zu greifen. Zusammen mit seinem Kollegen zog er ihn aus dem Fahrzeug heraus.
»Hier, neben den Wagen. Wir legen ihn erst mal in die Sonne, vielleicht wird er dann schneller nüchtern.«
»Ich weiß nicht, Richard, er sieht gar nicht so aus, als hätte er zu viel getrunken. Alkohol rieche ich jedenfalls nicht. Ich hol ihm erst mal eine Decke.«
Hauptkommissar Richard Lohmann brachte Roberts schlaffen Körper in eine Seitenlage und sagte zu sich selbst: »Himbeerwein, ganz klar. Den riecht man nicht. Oder Erdbeerwein. Auf jeden Fall rieche ich Fahrverbot, Freundchen. Mindestens für ein Jahr.«
Robert versuchte mit einer lahmen Bewegung, sich gegen die ihm unangenehme Position zu wehren. Sein Instinkt sagte ihm, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Er war noch nicht so weit, um die Situation zu erfassen oder gar zu begreifen. Das erste einigermaßen klare Bild, das sich in seinem Gehirn zusammensetzte, war eine perspektivisch verzogene Ansicht seines Chryslers, den er von unten zwischen einigen Grashalmen hindurch wahrnahm. Sein erster Gedanke war, dass der Wagen anscheinend unversehrt war. Es erstaunte ihn, wie beruhigend der cremefarbene Lack auf ihn wirkte, dabei hatte er die Farbe nie gemocht. Martha und seine Tochter hatten die Auswahl getroffen. Seine Meinung war nicht gefragt gewesen. Sei’s drum, der weiche Kontrast mit den Pastellfarben der Wiesenblumen und dem dezenten Vogelgezwitscher dämpfte zunächst den Vorgang des Begreifens. Erst als sich sein Verstand mit den grünen Uniformen der Streifenpolizisten beschäftigte, brach die Informationsflut über ihm zusammen. Er stemmte sich dagegen an und versuchte, eine Verbindung zwischen dem Jetzt und den Geschehnissen in der Nacht zu finden. Er stützte sich mühsam auf einen Ellbogen und atmete tief durch.
»Martha?« Seine Stimme krächzte ein wenig, deswegen räusperte er sich und wiederholte den Ruf nach seiner Frau: »Martha!«
Oberkommissar Christian Wegener kam vom Streifenwagen zurück und legte ihm behutsam eine Decke über die Schulter. »Beruhigen Sie sich, Herr Varell, es ist alles in Ordnung!« Er übersah Roberts verständnislosen Blick und winkte seinen Kollegen zur Seite. »Der Wagen ist auf Robert Varell zugelassen. Das Bild der Erkennungsbehörde und auf seinem Führerschein stimmen überein. Er ist Rentner, seine Frau heißt Martha. Sie muss hier irgendwo in der Nähe sein. Auf dem Beifahrersitz liegt eine Handtasche.«
Robert zog sich am Kofferraum seines Wagens hoch und schaute unsicher in die Umgebung. Der Chrysler stand mitten in einer Wiese. Er konnte sich nicht erinnern, in eine Wiese gefahren zu sein. Der letzte Moment, der ihm im Gedächtnis haftete, war das erneute Aussetzen des Motors und der heftige Kampf mit dem Bremspedal. Aber er hatte es geschafft, auf der Straße zu bleiben. Das wusste er noch ganz genau. Dann war viel blaues Licht um sie herum gewesen und dann … Ein blauer Lichtdom! Er hatte den Eindruck gehabt, als wären sie in eine lichtdurchflutete Diskothek hineingefahren. Martha hatte noch begeistert aufgeschrien: »Ich hab alles drauf!« Robert konnte sich noch an seine verwunderten Gedanken erinnern, dass Martha angesichts dieser unglaublichen Situation anscheinend überhaupt keine Angst gezeigt hatte.
»Herr Varell!« Der jüngere Streifenpolizist berührte ihn leicht an der Schulter. »Fühlen Sie sich in der Lage, uns zu sagen, was passiert ist?«
Robert ging nicht auf seine Frage ein. »Meine Frau Martha?«
Der Polizist sah unsicher seinen älteren Kollegen an.
»Wir wissen es nicht«, sagte Richard Lohmann. »Jedenfalls haben wir sie nirgendwo gesehen.«
Robert nickte, als wüsste er mehr darüber. »Wo ist die Straße?«
»Ahm, hier drüben, wo unser Streifenwagen steht.«
Robert setzte sich wankend in Bewegung, gefolgt von den beiden Beamten, die sich seiner nicht sicher waren. Sie folgten ihm jedoch schweigend hinüber zur nahen Straße. Falls er einen Fluchtversuch unternehmen wollte, würde er in seinem Zustand jedenfalls nicht weit kommen, dazu machte er einen allzu gebrechlichen Eindruck. Als er den Straßenrand erreichte, blickte er nach beiden Seiten die Straße entlang. Dann drehte er sich um und inspizierte die Wiese, in deren Mitte der Chrysler stand. »Es gibt überhaupt keine Spuren im Gras«, murmelte er. »Wie ist der Wagen da hingekommen?«
Jetzt riss Lohmann der Geduldsfaden. »Hören Sie mal, Herr Varell! Es wäre an der Zeit, dass Sie uns erklären, was passiert ist. Und vor allem, wo ist Ihre Frau? Mit diesen Mätzchen kommen Sie bei mir nicht weit!« Er ignorierte die warnenden Handbewegungen seines Kollegen. »Ist doch wahr! Er ist nicht der Erste, der auf verrückt macht, weil er seine Frau um die Ecke gebracht hat. Also, Herr Varell, was ist mit Ihrer Frau?«
Robert winkte ab. »Es war nicht hier. Es müsste … warten Sie, das Waldstück weiter da drüben und davor die Kurve. Das müsste … Können Sie mich die Straße zurückfahren, vielleicht ein oder zwei Kilometer?«
Richard Lohmann holte tief Luft. Bevor er verärgert antworten konnte, sagte Wegener beschwichtigend: »Können wir, Herr Varell, aber dort sollten Sie uns schon erklären, was eigentlich vorgefallen ist, sonst müssen wir andere Maßnahmen ergreifen.«
Lohmann stapfte wütend zum Streifenwagen und riss die Tür auf. Schweigend stiegen alle ein. Robert registrierte nicht, dass sich Hauptkommissar Lohmann demonstrativ neben ihm auf der Rückbank niedergelassen hatte. Auch dessen bohrende Blicke berührten ihn nicht. Er begann, sich ernsthaft Sorgen um seine Frau zu machen. Bisher war ihm alles wie ein einstudiertes Spiel erschienen. Auch die Streifenbeamten hatte er nicht wirklich ernst nehmen können. Erst in dem Moment, als er in der Wiese stand und keinerlei Reifenspuren ausmachen konnte, wurde er unsicher. Würde jemand tatsächlich einen solchen Aufwand treiben und ein fast anderthalb Tonnen schweres Auto mit einem Kran oder gar einem Hubschrauber in eine jungfräuliche Wiese versetzen, um Spuren zu verwischen? Welche Spuren? Was für einen Sinn sollte es haben, wenn er kilometerweit von der Stelle in seinem Wagen aufwachte, wo in der Nacht etwas Unerklärliches passiert war? Jetzt war es Tag, nicht mehr ganz früh am Morgen. War es überhaupt der darauffolgende Tag? Robert wagte nicht, den grimmigen Polizisten neben sich danach zu fragen, aber seinem ertragbaren Hungergefühl nach zu schließen, nahm er an, dass heute der nächste Morgen war.
Einige Minuten später bedeutete Robert dem Polizisten, langsamer zu fahren. Als sie über die Stelle an der Kurve hinaus waren, wo er in der Nacht zum zweiten Mal heftig auf die Bremse getreten war, ließ er ihn anhalten. Eilig stieg er aus, gefolgt von zwei misstrauischen Beamten, und trabte gebückt wie ein Fährtensucher die Straße hinunter. Heftig nach Atem ringend erreichte er die Stelle, an der er das schwarze Objekt vor sich über der Straße hatte schweben sehen.
»Hier, sehen Sie«, sagte er zu den beiden Polizisten, die neben ihn getreten waren und merklich ungeduldiger wurden. »Hier sind die Bremsspuren zu sehen. Hier habe ich heute Nacht angehalten.«
»Na prima!« antwortete Lohmann sarkastisch. »Und dann sind Sie also von hier aus direkt in die Wiese geflogen?«
»Nein, natürlich nicht, ich … äh …« Robert wusste nicht, wie er es erklären sollte.
»Herr Varell«, begann Wegener vorsichtig. »Jetzt sagen Sie uns doch einfach, was in der Nacht vorgefallen ist!« Immerhin hatten sie nun schon mal die Information, dass es in der Nacht gewesen sein musste.
Robert suchte die Baumwipfel ab, in der Hoffnung, dort eine Auffälligkeit oder gar einen gebrochenen Ast zu entdecken, der ihm die Gewissheit gab, nicht alles geträumt zu haben. Aber es war nichts zu sehen.
»Okay. Gut. Na gut, ich erzähle Ihnen alles, aber Sie dürfen mich nicht unterbrechen!« Robert begann, sein Erlebnis von der letzten Nacht wahrheitsgemäß wiederzugeben, ohne Ausschmückungen hinzuzufügen und ohne ein Detail wegzulassen. Er wagte nicht, während seiner Schilderung einem von den beiden in die Augen zu sehen, er konnte sich auch so vorstellen, wie sie bei der einen oder anderen Stelle ungläubig die Augen verdrehten. Zwei- oder dreimal war er drauf und dran, mit seiner Geschichte aufzuhören, weil seine Darstellungen von der letzten Nacht selbst für ihn unwahrscheinlich klangen. Jetzt redete er sich ins Irrenhaus, dachte er, als er bei der Stelle angelangt war, als das Objekt ohne eine merkliche Luftbewegung über sie hinweggezogen war.
Plötzlich kniff Wegener die Augen zusammen und machte eine warnende Handbewegung.
»Was ist?«, fragte Lohmann gelangweilt. »Noch ’n UFO?«
»Sei still! Da ruft jemand!«
Alle drei drehten sich hin und her und lauschten in die Umgebung. Wegener ging einige Schritte zum Straßenrand und spähte über die niedrigen Büsche den steilen Abhang hinunter.
»Da unten bewegt sich etwas«‚ sagte er und suchte nach einer günstigen Abstiegsmöglichkeit. »Wir brauchen das Seil aus dem Kofferraum. Hier kommen wir nicht so einfach hinunter.«
Während die beiden Polizisten zum Streifenwagen gingen, versuchte Robert, über die Büsche zu spähen. Keine fünf Meter unter ihm, auf einem moosigen Absatz, hing ein beigefarbener Fleck, der seine Position ab und zu veränderte.
»Martha?«, rief er zögernd, dabei wusste er, dass es sich um seine Frau handeln musste. Ganz deutlich erkannte er die hellblauen Streifen auf dem Kostüm. »Martha, nicht bewegen, gleich kommt Hilfe!«
Ungeduldig beobachtete er, wie die Beamten ihre Mützen im Wagen deponierten und anschließend umständlich mit einem Seil hantierten. Es kostete ihn einige Überwindung, keine beißende Bemerkung loszuwerden, aber er hielt sich zurück, denn nach ihren Gesichtern zu schließen, hielten sie die ganze Operation offensichtlich für die Folgen eines wirren Ehedramas, mit dessen Auswirkungen sie sich nun gezwungenermaßen zu beschäftigen hatten. Nachdem Wegener auch noch seine Uniformjacke ausgezogen hatte, schlang er ein Seilende um die Hüfte und sicherte sich mit einem gekonnten Knoten. Sein Kollege befestigte das andere Ende kurzerhand an der Anhängerkupplung des Streifenwagens und hängte sich das Seil um Hüfte und Schulter. Robert hielt den Aufwand für die Aktion angesichts des ungefährlich erscheinenden Abhanges für etwas übertrieben, aber er schwieg auch diesmal, besonders als Wegener auf seinem Weg nach unten anscheinend ausrutschte und Lohmann sich heftig in das Seil stemmen musste.
Nach einigen Minuten bangen Wartens hörte Robert leise Marthas klagende Stimme nach oben dringen. Erst jetzt bemerkte er die Anspannung, die sich aus Sorge um seine Frau in ihm breitgemacht hatte. Gleichzeitig spürte er eine quälende Müdigkeit als Folge der Ereignisse. Erschöpft lehnte er sich an den Wagen und überließ dankbar den Polizisten die Bergung seiner Frau. Er versuchte verzweifelt, die geheimnisvollen Vorgänge der letzten Nacht in sein Gedächtnis zurückzurufen, aber alles, an das er sich noch erinnern konnte, war das Aufflammen des blauen Lichtes, das sie plötzlich von allen Seiten umgeben hatte. Auch die Umrisse des riesigen schwarzen Objektes, das er kurz zuvor über der Straße schwebend erblickt hatte, waren vor seinem geistigen Auge präsent. Manchmal meinte er, dass einzelne Bilder kurz irgendwo in einer Ecke seines Gehirns aufflackerten, um sogleich wieder zu verschwinden. Er konnte sie jedoch nicht definieren oder beschreiben. Es waren Momente, die er nicht in seine Vergangenheit einzuordnen vermochte. Wie verblasste Wischer aus einer anderen Welt.
»Robert!«
Martha stand vor ihm. Ihr Kostüm war als solches fast nicht mehr zu erkennen. Überall klebte nasses Laub an ihrem Körper, aber sie schien wohlauf zu sein. Sie spuckte kleine Fetzen von Moos von den Lippen und stürzte unter Tränen auf ihn zu. »Gott sei Dank, du lebst!«, rief sie, während sie ihn heftig umarmte.
»Ich bin okay«, antwortete er verblüfft. »Aber um dich habe ich mir Sorgen gemacht! Was ist denn eigentlich geschehen?«
Als er die Frage aussprach, bereute er seine voreilige Neugier auch schon. Was würde seine Frau antworten? Und wie würden die Beamten reagieren, die scheinbar unbeteiligt das Seil wieder im Kofferraum verstauten, aber dabei ganz offensichtlich ihre Unterhaltung nicht nur beiläufig verfolgten.
»Ich weiß es nicht«, sagte sie zu seiner Erleichterung. »Vor einer Stunde ungefähr bin ich da unten aufgewacht. Ich weiß auch nicht, wie ich dahin gekommen bin. Ich hatte die ganze Zeit über Angst, dass ich noch weiter nach unten rutsche, deswegen habe ich nach Hilfe gerufen, aber es hat mich niemand gehört. Dann ist der Polizist erschienen.« Sie schaute sich besorgt um. »Wo ist unser Auto? Haben wir einen Unfall gehabt?«
Robert beschloss, bei der Wahrheit zu bleiben, und erzählte ihr seine Erlebnisse. Martha nickte immer wieder heftig und bestätigte damit seine Version der Vorgänge in der Nacht.
»Richtig, an das blaue Licht kann ich mich noch genau erinnern, aber dann weiß ich nichts mehr. Es war ganz eindeutig ein UFO!« Sie blickte die beiden Beamten auffordernd an, als wollte sie von ihnen eine weitere Bestätigung haben.
»Frau Varell«‚ wich Wegener aus. »Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir Sie beide erst einmal nach Hause bringen. Ich muss Sie aber bitten, spätestens morgen auf unser Revier zu kommen, damit wir Ihre Aussagen aufnehmen können!«
»Was ist mit unserem Wagen?«, fragte Robert. »Können Sie veranlassen, dass man ihn aus der Wiese herausholt? Ich glaube nicht, dass ich ihn alleine dort herauskriege.«
Lohmann nickte. »Wir machen das schon. Sie müssen aber verstehen, dass wir das Fahrzeug vorerst beschlagnahmen, bis die Umstände vollständig aufgeklärt sind. Es ist mir ein Rätsel, wie Sie in eine Wiese fahren konnten, ohne Reifenabdrücke zu hinterlassen. Deswegen muss ich die Spurensicherung benachrichtigen. Ich schätze, es wird ein paar Tage dauern, bis Sie den Chrysler bei uns abholen können.«
Robert war einverstanden. Schließlich hatte er nichts zu verbergen und vielleicht konnte die Polizei die rätselhaften Vorgänge aufklären, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, dass etwas dabei herauskam.
»Wie Sie meinen«, erklärte er bereitwillig. »Ich weiß, dass unsere Erklärungen verrückt klingen, aber wir haben Ihnen alles genauso geschildert, wie wir es erlebt haben. Wir haben nichts verschwiegen …«
Robert stutzte plötzlich und wandte sich an Martha. »Deine Cibes! Wo ist dein Cyberfon? Du hattest doch irgendwann gesagt, du willst alles aufnehmen!«
Martha fasste sich an den Kopf, als würde sie ihren Hut vermissen. »Herrgott, ja richtig! Natürlich, ich habe doch alles aufgenommen!«
Sie lief zum Abhang und lugte vorsichtig über die Büsche. »Vielleicht habe ich sie dort unten verloren. Oder sie liegen im Auto.«
Robert hörte Lohmann leise aufstöhnen.
»Martha, wir brauchen sie nicht. Du hast doch gesagt, du würdest die Aufnahmen nach Hause senden. Wir sehen sie uns dort an. Und wenn die Dinger noch funktionieren, wissen wir auch, wo sie abgeblieben sind.«
Wegener sah Robert zweifelnd an. »Wie bitte? Wollen Sie damit sagen, Sie haben das … äh … die Vorgänge von heute Nacht aufgenommen?«
»Ja freilich, junger Mann!« Martha blitzte ihn beinahe zornig an. »Bringen Sie uns nach Frankfurt und überzeugen Sie sich davon, dass wir Ihnen keine Märchen aufgetischt haben!«
Lohmann öffnete ohne weiteren Kommentar eine Tür des Streifenwagens und lud sie zum Einsteigen ein. »Bitte, wir sind sehr gespannt.«
Ich auch, dachte Robert. Hoffentlich hatte seine Frau keinen Fehler gemacht, sonst wären sie endgültig blamiert. Andererseits, was hatten sie schon zu verlieren!
Die Fahrt verlief größtenteils schweigend. Vorher hatten sie kurz bei dem Chrysler haltgemacht, um nach den Cibes zu suchen, aber ohne Erfolg. Die Streifenbeamten hatten dabei oberflächlich die Karosserie des Wagens nach verdächtigen Kratzspuren untersucht, um herauszubekommen, wie der Wagen auf die unberührte Wiese gelangt sein könnte. Ohne Erfolg. Sichtlich verärgert, weil sie nach wie vor glaubten, dass man sie an der Nase herumführte, hatten sie die flüchtigen Untersuchungen eingestellt und auf eine Weiterfahrt gedrängt. Robert saß nun im Fond des Streifenwagens und rief sich immer wieder den Moment ins Gedächtnis, als das Licht sie in der Nacht umhüllte. Doch danach kam nichts. Manchmal reihten sich farbige Schatten an diese letzte Erinnerung, aber das konnten auch Bilder aus seiner Bewusstlosigkeit sein, die sich ihm aufdrängten. Es war alles so rätselhaft. Ihm gingen Berichte von Leuten durch den Kopf, die angeblich von UFOs entführt worden waren. Bisher hatte er darüber nur gelacht. Einmal hatte ihm Martha einen Zeitungsartikel über solche Entführungen vorgelesen. »Das sind alles Wichtigtuer, die sich gerne produzieren«, hatte er verächtlich bemerkt und sich nicht weiter um den Blödsinn gekümmert. Und jetzt? Jetzt saß er in einem Streifenwagen mit zwei Polizisten, denen er praktisch erklärt hatte, dass auf seinem Videogerät ein UFO zu sehen wäre. Und wenn er sich das alles nur eingebildet hatte? Aber was war mit Martha? Konnten sich zwei erwachsene Leute das Gleiche einbilden? Nein. Er schüttelte energisch den Kopf, dass Martha ihn fragend ansah. Er war sich sicher, sie hatten beide alles real erlebt. Sie würden es ja gleich sehen. Oder auch nicht, fügte er in Gedanken hinzu.
Robert wurde zusehends nervöser, als er die Tür zu ihrer Wohnung aufschloss. Ohne sich um die Polizisten und um Martha zu kümmern, rannte er fast ins Wohnzimmer, um nach dem Rekorder zu sehen.
»Da!«, rief er laut aus. »Er läuft noch! Die Cibes übertragen immer noch Aufnahmen!«
Mit zitternden Fingern tastete er an der Fernbedienung herum. »Die DSD läuft seit 14 Stunden. Hier! Sehen Sie!« Er deutete auf die verschiedenen Displays, als müsste er den Polizisten eine neue Technik erklären. »Martha legt immer eine Neue ein, wenn wir wegfahren, falls sie etwas von unterwegs aufnehmen will …«
Ein an- und abschwellender Ton ließ ihn verstummen, als er den Fernsehmonitor einschaltete. Sekunden später erschien ein wirres farbiges Bild.
Ein Testbild, dachte er. Blödsinn, Testbilder gab es doch schon lange nicht mehr. »Das ist das Bild, das die Cibes jetzt im Moment aufnehmen!«
Es klang fast wie eine Entschuldigung.
Auf der linken Seite war ein schmaler grüner Streifen zu sehen, der zur Mitte hin an Helligkeit zunahm. Diagonal dazu liefen viele kleine Lichtpunkte nach oben in ein dunkles Gelb hinein. Sie sahen auf jeden Fall wie Lichtpunkte aus, es konnten aber auch helle Kegel oder kleine Vertiefungen sein, die Lichtquellen simulierten. Ein undeutlicher blassblauer Zacken ragte von der rechten Seite über einige der Lichter und verdeckte sie. Darunter lag ein stumpfes Grau, das von feinen gelben Linien durchbrochen wurde, die sich nach unten hin zu verbreitern schienen. Bewegungen waren keine zu entdecken.
»Hübsch«‚ sagte Martha. »Im Wald liegen meine Cibes auf jeden Fall nicht!«
Sie sahen sich das farbige Bild eine Weile schweigend an.
»Da tut sich nichts«‚ sagte Lohmann schließlich. »Gehen Sie einmal zum Anfang zurück. Ich meine, dorthin, wo die Übertragung in der Nacht beginnt!«
Robert unterbrach den Empfang und aktivierte die Aufzeichnung.
»Na bitte!«, triumphierte Martha, als auf dem Monitor Robert im schwachen Schein der Armaturenbeleuchtung zu erkennen war.
Nach einigen heftigen Schwenks zwischen einem konzentriert aussehenden Robert und der beleuchteten Straße blieben die Kameras der Cibes auf einem glimmenden Licht, das hinter den Bäumen hervorschimmerte. Gebannt blickten vier Augenpaare auf die Szene, die sich vor ihnen abspielte.
Lohmann fand als Erster die Sprache wieder.
»Das … ist ja unfassbar!«, sagte er leise. »Ich glaube es einfach nicht!«
Kapitel 3
Thomas Schweighart begann sich zu langweilen. Vor drei Stunden hatte das Space Shuttle Intrepid von der Raumstation ISS abgekoppelt. Seitdem war nicht sehr viel Aufregendes passiert, wenn man einmal davon absah, dass sich das Shuttle gleich nach der Trennung im sogenannten »Barbecue Mode« unentwegt um seine Achse drehte, um das Raumschiff einer gleichmäßigen Erwärmung durch die Sonne auszusetzen. Dabei hatte Schweighart noch das Privileg, gleich hinter den Piloten im Oberdeck zu sitzen. Trotzdem konnte er durch die nahen Bugfenster nichts erkennen außer einer zweifelhaften Schwärze des Weltraums, der in einer Höhe von 350 Kilometern über der Erdoberfläche von den meisten Astronauten wohl mehr als die letzten Ausläufer der Atmosphäre bezeichnet wurde. Die Erde, die sich scheinbar um das Shuttle drehte, konnte er von seinem Platz aus nicht sehen. Dafür verfolgte er mit müden Augen die sich stetig verändernden Schatten auf den unzähligen Armaturen vorne im engen Cockpit. Er lehnte sich mit einem Seufzer zurück und versuchte, sich zu entspannen. Er hatte vier Monate auf der Raumstation zugebracht und war während des Aufenthalts ausgiebig in den Genuss des Anblicks der Erde gekommen. Jetzt war er auf der Heimreise. Das Shuttle hatte mit einer neuen Besatzung für die Raumstation und Versorgungsgütern vor drei Tagen an der ISS angelegt. Außerdem hatte es die unterschiedlichsten Paletten mit fertig montierten Laborsegmenten im Laderaum mitgebracht, die sofort von den Neuankömmlingen in der Raumstation installiert und in Betrieb genommen wurden. Es waren sehr hektische Tage gewesen. Einem unbeteiligten Beobachter wäre es fast so vorgekommen, als würde die neue Besatzung die alte regelrecht aus ihrer exotischen Behausung hinauswerfen. Aber der junge deutsche Astronaut konnte sie verstehen. Als er mit der Französin Annick Denny, dem Russen Ilja Kohlschovsky und dem amerikanischen Ehepaar Kenneth und Hilary Cochran im Frühjahr an der ISS andockte, hatten sie ebenfalls die Raumstation sofort in ihren Besitz genommen. All ihre Konzentration hatte sich auf die bevorstehenden Experimente und die weiteren Aufgaben gerichtet. Jeder, der nicht damit zu tun hatte, war ein Ablenkungsfaktor gewesen und wurde mit Respekt ignoriert, ohne dabei gegen ihn unhöflich zu sein. Vielleicht war es eine Art Selbstschutz, den man dabei entwickelte. Alle Ratschläge von den Vorbewohnern wurden wohl zur Kenntnis genommen, richtig hingehört hatte dennoch keiner. Jeder glaubte, seine eigenen Erfahrungen sammeln zu müssen, um seine eigenen vorgefassten Meinungen und Vorstellungen zu verwirklichen, obwohl jeder wusste, wie wichtig die Erkenntnisse der Vorbesatzung sein konnten. Trotzdem waren sie erleichtert gewesen, endlich allein auf der Station zu sein.
Und dann, nach intensiver Arbeit in den ungewohnt beengten Dimensionen, war trotz der langen vier Monate Aufenthalt die Zeit auf der Raumstation plötzlich vorbei. All die Mühen in der Vorbereitungszeit, das Bangen und Hoffen, einer der wenigen Auserwählten zu sein, hatte mit dem ersten Besuch im Weltraum ein glückliches Ende gefunden. In zwei Stunden würde alles vorbei sein. Bald würde der Commander die Rotation stoppen und das Shuttle drehen, um danach die Primary Thrusters zu zünden. Knappe drei Minuten würden die Hauptlagetriebwerke feuern und das Shuttle damit in einen elliptischen Orbit versetzen, der es der Reibung der Erdatmosphäre ausliefern würde. Danach wäre es nur noch eine knappe Stunde bis zur Landung in Florida.
Es ging alles viel zu schnell, dachte Schweighart. Am liebsten hätte er seine Gurte gelöst und wäre nach vorne ins Cockpit geschwebt, um noch einmal einen letzten Blick auf die Erde werfen zu können. Ihm lag die Bitte auch schon auf der Zunge und er beugte sich leicht nach vorne, aber dann traute er sich doch nicht. Er wusste nicht, warum, aber irgendwie verbreitete der amerikanische Commander eine unterschwellig knisternde Spannung in der Kabine. Vielleicht lag es daran, dass die Astronauten des Johnson Space Centers die Raumfähre als eine Art nationales Heiligtum ansahen, das durch die Anwesenheit von drei Europäern zeitweilig entheiligt wurde. Schweighart sah von dem Commander im linken vorderen Sitz nur die rechte Schulter und einen Teil der Beine, aber das Gesicht des Amerikaners hatte bei der ersten Begegnung einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen: mürrisch dreinblickende Augen, deren grünbraunen Farbton man unter den dichten Brauen kaum ausmachen konnte. Harte Gesichtszüge, die keinen Widerspruch duldeten. Die kurzen grauen Haare zeugten von Disziplin. Seine knappen Befehle und Kommentare versah er mit einem ironischen Unterton, durchsetzt mit beleidigendem Sarkasmus. Ein Kotzbrocken also, wie er im Buche stand.
Schweighart lehnte sich resignierend zurück und überprüfte zum wiederholten Mal seine Gurte und die Anschlüsse der kleinen Sauerstoffflasche, die an seinem Oberschenkel befestigt war.
Lass es gut sein, sagte er sich. Irgendwann komm ich wieder in den Weltraum. Und dann vielleicht sogar weiter als nur bis zur Raumstation. Er sollte sein Glück jetzt nicht überstrapazieren.
Er atmete tief durch und blickte nach links. Neben ihm, im zentralen Sitz des Oberdecks, saß die gedrungene Gestalt des Missionsspezialisten Ilja Kohlschovsky. Ein Russe, dessen Eltern aus Polen stammten. Er selbst lebte seit acht Jahren in den USA.
»Unser Vorzeige-Russe«, wie ihn der Commander gestern einmal genannt hatte. Kohlschovsky hatte die abfällige Bemerkung entweder überhört oder es hatte ihn nicht weiter berührt. Schweighart tippte auf Zweiteres, denn den Russen schien so schnell nichts aus dem Gleichgewicht zu bringen. Auch jetzt, so kurz vor der Landung, machte er das Beste aus der langweiligen Situation: Er schlief mit zur Seite geneigtem Kopf und mit leicht geöffnetem Mund. Seine Hakennase sah unter diesem Blickwinkel wie eine Missbildung aus. Unter dem oberen Rand des Helmes kringelte sich eine verschwitzte Haarlocke hervor. Soweit Schweighart wusste, war Kohlschovsky damals vom Johnson Space Center als großzügige Geste an die ehemalige Sowjetunion in den Kader der amerikanischen Astronauten übernommen worden. Es war letztendlich ein groß aufgemachter PR-Gag gewesen, der die guten Beziehungen zwischen Ost und West unterstreichen sollte. Kohlschovsky hatte seine Chance jedenfalls genutzt. Bisher war er der einzige nichtamerikanische Astronaut, der in den Rang eines Missionsspezialisten aufgestiegen war und damit abwechselnd zu einer festen Besatzung eines Space Shuttles gehörte oder gar, wie in den vergangenen Monaten, als ergänzendes Mitglied in der Raumstation gearbeitet hatte.
Von rechts vorne war leise die Stimme des Piloten zu hören, der sich mit Houston unterhielt. Von links vorne kam nur Schweigen. Der Commander hatte sich seit einer halben Stunde nicht einmal gerührt.
Commander James Jefferson DeHaney war sich der gespannten Stimmung durchaus bewusst, die von ihm ausging, auch wenn er es nach außen hin nicht zugeben wollte. Dabei konnte er keinen direkten Grund für seine Gereiztheit angeben, ganz im Gegenteil, alles lief reibungslos und der Ablaufplan des Fluges lag genau in der Timeline. Der wahre Kern seines Problems lag viel tiefer verborgen. Gerade in solchen Momenten wie in diesen, in denen er nicht viel zu tun hatte, außer die computergesteuerten Überwachungsprogramme des Shuttles auf den Monitoren zu beobachten, haderte er besonders mit seinem Schicksal. Es war sein sechster Flug mit einem Space Shuttle. Alle sechs Missionen waren nichts anderes gewesen, als Menschen und Material in den nahen Orbit zu befördern und wieder zur Erde zurückzubringen. Dieser »Vorgang«, wie er insgeheim seine Aufgabe bezeichnete, war für ihn nichts Besonderes mehr: Man ließ sich aus dem Stand nach oben schießen, steuerte die Raumstation an, sagte dem Computer, dass man wieder nach unten wollte, und landete genau da, wo man einige Tage zuvor gestartet war: 28 Grad, 36 Minuten nördlicher Breite und 80 Grad, 36 Minuten westlicher Länge, Kennedy Space Center.
Scheiß Perfektion!, dachte er bei sich. Nein falsch, die Perfektion war durchaus in Ordnung, es lag am Ziel! Er war nun 49 Jahre alt. Wenn er viel Glück hatte, würde man ihm vielleicht noch eine weitere Tour zugestehen. Die gleiche Prozedur. 300 Meilen rauf und 300 Meilen runter.
Der Mond zum Beispiel war für ihn Lichtjahre entfernt, der Mars befand sich in einem anderen Universum. Alles, was er jetzt machte, war den Weg für Jüngere zu ebnen, die bald zu interessanteren Zielen aufbrechen würden. Er dagegen würde dann zum Zusehen verurteilt sein. Er lebte zur falschen Zeit, wie man so schön zu sagen pflegte. Dabei hatte es zu Beginn seiner Karriere nicht danach ausgesehen. Wäre das amerikanische Raumfahrtprogramm normal verlaufen, dann gäbe es diese verdammte Weltraumstation schon längst und alles wäre bereit gewesen für das große Abenteuer Mondbasis oder Marsflug. Aber dann hatte im Jahre 1986 ein Dichtungsring an einer Feststoffrakete der Raumfähre Challenger versagt. Damit hatte nicht nur der unglückselige Orbiter mit seiner siebenköpfigen Besatzung ein tragisches Ende gefunden, sondern mit ihnen auch die weitere Entwicklung der amerikanischen Raumfahrt. Man hatte den Grund für die Katastrophe gesucht und ihn gefunden. Aber anschließend wurden das System der Raumfähre und ihre zukünftigen Aufgaben neu definiert. Zwei Jahre vergingen bis zum nächsten Start eines Shuttles. Inzwischen wurde von den Medien die alte Leier von Sinn und Zweck, Wert und Nutzen der Eroberung des Weltraums wieder hervorgezerrt und abgespielt. Alles war erneut infrage gestellt. Zurück zum Anfang.
Schließlich die Columbia-Katastrophe im Januar 2003. Aus DeHaneys Sicht ein noch größerer Rückschlag für die Raumfahrt, denn mit der bis dahin ältesten Raumfähre verglühten auch die Träume für einen Flug zum Mars in der nahen Zukunft. Für die Öffentlichkeit lag es auf der Hand, dass die NASA ihre Hausaufgaben nicht gemacht und keine Lehren aus der Vergangenheit gezogen hatte. Wie sollten Menschen zum Roten Planeten und wieder unbeschadet zurück gelangen, wenn man es noch nicht einmal schaffte, die Technik für den erdnahen Orbit zu beherrschen?
DeHaney wusste, dass er ungerecht urteilte. Und genau das war sein Problem. Er war viel zu intelligent, um mit der Vergangenheit unzufrieden zu sein, denn er verdankte ihr seine Erfolge. Und gleichzeitig war er zu inkonsequent, um einen Schlussstrich zu ziehen. Er hatte während der letzten Jahre einfach seine Perspektiven verloren.
Nachdenklich sah er zu seinem Piloten rechts neben ihm. Timothy Caesar Cooper war gerade einmal 33 Jahre alt. Sein Vater hatte ihm den pompösen zweiten Vornamen gegeben, nachdem er kurz vor der Geburt seines Sohnes im Caesar’s Palace in Las Vegas mehrere Tausend Dollar an einer Slotmachine gewonnen hatte.
Es war Coopers erster Flug. Und bestimmt nicht sein letzter. Der ganze Weltraum lag noch vor ihm. Oder wenigstens der Mond. DeHaney dagegen war am Ende seiner Karriere angelangt, ohne zu wissen, was das für ihn bedeuten würde. Sicherlich würden sich einige »alte« Freunde für ihn starkmachen, damit er einen lukrativen Job bei der NASA übernehmen konnte, aber er wusste, dass er nicht dafür geschaffen war, anderen beim großen Spiel zuzuschauen. Also würde er sich in irgendeine komfortable Höhle auf dem Land verkriechen. Seine Frau Autumn hatte sogar schon eine gefunden und war eifrig damit beschäftigt, sie einzurichten: ein großräumiges Landhaus in der Nähe von Burlington, Vermont. Dort würden sie die restlichen Dekaden ihres Lebens verbringen, im Winter mit knisternden Holzscheiten im offenen Kamin und im Sommer auf der kleinen Jacht auf dem Lake Champlain. Zu gegebenen Anlässen würden die Kinder vorbeischauen und ansonsten würden er und seine Frau die Rolle eines ehemaligen Astronauten plus Ehefrau spielen, sehr zur Freude des Bürgermeisters, der damit einen Prominenten mehr in seiner Gemeinde vorzeigen konnte.
DeHaney fluchte innerlich. Sein Mentor John Young war vor ein paar Jahren auch noch mit dem Shuttle unterwegs gewesen, aber er hatte wenigstens in den Anfängen der Raumfahrt in einer besseren Konservenbüchse die Anziehungskraft der Erde abgeschüttelt, als einer von zwölf Menschen den Mond betreten und den ersten Flug eines Space Shuttles befehligt. Young hatte Glück gehabt. Ihm hätte der Orbit allein auch keinen Spaß gemacht mit all diesen Computern, die das Shuttle praktisch selbstständig steuerten und ihn mit quietschenden Piepsern und elektronischem Getöse daran erinnerten, was er als Nächstes zu tun hatte.
Oder der junge Deutsche rechts hinter ihm. Bald würden die Europäer ihr eigenes Shuttle nach oben schicken. Schweighart – war das sein Name? – hatte vier Monate auf der ISS verbracht. Mit seiner Erfahrung als Pay Load Specialist und mit seinen jungen Jahren stand er ganz oben auf der Liste für künftige Missionen. Ebenso die kleine Französin, die unten im Mitteldeck saß. Eine europäische Astronautin aus Paris. Die Boulevardpresse überschlug sich seit Monaten mit immer neuen Berichten über ihr Leben vor und während der Mission.
DeHaney grinste schmierig. Nach der Landung könnte sie vom Playboy wahrscheinlich jede Summe für eine ausklappbare Hochglanzseite verlangen. Sie sah einfach fantastisch aus. Eine hochgewachsene, grazile Person mit einer dunklen Lockenmähne, lebhaften grünen Augen und einem großen Mund, auf dem ständig ein herausforderndes Lächeln lag. Sie war eine von den Frauen, die man nur aus der Ferne anbeten konnte. Unnahbar und doch begehrenswert. Ob sie während der Zeit auf der Station etwas mit dem Deutschen gehabt hatte?
DeHaney presste wie unter plötzlichen Schmerzen die Augen zusammen und blickte auf die sanfte blaue Rundung der Erde, die sich langsam über ihn hinwegdrehte. O Mann, Jim, du verwandelst dich allmählich in einen bösen alten Mann!
Hätte Kenneth Cochran seine schmutzigen Gedanken lesen können, so wäre er von ihm unverzüglich ans Kreuz genagelt worden. Wahrscheinlich saß er jetzt mit glücklichem Gesichtsausdruck im Mitteldeck und hielt zufrieden die Hand seiner Frau. DeHaney hatte die beiden Biologen bei seinem ersten Flug kennengelernt. Deren puritanische Vorfahren hätten ihre wahre Freude an ihnen gehabt. Ken und Hilary Cochran lebten nach strengen moralischen Gesetzen. Ihre Lebensphilosophie bestand aus Arbeit, Disziplin und Demut. Und vor allem aus einer stoischen Hingabe zur Zufriedenheit und nach außen getragenem Glücklichsein. Er nahm ihnen nicht alles ab, aber er hatte bisher noch keine Abweichung von ihrem keuschen Lebenspfad feststellen können. Wozu auch? Sie waren hervorragende Wissenschaftler, die auf allen Kontinenten anerkannt waren und sich im Weltraum bewährt hatten. Auf der Erde begann ihr Tag um fünf Uhr früh mit Sport und anschließenden Lobpreisungen des Herrn und endete friedlich um neun Uhr abends mit einem Gebet. Bestimmt stellten sie ihr Müsli selbst her und widmeten sich ansonsten ganz ihrer Arbeit. DeHaney konnte sich nicht vorstellen, dass sie Zeit damit verbrachten, an so etwas Ähnliches wie Sex zu denken, geschweige denn überhaupt etwas damit zu schaffen zu haben.