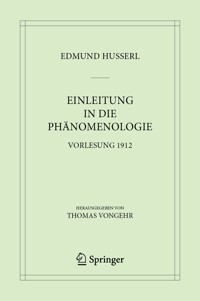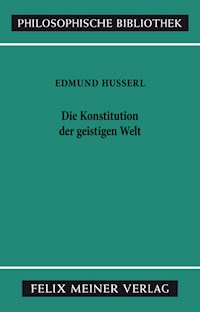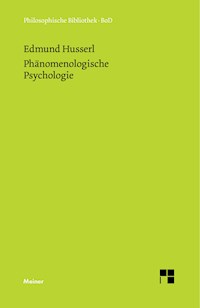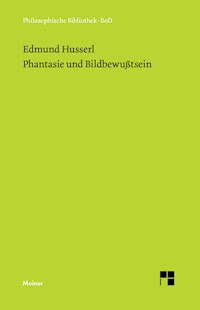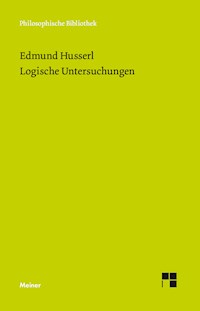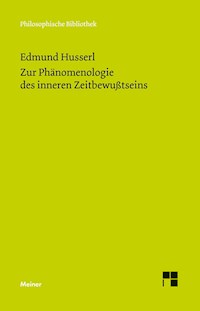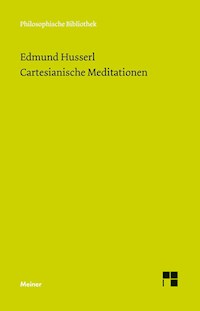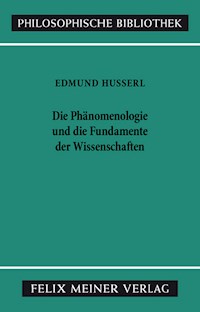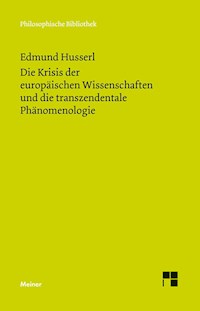9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der zweite Band der zweibändigen Husserl-Auswahlausgabe enthält neben einer ausführlichen Bibliographie Texte zu folgenden Themen: Analyse der Wahrnehmung – Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins – Konstitution der Intersubjektivität – Das Problem der Lebenswelt. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Ähnliche
Edmund Husserl
Phänomenologie der Lebenswelt
Ausgewählte Texte II
Herausgegeben von Klaus HeldBibliographisch ergänzt von Sebastian Luft
Reclam
1986, 2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Bibliographisch ergänzte Ausgabe 2021
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961909-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014187-8
www.reclam.de
Inhalt
Analyse der Wahrnehmung
Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins
Konstitution der Intersubjektivität
Das Problem der Lebenswelt
Zu dieser Ausgabe
Literaturhinweise
Nachwort
[5]Analyse der Wahrnehmung1
[3] 1. Originalbewusstsein und perspektivische Abschattung der Raumgegenstände
Die äußere Wahrnehmung ist eine beständige Prätention, etwas zu leisten, was sie ihrem eigenen Wesen nach zu leisten außerstande ist. Also gewissermaßen ein Widerspruch gehört zu ihrem Wesen. Was damit gemeint ist, wird Ihnen alsbald klarwerden, wenn Sie schauend zusehen, wie sich der objektive Sinn als Einheit 〈in〉 den unendlichen Mannigfaltigkeiten möglicher Erscheinungen darstellt und wie die kontinuierliche Synthese näher aussieht, welche als Deckungseinheit denselben Sinn erscheinen lässt, und wie gegenüber den faktischen, begrenzten Erscheinungsabläufen doch beständig ein Bewusstsein von darüber hinausreichenden, von immer neuen Erscheinungsmöglichkeiten besteht.
Worauf wir zunächst achten, ist, dass der Aspekt, die perspektivische Abschattung, in der jeder Raumgegenstand unweigerlich erscheint, ihn immer nur einseitig zur Erscheinung bringt. Wir mögen ein Ding noch so vollkommen wahrnehmen, es fällt nie in der Allseitigkeit der ihm zukommenden und es sinnendinglich ausmachenden Eigenheiten in die Wahrnehmung. Die Rede von diesen und jenen Seiten des Gegenstandes, die zu wirklicher Wahrnehmung kommen, ist unvermeidlich. Jeder Aspekt, jede noch so weit fortgeführte Kontinuität von einzelnen Abschattungen gibt nur Seiten, und das ist, wie wir uns überzeugen, kein bloßes Faktum: Eine äußere Wahrnehmung [6]ist undenkbar, die ihr Wahrgenommenes in ihrem sinnendinglichen Gehalt erschöpfte, ein Wahrnehmungsgegenstand ist undenkbar, der in einer abgeschlossenen Wahrnehmung im strengsten Sinn allseitig, nach der Allheit seiner sinnlich anschaulichen Merkmale gegeben sein könnte.
[4] So gehört zum Urwesen der Korrelation äußere Wahrnehmung und körperlicher »Gegenstand« diese fundamentale Scheidung von eigentlich Wahrgenommenem und eigentlich Nichtwahrgenommenem. Sehen wir den Tisch, so sehen wir ihn von irgendeiner Seite, und diese ist dabei das eigentlich Gesehene; er hat noch andere Seiten. Er hat eine unsichtige Rückseite, er hat unsichtiges Inneres, und diese Titel sind eigentlich Titel für vielerlei Seiten, vielerlei Komplexe möglicher Sichtigkeit. Das ist eine sehr merkwürdige Wesensanlage. Denn zu dem eigenen Sinn jeder Wahrnehmung gehört ihr wahrgenommener Gegenstand als ihr gegenständlicher Sinn, also dieses Ding: der Tisch, der gesehen ist. Aber dieses Ding ist nicht die jetzt eigentlich gesehene Seite, sondern ist (und dem eigenen Sinn der Wahrnehmung gemäß) ebendas Vollding, das noch andere Seiten hat, Seiten, die nicht in dieser, sondern in anderen Wahrnehmungen zur eigentlichen Wahrnehmung kommen würden. Wahrnehmung, ganz allgemein gesprochen, ist Originalbewusstsein. Aber in der äußeren Wahrnehmung haben wir den merkwürdigen Zwiespalt, dass das Originalbewusstsein nur möglich ist in der Form eines wirklich und eigentlich original Bewussthabens von Seiten und eines Mitbewussthabens von anderen Seiten, die eben nicht original da sind. Ich sage mitbewusst, denn auch die unsichtigen Seiten sind doch für das Bewusstsein irgendwie da, »mitgemeint« als mitgegenwärtig. Aber sie [7]erscheinen eigentlich nicht. Es sind nicht etwa reproduktive Aspekte als darstellende Anschauungen von ihnen da, wir können nur jederzeit solche anschaulichen Vergegenwärtigungen herstellen. Die Vorderseite des Tisches sehend, können wir, wenn wir gerade wollen, einen anschaulichen Vorstellungsverlauf, einen reproduktiven Verlauf von Aspekten inszenieren, durch den eine unsichtige Seite des Dings vorstellig würde. Was wir dabei aber tun, ist nichts anderes, als uns einen Wahrnehmungsverlauf vergegenwärtigen, in dem wir, von Wahrnehmung zu neuen Wahrnehmungen übergehend, den Gegenstand von immer neuen Seiten in den originalen Aspekten sehen würden. Das geschieht aber nur ausnahmsweise. Es ist klar, dass, was die wirklich gesehene Seite als bloße Seite charakterisiert und es macht, dass nicht sie als das Ding genommen wird, sondern dass etwas über sie Hinausreichendes bewusst ist als wahrgenommen, von dem gerade nur [5] das wirklich gesehen ist, in einem unanschaulichen Hinausweisen, Indizieren besteht. Das Wahrnehmen ist, noetisch gesprochen, ein Gemisch von wirklicher Darstellung, die das Dargestellte in der Weise originaler Darstellung anschaulich macht, und leerem Indizieren, das auf mögliche neue Wahrnehmungen verweist. In noematischer Hinsicht ist das Wahrgenommene derart abschattungsmäßig Gegebenes, dass die jeweilige gegebene 〈Seite〉 auf anderes Nichtgegebenes verweist, als nicht gegeben von demselben Gegenstand. Das gilt es zu verstehen.
Zunächst werden wir darauf aufmerksam, dass jede Wahrnehmung, noematisch: Jeder einzelne Aspekt des Gegenstandes in sich selbst auf eine Kontinuität, ja auf vielfältige Kontinua möglicher neuer Wahrnehmungen [8]verweist, eben diejenigen, in denen sich derselbe Gegenstand von immer neuen Seiten zeigen würde. Das Wahrgenommene in seiner Erscheinungsweise ist, was es ist, in jedem Momente des Wahrnehmens, 〈als〉 ein System von Verweisen, mit einem Erscheinungskern, an dem sie ihren Anhalt haben, und in diesen Verweisen ruft es uns gewissermaßen zu: Es gibt hier noch Weiteres zu sehen, dreh mich doch nach allen Seiten, durchlaufe mich dabei mit dem Blick, tritt näher heran, öffne mich, zerteile mich. Immer von neuem vollziehe Umblick und allseitige Wendung. So wirst du mich kennenlernen nach allem, was ich bin, all meinen oberflächlichen Eigenschaften, meinen inneren sinnlichen Eigenschaften usw. Sie verstehen, was diese andeutende Rede besagen soll. In der jeweiligen aktuellen Wahrnehmung habe ich gerade die und keine anderen Aspekte und Aspektwandlungen, und immer nur begrenzte Aspektwandlungen. In jedem Moment ist der gegenständliche Sinn derselbe hinsichtlich des Gegenstandes schlechthin, der gemeinter ist, und ist in der kontinuierlichen Abfolge der Momentanerscheinungen in Deckung. So etwa dieser Tisch da. Aber dieses Identische ist ein beständiges x, ist ein beständiges Substrat von wirklich erscheinenden Tisch-Momenten, aber auch von Hinweisen auf noch nicht erscheinende. Diese Hinweise sind zugleich Tendenzen, Hinweistendenzen, die zu den nicht gegebenen Erscheinungen forttreiben. Aber es sind nicht einzelne Hinweise, sondern ganze Hinweissysteme, Strahlensysteme von Hinweisen, die auf entsprechende mannigfaltige Erscheinungssysteme deuten. Es sind Zeiger in eine Leere, da ja die nicht aktualisierten [6] Erscheinungen nicht als wirkliche, auch nicht als vergegenwärtigte Erscheinungen bewusst [9]sind. Mit andern Worten, alles eigentlich Erscheinende ist nur dadurch Dingerscheinendes, dass es umflochten und durchsetzt ist von einem intentionalen Leerhorizont, dass es umgeben ist von einem Hof erscheinungsmäßiger Leere. Es ist eine Leere, die nicht ein Nichts ist, sondern eine auszufüllende Leere, es ist eine bestimmbare Unbestimmtheit. – Denn nicht beliebig ist der intentionale Horizont auszufüllen; es ist ein Bewusstseinshorizont, der selbst den Grundcharakter des Bewusstseins als Bewusstsein von Etwas hat. Seinen Sinn hat dieser Bewusstseinshof, trotz seiner Leere, in Form einer Vorzeichnung, die dem Übergang in neue aktualisierende Erscheinungen eine Regel vorschreibt. Die Vorderseite des Tisches sehend, ist die Rückseite, ist alles von ihm Unsichtige in Form von Leervorweisen bewusst, wenn auch recht unbestimmt; aber wie unbestimmt, so ist es doch Vorweis auf eine körperliche Gestalt, auf eine körperliche Färbung usw., und nur Erscheinungen, die dergleichen abschatten, die im Rahmen dieser Vorzeichnung das Unbestimmte näher bestimmen, können sich einstimmig einfügen; nur sie können ein identisches x der Bestimmung durchhalten als dasselbe, sich hierbei neu und näher bestimmende. Bei jeder Wahrnehmungsphase des strömenden Wahrnehmens, bei jeder neuen Erscheinung gilt immer wieder dasselbe, nur dass der intentionale Horizont sich geändert und verschoben hat. Zu jedem Dingerscheinenden einer jeden Wahrnehmungsphase gehört ein neuer Leerhorizont, ein neues System bestimmbarer Unbestimmtheit, ein neues System von Fortschrittstendenzen mit entsprechenden Möglichkeiten, in bestimmt geordnete Systeme möglicher Erscheinungen einzutreten, möglicher Aspektverläufe mit untrennbar [10]zugehörigen Horizonten, die in einstimmiger Sinnesdeckung denselben Gegenstand als sich immer neu bestimmenden zu wirklicher, erfüllender Gegebenheit bringen würden. Die Aspekte sind, wie wir sehen, nichts für sich, sie sind Erscheinungen-von nur durch die von ihnen nicht abtrennbaren intentionalen Horizonte.
Wir unterscheiden dabei zwischen Innenhorizont und Außenhorizont der jeweiligen Aspekterscheinung. Es ist nämlich zu beachten, dass die Scheidung von eigentlich Wahrgenommenem und nur Mitgegenwärtigem zwischen inhaltlichen Bestimmt[7]heiten des Gegenstandes unterscheidet, die wirklich erscheinungsmäßig und leibhaft dastehen, und solchen, die in völliger Leere und noch vieldeutig vorgezeichnet sind; dass auch das wirklich Erscheinende in sich selbst mit einem ähnlichen Unterschied behaftet ist. Auch hinsichtlich der schon wirklich gesehenen Seite ertönt ja der Ruf: Tritt näher und immer näher, sieh mich dann unter Änderung deiner Stellung, deiner Augenhaltung usw. fixierend an, du wirst an mir selbst noch vieles neu zu sehen bekommen, immer neue Partialfärbungen usw., vorhin unsichtige Strukturen des nur vordem unbestimmt allgemein gesehenen Holzes usw. Also auch das schon Gesehene ist mit vorgreifender Intention behaftet. Es ist, was schon gesehen ist, immerfort ein vorzeichnender Rahmen für immer Neues, ein x für nähere Bestimmung. Immerfort ist antizipiert, vorgegriffen. Neben diesem Innenhorizont dann aber die Außenhorizonte, die Vorzeichnungen für solches, das noch jedes anschaulichen Rahmens entbehrt, der nur differenziertere Einzeichnungen forderte.
[11]2. Das Verhältnis von Fülle und Leere im Wahrnehmungsprozess und die Kenntnisnahme
Um jetzt ein tieferes Verständnis zu gewinnen, müssen wir auf die Art achten, wie in jedem Momente Fülle und Leere zueinander stehen und wie im Wahrnehmungsverlauf die Leere sich Fülle zueignet und die Fülle wieder zur Leere wird. Wir müssen die Zusammenhangsstruktur in jeder Erscheinung und die alle Erscheinungsreihen einigende Struktur verstehen. Im kontinuierlichen Fortgang der Wahrnehmung haben wir, wie bei jeder Wahrnehmung, Protentionen, die sich stetig erfüllen im neu Eintretenden, eintretend in der Form des urimpressionalen Jetzt. So auch hier. In jedem Fortgang äußeren Wahrnehmens hat die Protention die Gestalt von stetigen Vorerwartungen, die sich erfüllen, und das sagt: Aus den Hinweissystemen der Horizonte aktualisieren sich gewisse Hinweislinien kontinuierlich als Erwartungen, die sich stetig erfüllen in näher bestimmenden Aspekten.
In der letzten Vorlesung lernten wir die Einheit jeder äußeren Wahrnehmung nach verschiedenen Richtungen verstehen. Die äußere Wahrnehmung ist ein zeitlicher Erlebnisabfluss, in dem [8] Erscheinungen in Erscheinungen einstimmig ineinander übergehen, in die Deckungseinheit, der Einheit eines Sinnes entspricht. Diesen Fluss lernten wir verstehen als ein systematisches Gefüge fortschreitender Erfüllung von Intentionen, womit freilich nach anderer Seite wieder Hand in Hand geht eine Entleerung schon voller Intentionen. Jede Momentanphase der Wahrnehmung ist in sich selbst ein Gefüge von partiell vollen und partiell leeren Intentionen. Denn in jeder Phase haben wir [12]eigentliche Erscheinung, und das ist erfüllte Intention, aber doch nur graduell erfüllte, da ein Innenhorizont der Unerfülltheit und einer noch bestimmbaren Unbestimmtheit da ist. Außerdem aber gehört zu jeder Phase ein völlig leerer Außenhorizont, der nach Erfüllung tendiert und im Übergang nach einer bestimmten Fortschrittsrichtung danach in der Weise der leeren Vorerwartung langt.
Genauer besehen müssen wir aber Erfüllung und Näherbestimmung noch (und in folgender Weise) unterscheiden und müssen jetzt den Prozess der Wahrnehmung als einen Prozess der Kenntnisnahme beschreiben. Indem im Fortschritt der Wahrnehmung sich der Leerhorizont, der äußere und innere, seine nächste Erfüllung schafft, besteht diese Erfüllung nicht bloß darin, dass die leer bewusste Sinnesvorzeichnung eine anschauliche Nachzeichnung erfährt. Zum Wesen der leeren Vordeutung, die sozusagen eine Vorahnung des Kommenden ist, gehört, wie wir sagten, Unbestimmtheit, und wir sprachen von bestimmbarer Unbestimmtheit. Unbestimmtheit ist eine Urform von Allgemeinheit, deren Wesen es ist, sich in der Sinnesdeckung nur durch »Besonderung« zu erfüllen; soweit diese selbst den Charakter der Unbestimmtheit hat, aber der besonderen Unbestimmtheit gegenüber der vorangegangenen allgemeinen, gewinnt sie eventuell in neuen Schritten weitere Besonderung usf. Nun ist aber zu beachten, dass dieser Prozess der Erfüllung, die besondernde Erfüllung ist, auch ein Prozess der näheren Kenntnisnahme ist, und nicht nur einer momentanen Kenntnisnahme, sondern zugleich ein Prozess der Aufnahme in die bleibende, habituell werdende Kenntnis. Das werden wir sogleich besser verstehen. Im Voraus merken wir schon, dass die Urstätte dieser Leistung [13]die immerfort mitfungierende Retention ist. Zunächst sei daran erinnert, dass kontinuierlich fortschreitende Erfüllung [9] zugleich kontinuierlich fortschreitende Entleerung ist. Denn sowie eine neue Seite sichtig wird, wird eine eben sichtig gewordene allmählich unsichtig, um schließlich ganz unsichtig zu werden. Aber was unsichtig geworden ist, ist für unsere Kenntnis nicht verloren. Worauf das thematisch sich vollziehende Wahrnehmen hinauswill, ist ja nicht bloß, von Moment zu Moment immer Neues vom Gegenstand anschaulich zu haben, als ob das Alte dem Griff des Interesses entgleiten dürfte, sondern im Durchlaufen eine Einheit originärer Kenntnisnahme zu schaffen, durch die der Gegenstand nach seinem bestimmten Inhalt zur ursprünglichen Erwerbung und durch sie zum bleibenden Kenntnisbesitz würde.2 Und in der Tat: Die ursprüngliche Kenntniserwerbung verstehen wir in der Beachtung des Umstandes, dass die mit der Erfüllung sich vollziehende Näherbestimmung ein bestimmtes Sinnesmoment neu beibringt, das zwar im Fortgang zu neuen Wahrnehmungen aus dem eigentlichen Wahrnehmungsfeld entschwindet, aber retentional erhalten bleibt. (Das geschieht schon vorthematisch, schon im Hintergrundwahrnehmen. Im thematischen Wahrnehmen hat die Retention den thematischen Charakter des Im-Griff-Bleibens.) Demgemäß hat der Leerhorizont, in den das Neue dank der Retention jetzt eingeht, einen anderen Charakter als der Leerhorizont der Wahrnehmungsstrecke, bevor sie originär aufgetreten war. Habe ich die Rückseite eines unbekannten Gegenstandes einmal gesehen und kehre ich wahrnehmend zur Vorderseite zurück, so hat die leere Vordeutung auf die Rückseite nun eine bestimmte Vorzeichnung, die sie vordem nicht [14]hatte. Im Wahrnehmungsprozess verwandelt sich dadurch der unbekannte Gegenstand in einen bekannten; am Ende habe ich zwar genau wie am Anfang nur eine einseitige Erscheinung, und ist das Objekt gar aus unserem Wahrnehmungsfeld ganz herausgetreten, so haben wir von ihm überhaupt eine völlig leere Retention. Aber trotzdem, den ganzen Kenntniserwerb haben wir noch, und bei thematischem Wahrnehmen noch im Griff. Unser Leerbewusstsein hat jetzt eine gegliederte, systematische Sinneseinzeichnung, welche vordem, und vor allem [10] bei Beginn der Wahrnehmung, nicht bestand. Was damals ein bloßer Sinnesrahmen war, eine weit gespannte Allgemeinheit, ist jetzt eine sinnvoll gegliederte Besonderheit, die freilich weiterer Erfahrung harrt, um noch reichere Kenntnisgehalte als Bestimmungsgehalte anzunehmen. Kehre ich zu Wahrnehmungen der früheren Bestimmung wieder zurück, so laufen sie nun ab im Bewusstsein des Wiedererkennens, im Bewusstsein: »All das kenne ich schon.« Nun findet bloß Veranschaulichung, und mit ihr erfüllende Bestätigung der leeren Intentionen statt, aber nicht mehr Näherbestimmung.
3. Die Möglichkeit der freien Verfügung über das zur Kenntnis Kommende
Indem die Wahrnehmung ursprünglich Kenntnis erwirbt, erwirbt sie auch ein für die Dauer bleibendes Eigentum des Erworbenen, einen jederzeit verfügbaren Besitz. Worin besteht diese freie Verfügbarkeit? Frei verfügbar ist dieses schon Bekannte, obschon Leergewordene insofern, als die [15]nachgebliebene leere Retention jederzeit frei erfüllbar ist, jederzeit zu aktualisieren ist durch Wiederwahrnehmung im Charakter des Wiedererkennens. Herumgehend, nähertretend, mit den Händen tastend etc., kann ich alle schon bekannten Seiten wiedersehen, wieder erfahren, sie sind wahrnehmungsbereit; und dasselbe gilt für die Folgezeit. Das bezeichnet den Grundcharakter der transzendenten Wahrnehmung, durch den allein eine bleibende Welt für uns da, für uns vorgegebene und eben frei verfügbare Wirklichkeit sein kann, dass für die Transzendenz eine Wiederwahrnehmung, erneute Wahrnehmung desselben möglich ist.
Doch noch ein Weiteres ist als wesentlich beizufügen. Haben wir ein Ding kennengelernt und tritt ein zweites Ding in unseren Gesichtskreis, das nach der eigentlich gesehenen Seite mit dem früheren und bekannten übereinstimmt, so erhält nach einem Wesensgesetz des Bewusstseins (vermöge einer inneren Deckung mit dem durch »Ähnlichkeitsassoziation« geweckten früheren) das neue Ding die ganze Kenntnisvorzeichnung vom früheren her. Es wird, wie man sagt, apperzipiert mit gleichen unsichtigen Eigenschaften wie das alte. Und auch diese Vorzeichnung, dieser [11] Erwerb innerer Tradition ist zu unserer freien Verfügung in Form aktualisierender Wahrnehmung.
Aber wie sieht nun des Näheren diese freie Verfügung aus? Was macht das freie Eindringen in unsere durch und durch von Antizipationen übersponnene Welt, was macht alle bestehende Kenntnis und neue Kenntnis möglich? Wir bevorzugen hierbei den normalen und Grundfall der Konstitution von äußerem Dasein, nämlich den von unveränderten Raumdingen. Die Klarlegung der Möglichkeit, dass [16]Veränderungen von Dingen vonstatten gehen können, ohne dass sie wahrgenommen sind, und doch in mannigfachen nachkommenden Wahrnehmungen und Erfahrungen der Kenntnis, nach allen ihren unwahrgenommenen Stücken, zugänglich sind, ist ein höher liegendes Thema, das schon die Aufklärung der Möglichkeit einer Erkenntnis von ruhendem Dasein voraussetzt.
Wir fragen also, um wenigstens dieses Grundstück der konstitutiven Problematik zum Verständnis zu bringen, wie sieht die freie Verfügung über Kenntnis aus, die ich schon habe, wenn auch noch so unvollkommen habe, und zwar im Fall unveränderter Dinglichkeit? Was macht sie möglich?
Aus dem Bisherigen ersehen wir, dass jede Wahrnehmung implicite ein ganzes Wahrnehmungssystem mit sich führt, jede in ihr auftretende Erscheinung ein ganzes Erscheinungssystem, nämlich in Form von intentionalen Innen- und Außenhorizonten. Keine erdenkliche Erscheinungsweise gibt darum den erscheinenden Gegenstand vollkommen, in keiner ist er letzte Leibhaftigkeit, die das vollkommen erschöpfende Selbst des Gegenstandes brächte, jede Erscheinung führt im Leerhorizont ein plus ultra mit sich. Und da mit jeder die Wahrnehmung doch prätendiert, den Gegenstand leibhaft zu geben, so prätendiert sie in der Tat beständig mehr, als sie ihrem eigenen Wesen nach leisten kann. In eigentümlicher Weise ist jede Wahrnehmungsgegebenheit ein beständiges Gemisch von Bekanntheit und Unbekanntheit, die auf neue mögliche Wahrnehmung verweist, die zur Bekanntheit bringen würde. Und das wird noch in einem neuen Sinn gelten als in dem, der bisher hervorgetreten ist.
[17]Sehen wir nun zu, wie im Übergang der Erscheinungen, etwa im Nähertreten, Herumgehen, Augenbewegen, die Deckungseinheit nach dem Sinn aussieht. Das Grundverhältnis in diesem be[12]weglichen Übergang ist das zwischen Intention und Erfüllung. Die leere Vorweisung eignet sich die ihr entsprechende Fülle an. Sie entspricht der mehr oder minder reichen Vorzeichnung, bringt aber, da ihr Wesen unbestimmbare Unbestimmtheit ist, in eins mit der Erfüllung auch Näherbestimmung. Also damit ist eine neue »Urstiftung« vollzogen, eine Urimpression, wie wir hier wieder sagen können, denn ein Moment ursprünglicher Originalität tritt auf. Das schon urimpressional Bewusste weist durch seinen Hof auf neue Erscheinungsweisen vor, die, eintretend, teils als bestätigende, teils als näher bestimmende auftreten. Vermöge der unerfüllten und jetzt sich erfüllenden Innenintentionen bereichert sich das schon Erscheinende in sich selbst. Dazu schafft sich im Fortgang der leere Außenhorizont, der mit der Erscheinung verflochten war, seine nächste Erfüllung, mindestens eine partielle. Der unerfüllt bleibende Teil des Horizonts geht über in den Horizont der neuen Erscheinung, und so geht es stetig weiter. Dabei verliert sich, was schon vom Gegenstand in die Erscheinung getreten war, partiell wieder im Fortgang aus der Erscheinungsgegebenheit, das Sichtige wird wieder unsichtig. Aber es ist nicht verloren. Es bleibt retentional bewusst und in der Form, dass der Leerhorizont der Erscheinung, die gerade aktuell ist, nun eine neue Vorzeichnung erhält, die bestimmt auf das schon früher gegeben Gewesene als Mitgegenwärtiges verweist. Habe ich die Rückseite gesehen und bin zur Vorderseite zurückgekehrt, so hat der Wahrnehmungsgegenstand für mich eine [18]Sinnesbestimmung erhalten, die auch im Leeren auf das vordem Gesehene verweist. Es bleibt dem Gegenstand zugeeignet. Der Prozess der Wahrnehmung ist ein Prozess beständiger Kenntnisnahme, der das in Kenntnis Genommene im Sinn festhält und so einen immer neu gewandelten und immer mehr bereicherten Sinn schafft. Dieser Sinn ist während des fortdauernden Wahrnehmungsprozesses zugeschlagen zu dem vermeintlich in Leibhaftigkeit erfassten Gegenstand selbst.
Es hängt nun von der Richtung des Wahrnehmungsprozesses ab, welche Linien aus dem System der unerfüllten Intentionen zur Erfüllung gebracht, also welche kontinuierlichen Reihen von möglichen Erscheinungen aus dem gesamten System möglicher Erscheinungen vom Gegenstand zur Verwirklichung gebracht werden. Im Fortgang in dieser Linie verwandeln sich die ent[13]sprechenden Leerintentionen in Erwartungen. Ist die Linie einmal eingeschlagen, so verläuft die Erscheinungsreihe im Sinne sich von der aktuellen Kinästhese her stetig erregender und stetig sich erfüllender Erwartungen, während die übrigen Leerhorizonte in toter Potentialität verbleiben. Schließlich ist noch zu erwähnen, dass die Zusammengehörigkeit in der Deckung der ineinander nach Intention und Erfüllung übergehenden Abschattungserscheinungen nicht nur die ganzen Erscheinungen betrifft, sondern alle ihre unterscheidbaren Momente und Teile. So entspricht jedem erfüllten Raumpunkt des Gegenstandes etwas Entsprechendes in der ganzen Linie kontinuierlich ineinander übergehender Erscheinungen, in welchen dieser Punkt sich als Moment der erscheinenden Raumgestalt darstellt.
Fragen wir endlich, was innerhalb jedes Zeitpunktes der [19]Momentanerscheinung Einheit gibt, Einheit als Gesamtaspekt, in dem sich die jeweilige Seite darstellt, so werden wir auch da auf wechselseitige Intentionen stoßen, die sich zugleich wechselseitig erfüllen. Im Übergang der Erscheinungen der Aufeinanderfolge sind sie alle in beweglicher Verschiebung, Bereicherung und Verarmung.
In diesen überaus komplizierten und wundersamen Systemen der Intention und Erfüllung, die die Erscheinungen machen, konstituiert sich der immer neu immer anders erscheinende Gegenstand als derselbe. Aber er ist nie fertig, nie fest abgeschlossen.
Wir müssen hier auf eine für die Objektivation des Wahrnehmungsgegenstandes wesentliche Seite der noematischen Konstitution hinweisen, auf die Seite der kinästhetischen Motivation. Nebenbei war immer wieder die Rede davon, dass die Erscheinungsabläufe mit inszenierenden Bewegungen des Leibes Hand in Hand gehen. Aber das darf nicht als ein zufälliges Nebenbei verbleiben. Der Leib fungiert beständig mit als Wahrnehmungsorgan und ist dabei in sich selbst wieder ein ganzes System aufeinander abgestimmter Wahrnehmungsorgane. Der Leib ist in sich charakterisiert als Wahrnehmungsleib. Wir betrachten ihn dabei rein als subjektiv beweglichen und sich im wahrnehmenden Tun subjektiv bewegenden Leib. In dieser Hinsicht kommt er nie in Betracht als wahrgenommenes Raumding, sondern hinsichtlich des Systems von sogenannten »Bewegungsempfindungen[14]«, die im Bewegen der Augen, des Kopfes usw. während der Wahrnehmung ablaufen, und sie sind nicht nur parallel mit den ablaufenden Erscheinungen da, sondern bewusstseinsmäßig sind die betreffenden kinästhetischen Reihen und die [20]Wahrnehmungserscheinungen aufeinander bezogen. Blicke ich auf einen Gegenstand, so habe ich ein Bewusstsein meiner Augenstellung und zugleich, in Form eines neuartigen systematischen Leerhorizonts, ein Bewusstsein des ganzen Systems möglicher, mir frei zu Gebote stehender Augenstellungen. Und nun ist das in der gegebenen Augenstellung Gesehene mit dem ganzen System verknüpft, dass ich evidenterweise sagen kann: Würde ich die Augen nach der und der Richtung bewegen, so würden demgemäß in bestimmter Ordnung die und die visuellen Erscheinungen ablaufen; würde ich die Augenbewegung nach der und der andern Richtung laufen lassen, so würden andere, und entsprechend zu erwartende Erscheinungsreihen verlaufen. Ebenso für die Kopfbewegungen im System ebendieser Bewegungsmöglichkeiten, wieder ebenso, wenn ich die Bewegungen des Gehens hereinziehen würde usw. Jede Linie der Kinästhese läuft in eigener Weise ab, in total anderer als eine Reihe von sinnlichen Daten. Sie verläuft als mir frei verfügbar, als frei zu inhibieren, frei wieder zu inszenieren, als ursprünglich subjektive Realisation ab. Also in der Tat in besonderer Weise ist das System der Leibesbewegungen bewusstseinsmäßig charakterisiert als ein subjektiv-freies System. Ich durchlaufe es im Bewusstsein des freien »Ich kann«. Ich mag unwillkürlich mich darin ergehen, meine Augen etwa unwillkürlich dahin und dorthin wenden; jederzeit kann ich aber in Willkür eine solche und jede beliebige Bewegungslinie einschlagen. Sowie ich mit einer solchen Stellung eine Dingerscheinung habe, ist aber dadurch im ursprünglichen Bewusstsein des Infolge ein System der Zugehörigkeit der mannigfaltigen Erscheinungen von demselben Ding vorgezeichnet. Ich bin [21]hinsichtlich der Erscheinungen nicht frei: Wenn ich eine Linie im freien System des »Ich bewege mich« realisiere, so sind im Voraus die kommenden Erscheinungen vorgezeichnet. Die Erscheinungen bilden abhängige Systeme. Nur als Abhängige der Kinästhese können sie kontinuierlich ineinander übergehen und Einheit eines Sinnes konstituieren. Nur in solchen Verläufen entfalten sie ihre intentionalen Hinweise. Nur durch dieses Zusammenspiel unabhängiger und abhängiger Vari[15]ablen konstituiert sich das Erscheinende als transzendenter Wahrnehmungsgegenstand, und zwar als ein Gegenstand, der mehr ist, als was wir gerade wahrnehmen, als ein Gegenstand, der ganz und gar meiner Wahrnehmung entschwunden und doch fortdauernd sein kann. Wir können auch sagen, er konstituiert sich als solcher nur dadurch, dass seine Erscheinungen kinästhetisch motivierte sind und ich somit es in meiner Freiheit habe, gemäß meiner erworbenen Kenntnis, die Erscheinungen willkürlich als originale Erscheinungen in ihrem System der Einstimmigkeit ablaufen zu lassen. Durch entsprechende Augenbewegungen und sonstige Leibesbewegungen kann ich jederzeit für einen bekannten Gegenstand zu den alten Erscheinungen, die mir den Gegenstand von denselben Seiten wiedergeben, zurückkehren, oder ich kann den nicht mehr wahrgenommenen Gegenstand durch freie Rückkehr in die passende Stellung wieder in die Wahrnehmung bringen und wieder identifizieren. Wir sehen also, in jedem Wahrnehmungsprozess wird ein konstitutives Doppelspiel gespielt: Intentional konstituiert ist als ein praktischer kinästhetischer Horizont 1) das System meiner freien Bewegungsmöglichkeiten, das sich in jedem aktuellen Durchlaufen nach einzelnen Linien von Bewegungen im [22]Charakter der Bekanntheit, also der Erfüllung aktualisiert. Jede Augenstellung, die wir gerade haben, jede Körperstellung ist dabei nicht nur bewusst als die momentane Bewegungsempfindung, sondern bewusst als Stelle in einem Stellensystem, also bewusst mit einem Leerhorizont, der ein Horizont der Freiheit ist. 2) Jede visuelle Empfindung bzw. visuelle Erscheinung, die im Sehfeld auftritt, jede taktuelle, die im Tastfeld auftritt, hat eine bewusstseinsmäßige Zuordnung zur momentanen Bewusstseinslage der Leibesglieder und schafft einen Horizont weiterer, zusammengeordneter Möglichkeiten, möglicher Erscheinungsreihen, zugehörig zu den frei möglichen Bewegungsreihen. Dabei ist noch in Hinsicht auf die Konstitution der transzendenten Zeitlichkeit zu bemerken: Jede Linie der Aktualisierung, die wir, diese Freiheit realisierend, faktisch einschlagen würden, lieferte kontinuierliche Erscheinungsreihen vom Gegenstand, die ihn alle für eine und dieselbe Zeitstrecke darstellen würden, die also alle denselben Gegenstand in derselben Dauer und nur von verschiedenen Seiten darstellen würden. Alle Bestimmungen, die dabei zur Kenntnis kämen, wären, dem Sinn des Konstituierten gemäß, koexistent.
[16] 4. Die Beziehung von esse und percipi bei immanenter und transzendenter Wahrnehmung
All dergleichen gibt es nur für transzendente Gegenstände. Ein immanenter Gegenstand, wie ein Schwarz-Erlebnis, bietet sich als dauernder Gegenstand dar, und in gewisser Weise auch durch »Erscheinungen«, aber nur so wie jeder [23]Zeitgegenstand überhaupt. Die zeitlich sich extendierende Dauer erfordert die beständige Abwandlung der Gegebenheitsweise nach Erscheinungsweisen der zeitlichen Orientierung. Nun, ein zeitlicher Gegenstand ist auch der Raumgegenstand, also dasselbe gilt auch von ihm. Aber er hat noch eine zweite, besondere Weise zu erscheinen. Achten wir aber auf die Zeitfülle und im Besonderen auf die urimpressionalen Phasen, so tritt uns der radikale Unterschied der Erscheinung von transzendenten und von immanenten Gegenständen entgegen. Der immanente Gegenstand hat in jedem Jetzt nur eine mögliche Weise, im Original gegeben zu sein, und darum hat auch jeder Vergangenheitsmodus nur eine einzige Serie zeitmodaler Abwandlungen, eben die der Vergegenwärtigung mit dem sich darin wandelnd konstituierenden Vergangen. Der Raumgegenstand aber hat unendlich viele Weisen, da er nach seinen verschiedenen Seiten im Jetzt, also in originaler Weise erscheinen kann. Erscheint er faktisch von der Seite, so hätte er von andern doch erscheinen können, und demgemäß hat jede seiner Vergangenheitsphasen unendlich viele Weisen, wie sich seine vergangenen erfüllten Zeitpunkte darstellen könnten. Wir können danach auch sagen: Für den transzendenten Gegenstand hat der Begriff Erscheinung einen neuen und eigenen Sinn.
Betrachten wir ausschließlich die Jetztphase, so gilt, dass für sie bei dem immanenten Gegenstand Erscheinung und Erscheinendes sich nicht sondern lässt. Was im Original neu auftritt, ist die jeweilige neue Schwarzphase selbst, und ohne Darstellung. Und das Erscheinen sagt hier nichts anderes als ein ohne jede hinausmeinende Darstellung Zu-sein und im Original Bewusst-zu-sein. Andererseits: [24]Hinsichtlich des transzendenten Gegenstandes ist es aber klar, dass das im neuen Jetzt als Ding leibhaft Bewusste bewusst ist nur durch eine Erscheinung hindurch, das ist, es scheidet sich Darstellung und Dargestelltes, Abschattung und [17] Abgeschattetes. Vertauschen wir die bisher bevorzugte noematische Einstellung mit der noetischen, in der wir auf das Erlebnis und seine reellen Gehalte den reflektiven Blick wenden, so können wir auch so sagen: Ein transzendenter Gegenstand, wie ein Ding, kann sich nur dadurch konstituieren, dass als Unterlage ein immanenter Gehalt konstituiert wird, der nun seinerseits sozusagen substituiert ist für die eigentümliche Funktion der »Abschattung«, einer darstellenden Erscheinung, eines sich durch ihn hindurch Darstellens. Die in jedem Jetzt neu auftretende Dingerscheinung, sagen wir, die optische Erscheinung, ist, wenn wir nicht auf den erscheinenden Dinggegenstand achten, sondern auf das optische Erlebnis selbst, ein Komplex so und so sich ausbreitender Farbenflächenmomente, die immanente Daten sind, also in sich selbst so original bewusst wie etwa Rot oder Schwarz. Die mannigfaltig wechselnden Rotdaten, in denen sich z. B. irgendeine Seitenfläche eines roten Würfels und ihr unverändertes Rot darstellt, sind immanente Daten. Andererseits hat es aber mit diesem bloß immanenten Dasein nicht sein Bewenden. In ihnen stellt sich in der eigenen Weise der Abschattung etwas dar, was sie nicht selbst sind, im Wechsel der im Sehfeld immanent empfundenen Farben stellt sich ein Selbiges dar, eine identische räumlich extendierte Körperfarbe. All die noematischen Momente, die wir in der noematischen Einstellung auf den Gegenstand und als an ihm aufweisen, konstituieren sich mittels der immanenten Empfindungsdaten und [25]vermöge des sie gleichsam beseelenden Bewusstseins. Wir sprechen in dieser Hinsicht von der Auffassung als von der transzendenten Apperzeption, die eben die Bewusstseinsleistung bezeichnet, die den bloß immanenten Gehalten sinnlicher Daten, der sogenannten Empfindungsdaten oder hyletischen Daten, die Funktion verleiht, objektives »Transzendentes« darzustellen. Es ist gefährlich, hierbei von Repräsentanten und Repräsentiertem, von einem Deuten der Empfindungsdaten, von einer durch dieses »Deuten« hinausdeutenden Funktion zu sprechen. Sich abschatten, sich in Empfindungsdaten darstellen ist total anderes als signitives Deuten.
»Immanente« Gegenständlichkeiten sind ihrerseits also nicht bewusst durch Apperzeption; »im Original bewusst sein« und »sein«, »percipi« und »esse« fällt bei ihnen zusammen. Und zwar für jedes Jetzt. Hingegen in weitem Umfang sind sie Träger von [18] apperzeptiven Funktionen, und dann stellt sich durch sie und in ihnen ein Nicht-Immanentes dar. Jetzt trennt sich das esse (für transzendente Gegenstände) prinzipiell vom percipi. In jedem Jetzt der äußeren Wahrnehmung haben wir zwar ein Originalbewusstsein, aber das eigentliche Perzipieren in diesem Jetzt, also das, was daran Urimpression ist (und nicht bloß retentionales Bewusstsein der vergangenen Phasen des Wahrnehmungsgegenstandes), ist Bewussthaben von einem sich originaliter Abschattenden.3 Es ist nicht ein schlichtes Haben des Gegenstands, in dem Bewussthaben und Sein sich deckt, sondern ein mittelbares Bewusstsein, sofern unmittelbar nur eine Apperzeption gehabt ist, ein Bestand von Empfindungsdaten, bezogen auf kinästhetische Daten, und eine apperzeptive Auffassung, durch die eine darstellende [26]Erscheinung sich konstituiert; und durch sie hindurch ist also der transzendente Gegenstand bewusst als originaliter sich abschattender oder darstellender. Im Prozess des kontinuierlichen Wahrnehmens haben wir in jedem Jetzt immer wieder diese Sachlage, prinzipiell bleibt es dabei, dass in keinem Moment der äußere Gegenstand in seiner originalen Selbstheit schlicht gehabt ist. Prinzipiell erscheint er nur durch apperzeptive Darstellung und in immer neuen Darstellungen, die im Fortgang aus seinen Leerhorizonten immer Neues zur originalen Darstellung bringen. Indessen, wichtiger ist für unsere Zwecke zu beachten: Es ist undenkbar, dass so etwas wie ein Raumgegenstand, der eben nur durch äußere Wahrnehmung als abschattende Wahrnehmung seinen ursprünglichen Sinn erhält, durch immanente Wahrnehmung gegeben wäre, gleichgültig ob einem menschlichen oder übermenschlichen Intellekt. Das aber beschließt in sich, dass es undenkbar ist, dass ein Raumgegenstand, dass all dergleichen wie Gegenstand der Welt im natürlichen Sinn sich von Zeitpunkt zu Zeitpunkt abgeschlossen darstellen könnten, mit ihrem gesamten Merkmalgehalt (als voll bestimmtem), der in diesem Jetzt ihren zeitlichen Inhalt ausmacht. Man spricht in dieser Hinsicht auch von adäquater Gegebenheit gegenüber der inadäquaten. Man erweist, um dies drastisch auszudrücken, und in theologischer [19] Wendung, Gott einen schlechten Dienst, wenn man es ihm zubilligt, 5 gerade sein zu lassen und jeden Widersinn zur Wahrheit machen zu können. Wesensmäßig gehört der Raumdinglichkeit die inadäquate Gegebenheitsweise zu, eine andere ist widersinnig. In keiner Phase der Wahrnehmung ist der Gegenstand als gegeben zu denken ohne Leerhorizonte und, was dasselbe sagt, ohne [27]apperzeptive Abschattung und mit der Abschattung zugleich Hinausdeutung über das sich eigentlich Darstellende. Eigentliche Darstellung selbst ist wieder nicht schlichtes Haben nach Art der Immanenz mit ihrem esse = percipi, sondern partiell erfüllte Intention, 〈die〉 also unerfüllte Hinausweisungen enthält. Originalität der leibhaften Darstellung von Transzendentem beschließt notwendig dies, dass der Gegenstand als Sinn die Originalität der apperzeptiven Erfüllung hat und dass diese unabtrennbar ein Gemisch von wirklich sich erfüllenden und noch nicht erfüllten Sinnesmomenten in sich birgt, sei es nur der allgemeinen Struktur nach vorgezeichneten und im Übrigen offen unbestimmten und möglichen, sei es schon durch Sondervorzeichnung ausgezeichneten. Darum ist die Rede von Inadäquation, zu deren Sinn der Gedanke eines zufälligen Manko gehört, das ein höherer Intellekt überwinden könnte, eine unpassende, ja völlig verkehrte.
Wir können hier einen Satz formulieren, der in unseren weiteren Analysen zu immer reinerer Klarheit kommen wird: Wo immer wir von Gegenständen sprechen, sie mögen welcher Kategorie immer sein, da stammt der Sinn dieser Gegenstandsrede ursprünglich her von Wahrnehmungen, als den ursprünglich Sinn und damit Gegenständlichkeit konstituierenden Erlebnissen. Konstitution eines Gegenstandes als Sinnes ist aber eine Bewusstseinsleistung, die für jede Grundart von Gegenständen eine prinzipiell eigenartige ist. Wahrnehmung ist nicht ein leeres Hinstarren auf ein im Bewusstsein Darinsteckendes und durch irgendein sinnloses Wunder je Hineinzusteckendes: als ob zuerst etwas da wäre und dann das Bewusstsein es irgendwie umspannte; vielmehr für jedes erdenkliche [28]Ichsubjekt ist jedes gegenständliche Dasein mit dem und dem Sinnesgehalt eine Bewusstseinsleistung, die für jeden neuartigen Gegenstand eine neue sein muss. Für jede Grundart von Gegenständen ist dafür eine prinzipiell verschiedene intentionale Struktur erfordert. Ein Gegenstand, der ist, aber nicht, und prinzipiell nicht Gegenstand eines Bewusstseins [20] sein könnte, ist ein Nonsens. Jeder mögliche Gegenstand eines möglichen Bewusstseins ist aber auch Gegenstand für ein mögliches originär gebendes Bewusstsein, und das nennen wir, mindestens für individuelle Gegenstände, »Wahrnehmung«. Von einem materiellen Gegenstand eine Wahrnehmung von der allgemeinen Struktur einer immanenten verlangen, umgekehrt von einem immanenten Gegenstand eine Wahrnehmung von der Struktur der äußeren Wahrnehmung verlangen, ist absurd. Sinngebung und Sinn fordern einander wesensmäßig, was die Wesenstypik ihrer korrelativen Strukturen anbelangt.
So gehört auch zum Wesen der ursprünglich transzendenten Sinngebung, die die äußere Wahrnehmung vollzieht, dass die Leistung dieser originalen Sinngebung im Fortgang von Wahrnehmungsstrecke zu Wahrnehmungsstrecke und so in beliebiger Fortführung des Wahrnehmungsprozesses eine nie abgeschlossene ist. Diese Leistung besteht nicht nur darin, immer Neues vom fest vorgegebenen Sinn anschaulich zu machen, als ob der Sinn von Anfang an schon fertig vorgezeichnet wäre, sondern im Wahrnehmen baut sich der Sinn selbst weiter aus und ist so eigentlich in beständigem Wandel und lässt immerfort neuen Wandel offen.
Es ist hier zu beachten, dass wir im Sinn einer einstimmig synthetisch fortschreitenden Wahrnehmung [29]immerfort unterscheiden können unaufhörlich wechselnden Sinn und einen durchgehenden identischen Sinn. Jede Phase der Wahrnehmung hat insofern ihren Sinn, als sie den Gegenstand im Wie der Bestimmung der originalen Darstellung und im Wie des Horizontes gegeben hat. Dieser Sinn ist fließend, er ist in jeder Phase ein neuer. Aber durch diesen fließenden Sinn, durch all die Modi »Gegenstand im Wie der Bestimmung« geht die Einheit des sich in stetiger Deckung durchhaltenden, sich immer reicher bestimmenden Substrates x, des Gegenstandes selbst, der all das ist, als was ihn der Prozess der Wahrnehmung und alle weiteren möglichen Wahrnehmungsprozesse zur Bestimmung bringen und bringen würden. So gehört zu jeder äußeren Wahrnehmung eine im Unendlichen liegende Idee, die Idee des voll bestimmten Gegenstandes, des Gegenstandes, der durch und durch bestimmter, durch und durch gekannter wäre und jede Bestimmung an ihm rein von aller Unbestimmtheit; und die volle Bestimmung selbst ohne jedes plus ultra an noch zu Bestimmendem, offen Verblei[21]bendem. Ich sprach von einer im Unendlichen liegenden, also unerreichbaren Idee, denn dass es eine Wahrnehmung geben könnte, (als einen abgeschlossenen Prozess kontinuierlich ineinander übergehender Erscheinungsverläufe), die eine absolute Kenntnis des Gegenstandes schüfe, in der die Spannung zwischen dem Gegenstand im Wie der sich wandelnden relativen und unvollkommenen Bestimmtheit und dem Gegenstand selbst dahinfiele, das ist durch die Wesensstruktur der Wahrnehmung selbst ausgeschlossen; denn evidenterweise ist die Möglichkeit eines plus ultra prinzipiell nie ausgeschlossen. Es ist also die Idee des absoluten Selbst des Gegenstandes und seiner absoluten und [30]vollständigen Bestimmtheit oder, wie wir auch sagen, seines absoluten individuellen Wesens. In Relation zu dieser herauszuschauenden unendlichen Idee, die aber als solche nicht realisierbar ist, ist jeder Wahrnehmungsgegenstand im Kenntnisprozess eine fließende Approximation. Den äußeren Gegenstand haben wir immerfort leibhaft (wir sehen, fassen, umgreifen ihn), und immerfort liegt er doch in unendlicher Geistesferne. Was wir von ihm fassen, prätendiert sein Wesen zu sein; es ist es auch, aber immer nur unvollkommene Approximation, die etwas von ihm fasst und immerfort auch mit in eine Leere fasst, die nach Erfüllung schreit. Das immerfort Bekannte ist immerfort Unbekanntes, und alle Erkenntnis scheint von vornherein hoffnungslos. Doch ich sagte »scheint«, und wir wollen uns hier 〈nicht〉 gleich an einen voreiligen Skeptizismus binden.
(Ganz anders verhält es sich natürlich mit den immanenten Gegenständen, die Wahrnehmung konstituiert sie und macht sie mit ihrem absoluten Wesen zu eigen. Sie konstituieren sich nicht durch beständige Sinneswandlung im Sinn einer Approximation – nur sofern sie in eine Zukunft hinein werden, haben sie Behaftung mit Protentionen und protentionalen Unbestimmtheiten. Was aber als Gegenwart im Jetzt konstituiert worden ist, das ist ein absolutes Selbst, das keine unbekannten Seiten hat.)
Wir versagten uns einem voreiligen Skeptizismus. In dieser Hinsicht müsste jedenfalls zunächst Folgendes unterschieden werden. Wenn ein Gegenstand zur Wahrnehmung kommt und im Wahrnehmungsprozess zu fortschreitender Kenntnis, so mussten wir unterscheiden den jeweiligen Leerhorizont, der durch den verlaufenen Prozess vorgezeichnet ist und mit dieser Vorzeich[22]nung der [31]momentanen Wahrnehmungsphase anhängt, und einen Horizont leerer Möglichkeiten ohne Vorzeichnung. Die Vorzeichnung besagt, dass eine leere Intention da ist, die ihren allgemeinen Sinnesrahmen mit sich führt. Zum Wesen solcher vorzeichnenden Intention gehört, dass bei Einschlagen passend zugehöriger Wahrnehmungsrichtung erfüllende Näherbestimmung oder, wie wir noch besprechen werden, als Gegenstück Enttäuschung, Sinnesaufhebung und Durchstreichung eintreten müsste. Es gibt aber auch partiale Horizonte ohne solche feste Vorzeichnung; das sagt, neben den bestimmt vorgezeichneten Möglichkeiten bestehen Gegenmöglichkeiten, für die aber nichts spricht und die immerfort offenbleiben. Z. B., dass in meinem Sehfeld, etwa bei der Wahrnehmung des gestirnten Himmels, irgendeine Lichterscheinung aufleuchtet, eine Sternschnuppe u. dgl., das ist, rein aus der Sinngebung der Wahrnehmung selbst heraus gesprochen, eine völlig leere Möglichkeit, die im Sinn nicht vorgezeichnet, aber durch ihn eben offengelassen ist. Halten wir uns also an die positive Sinngebung der Wahrnehmung mit ihren positiven Vorzeichnungen, so ist die Frage verständlich und naheliegend, ob denn im Überleiten der unanschaulichen, leeren Vorzeichnung in erfüllende Näherbestimmung gar kein stehendes und endgültig bleibendes Selbst des Gegenstandes erreichbar ist, ob m. a. W. nicht nur immer neue gegenständliche Merkmale in den Horizont der Wahrnehmung eintreten können, sondern im Prozess der Näherbestimmung auch diese schon erfassten Merkmale in infinitum eine weitere Bestimmbarkeit mit sich führen, also selbst wieder und immerfort den Charakter von unbekannten x behalten, die nie eine endgültige Bestimmung gewinnen [32]können. Ist denn die Wahrnehmung ein »Wechsel«, der prinzipiell nie einlösbar ist durch neue, ebensolche Wechsel, deren Einlösung also wieder auf Wechsel führt und so in infinitum? Erfüllung der Intention vollzieht sich durch leibhaftes Darstellen, freilich mit leeren Innenhorizonten. Aber ist an dem schon leibhaft Gewordenen gar nichts, was Endgültigkeit mit sich führt, so dass wir in der Tat in einem wie es scheint leeren Wechselgeschäft steckenbleiben?
Wir fühlen, dass es so nicht sein kann, und in der Tat stoßen wir, uns in das Wesen der Wahrnehmungsreihen tiefer hineinschauend, auf eine Eigentümlichkeit, die dazu berufen ist, zunächst für die Praxis und ihre anschauliche sinnliche Welt die [23] Schwierigkeit zu lösen. Im Wesen der eigentlichen Erscheinungen als Erfüllungen vorgezeichneter Intentionen liegt es, dass sie auch bei unvollkommener, also mit Vorweisungen behafteter Erfüllung auf ideale Grenzen als Erfüllungsziele vordeuten, die durch stetige Erfüllungsreihen zu erreichen wären. Das aber nicht gleich für den ganzen Gegenstand, sondern für die jeweils schon zu wirklicher Anschauung gekommenen Merkmale. Jede Erscheinung gehört hinsichtlich dessen, was in ihr eigentliche Darstellung ist, systematisch irgendwelchen in kinästhetischer Freiheit zu realisierenden Erscheinungsreihen an, in denen mindestens irgendein Moment der Gestalten seine optimale Gegebenheit und damit sein wahres Selbst erreichen würde.
Als Grundgerüst des Wahrnehmungsgegenstandes fungiert das Phantom als sinnlich qualifizierte körperliche Oberfläche. Dieselbe kann in kontinuierlich vielfältigen Erscheinungen sich darstellen, und ebenso jede sich abhebende Teilfläche. Für jede haben wir Fernerscheinungen [33]und Naherscheinungen. Und wieder innerhalb jeder dieser Sphären ungünstigere und günstigere, und in geordneten Reihen kommen wir auf Optima. So weist schon die Fernerscheinung eines Dinges und eine Mannigfaltigkeit von Fernerscheinungen auf Naherscheinungen zurück, in denen die oberflächliche Gestalt und ihre Fülle im Gesamtüberblick am besten erscheint. Diese selbst, die wir etwa für ein Haus durch Betrachtung von einem gut gewählten Standpunkt haben, gibt dann einen Rahmen für Einzeichnungen von weiteren optimalen Bestimmungen, die ein Nähertreten, in dem nur einzelne Teile, aber dann optimal gegeben wären, 〈beibringen würde〉. Das Ding selbst in seiner gesättigten Fülle ist eine im Bewusstseinssinn und in der Weise seiner intentionalen Strukturen angelegte Idee, und zwar gewissermaßen ein S〈ystem〉 aller Optima, die durch Einzeichnung in die optimalen Rahmen gewonnen würden. Das thematische Interesse, das in Wahrnehmungen sich auslebt, ist in unserem wissenschaftlichen Leben von praktischen Interessen geleitet, und das beruhigt sich, wenn gewisse für das jeweilige Interesse optimale Erscheinungen gewonnen sind, in denen das Ding so viel von seinem letzten Selbst zeigt, als dieses praktische Interesse fordert. Oder vielmehr es zeichnet als praktisches Interesse ein relatives Selbst vor: Das, was praktisch genügt, gilt als das Selbst. So ist das Haus selbst und in seinem wahren Sein, und [24] zwar hinsichtlich seiner puren körperlichen Dinglichkeit, sehr bald optimal gegeben, also vollkommen erfahren von dem, der es als Käufer oder Verkäufer betrachtet. Für den Physiker und Chemiker erschiene solche Erfahrungsweise völlig oberflächlich und vom wahren Sein noch himmelfern.
[34]Nur mit einem Wort sagen kann ich, dass alle solchen höchst verzweigten und an sich schwierigen intentionalen Analysen ihrerseits hineingehören in eine universale Genesis des Bewusstseins und hier speziell des Bewusstseins einer transzendenten Wirklichkeit. Ist das Thema der konstitutiven Analysen dies, aus der eigenen intentionalen Konstitution der Wahrnehmung, nach reellen Bestandstücken des Erlebnisses selbst, nach intentionalem Noema und Sinn die Weise verständlich zu machen, wie Wahrnehmung ihre Sinngebung zustande bringen und wie durch alle leere Vermeintheit hindurch sich der Gegenstand als sich immer nur relativ darstellender optimaler Erscheinungssinn konstituiert, so ist es das Thema der genetischen Analysen, verständlich zu machen, wie in der zum Wesen jedes Bewusstseinsstromes gehörigen Entwicklung, die zugleich Ichentwicklung ist, sich jene komplizierten intentionalen Systeme entwickeln, durch die schließlich dem Bewusstsein und Ich eine äußere Welt erscheinen kann.
[35]Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins4
[368] Einleitung
Die Analyse des Zeitbewusstseins ist ein uraltes Kreuz der deskriptiven Psychologie und der Erkenntnistheorie. Der erste, der die gewaltigen Schwierigkeiten, die hier liegen, tief empfunden und sich daran fast bis zur Verzweiflung abgemüht hat, war Augustinus. Die Kapitel 13–28 des XI. Buches der Confessiones muss auch heute noch jedermann gründlich studieren, der sich mit dem Zeitproblem beschäftigt. Denn herrlich weit gebracht und erheblich weiter gebracht als dieser große und ernst ringende Denker hat es die wissensstolze Neuzeit in diesen Dingen nicht. Noch heute mag man mit Augustinus sagen: si nemo a me quaerat, scio, si quaerenti explicare velim, nescio.5
Natürlich, was Zeit ist, wissen wir alle; sie ist das Allerbekannteste. Sobald wir aber den Versuch machen, uns über das Zeitbewusstsein Rechenschaft zu geben, objektive Zeit und subjektives Zeitbewusstsein in das rechte Verhältnis zu setzen und uns zum Verständnis zu bringen, wie sich zeitliche Objektivität, also individuelle Objektivität überhaupt, im subjektiven Zeitbewusstsein konstituieren kann, ja sowie wir auch nur den Versuch machen, das rein subjektive Zeitbewusstsein, den phänomenologischen Gehalt der Zeiterlebnisse einer Analyse zu unterziehen, verwickeln wir uns in die sonderbarsten Schwierigkeiten, Widersprüche, Verworrenheiten. […]
[36][369] 1. Ausschaltung der objektiven Zeit
Einige allgemeine Bemerkungen müssen noch vorausgeschickt werden. Unser Absehen geht auf eine phänomenologische Analyse des Zeitbewusstseins. Darin liegt, wie bei jeder solchen Analyse, der völlige Ausschluss jedweder Annahmen, Festsetzungen, Überzeugungen in Betreff der objektiven Zeit (aller transzendierenden Voraussetzungen von Existierendem). In objektiver Hinsicht mag jedes Erlebnis, wie jedes reale Sein und Seinsmoment, seine Stelle in der einen einzigen objektiven Zeit haben – somit auch das Erlebnis der Zeitwahrnehmung und Zeitvorstellung selbst. Es mag sich jemand dafür interessieren, die objektive Zeit eines Erlebnisses, darunter eines zeitkonstituierenden, zu bestimmen. Es mag ferner eine interessante Untersuchung sein, festzustellen, wie die Zeit, die in einem Zeitbewusstsein als objektive gesetzt ist, sich zur wirklichen objektiven Zeit verhalte, ob die Schätzungen von Zeitintervallen den objektiv wirklichen Zeitintervallen entsprechen, oder wie sie von ihnen abweichen. Aber das sind keine Aufgaben der Phänomenologie. So wie das wirkliche Ding, die wirkliche Welt kein phänomenologisches Datum ist, so ist es auch nicht die Weltzeit, die reale Zeit, die Zeit der Natur im Sinne der Naturwissenschaft und auch der Psychologie als Naturwissenschaft des Seelischen.
Nun mag es allerdings scheinen, wenn wir von Analyse des Zeitbewusstseins, von dem Zeitcharakter der Gegenstände der Wahrnehmung, Erinnerung, Erwartung sprechen, als ob wir den objektiven Zeitverlauf schon annähmen und dann im Grunde nur die subjektiven Bedingungen der Möglichkeit einer Zeitanschauung und einer [37]eigentlichen Zeiterkenntnis studierten. Was wir aber hinnehmen, ist nicht die Existenz einer Weltzeit, die Existenz einer dinglichen Dauer u. dgl., sondern erscheinende Zeit, erscheinende Dauer als solche. Das aber sind absolute Gegebenheiten, deren Bezweiflung sinnlos wäre. Sodann nehmen wir allerdings auch eine seiende Zeit an, das ist aber nicht die Zeit der Erfahrungswelt, sondern die immanente Zeit des Bewusstseinsverlaufes. Dass das Bewusstsein eines Tonvorgangs, einer Melodie, die ich eben höre, ein Nacheinander aufweist, dafür haben wir eine Evidenz, die jeden Zweifel und jede Leugnung sinnlos erscheinen lässt.
[370] Was die Ausschaltung der objektiven Zeit besagt, das wird vielleicht noch deutlicher, wenn wir die Parallele für den Raum durchführen, da ja Raum und Zeit so vielbeachtete und bedeutsame Analogien aufweisen. In die Sphäre des phänomenologisch Gegebenen gehört das Raumbewusstsein, d. h. das Erlebnis, in dem »Raumanschauung« als Wahrnehmung und Phantasie sich vollzieht. Öffnen wir die Augen, so sehen wir in den objektiven Raum hinein – das heißt (wie die reflektierende Betrachtung zeigt): wir haben visuelle Empfindungsinhalte, die eine Raumerscheinung fundieren, eine Erscheinung von so und so gelagerten Dingen. Abstrahieren wir von aller transzendierenden Deutung und reduzieren die Wahrnehmungserscheinung auf die gegebenen primären Inhalte, so ergeben sie das Kontinuum des Gesichtsfeldes, das ein quasi-räumliches ist, aber nicht etwa Raum oder eine Fläche im Raum: roh gesprochen ist es eine zweifache kontinuierliche Mannigfaltigkeit. Verhältnisse des Nebeneinander, Übereinander, Ineinander finden wir da vor, geschlossene Linien, die ein [38]Stück des Feldes völlig umgrenzen usw. Aber das sind nicht die objektiv-räumlichen Verhältnisse. Es hat gar keinen Sinn, etwa zu sagen, ein Punkt des Gesichtsfeldes sei 1 Meter entfernt von der Ecke dieses Tisches hier oder sei neben, über ihm usw. Ebensowenig hat natürlich auch die Dingerscheinung eine Raumstelle und irgendwelche räumlichen Verhältnisse: die Hauserscheinung ist nicht neben, über dem Haus, 1 Meter von ihm entfernt usw.
Ähnliches gilt nun auch von der Zeit. Phänomenologische Data sind die Zeitauffassungen, die Erlebnisse, in denen Zeitliches im objektiven Sinne erscheint. Wieder sind phänomenologisch gegeben die Erlebnismomente, welche Zeitauffassungen als solche speziell fundieren, also die evtl. spezifisch temporalen Inhalte (das, was der gemäßigte Nativismus das ursprünglich Zeitliche nennt). Aber nichts davon ist objektive Zeit. Durch phänomenologische Analyse kann man nicht das Mindeste von objektiver Zeit vorfinden. Das »ursprüngliche Zeitfeld« ist nicht etwa ein Stück objektiver Zeit, das erlebte Jetzt ist, in sich genommen, nicht ein Punkt der objektiven Zeit usw. Objektiver Raum, objektive Zeit und mit ihnen die objektive Welt der wirklichen Dinge und Vorgänge – das alles sind Transzendenzen. Wohl gemerkt, transzendent ist nicht etwa der Raum und die Wirklichkeit in einem mystischen Sinne, als »Ding an sich«, sondern gerade der phänomenale Raum, die phänomenale raum-zeitliche Wirklichkeit, die erscheinende Raumgestalt, die erscheinende Zeitgestalt. Das alles sind keine Erlebnisse. Und die Ordnungszusammenhänge, die in den Erlebnissen als echten Im[371]manenzen zu finden sind, lassen sich nicht in der empirischen, objektiven Ordnung antreffen, fügen sich ihr nicht ein.
[39]In eine ausgeführte Phänomenologie des Räumlichen gehörte auch eine Untersuchung der Lokaldaten (die der Nativismus in psychologischer Einstellung annimmt), welche die immanente Ordnung des »Gesichtsempfindungsfeldes« ausmachen, und dieses selbst. Sie verhalten sich zu den erscheinenden objektiven Orten wie die Qualitätsdaten zu den erscheinenden objektiven Qualitäten. Spricht man dort von Lokalzeichen, so müsste man hier von Qualitätszeichen sprechen. Das empfundene Rot ist ein phänomenologisches Datum, das, von einer gewissen Auffassungsfunktion beseelt, eine objektive Qualität darstellt; es ist nicht selbst eine Qualität. Eine Qualität im eigentlichen Sinne, d. h. eine Beschaffenheit des erscheinenden Dinges, ist nicht das empfundene, sondern das wahrgenommene Rot. Das empfundene Rot heißt nur äquivok Rot, denn Rot ist Name einer realen Qualität. Spricht man mit Beziehung auf gewisse phänomenologische Vorkommnisse von einer »Deckung« des einen und anderen, so ist doch zu beachten, dass das empfundene Rot erst durch die Auffassung den Wert eines dingliche Qualität darstellenden Momentes erhält, an sich betrachtet aber nichts davon in sich birgt, und dass die »Deckung« des Darstellenden und Dargestellten keineswegs Deckung eines Identitätsbewusstseins ist, dessen Korrelat »ein und dasselbe« heißt.
Nennen wir empfunden ein phänomenologisches Datum, das durch Auffassung als leibhaft gegeben ein Objektives bewusst macht, das dann objektiv wahrgenommen heißt, so haben wir in gleichem Sinne auch ein »empfundenes« Zeitliches und ein wahrgenommenes Zeitliches zu unterscheiden.6 Das letztere meint die objektive Zeit. Das erstere aber ist nicht selbst objektive Zeit (oder Stelle in der [40]objektiven Zeit), sondern das phänomenologische Datum, durch dessen empirische Apperzeption die Beziehung auf objektive Zeit sich konstituiert. Temporaldaten, wenn man will: Temporalzeichen, sind nicht tempora selbst. Die objektive Zeit gehört in den Zusammenhang der Erfahrungsgegenständlichkeit. Die »empfundenen« Temporaldaten sind nicht bloß empfunden, sie sind auch mit Auf[372]