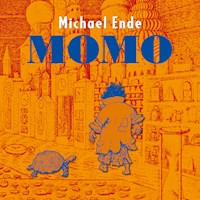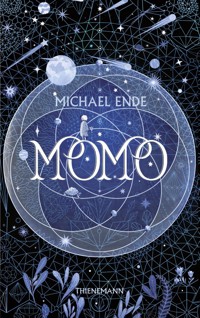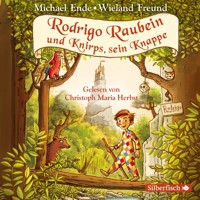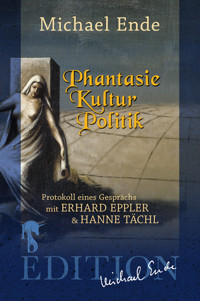
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Gesellschaft braucht mehr denn je positive Utopien. Anfang der 80er treffen sich Michael Ende, Hanne Tächl und Erhard Eppler im Tal der Seligen in den Albaner Bergen, nahe Rom. Zwei Tage lang diskutieren der Geschichtenerzähler, die Schauspielerin und der Politiker darüber, wie eine zeitgemäße Utopie aussehen könnte. Welchen Beitrag können und müssen Kultur und Politik für eine bessere Zukunft leisten? Durch den Austausch der Gesprächspartner, die aus ganz und gar verschiedenen Welten kommen, entstehen nach und nach neue Denkansätze für eine bessere und menschlichere Zukunft. Dabei spielt vor allem die Phantasie, die schöpferische Kraft des Menschen, eine überragende Rolle. Ein Debattenbuch, dessen Thesen bis heute Gültigkeit besitzen – denn die Kraft einer positiven Utopie, die die Menschen verbindet, ist in Zeiten globaler Krisen wichtiger denn je.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Michael EndeErhard EpplerHanne Tächl
Phantasie/Kultur/Politik
Protokoll eines GesprächsMit einem Vorwort von Peter Prange
»Um die Welt zu ändern, sie neu zu gestalten, müssen zuvor die Menschen sich selbst psychisch umstellen und eine andere Richtung einschlagen. Bevor man nicht innerlich zum Bruder eines jeden geworden ist, kann kein Brudertum zur Herrschaft gelangen.
Niemals werden die Menschen mithilfe einer Wissenschaft oder um eines Vorteils willen durch äußere Hilfsmittel es fertigbringen, ihr Eigentum und ihre Rechte so untereinander zu verteilen, dass niemand zu kurz komme und sich nicht gekränkt fühle. Immer wird es jedem zu wenig scheinen, und immer wird man einander vernichten. Sie fragen, wann sich das verwirklichen wird? Es wird sich verwirklichen, aber zuerst muss sich die Periode der menschlichen Vereinzelung vollenden.«
Fjodor M. Dostojewski
»Fällt Jugend gar in revolutionäre Zeiten, also in Zeitwende, und steht ihr nicht, wie heute im Westen so oft, der Kopf, durch Betrug, im Nacken, so weiß sie erst recht, was es mit dem Traum nach vorwärts mit sich hat. Er geht dann vom vagen, vor allem privaten Ahnen zum mehr oder minder sozial Geschärften, sozial Beauftragten über.«
Ernst Bloch
Ein paar Worte zum Geleit
»Es gibt Menschen, die können nie nach Phantásien kommen und es gibt Menschen, die können es, aber sie bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch einige, die gehen nach Phantásien und kehren wieder zurück. So wie du. Und die machen beide Welten gesund.«
Michael Ende
Noch zu keiner Zeit wurde so viel geredet wie heute. Ob im Radio oder Fernsehen, in den sozialen Netzwerken oder in den zahllosen Meetings bei der Arbeit: Wir reden und reden, dass uns Hören und Sehen vergeht. Sodass nicht selten der Verdacht aufkommt, dass wir vor allem deshalb so viel reden, um nur nicht mehr zu denken zu müssen.
Dabei ist das Gespräch die nicht nur anspruchsvollste, sondern auch ertragreichste Form, um Gedanken zu entwickeln … Der dialogische Diskurs hat in unserem Kulturkreis eine ebenso lange wie eindrucksvolle Tradition – ja, vermutlich wäre das, was wir heute unter westlichem Denken verstehen, ohne diese Tradition gar nicht entstanden. Bereits das Werk Platons, zu der einem Bonmot zufolge die ganze europäische Philosophie nur eine Ansammlung von Fußnoten ist, basiert auf dem Gespräch. Nicht in der Abgeschiedenheit des Elfenbeinturms, sondern mitten auf dem Marktplatz von Athen, hat Platons Protagonist Sokrates sein riesiges Denkgebäude entwickelt, im Austausch mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnern, um im Wechselspiel von These und Antithese Antworten zu finden auf die großen Fragen der Menschheit.
»Die Idee kommt beim Sprechen«, schreibt Heinrich von Kleist in seinem Aufsatz Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, dem wohl schönsten Plädoyer für die Dialogform des Denkens. Darin legt er dar, wie auch die sperrigsten Sachverhalte sich durch das Reden darüber erschließen, aus dunklen Vorstellungen klare Ideen werden. Dabei ist das oft im Titel unterschlagene Adjektiv »allmählich« entscheidend. Wahrheit ist nichts, was fertig da ist, sondern was im Prozess entfaltet werden muss, Schritt für Schritt, Argument für Argument, stets im Bewusstsein, dass auch der Klügste sich irren kann und seine Thesen ebenso der Infragestellung bedürfen wie die des größten Dummkopfs.
In diese Tradition fügt der vorliegende Textband sich ein. Dabei besteht sein besonderer Reiz in der Zusammensetzung der Gesprächspartner. Hier debattieren nicht verschiedene Vertreter einer Disziplin miteinander – nein, mit dem Schriftsteller Michael Ende, dem Politiker Erhard Eppler und der Theaterfrau Hanne Tächl treten hier vielmehr Protagonisten ganz und gar verschiedener Welten ins Gespräch: Denker und Macher, Träumer und Realisten, Phantasten und Pragmatiker.
Dabei heraus gekommen ist ein Buch, das beeindruckend Zeugnis gibt von dem Zeitgeist, in dem es entstand. Dieser prägt die Antworten, die die Protagonisten im Gespräch gemeinsam entwickeln. Wichtiger aber noch als die Antworten sind für den heutigen Leser die Fragen, die sie aufgeworfen haben: nach einem immer schneller zusammenwachsenden Europa und seinen Werten, nach der Überwindung des Freund-Feind-Denkens und der Schaffung einer Friedenskultur, nach dem Umgang mit unseren Ressourcen und dem Erhalt der Natur in der modernen Zivilisation. Fragen, die damals, in den frühen 80er Jahren, bahnbrechend neu waren – doch die bis heute immer noch die drängendsten Fragen sind, wenn es um die Gestaltung unserer Zukunft geht. Fragen, die wir immer wieder neu stellen müssen, um immer wieder neue Antworten zu finden, nach Maßgabe einer sich ständig wandelnden Welt.
Die Debatte ist eröffnet.
Tübingen, 8. November 2014
Peter Prange
Vorgeschichte
… so schnell werden wohl alle Beteiligten die Tage in Genzano bei Rom nicht vergessen! Mit einem Schlag nämlich war die Routine des Alltags durchbrochen – nicht allein der milde Winter und die südländische Umgebung Italiens trugen dazu bei, auch die Gedankenwelt, die in dem Gespräch ausgebreitet wurde, war spannend und faszinierend.
Eine solche Begegnung, wie sie zwischen Erhard Eppler, Michael Ende und Hanne Tächl stattfand, geschieht sicher nicht alle Tage und hat ihre eigene Vorgeschichte …
Die Weichen für das Gespräch wurden lange vor der Begegnung bei Rom gestellt. Michael Ende erhielt eines schönen Tages einen Brief von einer deutschen Fernsehanstalt mit der höflichen Anfrage, ob er an einer literarischen Sendung teilnehmen wolle. Erhard Eppler – so hieß es im Brief – habe die Bücher von Michael Ende mit großem Interesse und Begeisterung gelesen und wolle unbedingt mit ihm ein Gespräch über die Problematik der heutigen Jugend führen. Man finde diese Idee sehr gut und stelle dafür 70 Minuten Sendezeit zur Verfügung. Es wäre schön, wenn Michael Ende zusage, und überhaupt wäre es toll, wenn alles klappen würde.
Damals wusste man noch nicht, dass auch Erhard Eppler von gleicher Stelle einen ähnlichen Brief erhalten hatte, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass Michael Ende ein begeisterter Leser seiner Bücher sei und sich auf ein Gespräch mit ihm über die Problematik der heutigen Jugend freue. Man finde diese Idee sehr gut und würde sich freuen, wenn Erhard Eppler zusagen würde. Die Fernsehanstalt stelle für dieses Gespräch 70 Minuten Sendezeit zur Verfügung.
Erhard Eppler und Michael Ende sagten zu.
Michael Ende wurde von Rom nach Frankfurt eingeflogen, wo mit der Buchmesse im Hintergrund das Gespräch stattfinden sollte, während Erhard Eppler von Dornstetten anreiste – und schließlich begann die Fernsehsendung: Erhard Eppler wurde zusammen mit Johannes Gross an einen Tisch gesetzt, Michael Ende saß allein irgendwo mitten im Saal unter den vielen Leuten. Und dann ging der Zirkus richtig los: Als Erstes spielte eine Rock-Gruppe, dann gab es ein politisches Kabarett, darauf einen kurzen Schlagabtausch zwischen Johannes Gross und Erhard Eppler – schnell und schneller dreht sich das Karussell dann war wieder eine Liedermacherin an der Reihe, darauf fünf Minuten den üblichen Weihrauch für Michael Ende, dann noch zwei oder drei Interviews mit jungen Autoren – aus war die Sendung …
Und das siebzigminütige Gespräch zwischen Erhard Eppler und Michael Ende? Nach der schiefgelaufenen Fernsehsendung kehrten Erhard Eppler und Michael Ende in die Frankfurter Stuben ein und machten ihrem Ärger Luft. Hansjörg Weitbrecht, der Verleger Michael Endes, war auch dabei und hatte die Idee, das Gespräch in Form eines Buches stattfinden zu lassen. Der Vorschlag wurde gerne angenommen.
Da es kein reines Männergespräch werden sollte, bat man Hanne Tächl um ihre Mitwirkung.
Hanne Tächls politisches, soziales und künstlerisches Engagement spiegelt sich im komunalen kontaktteater wider, das sie mitleitet. Es handelt sich dabei um eine eigene Theaterform, die nicht allein vom Künstlerischen her verstanden sein will, sondern erklärtermaßen auch politische und soziale Themen behandelt. Und dies wirkt sich sehr direkt aus: Im Rahmen ihrer kontaktteater-Tätigkeit hat Hanne Tächl praktisch gearbeitet auf den Gebieten Strafvollzug, Nichtsesshaftenhilfe, gemeindenahe Psychiatrie und Altenhilfe, hier unter anderem auch Medienarbeit mit Altenheimbewohnern. Hanne Tächl versucht also, Politik und Kunst miteinander in Beziehung zu bringen – und bemüht sich um eine Synthese der zwei Bereiche, für die jeweils Erhard Eppler oder Michael Ende stellvertretend stehen könnten.
Erhard Eppler ist Politiker und ein äußerst umstrittener. Politisch wirkt er, nachdem er im Frühjahr nicht mehr in das Präsidium der SPD gewählt wurde und er sein Landtagsmandat in Baden-Württemberg niedergelegt hat, vor allem im Vorstand und als Vorsitzender der Grundwertekommission seiner Partei. Er ist auch amtierender Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Die politische Bedeutung Erhard Epplers liegt aber nicht nur in seinen politischen Funktionen, sondern auch in seiner Fähigkeit, über gesellschaftliche Prozesse nachzudenken. Für ihn bedeutet Politik mehr als nur ein »Management« von Krisen – er versucht, politische Praxis zu verbinden mit der Reflexion über Werte und Ziele. Die Aufgabe des Politikers besteht für ihn darin, Wege aufzuzeigen, und sie selbst in kleinen, oft winzigen Schritten zu gehen. Was für ihn zählt, ist nicht die Größe der Schritte, sondern die Erkennbarkeit der Richtung. Vor allem junge Leute sehen in ihm einen Menschen, der bemüht ist, sich nicht von politischen Sachzwängen leiten zu lassen und gesellschaftliche Bewegungen an der Basis wahrzunehmen. Wir sind auf Politiker wie Erhard Eppler angewiesen, denn solche Menschen decken verborgene gesellschaftliche Prozesse auf und veranlassen zum Nachdenken.
Zum Nachdenken in einem ganz anderen Bereich hat auch Michael Ende beigetragen. Seit 1979 haben seine beiden Bücher Momo und Die unendliche Geschichte einen ungeahnten Erfolg – das spricht nicht nur für die Bücher, sondern auch für den Hunger der Leser nach einer Art von Literatur, die unseren ausgetrockneten und verkümmerten Wirklichkeitsbegriff neu beleben will. Wenn von Michael Ende geschrieben wird, überwiegt leider noch das Klischee von dem »Märchenerzähler aus dem Süden«. Ein solches Bild wird nach diesem Gespräch wohl nicht mehr aufrechtzuerhalten sein. Michael Ende hat auf der Suche nach sich selbst scheinbar einen Schlüssel gefunden, mit dem er Türen und Tore öffnen kann, die wir vielleicht noch gar nicht sehen.
Am 5. und 6. Februar fand das Gespräch statt. Man war schon einen Tag vorher angereist und benutzte den Abend, um gemeinsam essen zu gehen und sich näher kennenzulernen. Diese beiden Tage waren wir zu Gast bei den Endes. Mitten in der römischen Campagna, zwischen Olivenhainen und Weinbergen, in den Albaner Bergen, unweit von Rom, wo Geschichte und Geschichten ineinander wachsen, erlebten wir zwei intensive und interessante Tage – und lernten auch die Lebensweise der beiden Endes kennen.
Der Boheme-Haushalt von Michael Ende und Ingeborg Hoffmann, ihre unbekümmerte und legere Art, ihre Fähigkeit, keinen Tag wie den vorhergegangenen zu leben, vermittelte allen ein Gefühl der Zeitlosigkeit, des Abenteuers, des Außergewöhnlichen. Als Erhard Eppler übermüdet und ausgelaugt vom politischen Alltag eintraf, ließ er sich gerne von dieser Atmosphäre einfangen. Allerdings war er an einem Teil des Gesprächs nicht anwesend. Die Gastgeber waren so sehr um seine Gesundheit besorgt, dass sie ihn schlicht ins Bett schickten.
Themen, die diesem Gespräch zugrunde liegen, waren weder besprochen und erst recht nicht fest ausgemacht worden. Man wollte ja, wie Hanne Tächl gleich zu Anfang sagt, »keine akademische Podiumsdiskussion veranstalten«, sondern ein bewusst ungeplantes Gespräch führen, das sich spiralförmig, gewisse Themen immer wieder berührend, entwickelt.
Es ging nämlich auch darum, wie drei Menschen, die auf ganz verschiedenen Gebieten arbeiten, miteinander ins Gespräch kommen. Von dieser Perspektive aus gesehen ist das Wie, die Art und Weise wichtig, wie man miteinander umgeht, wie man zueinander spricht. Mit der richtigen Einstellung nämlich kommt man zueinander – man muss ja nicht immer gleich argumentieren oder diskutieren. In einem Gespräch will man ja auch voneinander lernen, Neues erfahren und entwickeln. Deswegen der Untertitel »Protokoll eines Gesprächs«.
Stuttgart,
Roman Hocke
Freitagvormittag
… an dem das Gespräch beginnt. An diesem Vormittag sind Hanne Tächl, Erhard Eppler und Michael Ende anwesend. Das Tonbandgerät läuft schon seit einiger Zeit, aber da anfangs Anekdoten erzählt werden, beginnen wir mit der wörtlichen Wiedergabe des Gesprächs erst später. Nur so viel sei gesagt: Erhard Eppler erzählt aus den Fünfzigerjahren, als er Lehrer in Schwenningen war. Er lehrte dort Englisch, Deutsch und Geschichte. Acht Jahre verbrachte Eppler in Schwenningen, und er erinnert sich gerne daran, vor allem an seine Schüler. Einige von ihnen sieht er heute noch.
Auch Michael Ende erzählt aus seiner Vergangenheit: Er berichtet von seinen Erfahrungen, die er als junger Schauspieler, eben aus der Schauspielschule kommend, an der Landesbühne Schleswig-Holstein in Rendsburg gemacht hat. Auf seinen Tourneen soll es sogar des Öfteren vorgekommen sein, dass während auf der Bühne Schillers Fiesko mit großem Idealismus gespielt wurde, man im Saal unten Bier ausschenkte.
Erhard Eppler und Michael Ende haben sichtlich Freude daran, von ihren Erfahrungen und Erlebnissen in heiterer und humorvoller Art zu erzählen. Ingeborg Hoffmann, die Frau von Michael Ende, bringt dann noch einmal Kaffee und Tee. Nach einiger Zeit sagt Erhard
Eppler: Könnten wir uns kurz darüber verständigen, womit wir unser Gespräch beginnen wollen?
Ende: Wenn ihr einverstanden seid, möchte ich euch als Einstieg meine Erfahrung aus dem Duttweiler Institut erzählen. An dieser Erfahrung nämlich lässt sich meiner Einsicht nach gut die Frage nach dem Fehlen positiver Utopien anknüpfen. Positive Utopien fehlen ja ganz allgemein. Diese Tatsache prägt zweifellos das heutige Bewusstsein, vor allem in der jüngeren Generation. Meiner Meinung nach ist dieses Fehlen auch ausschlaggebend für die enorme Mutlosigkeit, mit der die jüngere Generation zu kämpfen hat.
Eppler: Ich habe nichts dagegen, wenn wir damit anfangen.
Tächl: Wir sollten uns auch einig darüber sein, dass wir uns bei unserer Unterhaltung einfach von dem führen lassen, was dabei entsteht – ohne festgelegten Plan und ohne vorherbestimmtes System. Wir wollen ja hier ein freies Gespräch führen und keine akademische Podiumsdiskussion veranstalten, deshalb brauchen wir auch keine Liste von Sachgebieten aufzustellen …
Ende: Nun, es geschehen ja auch heute noch manchmal Zeichen und Wunder. Eines Tages also, vor einigen Jahren, schneit mir ein Brief vom Duttweiler Institut ins Haus. Ich weiß nicht, ob ihr beide diese Einrichtung kennt. Duttweiler ist der größte Warenhauskonzern der Schweiz …
Eppler: … Migros …
Ende: … und der besitzt unter anderem ein Institut in der Nähe von Zürich, ein sehr schön gelegenes Institut, in dem Tagungen über alle möglichen sozialen, politischen und sonstigen Themen veranstaltet werden. Die Tagung, von der ich jetzt spreche, lief unter dem Thema »Die Rationalisierungsfalle«. Zu dieser Tagung waren etwa zweihundert Top-Manager aus ganz Europa eingeladen, auch Gewerkschaftsleute und einige Leute vom Club of Rome. Es ging bei der ganzen Sache um die Mikroprozessoren, die damals gerade aufkamen und die praktisch als die dritte industrielle Revolution gewertet wurden. Mit diesen Mikroprozessoren ist es ja möglich geworden, vollautomatische Fabriken zu bauen, in denen keine Menschen mehr arbeiten, sondern nur noch Maschinen.
Ich war einigermaßen erstaunt, dass die Veranstalter gerade mich einluden, an dieser Tagung teilzunehmen. Wie sie mir schrieben, brauchten sie auf dieser Tagung jemand, der Gretchenfragen stellt, also als Nichtfachmann ganz unbefangen und sozusagen naiv den Problemen gegenübersteht. Sie hätten aus meiner Momo[1] den Eindruck gewonnen, dass ich dafür genau der Richtige sei. Außerdem enthielt der Brief noch die Bitte, den dort versammelten Managern aus der Momo vorzulesen. Da dachte ich mir, das ist mal interessant, das mache ich und bin hingefahren.
Zunächst wurde den ganzen Tag schwer über alle möglichen Fragen des Wirtschaftswachstums diskutiert. Man sprach von der unabänderlichen Notwendigkeit von soundso viel Prozent Wachstum pro Jahr, wenn Katastrophen vermieden werden sollten. Die Leute vom Club of Rome versuchten dagegen, den Managern klarzumachen, dass es überhaupt kein Wachstum mehr geben dürfe, wenn noch schlimmere Katastrophen vermieden werden sollten. Dann kamen die Gewerkschaftler und sagten: Um Himmels willen, wenn die Mikroprozessoren jetzt alle Arbeit allein machen, was wird dann aus den Arbeitern? Das gibt eine Katastrophe! Darauf sagte ein besonders Schlauer, das mit den Arbeitern sei doch ganz einfach, alle die, die durch Mikroprozessoren ersetzt würden, könnten in Zukunft eben Mikroprozessoren bauen – und so ging alles rund im Kreis herum. Es war eine heftige und ziemlich groteske Diskussion.
Nach dem Abendessen sollte der gemütliche Teil kommen, und da war ich endlich an der Reihe. Ich stieg also auf das Podest und las erst mal den Managern zur allgemeinen Verblüffung ein Kapitel aus der Momo vor. Die Stelle mit Herrn Fusi, dem Friseur. Danach herrschte Ratlosigkeit im Saal. Man wusste nicht so recht, was das sollte, dass ihnen da einer plötzlich ein Märchen vorliest. Also fingen die Leute an, über den literarischen Wert oder Unwert der Sache zu diskutieren. Ich sagte: Meine Herren, ich glaube nicht, dass man mich aus diesem Grund zu Ihrer Tagung eingeladen hat. Die vorgelesene Stelle aus meinem Märchenroman sollte nur eine Anregung sein. Ich möchte Ihnen nämlich einen Vorschlag machen: Mir fällt auf, dass in unserem ganzen Jahrhundert kaum eine positive Utopie mehr geschrieben worden ist. Die letzten zumindest positiv gemeinten Utopien stammen aus dem vorigen Jahrhundert. Denken Sie etwa an Jules Verne, der noch glaubte, dass der technische Fortschritt den Menschen tatsächlich glücklich und frei machen könnte, oder an Karl Marx, der dasselbe von der Perfektion des sozialistischen Staates erhoffte. Beide Utopien haben sich inzwischen selbst ad absurdum geführt. Sieht man sich aber die Utopien an, die in unserem Jahrhundert geschrieben worden sind, angefangen von der Zeitmaschine von Wells über Brave New World von Huxley bis zu 1984 von Orwell, so finden wir nur noch Albträume. Der Mensch unseres Jahrhunderts hat Angst vor seiner eigenen Zukunft. Er fühlt sich dem, was er selbst geschaffen hat, offenbar hilflos ausgeliefert. Es wird nur noch in Sachzwängen gedacht. Und Zwänge machen Angst. Das Gefühl der Hilflosigkeit ist so groß, dass wir nicht einmal mehr wagen, uns zu überlegen, was wir uns eigentlich wünschen. Und deshalb möchte ich Ihnen, die Sie ja nun den ganzen Tag über Zukunftsfragen diskutiert haben, folgenden Vorschlag machen: Setzen wir uns doch einmal alle gemeinsam auf einen großen fliegenden Teppich und fliegen hundert Jahre in die Zukunft. Und jetzt soll jeder sagen, wie er sich denn nun wünscht, dass die Welt dann aussehen soll. Mir scheint nämlich, solange immer nur innerhalb der Sachzwänge argumentiert wird, wie heute den ganzen Tag, dann stellt man überhaupt nicht mehr die Frage, was wir überhaupt für wünschenswert halten. Ich habe sie jedenfalls kein einziges Mal gehört. Aber schließlich hängt die Zukunft der Welt doch von uns allen ab. Wir schaffen sie doch selbst. Wenn wir alle gemeinsam etwas Bestimmtes wollen, dann finden sich auch Mittel und Wege, es zu verwirklichen. Wir müssen nur wissen was! Dazu schlage ich Ihnen dieses Spiel vor. Dabei soll nur ein einziger Satz verboten sein, sozusagen als Spielregel, und der heißt: Das geht nicht! Sonst darf jeder einfach sagen, was ihm einfällt: Möchte er eine Gesellschaft mit Industrie, eine Gesellschaft ohne Industrie, wollen wir mit der Technik leben, wollen wir am liebsten die Technik ganz abschaffen, jeder soll sagen, wie er sich die zukünftige Welt wünscht.
Fünf Minuten Schweigen – peinliches Schweigen – ich hab’ es auch mit Absicht nicht unterbrochen, dieses Schweigen. Schließlich stand einer auf und sagte: Was soll der Quatsch? Das hat doch überhaupt keinen Sinn, wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben, und die Tatsachen sind eben die, dass wir, wenn wir nicht mindestens drei Prozent Wachstum im Jahr haben, nicht mehr konkurrenzfähig sind und wirtschaftlich zugrunde gehen. Ich sagte, das haben Sie jetzt den ganzen Tag über diskutiert. Sie werden morgen und übermorgen weiter darüber diskutieren, jetzt wollen wir das einen Augenblick vergessen und dieses Zukunftsspiel spielen. Aber das war nicht zu machen, im Gegenteil! Die Situation wurde so prekär, so mulmig, dass die Veranstalter den Versuch nach einer halben Stunde von sich aus abbrechen mussten, weil die Leute anfingen, mich zu beschimpfen und aggressiv zu werden.
Dieses Erlebnis hat mir viel zu denken gegeben. Ich glaube, es sind nicht nur diese Wirtschaftsleute, die heutzutage in einem ganz bestimmten Kreislaufdenken regelrecht gefangen sind, und dieser Kreislauf wird angetrieben durch Vorstellungen der Macht und der Angst, das heißt entweder überwältigen uns die anderen, dann sind wir verloren, oder wir überwältigen die anderen, dann gewinnen wir einen kleinen Vorsprung in diesem Wettlauf. Ich fand es grausig, dass diese Leute überhaupt nicht mehr außerhalb dieses Höllenkreislaufs denken konnten. Aber ich habe später bei öffentlichen Lesungen und Diskussionen bemerkt, dass eine ganz ähnliche Bewusstseinshaltung schon bei vielen jungen Leuten besteht. Viele haben das Gefühl, vor einer Art schwarzer Wand zu stehen. Sie sagen: Ja, ja gut, ich kann diesen oder jenen Beruf ergreifen, ich werde irgendwie schon durchs Leben kommen, aber wozu, was soll das Ganze? Da drückt es sich als totale Entmutigung aus, als Verzweiflung, als das Gefühl, man stünde vor einer unüberwindlichen schwarzen Mauer.
Da steckt das Problem unserer Konsumgesellschaft: Wir sind zum Konsum verdammt, weil sonst nichts da ist. Äußerlich haben wir alles, geistig sind wir arme Teufel.
Wir können keine Zukunft sehen, wir können keine Utopie finden. Mir scheint es lebensnotwendig, überlebensnotwendig, dass man sich – sei es im politischen, sei es im kulturellen, sei es auf wirtschaftlichem Gebiet – ein positives Bild von der Welt machen kann, in der man leben möchte. Ich würde vorschlagen, dass wir unser Gespräch damit anfangen; nicht, indem wir jetzt dieses Spiel spielen, das meine ich nicht. Vielleicht sollten wir uns überlegen, woher es eigentlich kommt, dass die heutige sogenannte zivilisierte Menschheit und vor allem die junge Generation sich so von allen guten Geistern verlassen fühlt.
Eppler: Ich würde gerne unterscheiden zwischen diesen Managern und den jungen Leuten. Diese Manager haben eine Utopie, eine miserable, eine banale, die dürftigste, die es je gegeben hat, nämlich die Utopie der technokratischen Fortschreibung – sie können sich Zukunft nicht anders vorstellen als durch Verlängerung der ökonomischen, technischen Trends, die sie dahin gebracht haben, wo sie jetzt sind. Deshalb wurden sie auch aggressiv. Nicht nur, dass sie ihre Phantasie nicht gebrauchen können, sie sind davon überzeugt, dass sie das auch nicht dürfen, weil dabei eine Zukunft entstünde abseits jener miserablen Utopie, an die sie glauben. Die Jungen dagegen haben inzwischen begriffen, dass Fortschreiben eine miserable Utopie ist, und da sie eine andere nicht sehen, bleibt ihnen gar nichts mehr übrig.
Ende: Das ist es eben. Ich glaube, auch bei den Managern war es so. Nicht, dass ich sie verteidigen möchte, aber ich hatte eigentlich den Eindruck, das, was sie so aggressiv machte, war, dass sie durch das vorgeschlagene Spiel zum Eingeständnis ihrer Ratlosigkeit gezwungen wurden. Aber das war überhaupt nicht meine Absicht gewesen.
Ich hatte allerdings auch nicht so sehr die Absicht, die anwesenden Manager zu enormen Phantasieleistungen anzuregen, sondern ich wollte einfach hören, was sich der Einzelne so vorstellt, wenn schon nicht für sich, dann doch für seine Kinder und Enkel. Man hatte im Laufe des Tages ja pausenlos festgestellt, dass uns die bestehenden Systeme in Katastrophen führen werden. Das Überraschende war, dass da gar keine Antwort kam. Ich hatte zumindest mit einer systemgläubigen Antwort gerechnet, aber auch die kam nicht.
Eppler: Die Löcher, die das Nichts in Phantásien[2] gerissen hat und noch weiter reißt, hast du also auf dieser Tagung gespürt. Für den Technokraten ist Phantasie in diesem Sinne etwas zutiefst Suspektes, etwas im Grunde Unanständiges. Wer sich auch nur den Anschein gibt, diese Art Phantasie zu haben, wird in diesem Kreis wahrscheinlich schon gar nicht mehr ernst genommen. Ich könnte mir vorstellen, wenn der eine oder andere in der Lage gewesen wäre, deine Frage zu beantworten, er hätte sich vor den anderen geniert.
Ende: Geniert? Das wäre allerdings ein bedenkliches Zeichen, wenn es als unanständig gilt, sich Gedanken über eine lebenswerte Zukunft zu machen!
Tächl: Wenn ich das Wort »unanständig« mal wörtlich nehme, das Erhard Eppler gerade gebraucht hat, im Sinne von »etwas steht nicht an«, dann muss ich sagen: Für diese Manager ist Phantasie für die nächsten hundert Jahre gar nicht relevant und nicht so wichtig im Vergleich zu dem nächsten kleinen Schritt, der für sie Realität besitzt.
Ende: Aber das kann ich ja gerade nicht verstehen. Es war ja die ganze Zeit auf dieser Tagung von nichts anderem die Rede als davon, dass die Leute vom Club of Rome den Managern klargemacht haben: Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann wird die Wärmeschwelle überschritten, dann werden die Ressourcen total verbraucht, dann laufen wir auf einen Abgrund zu. Es wurde von nichts anderem geredet, als davon, dass es so nicht bleiben kann, dass wir total neue Formen der Wirtschaft finden müssen, dass wir unsere Lebensweise ganz und gar umstellen müssen. Und wenn man nun fragt, was wünschen wir uns? Worauf wollen wir vor allem Wert legen?, dann herrscht Schweigen im Walde. Wenn überhaupt Vorschläge gemacht werden, dann laufen sie meist darauf hinaus, vorsichtiger zu sein, die Natur noch etwas schlauer auszubeuten, sodass sie es vielleicht nicht gleich merkt und zurückschlägt. In Wirklichkeit will man gar nichts grundsätzlich ändern, man will es nur ein bisschen gerissener anstellen, aber das alte System im Grunde beibehalten. Das Ausbeuten der Natur gilt ja nicht als unanständig. Man will nicht begreifen, dass man der Natur für alles, was man von ihr nimmt, etwas zurückgeben muss.
Ich habe auch bei manchen Vorschlägen, die aus der ökologischen Ecke kommen, das Gefühl, dass man die grundlegende Veränderung, in die wir jetzt eigentlich einwilligen müssen, gar nicht sehen will. Ich befürchte, dass selbst diejenigen, die es besser wissen sollten, sich selbst einreden, dass im Grunde alles beim Alten bleiben kann. Es ist einfach eine Tatsache, dass Industrieballungen, wie wir sie zum Beispiel im Ruhrgebiet haben, nicht aufrechterhalten werden können, ohne eben einen ungeheuerlichen Verbrauch unersetzlicher und begrenzter Energien in Kauf zu nehmen. Das geht eben nicht endlos so weiter! Da liegen doch die wahren Probleme, über die wir uns keine Illusionen machen dürfen. Aber da traut sich keiner wirklich ran, und keiner wagt es, laut und deutlich zu sagen, dass diese Zentren auf lange Sicht abgeschafft werden und dass für die Zukunft ganz andere Formen von Industrie gefunden werden müssen. Industrie dürfte eben nicht mehr in Ballungen auftreten, sondern müsste dezentralisiert werden. Eine solche Dezentralisierung würde bereits geringere Mengen von Energie verbrauchen. Stattdessen versucht man, die bestehenden Formen durch Atomenergiezentralen zu retten. Da treibt man den Teufel mit Beelzebub aus. Wir brauchen andere Wirtschaftsformen, andere Produktionsmethoden.
Solche Antworten und Vorschläge hatte ich mir eigentlich von den Managern im Duttweiler Institut erwartet. Genau so etwas hatte ich mir vorgestellt, als ich ihnen den Vorschlag machte, hundert Jahre in die Zukunft zu denken. Ich bin wirklich kein Fachmann auf wirtschaftlichem Gebiet, aber ich habe doch angenommen, dass man an jenem Abend über die Möglichkeiten sprechen könnte, wie man sich für die Zukunft eine Industrie denkt, die auf andere Grundlagen gestellt wäre. Die nicht auf Konkurrenz, sondern auf Zusammenarbeit basiert. Nur mal als Beispiel. Dann könnten viele Kleinbetriebe existieren, die meinetwegen aus fünfzig Menschen bestehen, was sowieso menschenwürdiger wäre, und die nur relativ wenig Energie verbrauchen. Nichts dergleichen kam …
Eppler: Wir haben schon vergessen, dass diese technokratische Utopie, die sich Zukunft nur als Fortschreibung des Üblichen, des Bestehenden vorstellen kann, bis etwa in die Mitte der sechziger Jahre noch eindeutig als positive Utopie empfunden wurde. Man konnte den Wohlstand alle zwölf Jahre, fünfzehn Jahre verdoppeln, und Hermann Kahn[3] hat Wachstumsraten bis ins vierte Jahrtausend fortgeschrieben …
Ende: Fabelhaft!
Eppler: Aber dann kamen die Zweifel, ob dies alles stimme, ob man so Zukunft erschließen könne. Aus der positiven Utopie wurde der Albtraum. Zuerst hat der Club of Rome errechnet, dass die Fortschreibung von Wachstumstrends in die Katastrophe führt, hat also aus der technokratischen Utopie eine negative Utopie gemacht. Die Manager, von denen du erzählt hast, stehen jetzt zwischen zwei für sie bedrückende Zukünften. Die eine Zukunft ist die des Club of Rome, heute würde man sagen, von Global 2000[4], wo ja noch viel exakter gerechnet wird. Wenn sie dieser bedrückenden Zukunft aber entgehen wollen, dann stellt sich die Frage: Was wird aus uns, wenn es nicht die drei oder vier Prozent Wachstum gibt? Muss dann nicht unser Betrieb, die Wirtschaft, das System zusammenbrechen? Diese Manager müssen befürchten, dass sie sehr viel früher in soziale und ökonomische Turbulenzen geraten. Sie fürchten um ihre Position. Und zwischen diesen beiden schlechten Zukünften wählen sie eben diejenige, die sie zu ihren Lebzeiten noch einigermaßen bewältigen können, also die Fortschreibung der Wachstumsgesellschaft. Sie überlassen den Rest, oder anders gesagt, die Sintflut, ihren Kindern und Enkeln.
Ende: Ja, das ist richtig. Irgendjemand hat mal gesagt: »Der dritte Weltkrieg hat längst begonnen, nur wird er diesmal nicht territorial geführt, sondern zeitlich. Wir führen einen Vernichtungskrieg gegen unsere eigenen Enkel.« Das ist sicher richtig … Aber was du sagst, Erhard, klingt so, als sei die ganze verteufelte Situation hauptsächlich Schuld der böswilligen Wirtschaftsleute.
Ich will jetzt zwar die Manager nicht unbedingt verteidigen, aber doch ein Wort zu ihren Gunsten reden. Ich hatte nämlich nicht den Eindruck, dass es sich bei diesen Leuten um Böswilligkeit handelt. Sie haben vielmehr vor ihrem eigenen System Angst – sie sitzen in einem Karussell, in dem einer hinter dem anderen herjagt und dieses Karussell dreht sich immer schneller und schneller. Das ist eben das Wesen einer auf Konkurrenz basierenden Wirtschaft. Keiner kann mehr aus diesem Karussell aussteigen – selbst wenn er möchte. Man jagt sich gegenseitig im Kreis, getrieben durch die Angst um den Markt, die Angst vor dem berühmten »ehernen Gesetz« von Angebot und Nachfrage … Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss man halt soundso viele Prozent Wachstum haben, denn nur dadurch ist es möglich, Ware billig herzustellen und in Mengen zu produzieren. Hierzu wiederum werden aber die entsprechenden Ressourcen benötigt … Denn wenn diese nicht angegriffen und verbraucht werden, dann kann man in diesem Teufelskreis nicht mehr mithalten. Ich glaube nicht, dass es die Einsichtslosigkeit oder der rücksichtslose Egoismus der Wirtschaftsleute ist, was die Sache so schlimm macht. Es ist das System selbst.
Und was ich an dieser ganzen Geschichte so beängstigend finde, ist, dass sich das Wirtschaftssystem selbstständig gemacht hat. Gerade dass niemand es steuert, niemand es mehr steuern kann, ist das Verhängnis. Das wild gewordene Karussell dreht sich im Kreise herum, und niemand kann es mehr anhalten. Die Leute, die darin sitzen, wissen oder ahnen zumindest, dass irgendwann einmal das Ganze nach allen Seiten auseinanderfliegen muss, aber sie wissen nicht, was sie tun können – oder sie können nichts mehr tun. Sie machen die Augen zu.
Eppler: Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es tatsächlich keiner kann. Vielleicht ist es auch nur so, dass niemand die Phantasie hat, sich etwas anderes vorzustellen. Neuerdings klingt bei manchen Technokraten auch ein gewisses Pathos des Tragischen durch: Wir wissen, dass das alles nicht mehr lange funktionieren kann – wir wissen, dass es im Grunde falsch ist, aber es gibt eben nichts anderes. Und es gibt nichts anderes, weil im technokratischen Denken, vielleicht bereits in der ganzen Gesellschaft, die kreative Phantasie entweder abgestorben ist oder aber aus Interessengründen heraus diskriminiert und tabuisiert wird. Kreative politische Phantasie könnte die Machtstrukturen der Gesellschaft gefährden, also muss man sie lächerlich machen.
Tächl: Ich kann mir gut vorstellen, dass es für diese Manager schwer ist, sich neue Wirtschaftsformen zu denken, solange sie nicht bereit sind, ihren Status aufzugeben, der sie abhängig macht.
Es ergeben sich eben beim Suchen nach neuen Wirtschaftsformen schnell unbequeme, fundamentale Fragen wie zum Beispiel nach den Eigentumsverhältnissen an den Produktionsmitteln. Um die kommt man sicher nicht herum.
Warum sollen sich nicht immer mehr Menschen zusammenfinden, um unter menschlicheren Bedingungen zu produzieren, zum Beispiel in kleineren Arbeitsgemeinschaften, von denen du vorhin gesprochen hast, Michael. Es ist doch auch denkbar, dass ein Betrieb denen gehört, die in ihm arbeiten. Und warum sollen nicht die Mitarbeiter einer Arbeitsgemeinschaft darüber entscheiden, wer welche Arbeit tut und wer von ihnen am besten geeignet ist, als Manager den Betrieb zu leiten?