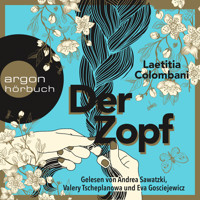8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Philomena Lee ist selbst noch fast ein Kind, als sie hochschwanger im Kloster Zuflucht sucht. Doch statt Barmherzigkeit erwartet sie dort ein unerbittliches System: Im Irland der 50er-Jahre verkaufen die Nonnen jedes uneheliche Kind, das in ihrem Konvent geboren wird, mit neuer Identität in die USA. Wie viele andere Mütter verliert auch Philomena ihren Sohn, aus Anthony Lee wird mit drei Jahren Michael Hess. Mutter und Sohn können einander nicht vergessen, doch erst 50 Jahre später erfährt Philomena, was aus ihrem Sohn geworden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Ähnliche
Über das Buch
Irland, 1952: Philomena Lee ist achtzehn Jahre alt und ledig, als sie im Kloster von Roscrea einen Sohn zur Welt bringt. Doch dafür zahlt sie einen hohen Preis. Nach drei Jahren harter Arbeit für die Schwestern muss Philomena ihren Sohn Anthony schließlich zur Adoption freigeben. Wie zahllose andere Kinder zu dieser Zeit wird Anthony von den Nonnen an eine amerikanische Familie verkauft – und erhält auch einen neuen Namen: Aus Anthony Lee wird Michael Hess.
Jahrzehntelang behält Philomena Lee ihr Geheimnis für sich. Sie heiratet, gründet eine Familie. Erst fünfzig Jahre später erzählt sie ihren Kindern von Anthony, ihre Tochter wendet sich daraufhin hilfesuchend an den Journalisten Martin Sixsmith. Gemeinsam gelingt es Philomena und Martin, das bewegte Leben von Anthony zu rekonstruieren. Dieses Buch erzählt seine Geschichte.
Über den Autor
Martin Sixsmith, geboren in Cheshire, England, studierte in Oxford, Harvard und an der Sorbonne. Von 1980 bis 1997 war er Auslandskorrespondent für dieBBC, später arbeitete er für die britische Regierung. Heute ist Martin Sixsmith freier Journalist, Moderator sowie Autor mehrerer Sachbücher und Romane.
Mit einem Vorwort von
Dame Judi Dench
Übersetzt von Heike Holtsch und Michael Windgassen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0869-2
1. Auflage Februar 2014
4. Auflage 2016
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014
Titel der englischen Originalausgabe:The Lost Child of Philomena Lee
© Pan Books, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 2010
© Martin Sixsmith 2009
Vorwort: © Dame Judi Dench 2013
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © 2013 Philomena Lee Limited, Pathé Productions Limited, British Film Institute and British Broadcasting Corporation
Filmplakat auf dem Aufkleber: © 2013: Squareone Entertainment, Universum Film, Philomena Lee Limited, Pathé Productions Limited, British Film Institute and British Broadcasting Corporation
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
eBook: LVD GmbH, Berlin
Vorwort
Philomena ist die außergewöhnliche Geschichte einer außergewöhnlichen Frau. Philomena Lee war ein naives junges Mädchen, dessen einzige Sünde es war, unverheiratet schwanger zu werden. Die irische Gesellschaft, beherrscht von der römisch-katholischen Kirche, verbannte sie in ein Kloster, wo sie ihr Kind zur Welt brachte, einen hübschen Jungen. Drei Jahre lang kümmerte sich Philomena um den kleinen Anthony und arbeitete in der Wäscherei des Klosters. Doch dann erging es ihr wie Tausenden anderen »gefallenen Mädchen«: Philomena wurde gezwungen, ihr Kind abzugeben, und erst als dies geschehen war, wurde sie aus dem Sklavendienst entlassen.
In Irland teilten viele junge Mütter mit unehelichen Kindern in den 1950er Jahren dieses Schicksal. Erst vor kurzem hat die irische Regierung sich für diese Verbrechen entschuldigt. Doch Philomenas Geschichte ist eine ganz besondere. Dieses Buch – ebenso wie der darauf basierende Film – erzählt die Geschichte ihrer Jahrzehnte währenden Suche nach ihrem verlorenen Sohn. Unsicherheit, Hoffnung und Momente der Verzweiflung – all das wird darin beschrieben.
Es hat mich sehr beeindruckt, dass sich Philomena trotz allem, was ihr widerfahren ist, ihren unerschütterlichen Glauben bewahrt hat. Sie stellt Dinge in Frage und spricht in aller Offenheit über das, was sie erlebt hat, aber sie hat nie ihr Gottvertrauen verloren – es ist ungebrochen wie eh und je.
Als man mir die Rolle der Philomena in Stephen Frears großartigem Film anbot, besann ich mich auf meine eigenen irischen Wurzeln. Meine Mutter stammte aus Irland, sie wurde in Dublin geboren. Mein Vater war Brite, er kam im Alter von drei Jahren mit seinen Eltern aus Dorset nach Irland. Er wuchs in Dublin auf und studierte am Trinity College.
Obwohl die Familie meiner Mutter methodistisch war, besuchte sie eine katholische Schule, und ich erinnere mich, dass sie gut über die Nonnen sprach. Da sie nicht katholisch war, wurde sie von den Gebeten entbunden und erhielt stattdessen die Aufgabe, in der Gebetszeit Statuen abzustauben. Meine Mutter erzählte später schmunzelnd, es sei ihre Aufgabe gewesen, »die Jungfrau Maria sauber zu halten«.
Vor diesem Hintergrund schätze ich es sehr, dass weder Martin Sixsmith in seinem Buch noch Stephen Frears in seinem Film Schwarzweißmalerei betrieben haben. Die Rolle der katholischen Kirche wird kritisch hinterfragt, dennoch entsteht kein Zerrbild der Geschehnisse. Die Zeiten waren andere, und das System war unerbittlich. Aber es gab auch gütige Nonnen, und nicht alle Mädchen wurden schikaniert.
Wie die meisten Iren in den 1950er und 1960er Jahren wusste auch meine Familie nichts von den hier beschriebenen Vorfällen. Doch Philomena war leider kein Einzelfall. Unzählige Mütter und Kinder wurden auseinandergerissen, und viele von ihnen haben sich bis zum heutigen Tag nicht wiedergefunden. Das ist furchtbar und erschütternd. Deshalb kann ich nur hoffen, dass Philomenas tapfere Suche und ihre mutige Entscheidung, jemanden ihre Geschichte erzählen zu lassen, ein Trost für all diejenigen sind, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben.
Als der Film entstand, war ich mir der ungeheuren Verantwortung bewusst, eine noch lebende Person zu spielen, und diese Verantwortung lastete schwer. Ich bin bald völlig in der Figur der Philomena aufgegangen. Die Rolle war für mich eine immense Herausforderung, aber es war großartig, mit Philomena selbst sprechen zu können – mich bei ihr rückzuversichern, wann immer es nötig war. Das gab mir die Möglichkeit, den Kern ihres Wesens auf eine Weise zu erkennen, die mir bei Elizabeth I. oder Iris Murdoch verwehrt blieb, denn beide waren schon lange tot. Eine Bereicherung für mich war außerdem, dass ich mir anschließend einige Szenen gemeinsam mit Philomena ansehen konnte und sie mir wohlwollend die Hand auf den Arm legte. Ich beobachtete jede ihrer Reaktionen genau – insbesondere, als der Junge ins Bild kam, der ihren verlorenen Sohn spielt.
Mehr als alles andere wollte ich, dass der Film Philomena und Martin Sixsmiths Buch gerecht würde. Ich habe schon oft unter der Regie von Stephen Frears gearbeitet, und ich wusste, dass wir bei ihm in guten Händen waren. Er hat sehr sorgfältig darauf geachtet, Philomenas Geschichte so wahrhaftig wie möglich umzusetzen. Ich bin unglaublich froh, dabei gewesen zu sein. Und ich hoffe, Philomena gefällt, was wir aus der Geschichte ihres Lebens gemacht haben.
Dame Judi Dench, 2013
Prolog
Das Jahr 2004 hatte gerade begonnen. Ich wollte aufbrechen – die Party war langweilig, und ich war müde –, als mir jemand auf die Schulter tippte. Es war eine mir fremde Frau, um die fünfundvierzig und ein wenig beschwipst. Verheiratet mit dem Bruder eines gemeinsamen Freundes – noch, wie sie betonte. Ich lächelte höflich. Sie meinte, sie habe etwas für mich, das mich interessieren könnte.
»Sie sind doch Journalist, nicht wahr?«
»Das war ich mal.«
»Aber Sie verstehen sich doch bestimmt darauf, Geschichten zu recherchieren, oder?«
»Kommt darauf an, worum es sich handelt.«
»Sie müssen meine Freundin kennenlernen. Sie steht vor einem Rätsel und möchte, dass Sie es lösen.«
Ich war neugierig genug, um mich mit der Freundin im Café der British Library zu verabreden. Sie war eine Finanzbuchhalterin Ende dreißig, elegant gekleidet, hatte klare blaue Augen und pechschwarzes Haar. Ein Geheimnis in ihrer Familie beunruhigte sie. Ihre Mutter, Philomena, hatte an Weihnachten ein Glas Sherry zu viel getrunken und war plötzlich in Tränen ausgebrochen. Dann enthüllte sie ihrer Familie ein Geheimnis, das sie fünfzig Jahre lang gehütet hatte …
Möchten wir nicht alle einmal Detektiv spielen? Das Treffen in der British Library war der Beginn einer Suche, die fünf Jahre andauern sollte und mich von London über Irland bis in die Vereinigten Staaten führte. Jetzt liegen alte Fotos, Briefe und Tagebücher verstreut auf meinem Schreibtisch – das nervöse Gekrakel einer Frau, Unterschriften auf traurigen Dokumenten und das Bild eines verlorenen kleinen Jungen in einem blauen Pullover, in der Hand ein kleines Flugzeug aus Blech …
Alles, was nun folgt, entspricht der Wahrheit oder ist nach bestem Wissen und Gewissen rekonstruiert. Manche Protagonisten dieser Geschichte führten Tagebuch oder hinterließen eine umfangreiche Korrespondenz; andere, die noch leben, waren bereit, sich mit mir zu unterhalten, und nicht wenige haben ihre Version der Ereignisse Freunden anvertraut. Lücken wurden geschlossen, Wesenszüge erinnert und Mutmaßungen angestellt. So arbeiten Detektive doch, oder?
Teil 1
Eins
Samstag, 5. Juli 1952
Sean Ross Abbey, Roscrea, County Tipperary, Irland
Schwester Annunciata verfluchte das elektrische Licht. Bei jedem Gewitter flackerte es schlimmer als die alten Petroleumlampen. Doch gerade in dieser Nacht brauchten sie so viel Licht wie nur möglich.
Sie wollte ihre Schritte beschleunigen, stolperte aber über den Saum ihres Ordensgewands. Ihr zitterten die Hände, und heißes Wasser schwappte aus der Emailleschüssel auf den steinernen Boden des dunklen Gangs. Für die anderen war alles ganz einfach, sie brauchten nichts weiter zu tun, als zur Heiligen Jungfrau zu beten. Von Schwester Annunciata jedoch erwartete man tatkräftige Hilfe. Sonst würde das Mädchen sterben, denn niemand außer ihr wusste, wie man es retten konnte.
In dem improvisierten Kreißsaal über der Kapelle kniete sich Annunciata neben ihre Patientin und sprach ihr flüsternd Mut zu. Das Mädchen versuchte zu lächeln und antwortete etwas Unverständliches. Als ein Blitz den Raum erhellte, zog Annunciata die Laken höher, damit das Mädchen nicht sah, wie blutig sie waren.
Annunciata war selbst kaum älter als ihre Patientin. Beide kamen sie vom Land, aus dem hintersten Winkel von Limerick. Aber Annunciata war die Geburtshelferin, und die Nonnen warteten darauf, dass sie irgendetwas tat.
Von unten hörte sie, dass Mutter Barbara die anderen Mädchen in die Kapelle rief. Sie sollten beten – für den gefallenen Engel, die sterbende Sünderin, die die gleiche Schande auf sich geladen hatte wie all die anderen. Gedämpft, aber unbarmherzig schallten die körperlosen Stimmen herauf. Annunciata drückte ihrer Patientin die Hand und sagte, sie solle nicht darauf achten. Sie hob den weißen Leinenkittel und wischte dem Mädchen mit warmem Wasser das Blut von den Beinen. Man konnte das Baby bereits sehen, aber nur den Rücken, nicht den Kopf. Annunciata hatte schon von Steißgeburten gehört, und sie wusste, noch eine Stunde, dann wären Mutter und Kind tot. Denn gleich würde das Fieber einsetzen.
Schwester Annunciata beugte sich über die Gebärende und wischte ihr über die Stirn.
Das Mädchen wusste gar nicht, wie ihm geschah. Niemand hatte es besucht, obwohl es schon seit zwei Monaten hier war. Vater und Bruder hatten es zu den Nonnen gebracht, und jetzt ließen die Nonnen es einfach sterben.
Annunciata dankte Gott, dass sie nicht diejenige war, die dort lag. Dann riss sie sich zusammen. Sie als Bauerntochter war schließlich nicht zimperlich! Sie packte das Baby, seine Haut fühlte sich warm und lebendig an. Mutter Barbara hatte gesagt, Sünderinnen verdienten keine Schmerzmittel, und die junge Mutter schrie. Sie schrie um ihr Baby. »Lass nicht zu, dass sie ihn hier begraben … Sie werden ihn im Kloster begraben …«
Mit ihren kräftigen Händen – und dann mit der Zange aus kaltem Metall – zog und zerrte Annunciata an dem winzigen Körper. Er bewegte sich, wenngleich auch nur widerwillig, als wollte er die warme Geborgenheit nicht aufgeben. Blassrote Flüssigkeit quoll auf das weiße Laken. Annunciata hatte den Kopf des Babys gefunden. Und sie zog weiter, zerrte ein neues Leben auf Gottes Erde.
Schwester Annunciata war dreiundzwanzig. Seit fünf Jahren trug sie diesen Namen, davor war sie Mary Kelly gewesen, eine von den Kellys aus Limerick, eine von sieben.
Eines Abends war der Priester gekommen, hatte mit dem alten Mr Kelly etwas getrunken und ihm sein Bedauern ausgesprochen, weil ihm Söhne versagt geblieben waren. Nach dem dritten Whiskey hatte sich der Priester vorgebeugt und dem alten Kelly zugeraunt: »Also, Tom, ich weiß ja, du liebst deine Mädchen. Das Beste wäre also, wenn du dich darum kümmern würdest, dass sie gut versorgt sind. Eine kannst du Gott doch überlassen, oder nicht, Tom?«
Nun war sie also hier, fünf Jahre später – Schwester Annunciata, Gott überlassen.
Wann immer Annunciata in den nächsten Tagen die Gelegenheit dazu hatte, herzte sie den Kleinen, als wäre er ihr eigenes Kind. Schließlich war sie diejenige, die ihm das Leben geschenkt hatte. Sie hatte ihn gerettet, ihn das Licht der Welt erblicken lassen. Auf ihren Vorschlag hin war er auf den Namen Anthony getauft worden, und sie hatte das Gefühl, dass sie in besonderer Weise miteinander verbunden waren. Sie tröstete ihn, wenn er weinte, und wenn er Hunger hatte, hätte sie nichts lieber getan, als ihn zu stillen.
Der Mutter des Jungen hatten die Nonnen den Namen Marcella gegeben – hier im Kloster durfte keines der Mädchen seinen richtigen Namen behalten. Von der Familie verlassen, suchte Marcella Halt bei Annunciata. Annunciata ihrerseits spendete Marcella Trost und ließ sie spüren, dass sie sie – im Gegensatz zu den Nonnen – nicht verurteilte. Ungeachtet der gebotenen Stille suchten sich die beiden ein ruhiges Plätzchen und tauschten Geheimnisse aus ihren alten Leben aus. »Erzähl mir von dem Mann«, flüsterte Annunciata Marcella ins Ohr. »Erzähl, wie war er?«
Marcella kicherte, und Annunciata rutschte noch näher, sie wollte es unbedingt wissen.
»Nun sag schon, wie war er? Sah er gut aus?«
Marcella lächelte. Mittlerweile erschienen ihr die wenigen Stunden mit John McInerney wie das Licht der Erkenntnis in ihrem zuvor so unwissenden Leben. Seit ihrer Ankunft im Kloster hatte sie diese kostbare Erinnerung bewahrt, davon geträumt und sie immer wieder durchlebt.
»Er war der bestaussehende Mann, der mir je begegnet ist. Groß und dunkelhaarig … und er hatte einen so sanften, gütigen Blick. Er arbeitet auf dem Postamt in Limerick, hat er gesagt.«
Noch ein wenig Ermunterung von Annunciata, und Marcella erzählte alles über den Abend, an dem das Baby gezeugt wurde – wie unbeschwert und glücklich sie gewesen war, als sie noch Philomena Lee hieß.
Es war ein milder Abend gewesen, und die Lichter des Jahrmarkts, die Musik des Ceilidh und der Duft von Zuckerwatte und kandierten Äpfeln hatten ihre Abenteuerlust geweckt. Philomena warf immer wieder verstohlene Blicke zu dem jungen Mann vom Postamt. Er lachte sie an und prostete ihr mit seinem Bierglas zu. Mit einer Mischung aus Zögern und Spannung hatten sie sich angesehen. Und dann … und dann …
Zwei
7. Juli 1952
Dublin, Irland
Die Sommerstürme, die Schwester Annunciata in der Nacht von Anthonys Geburt zu schaffen gemacht hatten, wüteten nicht nur in Roscrea. Das Stromnetz der gesamten Republik Irland musste dringend modernisiert werden.
In Glasnevin, einem Vorort von Dublin, sorgte ein Stromausfall dafür, dass es im ganzen Haus stockdunkel war, als Joe Coram am Montagmorgen aufwachte. Eine halbe Stunde später fand Corams Frau Maire ihn im Dunkeln sitzend beim Frühstück vor, das aus ungetoastetem Brot und kaltem Tee bestand. Sie musste lachen. Auch Joe lachte. Er war jung und voller Tatendrang, und er liebte seinen Job, ebenso wie seine Frau, sein Haus und das Leben im Allgemeinen. Er umarmte Maire, und einmal mehr fiel ihm auf, wie hübsch sie war.
»Heute Abend kann es spät werden, Maire, vorausgesetzt, die Straßenbahnen fahren. Ich muss zu diesem vermaledeiten Arbeitskreis Kirchenpolitik« – Corams Frau verdrehte die Augen –, »wo es bekanntermaßen momentan ein wenig zäh läuft.«
Glücklicherweise waren die Straßenbahnen nicht von dem Stromausfall betroffen, und Joe Coram erreichte ungehindert sein Büro. Zehn Minuten später wünschte er, er wäre niemals dort angekommen. Seine Sekretärin hatte sich krankgemeldet, und auf seinem Schreibtisch lag eine Mitteilung, der er entnahm, dass der Minister ihn sprechen wollte, und zwar umgehend.
Frank Aiken, Außenminister der Republik Irland, war schlecht gelaunt, und in Iveagh House hielten schon alle den Atem an. Aiken war ein Sturkopf, der gegen alles und jeden einen Groll hegte – noch immer nahm er es seinen ehemaligen Kameraden übel, dass sie 1921 dem Anglo-Irischen Vertrag zugestimmt hatten.
Joe wusste, worum es bei dem ganzen Wirbel ging – er war Leiter der Abteilung für Pässe und Visa und hatte als solcher Einblick in die Russell-Kavanagh Affäre, von Beginn an, seit die Geschichte sechs Monate zuvor ins Rollen gekommen war. Im Vorzimmer des Ministers setzte der junge Privatsekretär Joe in aller Kürze in Kenntnis: »Diese verfluchte Jane-Russell-Sache fällt uns wieder auf die Füße. Jetzt hat auch noch die internationale Presse Wind davon bekommen. Ich würde Ihnen die Depesche gern zeigen, aber Frank hat sie mit in sein Büro genommen. Also machen Sie sich auf etwas gefasst.«
Frank Aiken hatte sich gerade die fünfte Zigarette an diesem Morgen angesteckt, als Joe an die Tür klopfte und das Büro betrat. Auf dem Schreibtisch stapelten sich wie üblich interne Mitteilungen, Zeitungen und aufgerissene braune Briefumschläge. Aiken war dermaßen wütend, dass er schon beinahe komisch wirkte – für einen kurzen Moment meinte Joe den Rauch zu sehen, der seinem kahlen Schädel entströmte. Ohne den Blick von der Irish Times abzuwenden, hielt ihm der Außenminister die Depesche hin.
»Was hat das zu bedeuten, Coram? Woher haben die das? Was tun wir jetzt dagegen, Mann?«
Joe las. Es handelte sich um einen Bericht, den die Jungs in der Bonner Botschaft über Nacht angefertigt hatten. Ganz oben stand die Übersetzung eines Artikels, der in einer westdeutschen Boulevardzeitung erschienen war, dem Acht Uhr-Blatt. Warum man in der Botschaft der Ansicht gewesen war, Frank Aiken müsse dringend informiert werden, war eindeutig, denn die Schlagzeile lautete: 1000 Kinder aus Irland verschwunden.
Die Zeitung hatte die komplette Jane-Russell-Affäre aufgedeckt. In dem Artikel war zu lesen, dass die kinderlose Hollywood-Schauspielerin nach Irland geflogen war, um einen irischen Jungen zu adoptieren. Es wurden Einzelheiten über die Vereinbarung mit Michael und Florrie Kavanagh aus Galway genannt, die zugestimmt hatten, dass Jane Russell ihnen den kleinen Tommy wegnahm, vermutlich gegen eine größere Summe. Und nun kam das Schlimmste: Es folgte eine erschreckend detaillierte Schilderung darüber, wie das irische Konsulat in London dem Kind einen Pass für die Ausreise nach New York ausgestellt hatte, ohne weitere Fragen zu stellen. Das – so hieß es in dem Artikel – sei der Beweis dafür, dass die irische Regierung den Verkauf und Export irischer Kinder billige. »Irland ist zum Jagdrevier für Millionäre aus dem Ausland geworden, die offenbar glauben, man könne Kinder nach Gutdünken kaufen, als seien sie Hunde mit Stammbaum. In den vergangenen Monaten haben Hunderte von Kindern Irland verlassen, ohne dass auf Anfragen seitens offizieller Stellen Auskunft bezüglich der künftigen Aufenthaltsorte der Kinder gewährt wurde.«
Aiken wischte sich die Stirn ab.
»So!«, sagte er. »Was ich jetzt von Ihnen brauche, Coram, ist ein umfassender Bericht – mit allen Details, ganz gleich, wie peinlich die auch sein mögen. Ich will sämtliche Einzelheiten, jeden Hinweis auf Fehlverhalten und jeden Beweis gegen den Erzbischof und diese Kirchenheinis. Ist das klar? Und zwar bis Freitag. Nun machen Sie schon!«
Das abendliche Treffen des Kirchenpolitik-Arbeitskreises war nervenaufreibend. Bis weit nach acht Uhr saß Joe dort fest und führte Protokoll. Die Mitglieder des Kabinetts waren nahezu vollzählig – sogar Eamon de Valera, der Premierminister, war während der hitzigen Debatten die meiste Zeit zugegen gewesen. Als Joe endlich wieder zu Hause in Glasnevin war, hatte Maire längst das Abendessen zubereitet, zugesehen, wie es kalt wurde, und die pappige Masse in den Abfall befördert.
»Da ist dein Abendessen, Joe Coram«, meinte sie lachend und wies auf den Eimer. »Dafür kannst du dich bei de Valera oder sonst wem bedanken, aber jetzt ist nichts mehr zu machen – heute Abend wirst du dich wohl mit einem Schmalzbrot begnügen müssen!«
Joe lächelte und legte seiner Frau einen Arm um die Taille. »Und wenn ich von nichts anderem als trockenem Brot leben müsste, würde ich mich trotzdem fühlen wie ein König, solange du nur bei mir bist, Liebes«, sagte er. »Es tut mir leid, dass du dir all die Mühe umsonst gemacht hast. Aber nachdem Frank und Dev erst einmal mit dem Thema Kirche, Nonnen und Pässe angefangen hatten, waren sie nicht mehr zu bremsen. Ich habe fünfundzwanzig Seiten voller Notizen, die ich bis Mittwoch entziffern muss. Und dann will Frank auch noch einen ausführlichen Bericht über diese Machenschaften, und das bis Ende der Woche. Ich muss dich also vorwarnen: Das war nicht der letzte lange Abend in diesem Monat, liebste Maire, und bestimmt nicht das letzte Essen, das im Müll landet.«
Maire tat, als wolle sie ihm einen Klaps geben, gab ihm jedoch stattdessen einen Kuss.
»Hast du schon einen Blick in die Evening Mail geworfen?«, fragte sie. Den Artikel über Jane Russell und die Anschuldigungen der deutschen Presse hatte sie bereitgelegt. »Solche Leute kennt man ja sonst nur aus dem Kino, und man denkt, die haben es sicher leichter im Leben, oder? Und dann sieht man, dass auch die ihre Sorgen haben.«
Joe nahm die Zeitung vom Küchentisch.
»Ich weiß schon Bescheid. Frank hat sofort jemanden zum Kiosk in der Merrion Street schicken lassen, um eine Ausgabe zu besorgen. Jane Russell ist übrigens nicht die Einzige. Sie haben Babys Pässe ausgestellt, als gäbe es kein Morgen mehr. Ab nach Amerika, obwohl keiner weiß, was dort aus ihnen wird.«
Maire sah ihren Mann an und wusste, dass er das Gleiche dachte wie sie: Seit drei Jahren waren sie nun schon verheiratet, und die Familie wurde allmählich ungeduldig.
»Vergiss Jane Russell«, sagte sie und gab ihm einen Kuss auf den Nacken. »Wir warten auch auf ein Baby, Joe Coram. Also beende dein Festmahl, und sieh zu, was wir da tun können.«
Drei
11. Juli 1952
Roscrea
Über Staatsaffären machte man sich an der Sean Ross Abbey, die eine Meile außerhalb des Städtchens Roscrea in der Grafschaft Tipperary lag, keinerlei Gedanken. Weder Nonnen noch Sünderinnen bekamen das Plakat mit Jane Russell als Satansweib vor dem Kino in Roscrea zu sehen. Weder Nonnen noch Sünderinnen lasen Zeitung, und das einzige verfügbare Radio hielt Mutter Barbara streng unter Verschluss. Die langen Tage in den Waschküchen und die langen Nächte in den Schlafsälen waren erfüllt von Gedanken an Gott – oder von Gedanken an ein früheres Leben.
Eine Mutter Oberin ließ man nicht einfach warten. Es war 9.00 Uhr, und Mutter Barbara hatte bereits die Messe besucht, ein karges Frühstück verzehrt und eine aufreibende halbe Stunde damit verbracht, ein paar unnötige und peinliche Einträge aus der doppelten Buchführung des Klosters zu bereinigen. Kopfschüttelnd sah sie auf die Uhr an der Wand ihres Büros, als jemand an die Tür klopfte. Schwester Annunciata eilte atemlos herein und entschuldigte sich für ihre Verspätung. Wie sehr sie diese wöchentlichen Treffen doch hasste – so sehr, dass sie jedes Mal zu spät kam.
»Ich bitte um Verzeihung, Mutter Oberin, aber es war ein turbulenter Morgen. Drei unserer Mädchen lagen letzte Nacht in den Wehen – bei einem hat es sieben Stunden gedauert –, wir haben fünf Neuzugänge, und …«
Mutter Barbara brachte Annunciata mit einer Geste zum Schweigen.
»Komm herein, und setz dich, Schwester. Dann kannst du mir alles in Ruhe erzählen. Aber der Reihe nach! Fang mit den Geburten an. Wie viele waren es in dieser Woche?«
»Also, die drei der letzten Nacht mitgerechnet, waren es sieben«, antwortete Annunciata, »darunter eine Steißgeburt, bei der ich letzten Samstag geholfen habe, und …«
»Danke, Schwester. Keine Einzelheiten. Gab es auch Totgeburten?«
Mutter Barbara machte sich Notizen und hob den Kopf, um sich zu vergewissern, dass Annunciata ihre Fragen sachgemäß beantwortete.
»Nein, Mutter Oberin, gottlob nicht. Aber noch mal zu dieser Steißgeburt, das Mädchen hat immer noch starke Schmerzen von all dem Gezerre, und ich wollte fragen, ob ich vielleicht den Schlüssel für das Magazin mit den Schmerzmitteln haben könnte, oder den Arzt rufen, damit er …« Verunsichert brach sie ab.
Mutter Barbara sah sie an und lächelte milde.
»Annunciata, offenbar hörst du mir nicht richtig zu. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass Schmerz eine Strafe für Sünde ist? Diese Mädchen haben gesündigt, und dafür müssen sie büßen. Also weiter, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Wie viele Neuzugänge haben wir insgesamt, und wie viele Abgänge?«
Annunciata nannte ihr die Zahlen, und Mutter Barbara trug sie in das Bestandsbuch ein. Sie überschlug die Einträge. »Einhundertzweiundfünfzig, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Einhundertzweiundfünfzig gottverlassene Seelen, die sich glücklich schätzen können, dass wir uns ihrer annehmen.«
Annunciata wollte noch etwas sagen, aber Mutter Barbara schnitt ihr das Wort ab.
»Sehr schön, mein Kind. Heute Vormittag schickst du mir die Neuankömmlinge. Und heute Nachmittag die neuen Mütter. Weißt du zufällig, ob irgendeine genug Geld hat, um zu bezahlen?«
Das konnte Schwester Annunciata nur bezweifeln. Denn hundert Pfund waren eine stolze Summe.
An diesem Tag empfing Mutter Barbara zwölf Mädchen. Mit gefalteten Händen hörte sie sich geduldig die Geschichte jedes einzelnen an. Sie hielt sich keineswegs für unbarmherzig – die Kirche verpflichtete zu Wohltätigkeit, und durch ihre Arbeit kam sie dieser Schuldigkeit nach. Mutter Barbara war sich zudem absolut sicher, dass sie zwischen Gut und Böse unterscheiden konnte, und ihrer Ansicht nach war Fleischeslust die schlimmste aller Sünden, daran bestand nicht der geringste Zweifel.
Angesichts der Schande, die sie auf sich geladen hatten, stammelten und erröteten die Mädchen, während Mutter Barbara sie dazu anhielt, keine Einzelheit auszulassen, und ihnen schließlich dieselbe Frage stellte, mit der sie bereits Generationen junger Frauen konfrontiert hatte: »Und nun, mein Kind, sag mir, waren die fünf Minuten Vergnügen den ganzen Ärger wert?«
Philomena – oder Marcella, wie sie nun hieß – wurde am späten Nachmittag zu Mutter Barbara zitiert. Sechs Tage waren seit der Entbindung vergangen, und sie litt noch immer unter den Folgen der Steißgeburt, aber die Wöchnerinnenzeit war vorüber, und die Regeln des Klosters erlaubten keine weitere Schonfrist. Mit vor Angst halberstickter Stimme beantwortete sie die Fragen der Mutter Oberin. Als sie ihren Namen nennen sollte, sagte sie: »Marcella«, woraufhin Mutter Barbara sie mit einem geringschätzigen Blick bedachte.
»Ich meinte nicht deinen hiesigen Namen, Mädchen, sondern deinen richtigen.«
»Philomena, Mutter Oberin. Philomena Lee.«
»Geburtsdatum und Geburtsort?«
»Vierundzwanzigster März 1933, Mutter Oberin, in Newcastle West, County Limerick.«
»Dann warst du also schon achtzehn Jahre alt, als du gesündigt hast. Alt genug, um es besser zu wissen.«
Bis zu diesem Zeitpunkt war es Philomena gar nicht in den Sinn gekommen, dass sie eine Sünde begangen hatte, doch ungeachtet dessen nickte sie.
»Eltern?«
»Meine Mutter ist tot, Mutter Oberin. An Tuberkulose gestorben, da war ich sechs. Daddy ist Metzger.«
»Wer hat sich dann um euch Kinder gekümmert? Euer Vater?«
»Nein, Mutter Oberin. Wir waren zu sechst, und er konnte sich nicht um uns alle kümmern. Deshalb brachte er mich und Kaye und Mary in eine Klosterschule. Ralph, Jack und der kleine Pat blieben bei ihm zu Hause.«
»Welche Schule war das, mein Kind?«
»Die der Barmherzigen Schwestern, Mutter Oberin. Mount St Vincent in Limerick. Dort haben wir auch gewohnt, nur im Sommer sind wir für zwei Wochen nach Hause gekommen. Zwölf Jahre lang waren wir da, auch Weihnachten und Ostern, und Daddy und Jack haben uns nur ein paarmal besucht. Wir waren viel allein, Mutter Oberin …«
Mutter Barbara winkte ungeduldig ab.
»Genug davon. Was ist passiert, nachdem du die Barmherzigen Schwestern verlassen hast?«
»Ich bin zu meiner Tante gezogen.«
Philomena senkte den Blick und sprach so leise, dass sie kaum noch zu hören war.
»Und wie heißt deine Tante?«
»Kitty Madden, Mutter Oberin, sie ist Mammys Schwester in Limerick.«
»Wie lange hast du bei deiner Tante gewohnt?«
Philomena überlegte und sah hinauf zur Decke, während sie sich die Fakten ihres kurzen Lebens ins Gedächtnis rief.
»Also, ich habe … Letztes Jahr im Mai war ich mit der Schule fertig. Die Kinder meiner Tante waren schon aus dem Haus, und sie wollte, dass ich bei ihr wohne, damit ich ihr zur Hand gehen kann. Da habe ich John kennengelernt, im Oktober, beim Jahrmarkt in Limerick, also …«
Aber noch wollte Mutter Barbara all das nicht wissen.
»Deine Tante, Mädchen. Als was arbeitet sie? Ist sie wohlhabend?«
»Nein, ich glaube nicht, Mutter Oberin. Sie arbeitet bei den Nonnen in St Marys. Und sie hat mir da auch eine Stelle besorgt – Staub wischen, saubermachen und solche Sachen …«
Mutter Barbara, die einsah, dass es wenig Zweck hatte, sich weiter mit den finanziellen Verhältnissen dieser Familie zu befassen, kam auf ihr bevorzugtes Thema zurück.
»Und obwohl deine Tante einen solch engen Bezug zur Kirche hat, konnte sie dich nicht davor bewahren, zu sündigen? Wie ist das möglich? Bist du derart der Sünde verfallen, dass du diejenigen zu täuschen vermagst, denen an deinem Seelenheil gelegen ist?«
Philomena wurde kreidebleich und musste heftig schlucken.
»Aber nein, Mutter Oberin! Ich bin nie der Sünde verfallen …«
»Warum hast du deine Tante dann hintergangen?«
»So war es nicht! Meine Tante wusste, dass ich zum Jahrmarkt gehen wollte. Sie hatte eine Freundin zu Besuch und sagte: ›Geh nur.‹ Und dann bin ich losgezogen … und dann … na ja … dann ist es passiert.«
Mutter Barbara schnaubte verächtlich.
»Was meinst du mit ›es‹, Mädchen? Du hast keine Scham empfunden, als du gesündigt hast, also solltest du wohl auch keine Scham empfinden, wenn du es mir erzählst!«
Philomena dachte zurück an den Abend auf dem Jahrmarkt und suchte nach einer Möglichkeit, Mutter Barbara begreiflich zu machen, was geschehen war, doch die Worte blieben ihr im Halse stecken.
»Er … er sah gut aus, Mutter Oberin, und er war nett zu mir.«
»Soll das heißen, du hast ihn zur Sünde verleitet? Hast du freiwillig zugelassen, dass er Hand an dich legt?«
Philomena zögerte, dann sagte sie leise: »Ja, Mutter Oberin, das habe ich.«
Mutter Barbaras Miene verdüsterte sich. Mit betont sanfter Stimme fragte sie: »Und hast du dabei Vergnügen empfunden? Hat deine Sünde dir Vergnügen bereitet?«
Philomena stiegen Tränen in die Augen, und ihre nächsten Worte klangen für sie selbst, als kämen sie von weit entfernt.
»Ja, Mutter Oberin.«
»Und sag mir, Kind, hast du deine Unterhose ausgezogen?«
Philomena fing an zu weinen.
»Ach, Mutter Oberin, mir hatte doch niemand davon erzählt. Niemand hat je mit mir über Babys gesprochen. Davon haben auch die Schwestern niemals etwas gesagt …«
In Mutter Barbara wallte Zorn auf.
»Untersteh dich, die Barmherzigen Schwestern zu beschuldigen!«, rief sie empört. »Diese Schande hast du dir selbst zuzuschreiben. Deiner sinnlichen Begierde und deinem unsittlichen Verhalten!«
»Es ist alles so ungerecht«, schluchzte Philomena. »Warum ist meine Mammy tot? Warum hat sich niemand um uns gekümmert? Nie hat uns jemand in den Arm genommen …«
Angewidert sah Mutter Barbara Philomena an.
»Still jetzt! Was geschah, als du von dem Jahrmarkt zurückkamst?«
Philomena wischte sich die Tränen ab und zog die Nase hoch. Der Abend war ihr noch bestens in Erinnerung …
Sie war erst nach Mitternacht wieder zu Hause, doch ihre Tante hatte voller Argwohn auf sie gewartet. Zunächst hatte Philomena ihre Vorwürfe lachend abgetan und gesagt, sie brauche sich nicht aufzuregen. Es sei nichts passiert, sie habe sich lediglich mit ein paar Freundinnen einen schönen Abend gemacht. Aber ihrer Tante war längst aufgefallen, dass sie nach Bier roch, und auch ihre geröteten Wangen waren ihr nicht entgangen. Sie ließ nicht locker und drohte mit allen möglichen Strafmaßnahmen, wenn Philomena nicht endlich die Wahrheit sagte.
Und so erzählte ihr Philomena schließlich alles.
Ja, es stimmte, sie hatte einen jungen Mann kennengelernt – nett, groß, gutaussehend. Aber davon wollte Tante Kitty nichts hören. »Was habt ihr getan? Worauf hast du dich eingelassen?«
»Auf gar nichts, Tante. Er hat meine Hand gehalten. Er ist der netteste Mann, den man sich nur vorstellen kann. Wir haben uns für Freitag verabredet, er wartet an der Ecke von …«
Philomena bekam eine Ohrfeige.
»Er kann warten, bis er schwarz wird. Du wirst dich nicht mit irgendeinem Mann treffen. Nicht, solange du unter meinem Dach lebst!«
Philomenas Wange brannte vor Schmerz, und Tränen stiegen ihr in die Augen.
»Aber warum denn nicht, Tante Kitty? Ich habe es doch versprochen. Ich liebe ihn …«
Von Liebe wollte Philomenas Tante schon lange nichts mehr wissen. Damit hatte sie vor Jahren abgeschlossen, und wenn es nach ihr ging, brauchte ihre Nichte gar nicht erst damit anzufangen.
Sie verbannte Philomena in ihr Zimmer, und dort sollte sie bleiben, bis sie sich ihre Flausen aus dem Kopf geschlagen hatte. Sollte dieser dumme Junge vom Postamt doch warten, solange er wollte … und wieder verschwinden.
Für Philomena war es die reinste Qual, in ihrem Zimmer zu hocken, schließlich wusste sie, dass er auf sie wartete.
Zehn Tage später gab sie klein bei.
Nie wieder würde sie so lange ausbleiben, beteuerte sie, sich nie wieder mit jemandem unterhalten, außer mit den Mädchen, die sie von der Schule kannte, und vor allen Dingen würde sie niemals wieder versuchen, den jungen Mann vom Postamt zu treffen.
In den folgenden zwei Wochen schmiedete sie jedoch alle möglichen Pläne. Sie wollte davonlaufen und ihn ausfindig machen. Doch ihre Tante behielt sie wachsam im Auge. Sie wusste, welch inneren Aufruhr Leidenschaft hervorrufen konnte, und sie ließ ihre Nichte nicht aus dem Haus.
Einige Wochen später sah man Philomena bereits die Schwangerschaft an, und alles Staunen, alle Reue halfen nichts – ihre Tante ließ sich nicht besänftigen. Aus der Kirche wusste Philomena, dass es eine Sünde war, sich unverheiratet mit einem Mann einzulassen. Aber dass dabei auch Babys entstehen konnten – das hatte sie nicht gewusst.
»Und was hat deine Tante daraufhin getan?«, erkundigte sich Mutter Barbara.
Philomena schauderte beim Gedanken an die schrecklichen Wochen.
»Sie hat meinen Bruder Jack und meinen Vater angerufen. Ich glaube, eigentlich wollte sie, dass mein Vater sie heiratet. Er war ja allein, und sie auch. Aber Dad mochte nichts davon wissen. Dann ging sie mit mir zu einem Arzt in Limerick, und der hat gesagt, ich muss nach Roscrea. So bin ich vor zwei Monaten hierhergekommen.«
Mutter Barbara machte eine ungeduldige Handbewegung.
»Was hat dein Vater gesagt? Soweit ich weiß, hat er dich noch nie hier besucht.«
Philomena biss sich auf die Lippen, denn diese Frage schmerzte ganz besonders.
»Mein Vater hat Mitleid mit mir, Mutter Oberin. Ganz bestimmt. Aber er konnte niemandem erzählen, was mir passiert war, nicht einmal meinen Geschwistern. Kaye und Mary glauben, ich wäre nach England gegangen. Meine Mammy fehlt mir so, ich will nach Hause …«
In Philomenas Gesicht spiegelte sich die Verlassenheit, die hunderte Mädchen in Roscrea und ganz Irland erfahren mussten. Verbannt wegen einer Sünde, die ihnen kaum bewusst war, waren die meisten von ihnen fast noch Kinder und hatten unter der grausamen Härte der Erwachsenen zu leiden.
Mutter Barbara hatte Philomenas Geschichte in ihrem Bestandsbuch notiert und beendete nun das Gespräch.
»Du gehst jetzt zurück in den Schlafsaal, Marcella. Wir sind hier nicht in einem Ferienlager, und was wir von dir erwarten, ist harte Arbeit. Du musst hierbleiben und für deine Sünden büßen. Es sei denn, du kannst hundert Pfund aufbringen. Glaubst du, deine Familie hat so viel Geld?«
Mit leerem Blick sah Philomena Mutter Barbara an.
»Ich weiß es nicht, Mutter Oberin. Aber wenn mein Dad noch nicht bezahlt hat, heißt das wohl, dass er so viel Geld nicht hat.«
Vier
Roscrea
In den Wochen nach Anthonys Geburt begriff Philomena allmählich, was es bedeutete, in Sean Ross zu leben. Die Aussichten waren alles andere als rosig.
Wie die meisten Heime für ledige Mütter in Irland gehörte auch dieses zu einem alten Kloster. Die Schwestern der Heiligsten Herzen Jesu und Marias hatten das Gebäude 1931 bezogen: Es war ein imposantes georgianisches Herrenhaus mit weitläufigen Rasenflächen und einem Garten, der von dicken Mauern umgeben war. Die Ruine der mittelalterlichen Abtei stand noch, und auf dem kleinen gepflegten Friedhof hatten einige der Nonnen ihre letzte Ruhestätte gefunden. Mütter und Säuglinge, die hier starben, wurden ohne Grabstein auf der benachbarten Weide beerdigt.
Neben dem Kloster, abgeschieden von der Außenwelt, stand ein weiteres Gebäude – ein trostloser Betonklotz. Offenbar war die Kirche der Ansicht, Sünderinnen verdienten weder Komfort noch eine angenehme Umgebung. Im Inneren des Gebäudes lagen die Schlafsäle: einer für die werdenden Mütter, einer für die Wöchnerinnen und einige weitere für diejenigen, deren Kinder im angrenzenden Hort untergebracht waren.
Ebenso wie die anderen Mädchen wurde auch Philomena für die kommenden drei Jahre hier einquartiert. Sie war eine von vielen in einem der Einzelbetten, die entlang der cremefarbenen Wände aufgereiht waren. Über jedem Kopfende hing eine kleine Marienstatue. Die quadratischen Fenster an beiden Enden des Raums lagen so weit oben, dass es selbst bei Sonnenschein düster war.
Die Mädchen hatten ihre eigene Kleidung am Tag ihrer Ankunft abgegeben, denn in Sean Ross trugen alle die gleichen einfachen Baumwollkittel und klobige Holzpantinen. Das Haar wurde ihnen kurz geschoren, um Läusebefall vorzubeugen, und auf dem Kopf trugen sie fortan gehäkelte Käppchen.
Miteinander zu sprechen, ihre wirklichen Namen zu nennen, oder zu erzählen, woher sie kamen, war den Mädchen untersagt. Sie waren »weggeschickt worden« – so die offizielle Sprachregelung –, um ihren Familien und der Gesellschaft die Schande zu ersparen. Nur wenige bekamen jemals Besuch von Verwandten, die Väter der Kinder ließen sich überhaupt nicht blicken.
Morgens um sechs Uhr wurden die jungen Mütter vom Aushilfspersonal geweckt und in den Kinderhort gebracht, damit sie noch vor der Morgenandacht ihre Babys versorgen konnten. Nach der Messe hatten sie sich zu ihren Arbeitsstellen zu begeben: in die Küche, in den Kinderhort oder in die Wäscherei. Die Arbeit in der Küche war begehrt, denn obwohl man stundenlang schuften musste, fiel hin und wieder ein Bissen ab, mit dem sich die ansonsten mageren Rationen aufstocken ließen. Wer zur Arbeit im Hort eingeteilt war, wurde von Kinderschwestern in langen weißen Ordensgewändern und von Aushilfen beaufsichtigt. Tag und Nacht mussten die Mädchen Windeln wechseln, die kleinen Kinder waschen und dafür sorgen, dass sie von ihren Müttern gestillt wurden. Um Säuglingsnahrung zu sparen, hatten die Nonnen verfügt, dass die Babys mindestens ein Jahr lang ausschließlich Muttermilch bekamen, oftmals sogar länger.
Am unbeliebtesten war die Arbeit in der Wäscherei – die man auch Philomena zugewiesen hatte. Tag für Tag stand sie dort stundenlang mit den anderen Mädchen in einem düsteren, stickigen Raum vor dampfenden Zubern, rührte mit einem schweren Holzlöffel die Wäsche und wrang sie mit den Händen aus, während erschöpfte, schwitzende Frauen bergeweise weitere verschmutzte Laken, Ordensgewänder und Kittel brachten – nicht nur aus Sean Ross, sondern auch aus Krankenhäusern und Schulen der Umgebung. Die Nonnen behaupteten, das Schrubben und Auswringen der Wäsche symbolisiere das Reinwaschen der Seele, doch darüber hinaus war die Wäscherei für das Kloster ein einträgliches Geschäft.
Ihre kurze Mittagspause durften die Mädchen mit ihren Kindern verbringen. Abends mussten sie die Fußböden des Klosters schrubben, und nach dem Abendessen folgte eine Stunde Handarbeit, während der die jungen Mütter Kleidung für die Kinder stricken oder nähen mussten. Es gab weder Radio noch Bücher, dennoch freuten sich die Mädchen auf die Abendstunden. Sie durften sich in den Schlafsaal oder in den Aufenthaltsraum setzen und ihren Kindern nahe sein – was sich letztlich als grausamer erwies, als wenn von vornherein keinerlei Kontakt zugelassen gewesen wäre.
Fünf
Dublin
Während Philomena in der Wäscherei schuftete, wurde sich die irische Regierung allmählich eines Problems bewusst, das man lange zu ignorieren versucht hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!