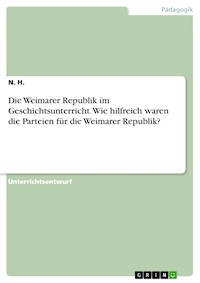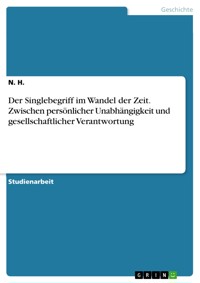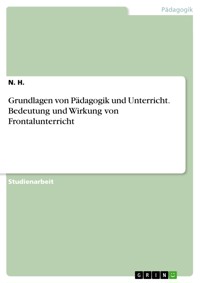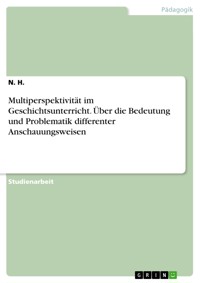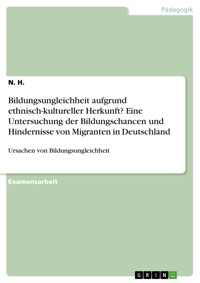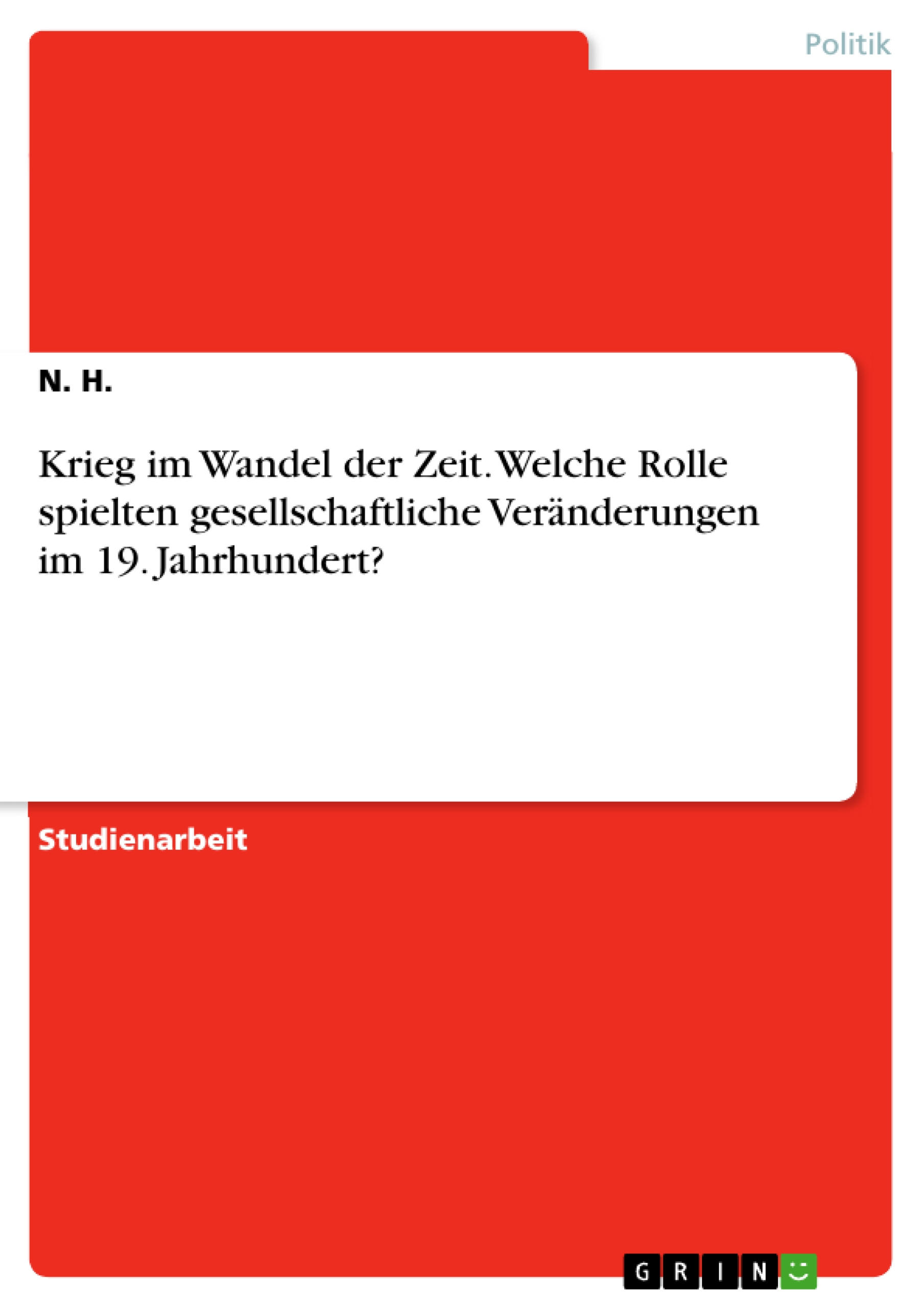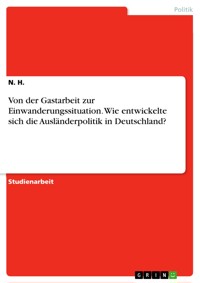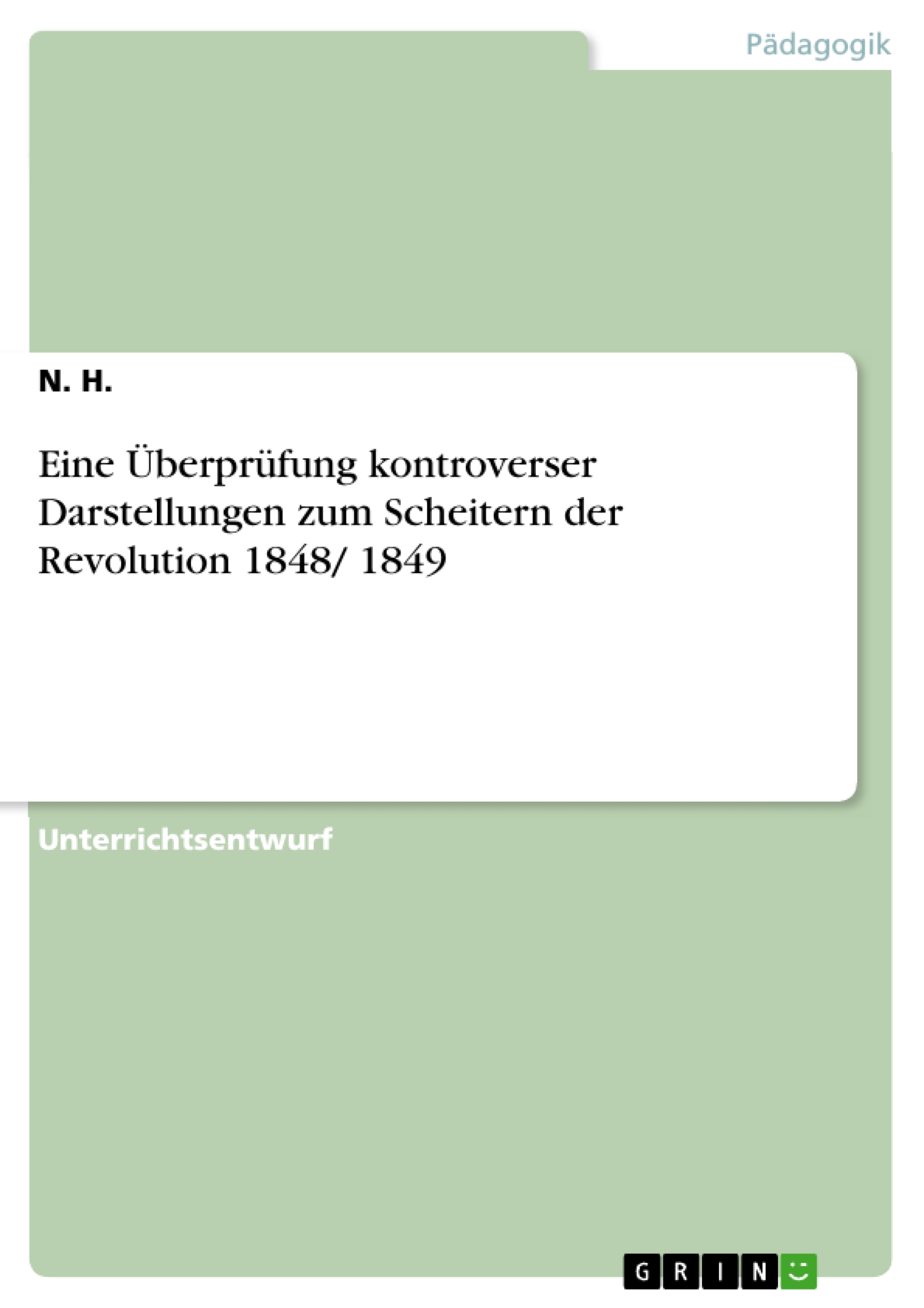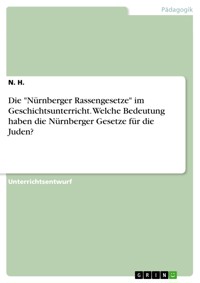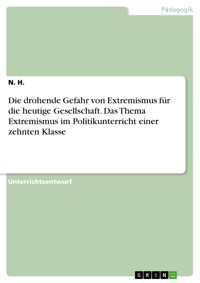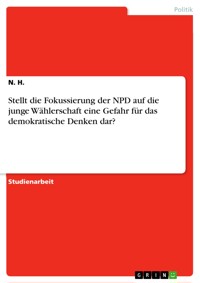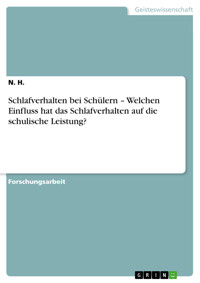Plastiktüten: Verbot oder Zwangsabgabe? Beeinflussung wirtschaftlichen Handelns (EF Sozialwissenschaft, Gymnasium / Gesamtschule) E-Book
N. H.
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Sozialwissenschaften allgemein, Note: 1,3, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Unterrichtsziel: Die SuS bilden ein eigenes Urteil, indem sie kontroverse Standpunkte zur Problematik Plastiktüte kennenlernen, anschließend die Inhalte unterschiedlicher Standpunkte erarbeiten und die Argumentationen in Form eines Streitgespräches gegenüberstellen. Die SuS lernen die kontroverse Debatte zur Problematik Plastiktüte kennen, indem sie mittels eines Zitates die Frage nach einem „Verbot“ oder einer „Zwangsabgabe“ für Plastiktüten erarbeiten. Die SuS erarbeiten zunächst in Einzel- und anschließend in Partnerarbeit jeweils einen Standpunkt, formulieren Argumente ggf. mögliche Gegenargumente und bereiten sich auf das Streitgespräch vor. Die SuS diskutieren mittels eines Streitgespräches, bei dem die Argumentationen beider Seiten gegenüberbestellt werden. Abschließend bilden sie auf Grund der Argumente ein eigenes Urteil. Plastiktüten sind besonders beim Einkaufen allgegenwärtig. Sie sind so selbstverständlich, dass sie in Einkaufsläden kaum bzw. gar nicht wahrgenommen werden. Erst wenn sie in der Natur auftauchen, verdeutlicht sich das Problem. So kann der alltägliche Umgang mit der Plastiktüte auch als Symbol der sogenannten Wegwerfgesellschaft gelten. Daher ist das Verhalten von Händlern und Konsumenten ein Teil der Problematik und muss berücksichtigt werden, wenn es um Lösungsansätze geht. Der ungehemmte Ge- und Verbrauch von Einwegplastiktüten stellt für Europa, aber auch weltweit, ein beträchtliches Umweltproblem dar. Sie werden massenhaft produziert und meist kostenlos durch Handelsunternehmen herausgegeben, jedoch wird ein Großteil davon nicht umweltfreundlich entsorgt. Dadurch sammeln sich die Tüten in der Landschaft und insbesondere im Meer an und werden zu einer Gefahr für die Tierwelt. Verschluckte Plasteteile führen zur Anreicherung von Giftstoffen im Gewebe der Tiere. Erkrankungen, erhöhte Sterblichkeit und eingeschränkte Fortpflanzung sind die Folgen, und zwar nicht nur für die Tiere. Durch den Verzehr von Fischen wird Plastikmüll auch für den Menschen zum Gesundheitsrisiko.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Formalia
2. Stunden- und Reihenthema
3. Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe
4. Angestrebte Lernziele
5. Zentrale methodisch-didaktische Begründungen
5.1 Curriculare Legitimation
5.2 Begründung der Auswahl des Inhalts
5.3 Sachanalyse
5.4 Lerngruppenanalyse
5.5 Unterrichtsmethodische Entscheidungen
6. Stundenverlaufsplan
7. Antizipiertes Tafelbild
Vorderseite
Rückseite
8. Literaturverzeichnis
Anhang
Arbeitsblätter
Rollenkarten
Argumentationszettel
1. Formalia
2. Stunden- und Reihenthema
3. Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe
4. Angestrebte Lernziele
Stundenziel:
Die SuS bilden ein eigenes Urteil, indem sie kontroverse Standpunkte zur Problematik Plastiktüte kennenlernen, anschließend die Inhalte unterschiedlicher Standpunkte erarbeiten und die Argumentationen in Form eines Streitgespräches gegenüberstellen.
Teilziele:
Die SuS lernen die kontroverse Debatte zur Problematik Plastiktüte kennen, indem sie mittels eines Zitates die Frage nach einem „Verbot“ oder einer „Zwangsabgabe“ für Plastiktüten erarbeiten.
Die SuS erarbeiten zunächst in Einzel- und anschließend in Partnerarbeit jeweils einen Standpunkt, formulieren Argumente ggf. mögliche Gegenargumente und bereiten sich auf das Streitgespräch vor.
Die SuS diskutieren mittels eines Streitgespräches, bei dem die Argumentationen beider Seiten gegenüberbestellt werden. Abschließend bilden sie auf Grund der Argumente ein eigenes Urteil.
Kompetenzbeiträge
Handlungskompetenz:
-SuS führen unter Anleitung eine Diskussionsrunde, dabei sollen sie eigene Argumente präsentieren und begründen sowie Gegenargumente akzeptieren bzw. widerlegen.
5. Zentrale methodisch-didaktische Begründungen
5.1 Curriculare Legitimation
Die vorliegende Stunde wird in einem Kurs Sozialwissenschaft in der Einführungsphase durchgeführt. Eingebettet ist die Stunde in die Reihe „Werden wirtschaftliche Entscheidungen beeinflusst? – Erklärung des wirtschaftlichen Handelns“. Diese ist sowohl durch den Lehrplan (alt)[1] / Kernlehrplan (neu)[2] als auch durch das schulinterne Curriculum[3] legitimiert. Besonders die Inhaltsfelder I (Marktwirtschaft: Produktion, Konsum, Verteilung) und IV (Wirtschaftspolitik) kommen in dieser Unterrichtsreihe zum Tragen. Ein Schwerpunkt wurde dabei auf die „Grenzen des Marktsystems: Konzentration, Krisen, ökologische Fehlsteuerung“ gelegt Lehrplan (alt).[4]
5.2 Begründung der Auswahl des Inhalts
Ziel der Reihe soll es sein, den SuS ein Grundverständnis ökonomischer Zusammenhänge, Einflüsse und Interessenlagen in einer marktwirtschaftlichen geprägten Wirtschaftsordnung zu vermitteln, um somit Urteilskompetenz zu erzeugen, die notwendig ist, um aktuelle tagespolitische Wirtschaftsthemen und -fragen verstehen und beurteilen zu können. Vermittelt wurden in der Unterrichtsreihe ökonomische Prinzipien, Theorien und Modelle, die zentral für das Grundverständnis ökonomischer Abläufe sind. Zudem sollen die SuS die wechselseitige Beziehung zwischen Wirtschaft und Konsument erkennen, Einflussfaktoren für das wirtschaftliche Handeln kennenlernen und ihr eigenes Konsumverhalten reflektieren, da die Erziehung zu einem mündigen (Verbrauchs-)Bürger[5] die Aufgabe des sozialwissenschaftlichen Unterrichts ist. Retzmann bringt es auf den Punkt, indem er sagt: „Ökonomische Bildung kulminiert in der individuellen Fähigkeit, ‚zum eigenen Wohl wie auch zum Wohle Aller ökonomisch urteilen, argumentieren, entscheiden und handeln’ zu können.“[6]
In der letzten Unterrichtsstunde lag der Fokus auf der Erarbeitung der „Problematik von Plastikmüll“ und führte dementsprechend zu folgendem Kompetenzbeitrag (entlehnt aus dem neuen Kernlehrplan): Die SuS erklärten Grenzen der Leistungsfähigkeit des Marktsystems im Hinblick auf Konzentration und Wettbewerbsbeschränkungen, soziale Ungleichheit, Wirtschaftskrisen und ökologische Fehlsteuerungen [Sachkompetenz].[7] In der vorliegenden Stunde geht es um die vorgestellte Lösung des „Plastiktüten-Problems“ und welche sie im Hinblick auf den Kompetenzbeitrag der Reihe folgendes leisten soll: Die SuS praktizieren im Unterricht unter Anleitung Formen demokratischen Sprechens und demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen dabei Verantwortung für ihr Handeln [Handlungskompetenz].[8] Aufbauend darauf führt dies zu folgendem Kompetenzbeitrag: Die SuS erörtern die eigenen Möglichkeiten zu verantwortlichem, nachhaltigem Handeln als Konsumentinnen und Konsumenten [Urteilskompetenz].[9]
5.3 Sachanalyse
Plastiktüten sind besonders beim Einkaufen allgegenwärtig. Sie sind so selbstverständlich, dass sie in Einkaufsläden kaum bzw. gar nicht wahrgenommen werden. Erst wenn sie in der Natur auftauchen, verdeutlicht sich das Problem. So kann der alltägliche Umgang mit der Plastiktüte auch als Symbol der sogenannten Wegwerfgesellschaft gelten. Daher ist das Verhalten von Händlern und Konsumenten ein Teil der Problematik und muss berücksichtigt werden, wenn es um Lösungsansätze geht.
Der ungehemmte Ge- und Verbrauch von Einwegplastiktüten stellt für Europa, aber auch weltweit, ein beträchtliches Umweltproblem dar. Sie werden massenhaft produziert und meist kostenlos durch Handelsunternehmen herausgegeben, jedoch wird ein Großteil davon nicht umweltfreundlich entsorgt. Dadurch sammeln sich die Tüten in der Landschaft und insbesondere im Meer an und werden zu einer Gefahr für die Tierwelt. Verschluckte Plasteteile führen zur Anreicherung von Giftstoffen im Gewebe der Tiere. Erkrankungen, erhöhte Sterblichkeit und eingeschränkte Fortpflanzung sind die Folgen, und zwar nicht nur für die Tiere. Durch den Verzehr von Fischen wird Plastikmüll auch für den Menschen zum Gesundheitsrisiko.[10]
Aufgrund der Problematik will die Kommission der Europäischen Union dafür sorgen, dass EU-weit in Zukunft weniger Plastiktüten verbraucht werden. Am 4. November 2013 wurde daraufhin ein Vorschlag zur Änderung der entsprechenden EU-Gesetzgebung vorgestellt. Die Mitgliedstaaten sollen verpflichtet werden, den Verbrauch von besonders dünnen Kunststoff-Tragetaschen zu reduzieren.[11] Die EU-Mitglieder sollen zu diesem Zweck zum Beispiel Abgaben einführen können. Die EU-Kommission führt Irland als positives Beispiel, im Hinblick auf eine Reduzierung des Verbrauches, an. Das Land hat eine Abgabe auf den Vertrieb von Plastiktüten von 22 Cent je Tüte eingeführt und so 2010 den Verbrauch pro Einwohner von 328 auf 18 Plastiktüten reduziert.[12]
5.4 Lerngruppenanalyse
Leistungsvermögen und Arbeitshaltung.Ich habe diesen EF-Kurs in Sozialwissenschaften bereits zu Beginn meines Referendariats im Ausbildungsunterricht kennengelernt. Seit Beginn des zweiten Halbjahres konnte ich den Kurs eigenständig unterrichten. Durch diese lange Zeit der gemeinsamen Lehr-Lern-Situation ist ein gewisses Vertrauensverhältnis entstanden, was sich im Unterricht zeigt. So haben die SuS sich mittlerweile an mich als Lehrperson sowie auch an meinen Unterrichtsstil gewöhnt. Die Schüleraktivität ist sukzessiv angestiegen und gegenwärtig im Allgemeinen als mittelmäßig bis hoch einzuschätzen. Der Kurs ist vom Leistungsvermögen deutlich heterogen, sowohl bezüglich der Mitarbeit, im Umgang mit Sachtexten als auch hinsichtlich des wirtschaftspolitischen Verständnisses. Die genannten analytischen Aspekte der Lerngruppe sollen im folgenden Unterkapitel ihre Berücksichtigung finden.
5.5 Unterrichtsmethodische Entscheidungen
Im Folgenden wird auf die Wahl der Sozialform (PA) und die Methode des Streitgespräches eingegangen.
Die Entscheidung der Sozialform (PA) beruht einerseits auf den Lernchancen, denn aus lernpsychologischer Sicht ist Partnerarbeit besonders wertvoll, wenn ihr eine Einzelarbeitsphase vorgeschaltet wird. Die Partner sprechen miteinander und lernen im Prozess der kommunikativen Anwendung besonders intensiv. Weiterhin agieren sie hier in einem sogenannten Schonraum, indem Partner oft konzentrierter arbeiten als in Gruppen. Des Weiteren befinde ich die gewählte Sozialform Partnerarbeit sinnvoll, um das Verständnis des Textes am Ende der Erarbeitungsphase abzusichern.[13] Andererseits habe ich mich wegen negativer Erfahrungen in dem Kurs sowie aus organisatorischen Gründen gegen die Sozialform (GA) entschieden, da der gewünschte Lernertrag meiner Meinung nach nicht gegeben ist.
Für das Streitgespräch habe mich aus folgenden Gründen entschieden. So „verwirklichen sich [im Streitgespräch] grundlegende Prinzipien und Ziele der politischen Bildung. Durch die methodisch arrangierte Multiperspektivität wird das didaktische Prinzip der ‚Kontroversität‘ zum grundlegenden Charakteristikum dieser Interaktionsform.“[14] Aufbauend auf der Aussage lässt sich folgendes über die Methode sagen: Das primäre Ziel stellt demnach die Stärkung der politischen Urteilsfähigkeit der SuS dar. Hinzu kommen noch die Förderung der Empathie- und Argumentationsfähigkeit.
In der Ausgestaltung der Phasen und Auswahl der Materialien habe ich versucht, den Kriterien des Beutelsbacher Konsenses zu folgen. Das Überwältigungsverbot wird durch die Darstellung verschiedener, konträrer Positionen und der Bildung eines selbstständigen Urteils erfüllt. Anhand einer kontroversen Debatte wird das „Streitthema“ von zwei gegensätzlichen Positionen betrachtet. Damit wird das Kontroversitätsgebot eingehalten. Die SuS analysieren für die Diskussion jeweils einen Standpunkt und sollen in der Auswertung/Abstimmung ein eigenes Interesse erkennen und formulieren können.[15]
Zusammengefasst kann die Methode bestenfalls folgendes leisten: Die Schüler entwickeln/verbessern ihre Empathiefähigkeit[16], weil sie sich mittels der Methode in andere Perspektiven hineindenken müssen. Des Weiteren lernen sie „politisch zu streiten“, indem sie einen eigenen Standpunkt durch Argumente vertreten, sich Gegenargumente anhören und abwägen und abschließend ein Urteil bilden. Folglich werden die Argumentationsfähigkeit und die Urteilsbildung der SuS gefördert.[17]
Anzumerken ist noch, dass die Methode des Streitgespräches bereits zweimal im Unterricht angewandt wurde und die SuS daher bereits mit dem grundlegenden Ablauf vertraut sind. Aufgrund der Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge der SuS nach dem letzten Streitgespräch habe ich mich diesmal für jeweils drei Redner pro Seite, also insgesamt sechs Disputanten, entschieden. Des Weiteren werden zwei Moderatoren das Streitgespräch mit Hilfe von Rollenkarten leiten. Die Aufgabe der Moderatoren ist unter anderem die Einhaltung der Gesprächsregeln und –dauer. Die Sicherung der Argumente wird von zwei weiteren SuS vorgenommen, jedoch werden die Argumentationen zunächst auf der Rückseite der Tafel festgehalten. Der Grund für diese Entscheidung liegt darin begründet, dass die Beobachter zuhören sowie die Argumente der Gegenseite notieren sollen. Würden die gesicherten Argumente an der Tafel bereits von Anfang an für die Beobachter ersichtlich sein, bestünde die Gefahr, dass die SuS „abschalten“ und lediglich die Argumente von der Tafel übernehmen.
6. Stundenverlaufsplan
[18]
7. Antizipiertes Tafelbild
Vorderseite
8. Literaturverzeichnis
Gammelin, Cerstin: Gebeutelte Plastiktüten, in: Süddeutsche Zeitung 17.04.2014 (abgerufen 28.05.2014).
Gänger, Sven: Streitgespräch Pro/Kontra, in: Reinhardt, Sibylle u.a. (Hg.): Politik Methodik, Berlin 2007.
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen, Sozialwissenschaften, Düsseldorf 2013.
Kuhn, Hans Werner u.a. (Hg.): Die pro-Contra-Debatte, in: Methodentraining I für den Politikunterricht, Bonn 2007.
Mattes, Wolfgang: Methoden für den Unterricht, Paderborn 2011.
Meeresmüllkonferenz in Berlin:Umweltbundesamt will Zwangsabgabe auf alle Plastiktüten, in:Spiegel-Online, 17.4.2014 (abgerufen 28.05.2014).