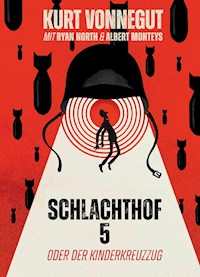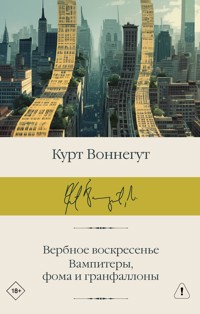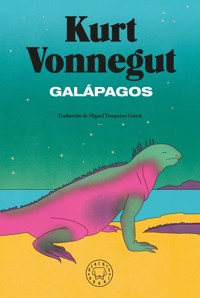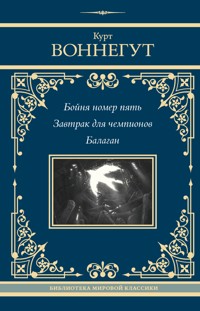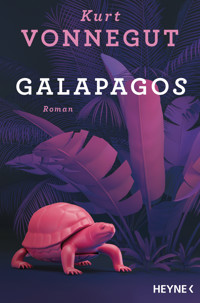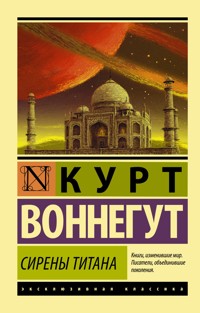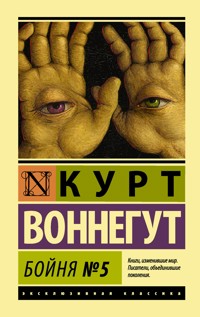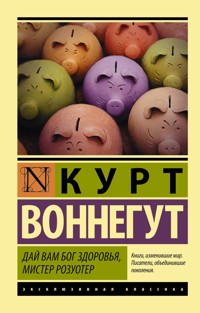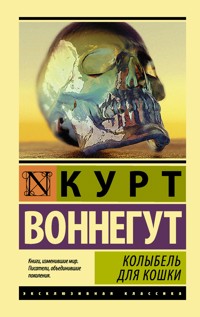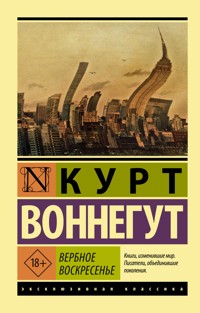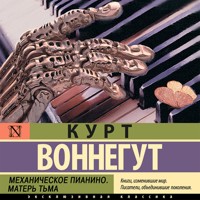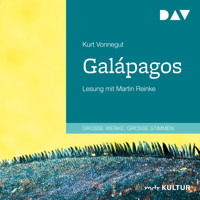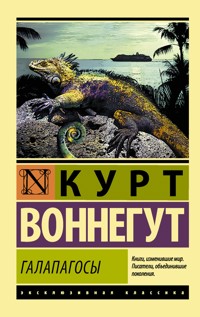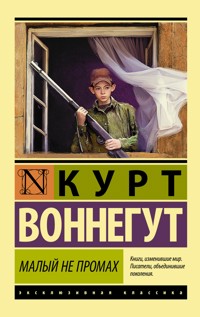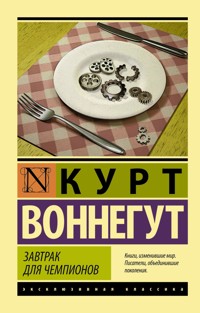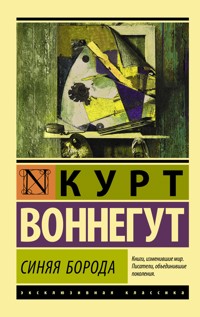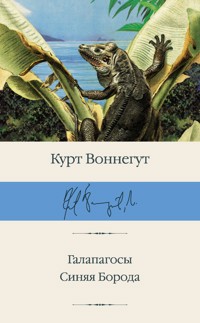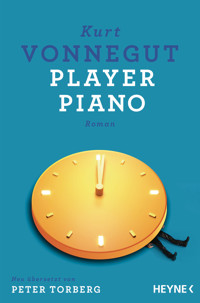
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ilium, New York, in der nahen Zukunft. Alles wird von Maschinen produziert, der Großteil der amerikanischen Arbeiterklasse ist überflüssig geworden. Für Ingenieur Paul Proteus erweist sich diese schöne neue Welt als sinnentleerte Hölle – und so stellt er sich gegen das System. Doch diesen Kampf kann er unmöglich gewinnen.
Der große Klassiker der amerikanischen Gegenwartsliteratur – erstmals ungekürzt und in neuer Übersetzung von Peter Torberg!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Die USA in der nahen Zukunft. Das Land wird von einem Supercomputer gesteuert, Güter werden vollautomatisch produziert. Nur die besten und intelligentesten Männer und Frauen dürfen noch arbeiten, alle anderen werden in Siedlungen untergebracht und mit allem, was sie brauchen, versorgt. Der junge Ingenieur Paul Proteus lebt in Ilium, New York, und ist Direktor einer Fabrik. Seine Frau Anita will unbedingt, dass er den Posten als Werksleiter in Pittsburgh bekommt – und die damit einhergehenden Annehmlichkeiten einer Beförderung. Doch Paul hat seinen Glauben an das System verloren. Bei einem Besuch seines alten Freundes Ed Finnerty wird sein Weltbild weiter erschüttert: Ist diese Art zu leben und zu arbeiten wirklich das, was er möchte? Ist es fair denjenigen gegenüber, die keine Arbeit bekommen?
Paul wird immer mehr zum Kritiker des Systems, das sein Vater einst mit aufgebaut hat. Doch wie gewinnt man den Kampf gegen etwas, das alle Bereiche des Lebens kontrolliert?
Player Piano ist Kurt Vonneguts Debütroman aus dem Jahr 1952 und eine aufrüttelnde Dystopie, die nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Sie liegt erstmals in einer neuen, ungekürzten Übersetzung vor.
Der Autor
KURTVONNEGUT wurde 1922 in Indianapolis als Sohn deutscher Einwanderer geboren. Nach einem Biochemiestudium an der Cornell University meldete er sich freiwillig zur Armee und nahm 1944 an der Ardennenoffensive teil. Im Februar 1945 erlebte er als Kriegsgefangener die Bombardierung Dresdens. Nach dem Krieg war Vonnegut zunächst als Polizeireporter und PR-Fachmann tätig, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. In seinem bekanntesten Roman Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug verarbeitete er seine Erfahrungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Kurt Vonnegut gilt heute als einer der bedeutendsten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Er starb 2007 in New York.
PETERTORBERG studierte in Münster, Milwaukee, Wisconsin und München. Er übersetzt hauptberuflich aus dem Englischen, u. a. Werke von Paul Auster, Ray Bradbury, John Le Carré, William Golding, John Irving, Mark Twain und Oscar Wilde. Peter Torberg lebt in Bayern.
Kurt
VONNEGUT
PLAYER
PIANO
Roman
Aus dem Amerikanischen von Peter Torberg
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
PLAYERPIANO
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Neuausgabe 05/2025
Die Eingangsseiten wurden im Rahmen des Seminars »Themenspezifisches Übersetzen« 2022 an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit den Studierenden des MA Literarisches Übersetzen erarbeitet.
Redaktion: Elisabeth Bösl
Copyright © 1952 by Kurt Vonnegut
Published by Charles Scribner’s Sons
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (HammadKhn und Lia Koltyrina)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30067-8V001
www.diezukunft.de
Für Jane – Gott segne sie
Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eins.
MATTHÄUS 6,28
Vorwort
Dieses Buch handelt nicht von dem, was ist, sondern von dem, was sein könnte. Die Figuren sind Personen nachempfunden, die noch nicht geboren wurden oder zum Zeitpunkt dieser Niederschrift erst Kleinkinder sind.
Es handelt vorwiegend von Führungskräften und Ingenieuren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Geschichte, im Jahr 1952, hängen unser Leben und unsere Freiheit überwiegend von den Fähigkeiten, der Vorstellungskraft und dem Mut unserer Führungskräfte und Ingenieure ab, und ich hoffe, Gott hilft ihnen dabei, uns zu helfen, am Leben zu bleiben und frei zu sein.
Doch dieses Buch handelt von einem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Es gibt keine Kriege mehr und …
1
Ilium, New York, ist in drei Teile gegliedert.
Im Nordwesten leben die Führungskräfte und Ingenieure, die Staatsdiener und ein paar wenige Fachkräfte; im Nordosten stehen die Maschinen; und im Süden, jenseits des Iroquois River, vor Ort bekannt als Homestead, wohnen alle anderen.
Würde man die Brücke über den Iroquois sprengen, würde das an der täglichen Routine kaum etwas ändern. Nur wenige Menschen zu beiden Seiten des Flusses haben einen Grund, ihn zu überqueren, von Neugier mal abgesehen.
Während des Kriegs hatten die Führungskräfte und Ingenieure in Hunderten von Iliums in ganz Amerika ohne ihre Männer und Frauen auskommen müssen, die in den Kampf gezogen waren. Produktion fast ohne Arbeitskräfte – das war das Wunder, das den Krieg gewann. Im Jargon der Nordseite des Flusses war es das Know-how, das den Krieg gewann. Die Demokratie verdankte ihre Existenz diesem Know-how.
Zehn Jahre nach dem Krieg – nachdem die Männer und Frauen heimgekehrt, die Unruhen niedergeschlagen und Tausende aufgrund der Antisabotagegesetze inhaftiert worden waren – streichelte Doktor Paul Proteus in seinem Büro eine Katze. Proteus, die wichtigste und brillanteste Person in Ilium, war erst fünfunddreißig und bereits Direktor der Ilium-Werke. Er war groß, dürr, fahrig und ernst, und die sanften Züge seines schmalen Gesichts wurden durch die Gläser seiner dunkel umrandeten Brille verzerrt.
Proteus kam sich im Augenblick allerdings nicht sonderlich wichtig oder genial vor, schon seit längerem nicht mehr. Im Augenblick war seine größte Sorge, ob die schwarze Katze sich in ihrer neuen Umgebung wohlfühlen würde.
Jene, die alt genug waren, um sich daran zu erinnern, aber zu alt, um ihm Konkurrenz zu machen, sagten voller Wohlwollen, dass Doktor Proteus ganz wie sein Vater aussah, als der ebenso alt gewesen war, und man ging allgemein davon aus – mancherorts durchaus missgünstig –, dass Paul es in der Organisation ebenso weit bringen würde wie sein Vater. Doktor George Proteus war zum Zeitpunkt seines Todes der erste Direktor für Industrie, Handel, Kommunikationswesen, Nahrungsmittel und Rohstoffe des ganzen Landes gewesen, eine Position, an die in ihrer Bedeutung nur die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten heranreichte.
Doch die Chancen, dass die Proteus-Gene an die nächste Generation weitergegeben wurden, lagen bei null. Pauls Frau Anita, die während des Krieges seine Sekretärin gewesen war, konnte keine Kinder bekommen. Blanke Ironie, dass er sie heiratete, nachdem sie verkündet hatte, sie sei, nach einer ziemlich ausschweifenden Siegesfeier im Büro, ganz gewiss schwanger.
»Gefällt dir das, Kätzchen?« Mit Besorgnis und insgeheimer Freude fuhr der junge Proteus mit einer zusammengerollten Blaupause über den Katzenbuckel. »Mmh-ooh, gut, hm?« Er hatte die Katze am Vormittag in der Nähe des Golfplatzes entdeckt und als Mäusefängerin für die Fabrik mitgenommen. Erst letzte Nacht hatte eine Maus die Isolierung eines Steuerdrahts durchgenagt und die Gebäude 17, 19 und 21 vorübergehend lahmgelegt.
Paul betätigte die Gegensprechanlage. »Katharine?«
»Ja bitte, Doktor Proteus?«
»Wann ist meine Rede fertig getippt?«
»Ich bin gerade dabei, Sir. In zehn, fünfzehn Minuten, versprochen.«
Doktor Katharine Finch, die einzige Frau in den Ilium-Werken, war seine Sekretärin. Genau genommen war sie eher Statussymbol denn richtige Hilfe, allerdings machte sie sich ganz gut als Vertretung, wenn Paul krank war oder früher nach Hause gehen wollte. Nur die hohen Tiere, Fabrikdirektoren und höher, hatten Sekretärinnen. Während des Krieges hatten die Führungskräfte und Ingenieure herausgefunden, dass der Großteil der Büroarbeit – wie fast alle niederen Arbeiten – schneller, effizienter und billiger von Maschinen erledigt werden konnte. Anita hatte kurz vor der Entlassung gestanden, als Paul sie heiratete. Jetzt zum Beispiel war Katharine irritierend unmaschinenhaft, trödelte mit Pauls Rede herum und schäkerte gleichzeitig mit ihrem mutmaßlichen Liebhaber, Doktor Bud Calhoun.
Bud, Manager des Ölterminals in Ilium, arbeitete nur, wenn Öl per Schiff oder Pipeline angeliefert oder weitergeleitet wurde, und verbrachte die übrige Zeit – wie auch jetzt – damit, Katharine mit seinem überschwänglichen Südstaatensingsang zu besäuseln.
Paul nahm die Katze und trug sie zu dem Fenster, das die ganze Wand einnahm. »Da draußen gibt es jede Menge Mäuse, Kätzchen.«
Er zeigte der Katze ein altes Schlachtfeld in Friedenszeiten. Hier an der Biegung des Flusses hatten die Mohawks die Algonquins überwältigt, die Holländer die Mohawks, die Engländer die Holländer und die Amerikaner die Engländer. Heute lag dort auf den Knochen, verrotteten Palisaden, Kanonenkugeln und Pfeilspitzen ein an jeder Seite achthundert Meter langes Dreieck aus Stahl- und Ziegelbauten – die Ilium-Werke. Wo früher die Männer gebrüllt, aufeinander eingehackt und mit der Natur gerungen hatten, summten, brummten und klackerten nun die Maschinen und produzierten Teile für Kinderwagen, Kronkorken, Motorräder, Kühlschränke, Fernseher und Dreiräder – die Früchte des Friedens.
Paul schaute über die Dächer des großen Dreiecks hinüber zu der sich gleißend im Iroquois spiegelnden Sonne und darüber hinaus nach Homestead, wo viele der Namen der Pioniere noch immer fortlebten: van Zandt, Cooper, Cortland, Stokes …
»Doktor Proteus?«, meldete sich Katharine.
»Ja, bitte?«
»Es ist wieder an.«
»Nummer Drei in Halle 58?«
»Jawohl. Das Licht ist schon wieder an.«
»Na gut. Rufen Sie Doktor Shepherd an und fragen Sie ihn, was er dagegen unternimmt.«
»Aber der ist doch heute krank.«
»Dann muss ich mich wohl selbst darum kümmern.« Proteus zog den Mantel an, seufzte schwer, nahm die Katze und ging in Katharines Büro hinüber. »Bleiben Sie sitzen, bleiben Sie sitzen«, sagte er zu Bud, der sich auf dem Sofa fläzte.
»Hatte ich vor«, meinte Bud.
Drei Wände des Büros waren von oben bis unten mit Messgeräten vollgestellt, bis auf die Türen zum Flur und in Pauls Büro. Die vierte Wand war ganz aus Glas, genau wie bei Paul. Die zigarettenschachtelgroßen, mit einem glänzenden Messingschild versehenen Messgeräte waren identisch und wie Ziegel aufgestapelt. Jedes einzelne war mit einer Maschineneinheit im Werk verbunden. Ein rot leuchtendes Juwel an der Ostwand zog den Blick auf das siebte Messgerät von unten, fünfte Reihe von links.
Paul tippte auf das Messgerät. »Aha, schon wieder: Nummer Drei in 58 produziert Ausschuss.« Er ließ den Blick über alle Wände schweifen. »Das war wohl alles, hm?«
»Ja, nur das eine.«
»Was haben Sie denn mit der Katze vor?«, fragte Bud.
Paul schnippte mit den Fingern. »Gut, dass Sie fragen. Ich habe eine Aufgabe für Sie, Bud. Ich möchte ein Ortungsgerät haben, das der Katze hier anzeigt, wo sie eine Maus findet.«
»Elektronisch?«
»Das will ich hoffen.«
»Dazu bräuchte man eine Art Sensor, der eine Maus riechen kann.«
»Oder eine Ratte. Bitte arbeiten Sie in meiner Abwesenheit daran.«
Bud Calhoun würde tatsächlich einen Mausalarm entwickeln, einen für Katzen verständlichen. Das wurde Paul bewusst, als er in der blassen Märzsonne zu seinem Wagen ging. Hin und wieder fragte er sich, ob er selbst sich nicht in einer anderen Epoche wohler gefühlt hätte, aber dass Bud genau zur richtigen Zeit lebte, stand außer Frage. Buds Denkweise entsprach genau jener, die seit Gründung der Nation als ausgesprochen amerikanisch galt – die ruhelose, sprunghafte Art und Vorstellungskraft eines Tüftlers. Bud stellte die Krönung ganzer Generationen von Bud Calhouns dar, zumindest kam er ihr recht nah, so als sei nahezu die gesamte amerikanische Industrie in einer einzigen aberwitzigen Maschine vereint.
Paul blieb an Buds Auto stehen, das neben dem seinen stand. Bud hatte ihm schon mehrere Male dessen besondere Ausstattung vorgeführt, und spaßeshalber ließ Paul sich von dem Auto zeigen, was es konnte. »Auf geht’s«, sagte er zu dem Wagen.
Ein Summen und Klicken und schon sprang die Tür auf. »Einsteigen, bitte«, kam es vom Band unter dem Armaturenbrett. Der Anlasser orgelte, der Motor sprang an, brummte im Leerlauf, und das Radio lief.
Vorsichtig drückte Paul auf einen Knopf an der Lenksäule. Ein Motor schnurrte, eine Mechanik murrte leise, und die beiden Vordersitze legten sich flach nebeneinander wie ein müdes Liebespaar. Paul erinnerte das an einen OP-Tisch für Pferde, den er mal in einer Tierklinik gesehen hatte. Das Pferd wurde neben den senkrecht gekippten Tisch geführt, daran festgeschnallt, betäubt und dann von der motorgetriebenen Tischplatte in Behandlungsposition gebracht. Er konnte schon Katharine Finch sehen, wie sie daniedersank, während Bud auf den Knopf drückte und säuselte. Mit einem zweiten Knopf ließ Paul die Sitze wieder hochfahren. »Tschüss«, sagte er zu dem Wagen.
Der Motor ging aus, das Radio verstummte, und die Tür schlug zu. »Lass dir nicht die Butter vom Brot klauen«, rief das Auto, und Paul stieg in seinen Wagen. »Lass dir nicht die Butter vom Brot klauen, lass dir die Butter nicht vom Brot klauen, lass dir nicht …«
»Mach ich nicht!«
Buds Auto verstummte zufrieden.
Paul fuhr den breiten sauberen Boulevard entlang, der die Fabrik teilte, und sah die Gebäudenummern vorbeihuschen. Ein hupender Kombi mit winkenden Passagieren schoss ihm in spielerischen Schlangenlinien auf der verlassenen Straße entgegen und fuhr zum Haupttor. Paul schaute auf die Uhr. Die zweite Schicht hatte gerade Feierabend. Es irritierte ihn, dass solch jugendlicher Übermut ausgerechnet mit jener Art von jungen Männern korrelierte, die man brauchte, um die Fabrik am Laufen zu halten. Zumindest war er sich sicher, dass Finnerty, Shepherd und er, als sie vor dreizehn Jahren hier in den Ilium-Werken angefangen hatten, um einiges erwachsener und erheblich weniger arrogant gewesen waren, ganz bestimmt aber ohne all die Allüren, zu einer Elite zu gehören.
Manche, darunter auch Pauls berühmter Vater, hatten damals davon gesprochen, dass Ingenieure, Manager und Wissenschaftler die Elite bildeten. Und als der Krieg unausweichlich wurde, herrschte die allgemeine Ansicht, dass die einzige Antwort auf die zahlenmäßige Überlegenheit des zu erwartenden Feindes das amerikanische Know-how war. Es war die Rede davon, für die Besitzer dieses Know-hows tiefere, sicherere Bunker zu bauen und diese Crème de la Crème aus der Kampfzone herauszuhalten. Aber nicht allzu viele hatten sich diese Vorstellung von einer Elite zu Herzen genommen. Als Paul, Finnerty und Shepherd zu Beginn des Krieges ihr Studium abschlossen, war es ihnen peinlich gewesen, nicht in den Kampf zu ziehen, und sie hatten sich jenen unterlegen gefühlt, die es taten. In der Zwischenzeit aber wurde all das – dieses Gerede von der Elite, dieses Überlegenheitsgefühl, dieses Gefühl von der Richtigkeit der Hierarchie mit den Führungskräften und Ingenieuren an der Spitze – den Absolventen eingetrichtert, ohne einen Hehl daraus zu machen.
Als Paul die schmale, vier Blocks lange Halle 58 betrat, ging es ihm besser. Halle 58 war sein Lieblingsgebäude. Ihm war aufgetragen worden, den nördlichen Teil davon abzureißen und neu zu errichten, doch das hatte er der Zentrale ausgeredet. Das nördliche Ende war das älteste Gebäude auf dem Gelände, und Paul hatte es gerettet, weil es für Besucher von historischem Interesse sei, so sein Argument. Dabei machte er sich nichts aus Besuchern, er mochte sie nicht, und in Wahrheit hatte er das nördliche Ende der Halle 58 nur aus Eigeninteresse behalten. Es handelte sich um die ursprüngliche Maschinenhalle, die Edison 1886 errichtet hatte, in demselben Jahr, in dem er in Schenectady eine zweite aufmachte; ein Besuch hier nahm Pauls depressiven Phasen ihre Schärfe. Ein Vertrauensbeweis aus der Vergangenheit, fand er – hier räumte die Vergangenheit ein, wie bescheiden und schäbig sie war, hier konnte man vom Alten zum Neuen schauen und erkennen, wie weit die Menschheit tatsächlich gekommen war. Von Zeit zu Zeit brauchte Paul diese Art Vergewisserung.
Objektiv betrachtet, war wirklich alles besser als je zuvor, zumindest versuchte er sich das einzureden. Endlich hatte sich die Welt, nach dem großen Blutbad des Krieges, von menschengemachten Schrecken befreit – Hunger, Gefangenschaft, Folter und Mord größten Ausmaßes. Objektiv betrachtet, erhielten Know-how und weltweit geltendes Recht die lang ersehnte Chance, die Erde zu einem ganz und gar angenehmen und komfortablen Ort zu machen, um auf den Jüngsten Tag zu warten.
Paul wäre lieber an der Front gewesen, hätte gern Schlachtengetümmel und Gedonner miterlebt, die Toten und Verletzten gesehen, und vielleicht hätte ihn ein Schrapnell am Bein erwischt. Vielleicht hätte er dann begriffen, wie gut heute alles im Vergleich dazu war, vielleicht hätte er dann gesehen, was anderen offensichtlich schien – was er als Führungskraft und Ingenieur tat, getan hatte und tun würde, war lebenswichtig, über jeden Zweifel erhaben und hatte tatsächlich ein Goldenes Zeitalter eingeläutet. In letzter Zeit allerdings hatte ihn seine Arbeit, das System, die betriebsinternen Winkelzüge abwechselnd irritiert, gelangweilt oder gereizt.
Er stand im alten Teil der Halle 58, der nun voller Schweißanlagen und einer Reihe von Isolationsflechtmaschinen war. Der Blick auf die Holzbalken mit ihren Einkerbungen unter der abblätternden Kalkfarbe beruhigte ihn ebenso wie der auf die tristen Ziegelwände, in die Männer vor Gott weiß wie langer Zeit ihre Initialen geritzt hatten: »KTM«, »DG«, »GP«, »BDH«, »HB«, »NNS«. Einen Augenblick lang stellte sich Paul vor, wie er es bei seinen Besuchen in diesem Gebäude häufiger tat, er sei Edison und stünde auf der Schwelle eines einsamen Ziegelgebäudes an den Ufern des Iroquois, während der harte Winter durch die Hirse peitscht. Die Holzbalken zeugten noch immer davon, was Edison aus dieser einsamen Ziegelscheune gemacht hatte: An Bolzenlöchern sah man, wo Eisenwellen die Kraft auf einen ganzen Wald von Treibriemen übertragen hatten, und das Dielenholz war schwarz vom Öl und zerschunden von den Füßen der groben Maschinen, die diese Riemen angetrieben hatten.
An Pauls Bürowand hing ein Foto von der Werkstatt, wie sie zu Beginn ausgesehen hatte. Alle Mitarbeiter, die meisten von umliegenden Farmen, hatten sich für den Fotografen Schulter an Schulter inmitten der klobigen Maschinen aufgestellt, schauten fast grimmig vor Stolz und Würde und wirkten leicht albern mit ihren steifen Krägen und Melonen. Der Fotograf hatte offenbar ständig Fotos von Sportmannschaften und Vereinigungen gemacht, denn das Foto erinnerte, ganz im Stil der Zeit, an beides. In jedes Gesicht stand die trotzige Andeutung von körperlicher Stärke geschrieben, und gleichzeitig war da auch die Haltung einer Geheimgesellschaft, die dank der Teilnahme an wichtigen, berührenden Riten, über die der Laie nur spekulieren konnte – und damit irrte –, über und neben der Gesellschaft stand. Der Stolz auf die Kraft und den bedeutsamen Mysterienkult zeigte sich nicht weniger im Blick des Kehrers als in denen der Maschinisten, Inspektoren und des Vorarbeiters, der als Einziger keinen Henkelmann dabeihatte.
Ein Signal ertönte und Paul trat im Gang beiseite, um die Kehrmaschine auf ihren Gleisen vorbeirattern zu lassen, die mit rotierenden Bürsten eine Staubwolke aufwirbelte und sie mit gefräßiger Schnauze aufsaugte. Die Katze auf Pauls Arm krallte Fäden aus dem Anzug und fauchte die Maschine an.
Pauls Augen machten sich mit einem unangenehmen Stechen bemerkbar; ihm wurde klar, dass er zu lange ungeschützt in das grelle Licht und den Funkenschlag der Schweißmaschinen geschaut hatte. Er klipste dunkle Gläser auf seine Brille und schritt durch den antiseptischen Ozongeruch in Richtung der Drehmaschinengruppe Drei, die sich in der Mitte des neuen Teils der Halle befand.
Einen Augenblick lang blieb er bei der letzten Schweißmaschinengruppe stehen; am liebsten hätte er Edison bei sich gehabt. Der alte Mann wäre entzückt gewesen. Zwei Stahlplatten wurden von einem Stapel gezogen und rutschten eine Rampe hinunter; dort wurden sie von Greifern gepackt und unter das Schweißgerät geschoben. Die Schweißköpfe senkten sich, Funken sprühten, und die Köpfe hoben sich wieder. Eine Batterie elektrischer Augen begutachtete misstrauisch die Verbindung der beiden Platten, signalisierte einem Messgerät in Katharines Büro, dass mit der Schweißmaschinengruppe Fünf in Halle 58 alles in Ordnung war, dann ratterten die verschweißten Platten eine weitere Rampe hinunter in den Schlund der Stanzpressengruppe im Kellergeschoss. Diesen Zyklus absolvierten die zwölf Maschinen der Gruppe alle siebzehn Sekunden.
Paul sah die gesamte Länge der Halle 58 entlang; das Ganze kam ihm vor wie eine riesige Sporthalle, in der unzählige Einheiten präzise Übungen vollzogen – alles wippte, drehte, sprang, schob, schwenkte … Wenigstens das mochte Paul an der neuen Zeit: Die Maschinen selbst unterhielten und erfreuten einen.
Ganz nebenbei öffnete er den Schaltkasten der Schweißmaschinengruppe und sah, dass die Einstellung der Maschine noch weitere drei Tage Laufzeit vorsah. Danach würde sie sich automatisch abschalten, bis Paul weitere Befehle von der Zentrale erhielt und sie an Doktor Lawson Shepherd weitergab, der als sein Stellvertreter für die Hallen 53 bis 71 verantwortlich zeichnete. Shepherd, der heute krank war, würde dann die Maschinen einstellen, damit sie eine neue Lieferung an Kühlschrankrückseiten herstellten – genau so viele Rückseiten, wie der Markt nach Einschätzungen von EPICAC, einer Rechenmaschine in den Carlsbad Caverns, aufnehmen könnte.
Paul streichelte die aufgeregte Katze beruhigend mit seinen langen, schlanken Fingern und fragte sich beiläufig, ob Shepherd tatsächlich krank war. Eher nicht. Wahrscheinlich traf er sich mit einflussreichen Leuten und versuchte, sich versetzen zu lassen, um von Paul wegzukommen.
Shepherd, Paul und Edward Finnerty waren gemeinsam als junge Männer nach Ilium gekommen. In der Zwischenzeit hatte Finnerty Karriere in Washington gemacht, Paul hatte den höchsten Posten in Ilium erreicht und Shepherd, der mürrische, aber tüchtige Nörgler, war in seinen Augen dadurch gedemütigt worden, dass man ihn zum zweiten Mann hinter Paul gemacht hatte. Versetzungen wurden auf den oberen Etagen entschieden; Paul hoffte inständig, dass es bei Shepherd klappte.
Paul kam zur Drehbankgruppe Drei, der Unruhestifterin, wegen der er hergekommen war. Er kämpfte schon seit längerem um die Erlaubnis, die Gruppe zu verschrotten, doch ohne Erfolg. Die Drehbänke waren noch von der alten Sorte, ursprünglich dazu bestimmt, von Menschen bedient zu werden; während des Krieges waren sie notdürftig an die neue Technik angepasst worden. Nun nahm die Passgenauigkeit ab und der Ausschuss zu, wie das Messgerät in Katharines Büro zeigte. Paul hätte darauf wetten können, dass die Drehbankgruppe wieder mindestens zehn Prozent von dem Ausschuss produzierte, der in den Tagen menschlicher Kontrolle und berghoher Schrotthaufen angefallen war.
Die Einheit aus fünf Reihen von jeweils zehn Maschinen fuhr mit ihren Werkzeugen unisono über Stahlstangen, warf fertige Antriebswellen auf Laufbänder, hielt kurz an, während unbearbeitete Werkstücke zwischen Spannfutter und Reitstock gespannt wurden, dann fuhren die Werkzeuge wieder über die Stahlstangen und warfen die fertigen Wellen aus …
Paul schloss den Kasten mit der Bandaufzeichnung auf, die das alles steuerte. Es lief in einer Endlosschleife durch magnetische Tonabnehmer. Auf dem Band waren die Bewegungen eines hervorragenden Maschinisten aufgezeichnet worden, der die Welle eines elektrischen Kleinmotors drehte. Paul rechnete zurück – vor elf, zwölf, dreizehn Jahren war er bei der Aufzeichnung des Masterbands dabei gewesen, von dem dieses hier kopiert worden war …
Finnerty, Shepherd und er, frisch gebackene Doktoren, waren zu einer der Werkstätten geschickt worden, um die Aufzeichnung zu machen. Der Vorarbeiter hatte sie an seinen besten Mann verwiesen – wie hieß er noch gleich? –, und während die drei jungen hellen Köpfe mit dem verdutzten Maschinisten herumwitzelten, hatten sie das Aufzeichnungsgerät an die Steuerung der Drehbank angeschlossen. Hertz! So hatte er geheißen, Rudy Hertz, ein alter Hase kurz vor der Rente. Paul erinnerte sich wieder an den Namen und an die Hochachtung, die der alte Mann den jungen Hüpfern entgegengebracht hatte.
Danach hatten sie Rudys Vorarbeiter dazu gebracht, ihm freizugeben, und waren in einem übermütigen Anfall industrieller Demokratie mit ihm auf ein Bier ins Pub gegenüber gegangen. Rudy hatte nicht ganz verstanden, wozu die Aufzeichnungsgeräte dienten, aber das, was er verstanden hatte, gefiel ihm: Er war aus Tausenden von Maschinisten ausgewählt worden, um seine Bewegungsabläufe auf Band verewigen zu lassen.
Hier also, auf dieser kleinen Endlosschleife in dem Kasten vor Paul, war Rudy, wie er an jenem Nachmittag an seiner Maschine gewesen war – Rudy, der den Strom angestellt, die Geschwindigkeit geregelt, das Schneidwerkzeug angesetzt hatte. Dies hier war Rudys Destillat, zumindest was seine Maschine, was Wirtschaft und Kriegsanstrengungen betraf. Das Band war das Destillat des kleinen, höflichen Mannes mit den großen Händen und schwarzen Fingernägeln, des Mannes, der glaubte, man könne die Welt dadurch retten, wenn jeder am Abend in der Bibel las, des Mannes, der mangels eigener Kinder seinen Collie verhätschelte, des Mannes, der … Was hatte Rudy an jenem Nachmittag noch erzählt? Der alte Mann war wohl schon gestorben, nahm Paul an, oder er erlebte seine zweite Kindheit in Homestead.
Und nun konnte Paul das Destillat von Rudy Hertz dazu bringen, eine Welle, zehn, hundert oder tausend Wellen herzustellen, indem er an einem Kontrolltisch Drehmaschinen zuschaltete und sie mit den Signalen vom Band fütterte.
Paul schloss den Kasten wieder. Das Band schien in gutem Zustand, ebenso die Tonabnehmer. Eigentlich war alles tipptopp angesichts des Alters der Maschinen. Es würde nun mal ab und zu Ausschuss anfallen, Punkt. Die ganze Einheit gehörte ins Museum, nicht in eine Werkshalle. Selbst der Kasten war archaisch, eine Art Tresor, der an den Fußboden genietet war, mit Stahltür und Schloss. Während der Aufstände direkt nach dem Krieg waren die Masterbänder alle auf diese Weise aufbewahrt worden. Seitdem die Antisabotagegesetze strikt durchgesetzt wurden, war der einzige Schutz, den die Steuerungen brauchten, der vor Staub, Kakerlaken und Mäusen.
Paul blieb einen Augenblick an der Tür im alten Teil der Halle stehen, um der Musik von Halle 58 zu lauschen. Seit Jahren war ihm immer mal wieder der Gedanke gekommen, einen Komponisten zu beauftragen, daraus etwas zu machen: The Building 58 Suite. Eine wilde Musik, hektische Latino-Rhythmen, mal im Takt, mal nicht, phasenverschoben, kaleidoskopisch. Paul versuchte die einzelnen Themen herauszuhören und zu identifizieren. Da! Die Drehbänke, Tenor: »Farrass-au-au-au-au-au-wak! Ting! Farrass-au-au …« Die Schweißmaschinen, Bariton: »Vaaaaaaa-zasip! Vaaaaaaa-zasip!« Und dazu die Stanzpressen, mit dem Keller als Resonanzraum, Bass: »Hau-gromph! Tanka-tanka. Hau-gromph! Tanka-tanka …« Eine begeisternde Musik, und Paul, dem die Röte ins Gesicht gefahren war und der seine namenlosen Ängste vergessen hatte, gab sich ihr ganz hin.
Aus dem Augenwinkel heraus nahm er eine verrückte Drehbewegung wahr, die seine Aufmerksamkeit weckte, er drehte sich um und entdeckte zu seiner Freude eine Gruppe von winzigen Maibäumen, die eine helle Stoffisolierung um eine schwarze Kabelschlange flochten. Unzählige kleine Tänzerinnen wirbelten in atemberaubender Geschwindigkeit umeinander, drehten Pirouetten, wichen einander aus und legten unfehlbar eine feste Schlinge um das Kabel. Paul lachte über die wunderbaren Maschinen und musste wegschauen, damit ihm nicht schwindlig wurde. Damals, als die Maschinen noch von Frauen überwacht wurden, konnte man lange nach Schichtende einige der schlichteren Gemüter reglos auf ihren Posten sitzen und zuschauen sehen.
Pauls Blick fiel auf ein asymmetrisches Herz, das in die alten Ziegel geritzt worden war. In der Mitte stand »K.L.–M.W.« und die Jahreszahl »1931«. K.L. und M.W. hatten in demselben Jahr Gefallen aneinander gefunden, in dem Edison gestorben war. Wieder dachte Paul daran, welche Freude es wohl wäre, den alten Mann in der Halle 58 herumzuführen, doch plötzlich wurde ihm bewusst, dass der Großteil der Maschinen selbst für Edison nichts Neues gewesen wäre. Flechtmaschinen, Schweißgeräte, Stanzpressen, Drehbänke, Förderbänder, fast alles hatte es schon zu Edisons Zeiten gegeben. Die wesentlichen Bestandteile der automatischen Steuerung ebenfalls, Fotozellen und anderes, die das, was die menschlichen Sinne für die Industrie getan hatten, ebenfalls konnten und besser, waren in wissenschaftlichen Kreisen bereits um 1920 bekannt gewesen. Neu war nur die Kombination dieser Bestandteile. Paul nahm sich vor, das in seiner Rede im Country Club diesen Abend aufzugreifen.
Die Katze machte einen Buckel und verkrallte sich erneut in Pauls Anzug. Wieder schnüffelte die Kehrmaschine im Gang auf sie zu. Sie gab ihren Warnton ab, und Paul trat beiseite. Die Katze fauchte, kratzte plötzlich Pauls Hand auf und sprang. Steifbeinig hüpfend, floh sie vor der Kehrmaschine. Schnappende und blitzende, krachende und kreischende Maschinen zwangen sie ein paar Meter vor den rauschenden Drehbesen der Kehrmaschine in die Mitte des Gangs. Paul suchte verzweifelt nach dem Schalter, um die Kehrmaschine anzuhalten, doch bevor er ihn fand, blieb die Katze stehen und drehte sich um. Mit gebleckten Nadelzähnen und peitschendem Schwanz stellte sie sich der heranrollenden Maschine. Ein Schweißgerät blitzte wenige Zentimeter vor ihren Augen auf, die Kehrmaschine verschlang sie und schleuderte die schreiende und krallende Katze in den galvanisierten Blechbauch.
Nach einem Vierhundert-Meter-Lauf durch die Halle erreichte Paul außer Atem die Maschine, kurz bevor sie an eine Rampe kam. Sie würgte und spuckte die Katze die Rampe hinunter in einen offenen Güterwaggon. Als Paul aus der Halle kam, war die Katze an der Seite des Waggons hochgeklettert, dann zu Boden gepurzelt und kletterte verzweifelt den Zaun hoch.
»Nein, Kätzchen, nein!«, rief Paul.
Die Katze stieß an den Alarmdraht am Zaun und Sirenen gellten vom Wachposten herüber. Im nächsten Augenblick geriet die Katze an die stromführenden Drähte auf dem Zaun. Ein Knall, ein grüner Blitz, und die Katze segelte über den obersten Draht hinweg, als hätte sie jemand geworfen. Sie fiel auf den Asphalt – tot und qualmend, aber draußen.
Ein Panzerwagen, dessen Geschützturm mit seinen Maschinengewehren nervös hin und her schwenkte, blieb murrend vor dem kleinen Kadaver stehen. Der Deckel im Geschützturm öffnete sich klappernd und eine Fabrikwache steckte vorsichtig den Kopf heraus. »Alles in Ordnung, Sir?«
»Schalten Sie die Sirenen aus. Nur eine Katze auf dem Zaun.« Paul kniete sich hin und betrachtete ganz aufgelöst die Katze durch den Maschendraht. »Heben Sie sie auf und bringen Sie sie in mein Büro.«
»Wie bitte, Sir?«
»Die Katze. Ich möchte, dass Sie sie in mein Büro bringen.«
»Aber sie ist tot, Sir.«
»Habe ich mich unklar ausgedrückt?«
»Nein, Sir.«
Als Paul vor dem Gebäude 58 in seinen Wagen stieg, war er wieder ganz trübsinnig. Weit und breit nichts, was ihn ablenkte, nichts als Asphalt, ein Ausblick auf nichtssagende, nummerierte Fassaden und Fähnchen kalter Federwolken an einem Streifen blauen Himmels. Durch eine schmale Schlucht zwischen den Gebäuden 57 und 59, die auf den Fluss hinausging und eine Reihe von grauen Veranden in Homestead zeigte, erhaschte Paul einen flüchtigen Blick auf das einzige sichtbare Leben. Auf der obersten Veranda saß ein alter Mann in einem Schaukelstuhl und schaukelte in einem Flecken Sonnenlicht. Ein Kind beugte sich über das Geländer und warf ein Stück Papier in einem trägen Schwung zum Flussufer hinunter. Das Kind blickte von dem Papier auf und schaute Paul an. Der alte Mann hörte auf zu schaukeln und betrachtete ebenfalls dieses Kuriosum, ein lebendes Wesen in den Ilium-Werken.
Als Paul auf dem Weg in sein Büro an Katharine Finchs Schreibtisch vorbeikam, hielt sie ihm seine abgetippte Rede hin. »Sehr gut, was Sie da über die Zweite Industrielle Revolution sagen«, meinte sie.
»Uraltes Zeug.«
»Mir kam das sehr neu vor, vor allem den Abschnitt, wo Sie davon sprechen, dass die Erste Industrielle Revolution die Muskelkraft entwertet hat und dann die zweite die Kopfarbeit. Ich fand es faszinierend.«
»Das hat der Mathematiker Norbert Wiener schon damals in den Neunzehnvierzigern gesagt. Das kommt Ihnen nur so neu vor, weil Sie zu jung sind und die Dinge nur so kennen, wie sie heute sind.«
»Eigentlich ist es schon unglaublich, dass die Dinge früher mal anders waren, oder? Es ist doch lächerlich, die Menschen den ganzen Tag an einem Ort zusammenzupferchen und nur ihre Sinne zu nutzen, dann einen Reflex, dann wieder die Sinne, dann einen Reflex, ohne überhaupt darüber nachzudenken.«
»Teuer«, sagte Paul, »und ungefähr so zuverlässig wie ein Lineal aus Knetgummi. Sie können sich ja vorstellen, wie groß der Ausschuss war und was für eine Hölle es bedeutete, damals Betriebsleiter gewesen zu sein. Saufgelage, Familienstreitigkeiten, Groll auf den Chef, Schulden, der Krieg … Jede Art von menschlichen Kümmernissen schlug sich auf die eine oder andere Weise im Produkt nieder.« Er lächelte. »Und Glück ebenfalls. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man die Feiertage mit einkalkulieren musste, vor allem um Weihnachten herum. Das musste man so hinnehmen. Der Ausschuss stieg um den fünften Dezember herum langsam an und stieg und stieg bis Weihnachten. Dann war Feiertag, und danach gab es eine entsetzliche Menge an Ausschuss; dann kam Neujahr, und wieder eine erschreckende Menge an Ausschuss. Dann sank es bis zum fünfzehnten Januar langsam wieder auf ein Normalmaß, das immer noch schlimm genug war. All das mussten wir bei der Preisgestaltung mitberücksichtigen.«
»Glauben Sie, dass es eine dritte industrielle Revolution geben wird?«
Paul blieb in der Tür zu seinem Büro stehen. »Eine dritte? Was könnte das denn sein?«
»Ich weiß nicht genau. Die erste und die zweite müssen irgendwann ja auch ziemlich unvorstellbar gewesen sein.«
»Für die Menschen, die durch Maschinen ersetzt wurden, vielleicht schon. Eine dritte industrielle Revolution, hm? In gewisser Hinsicht ist die Dritte schon eine Weile im Gange, falls Sie dabei denkende Maschinen meinen. Das wäre ja wohl die Dritte Industrielle Revolution: Maschinen, die das menschliche Denken entwerten. Auf speziellem Gebiet tun das ein paar der großen Computer ja jetzt schon.«
»Hm-hm«, machte Katharine nachdenklich. Sie schlug sich mit einem Bleistift gegen die Zähne. »Erst die Muskelarbeit, dann die Routinearbeit und dann vielleicht die richtige Verstandesarbeit.«
»Ich hoffe nur, ich lebe nicht lange genug, um diesen letzten Schritt mitzuerleben. Wo wir gerade von industriellen Revolutionen reden, wo ist Bud?«
»Ein Frachter hat angelegt, also musste er wieder an die Arbeit.« Sie reichte ihm eine knittrige Wäschereiquittung mit Buds Namen darauf.
Paul drehte den Zettel um und fand dort wie erwartet die Zeichnung eines Schaltkreises für einen Mausdetektor und ein Alarmsystem, das sehr wahrscheinlich funktionieren würde. »Ein staunenswerter Sachverstand, Katharine.«
Sie nickte unsicher.
Paul machte die Tür hinter sich zu, schloss leise ab und zog aus einer der unteren Schubladen eine Flasche unter einem Stapel Papiere hervor. Unter der wunderbar heißen Wirkung eines Schlucks Whisky wurde ihm kurz finster vor Augen. Tränen schossen ihm hoch, und er versteckte die Flasche wieder.
»Doktor Proteus, Ihre Frau ist am Telefon«, sagte Katharine über die Gegensprechanlage.
»Proteus?« Er wollte sich hinsetzen, entdeckte zu seinem Schrecken aber auf seinem Stuhl einen kleinen Weidenkorb mit einer toten schwarzen Katze darin.
»Ich bin’s, Schatz, Anita.«
»Hallo, hallo, hallo.« Er stellte vorsichtig den Korb auf dem Boden ab und ließ sich auf seinen Stuhl sinken. »Wie geht es dir, Schatz?«, fragte er abwesend. In Gedanken war er immer noch bei der Katze.
»Alles bereit für eine gute Zeit heute Abend?« Eine bühnenreife Altstimme, verständnisinnig und leidenschaftlich: Iliums Gutsherrin sprach.
»Ich bin schon den ganzen Tag über wegen der Rede nervös.«
»Dann wird es bestens laufen, Schatz. Du kommst schon noch nach Pittsburgh. Daran habe ich nicht den leisesten Zweifel, Paul, nicht den leisesten. Warte nur ab, bis Kroner und Baer dich heute Abend hören.«
»Kroner und Baer haben also zugesagt?« Bei den beiden handelte es sich um den Manager und den Chefingenieur der gesamten Abteilung Ost, von denen die Werksanlage in Ilium nur ein kleiner Teil war. Kroner und Baer entschieden, wer den wichtigsten Posten in ihrer Abteilung bekommen sollte, ein Posten, der vor zwei Wochen durch einen Todesfall frei geworden war – die Leitung der Werksanlage Pittsburgh. »Besser kann es nicht werden.«
»Nun, wenn dir das nicht gefällt, dann habe ich noch eine Neuigkeit, die dir gefallen wird. Es wird noch einen weiteren ganz besonderen Gast geben.«
»Na, wie nett.«
»Und du musst nach Homestead und ihm eine Flasche irischen Whisky besorgen. Im Club gibt es keinen.«
»Finnerty! Ed Finnerty!«
»Ja, Finnerty. Er hat heute Nachmittag angerufen und extra betont, dass du ihm irischen Whisky besorgen sollst. Er ist auf dem Weg von Washington nach Chicago und macht hier einen Zwischenstopp.«
»Wie lang ist das jetzt her, Anita? Fünf, sechs Jahre?«
»Bevor du die Leitung übernommen hast, so lange.« Sie klang munter und enthusiastisch über Finnertys Eintreffen. Das verdrießte Paul, denn er wusste ganz genau, dass sie sich nichts aus Finnerty machte. Sie frohlockte nicht, weil sie Finnerty mochte, sondern weil sie die Rituale von Freundschaften mochte, weil sie keine hatte. Außerdem war Ed Finnerty, seit er Ilium verlassen hatte, ein einflussreicher Mann geworden, Angehöriger des Nationalen Industriellen Planungsausschusses NIPA; diese Tatsache milderte zweifellos ihre Erinnerungen an die Zwischenfälle mit Finnerty in der Vergangenheit.
»Du hast recht, das sind mal gute Nachrichten, Anita. Einfach wunderbar. Das nimmt der Anwesenheit von Kroner und Baer die Schärfe.«
»Aber du bist auch zu den beiden freundlich.«
»Natürlich. Pittsburgh, wir kommen.«
»Versprichst du mir, dass du nicht wütend wirst, wenn ich dir etwas rate, was zu deinem Besten ist?«
»Nein.«
»Also gut, ich sage es trotzdem. Amy Halporn hat heute Morgen gesagt, sie hätte ein Gerücht über Pittsburgh und dich aufgeschnappt. Ihr Gatte war heute bei Kroner, und Kroner hätte den Eindruck gehabt, du würdest gar nicht nach Pittsburgh gehen wollen.«
»Wie soll ich ihm das denn noch mitteilen? Auf Esperanto? Auf Englisch habe ich ihm schon auf zig Arten gesagt, ich will den Posten.«
»Offenbar hat Kroner nicht den Eindruck, dass du es wirklich ernst meinst. Du bist zu subtil und bescheiden gewesen, Schatz.«
»Kroner ist offenbar nicht auf den Kopf gefallen.«
»Was meinst du damit?«
»Ich meine, er schaut tiefer in mich hinein als ich selbst.«
»Dass du den Posten in Pittsburgh nicht willst, meinst du?«
»Ich bin mir nicht sicher. Er wusste das offenbar, bevor ich es wusste.«
»Du bist erschöpft, Schatz.«
»Kann sein.«
»Du brauchst einen Drink. Komm früh nach Hause.«
»Mach ich.«
»Ich liebe dich, Paul.«
»Ich liebe dich, Anita. Bis später.«
Anita beherrschte die Mechanik der Ehe aus dem Effeff, bis hin zu den kleinsten Gepflogenheiten. Zwar war ihr Ansatz bestürzend rational und systematisch, aber sie war gründlich genug, um eine glaubwürdige Nachahmung von Warmherzigkeit zu inszenieren. Paul konnte nur vermuten, dass ihre Gefühle oberflächlich waren – aber vielleicht war diese Vermutung bereits Teil dessen, was er für seine Krankheit hielt.
Als er auflegte, hielt er den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen. Als er sie aufschlug, starrte er die tote Katze in dem Korb an.
»Katharine!«
»Ja, Sir.«
»Sorgen Sie dafür, dass jemand die Katze vergräbt.«
»Wir haben uns schon gefragt, was Sie damit machen wollen.«
»Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe.« Er besah sich den Kadaver und schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Vielleicht ein richtiges Begräbnis. Vielleicht hatte ich gehofft, sie würde sich wieder berappeln. Schaffen Sie sie sofort weg, bitte.«
Als er nach Hause aufbrach, blieb er an Katharines Schreibtisch stehen und sagte, sie solle sich keine Sorgen um den leuchtenden Juwel am siebten Messgerät von unten, fünfte Reihe von links an der Ostwand machen.
»Da ist nichts mehr zu machen«, sagte er. Drehbankgruppe Drei, Halle 58, war zu seiner Zeit gut gewesen, ließ aber nun Abnutzung erkennen und passte nicht mehr in den raffinierten, stromlinienförmigen Aufbau, in dem es keinen Platz für abweichendes Verhalten gab. »Prinzipiell ist sie nicht für die Arbeiten gebaut worden, die sie da leistet. Ich warte nur darauf, dass jeden Augenblick der Summer losgeht, und das war’s dann.«
In jeder Messeinheit steckte neben dem Gerät, dem Juwel und der Warnlampe ein Summer. Ging dieser an, dann war das das Signal für den Komplettausfall dieser Einheit.
2
Der Schah von Bratpuhr, geistiges Oberhaupt der sechs Millionen Angehörige umfassenden Sekte der Kolhouri, schrumpelig und weise und dunkel wie Kakao, geradezu überkrustet mit Goldbrokat und Gestirnen aus funkelnden Edelsteinen, versank tief in den königsblauen Polstern der Limousine – wie eine unbezahlbare Brosche in ihrer Geschenkschatulle.
Auf der anderen Seite der Rückbank saß Doktor Ewing J. Halyard vom Außenministerium der USA, ein schwerer, rotgesichtiger, weltmännischer Mann Anfang vierzig. Er trug einen mächtigen rotgelben Schnäuzer, ein farbiges Hemd, eine Blume im Knopfloch und eine Weste, die sich von dem dunklen Anzug abhob, und dies alles mit einer derartigen Haltung, die einem den Eindruck vermittelte, dass er gerade erst aus einer distinguierten Gesellschaft gekommen war, in der sich alle derartig kleideten. In Wahrheit trug nur Doktor Halyard so etwas. Und er kam problemlos damit durch.
Zwischen den beiden saß der Dolmetscher Khashdrahr Miasma, nervös, grinsend, jung und sich unentwegt für seinen fehlenden Glanz und mangelnden Einfluss entschuldigend; er war ein Neffe des Schahs und hatte Englisch gelernt, ohne den Palast jemals verlassen zu haben.
»Khabu?«, fragte der Schah mit hoher, zittriger Stimme.
Halyard war nun schon seit drei Tagen mit dem Schah zusammen und konnte auch ohne Khashdrahrs Hilfe fünf Ausdrücke verstehen. »Khabu« hieß »wo?«, »Siki« hieß »was?«, »Akka sahn« hieß »warum?«, »Brahous brahouna, houna saki« war eine Mischung aus Segen und Dank, und »Samklish« war das heilige Getränk der Kolhouri, das Khashdrahr für den Schah in einem Flachmann bei sich trug.
Der Schah hatte seine militärische und geistige Feste in den Bergen verlassen, um nachzuschauen, was er von der mächtigsten Nation der Erde zum Wohl seines Volkes lernen konnte. Doktor Halyard war sein Fremdenführer und Gastgeber.
»Khabu?«, fragte der Schah erneut und schaute auf die Stadt hinaus.
»Der Schah möchte wissen, bitte, wo wir jetzt sind«, sagte Khashdrahr.
»Ich weiß«, entgegnete Halyard und lächelte matt. Er wurde schier verrückt, so lange ging das mit khabu und siki und akka sahn schon. Er beugte sich vor. »Ilium, New York, Eure Hoheit. Wir überqueren gleich den Iroquois River, der die Stadt teilt. Dort drüben auf der anderen Seite liegen die Ilium-Werke.«
Die Limousine blieb am Ende der Brücke stehen, wo ein großer Bautrupp ein kleines Schlagloch verfüllte. Der Trupp hatte für einen alten Plymouth mit einem kaputten Scheinwerfer, der von der Nordseite des Flusses herüberkam, eine Fahrspur freigegeben. Die Limousine wartete darauf, dass der Plymouth durchfuhr, und setzte sich wieder in Bewegung.
Der Schah drehte sich um, starrte die Gruppe durch die Heckscheibe an und sagte nach einiger Zeit etwas.
Doktor Halyard lächelte, nickte verständnisvoll und wartete auf die Übersetzung.
»Der Schah«, sagte Khashdrahr, »er möchte wissen, bitte, wem all die Sklaven gehören, die wir den ganzen Weg von New York City bis hierher gesehen haben.«
»Keine Sklaven«, sagte Halyard und kicherte gönnerhaft. »Staatsbürger, von der Regierung angestellt. Sie haben dieselben Rechte wie alle anderen Bürger, Meinungsfreiheit, freie Religionsausübung, Wahlrecht. Vor dem Krieg arbeiteten sie in den Ilium-Werken und kontrollierten die Maschinen, doch heutzutage kontrollieren die Maschinen sich selbst viel besser.«
»Aha!«, machte der Schah, nachdem Khashdrahr übersetzt hatte.
»Weniger Ausschuss, viel bessere und preiswertere Produkte durch automatische Kontrolle.«
»Aha!«
»Und alle, die sich nicht dadurch ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie eine Arbeit besser erledigen können als eine Maschine, werden von der Regierung angestellt, entweder in der Armee oder in Wiederaufbau und Wartung.«
»Aha! Khabu bonanza-pak?«
»Mh?«
»Er sagt: ›Woher kommt das Geld, um sie zu bezahlen?‹«, sagte Khashdrahr.
»Ach so. Von der Maschinen- und der Einkommenssteuer. Dann stecken die Angehörigen der Armee und des Korps für Wiederaufbau und Wartung ihr Geld wieder in das System und kaufen mehr Produkte für ein besseres Leben.«
»Aha!«
Doktor Halyard, ein pflichtbewusster Mann mit einem schlechten Gewissen, was die Größe seiner Spesenkonten anging, erklärte weiter Amerika, obwohl er wusste, dass nur sehr wenig davon durchdrang. Er erklärte dem Schah, dass die tiefgreifendsten Fortschritte in den rein industriellen Gegenden erzielt worden waren, in denen ein Großteil der Bevölkerung – wie in Ilium – den Lebensunterhalt damit verdient hatte, die Maschinen auf die eine oder andere Weise zu warten. In New York City, zum Beispiel, gab es viele Fertigkeiten, deren Mechanisierung zu schwierig oder zu unwirtschaftlich waren, und die Fortschritte hatten dort keinen so hohen Prozentsatz an Menschen von der Produktion befreit.
»Kuppo!«, sagte der Schah und schüttelte den Kopf.
Khashdrahr wurde rot und übersetzte beklommen und entschuldigend. »Der Schah sagt: ›Kommunismus.‹«
»Kein Kuppo«, entgegnete Halyard vehement. »Die Maschinen gehören nicht der Regierung. Sie besteuert lediglich jenen Teil des industriellen Gewinns, der früher für die Arbeit aufgebracht wurde, und verteilt ihn um. Die Industrie ist in Privatbesitz und wird privat geleitet, und sie wird zur Vermeidung von Überschuss durch Konkurrenz von einem Führungskomitee aus führenden Köpfen der Privatindustrie, nicht der Politik, koordiniert. Durch die Eliminierung der menschlichen Fehler durch Maschineneinsatz und sinnloser Konkurrenz durch Organisation haben wir den Lebensstandard des Durchschnittsmenschen ungeheuer gesteigert.«
Khashdrahr unterbrach sich beim Dolmetschen und runzelte verwirrt die Stirn. »Bitte, dieser Durchschnittsmensch, dafür gibt es kein passendes Wort in unserer Sprache, fürchte ich.«
»Sie wissen schon«, sagte Halyard, »der gewöhnliche Mensch, wie, na ja, wie jeder andere auch. Die Männer, die auf der Brücke gearbeitet haben, der Mann in dem alten Auto, das uns entgegengekommen ist. Der kleine Mensch, nicht besonders klug, aber herzensgut, unscheinbar, schlicht, durchschnittlich.«
Khashdrahr übersetzte.
»Aha«, machte der Schah und nickte, »Takaru.«
»Was hat er gesagt?«
»Takaru«, antwortete Khashdrahr. »Sklave.«
»Kein Takaru«, entgegnete Halyard, direkt an den Schah gewandt. »Staats-bür-ger.«
»Aah«, machte der Schah. »Staats-bür-ger.« Er grinste fröhlich. »Takaru – Bürger. Bürger – Takaru.«
»Kein Takaru!«, sagte Halyard.
Khashdrahr zuckte mit den Schultern. »Im Land des Schahs gibt es nur die Elite und die Takaru.«
Halyards Magengeschwür, das im Laufe seiner Zeit als Erklärer Amerikas für die provinziellen und unwissenden Honoratioren aus den verschlafenen Winkeln der Zivilisation an Größe und Geltung zugenommen hatte, versetzte ihm einen Stich.
Wieder hielt die Limousine, und der Fahrer hupte einen Trupp des Korps für Wiederaufbau und Wartung an. Sie hatten ihre Schubkarren stehen lassen, die nun die Straße blockierten, und warfen mit Steinen nach einem Eichhörnchen, das dreißig Meter über ihnen auf einem Ast saß.
Halyard kurbelte die Scheibe herunter. »Schafft diese verdammten Schubkarren aus dem Weg!«, rief er.
»Bürger!«, flötete der Schah und lächelte bescheiden über seine neu gewonnene Zweisprachigkeit.
»Verpiss dich«, rief einer der Steinewerfer. Unwillig und mürrisch kam er die Straße entlang, schob sehr langsam zwei Schubkarren beiseite und beobachtete dabei den Wagen und seine Insassen. Dann trat er aus dem Weg.
»Danke! Wurde auch Zeit!«, sagte Halyard, als der Wagen an dem Mann vorbeischlich.
»Gern geschehen, Doc«, entgegnete der Mann und spuckte ihm ins Gesicht.
Halyard stotterte, fand mannhaft die Fassung wieder und wischte sich das Gesicht ab. »Ein Einzelfall«, sagte er verbittert.
»Takaru yamu brouha, pu dinka bu«, meinte der Schah mitfühlend.
»Der Schah«, betonte Khashdrahr ernst, »er sagt, seit dem Krieg ist es überall so mit den Takaru.«
»Keine Takaru«, meinte Halyard apathisch und beließ es dabei.
»Samklish«, bat der Schah mit einem Seufzer.
Khashdrahr reichte ihm den Flachmann mit dem heiligen Schnaps.
3
Doktor Paul Proteus, der Mann mit dem höchsten Einkommen in ganz Ilium, lenkte seinen billigen, alten Plymouth über die Brücke nach Homestead. Den Wagen hatte er schon in den Zeiten der Unruhen gehabt; unter dem Krimskrams im Handschuhfach – Streichholzheftchen, Fahrzeugschein, Taschenlampe und Taschentücher – lag die rostige Pistole, die ihm damals zugeteilt worden war. Eine Pistole dort aufzubewahren, wo eine unbefugte Person Zugang hatte, war strengstens verboten. Selbst die große Zahl an Soldaten der Berufsarmee kam ohne Bewaffnung aus, bis sie zum Besatzungsdienst ins Ausland geschickt wurden. Waffen trugen nur Polizisten und Werkswachen. Eigentlich wollte Paul die Pistole nicht, vergaß aber ständig, sie abzuliefern. Im Laufe der Jahre hatte sie Patina angesetzt, und er betrachtete sie mittlerweile als harmlose Antiquität. Das Handschuhfach ließ sich nicht mehr abschließen, also versteckte er die Pistole unter Taschentüchern.
Der Motor lief nicht rund, stotterte ab und zu, fing sich wieder, stockte plötzlich, fing sich erneut. Seine anderen Autos, ein neuer Kombi und eine sehr teure Limousine, standen für Anita zuhause, wie er sagte. Keines der beiden Fahrzeuge war jemals in Homestead gewesen, Anita auch schon lange nicht mehr. Zwar zog Anita ihn nicht wegen seiner Hingabe zu dem alten Wagen auf, schien aber der Ansicht zu sein, dass anderen gegenüber eine Erklärung angebracht wäre. Er hatte mitbekommen, wie sie Gästen erzählte, dass er es hatte umbauen lassen, um es gegenüber den Fahrzeugen, die vom automatischen Fließband in Detroit rollten, mechanisch erheblich zu verbessern – was einfach nicht stimmte. Es war auch vollkommen unlogisch, dass ein Mann mit einem solchen besonderen Fahrzeug es immer wieder vor sich herschob, den linken Scheinwerfer reparieren zu lassen. Und er fragte sich, welche Erklärung sie parat hätte, wenn sie von der Lederjacke wüsste, die er im Kofferraum aufbewahrte, und dass er sein Jackett dagegen tauschte und den Schlips ablegte, bevor er den Iroquois überquerte. Diese Fahrt unternahm er nur, wenn es unbedingt sein musste, beispielsweise, um eine Flasche irischen Whisky für einen der wenigen Menschen zu kaufen, denen er sich je nahe gefühlt hatte.
Er hielt am anderen Ende der Brücke. Etwa vierzig Männer stützten sich auf Brechstangen, Spitzhacken und Schaufeln, rauchten, schwatzten und drängten sich um etwas mitten auf der Straße und standen im Weg. Sie drehten sich zu Paul um, schauten ihn abgestumpft an, traten langsam an den Straßenrand, als hätten sie alle Zeit der Welt, und machten gerade so viel Platz, dass Paul hindurchfahren konnte. Dabei sah Paul, um was sie dort gestanden hatten. Ein kleiner Mann kniete neben einem Schlagloch von gut einem halben Meter Durchmesser und klopfte den frisch eingefüllten Asphalt mit der Schaufel fest.
Der Mann bedeutete wichtigtuerisch, Paul solle um den Fleck herum und nicht darüber fahren. Die anderen verstummten und passten auf, dass Paul wirklich darum herumfuhr.
»He, Kumpel, dein Scheinwerfer ist hin«, rief einer der Männer. Die anderen schlossen sich ihm unisono an.
Paul nickte zum Dank. Seine Haut begann zu jucken, als hätte er sich plötzlich besudelt. Die Männer waren Angehörige des Korps für Wiederaufbau und Wartung, in ihren eigenen Worten die »Widerlichen Wracks«. Wer nicht mit den Maschinen konkurrieren konnte und keine Einkünfte hatte, dem blieb die Wahl zwischen der Armee oder dem Aufbau- und Wartungskorps. Die Soldaten, deren innere Leere sich hinter polierten Knöpfen und Schnallen, makellosen Uniformen und glänzendem Leder verbarg, deprimierten Paul längst nicht so sehr wie die Widerlichen Wracks.
Er rollte durch den Arbeitstrupp, kam an einer schwarzen Dienstlimousine vorbei und fuhr nach Homestead.
Gleich hinter der Brücke kam eine Bar. Paul musste ein ganzes Stück weiter weg parken, weil ein anderer Trupp gerade einen Feuerhydranten aufgedreht hatte und die Gullys spülte. Dies schien ein beliebter Zeitvertreib zu sein. Wann immer er nach Homestead kam und die Temperatur über dem Gefrierpunkt war, stieß er auf einen geöffneten Hydranten.
Ein großer Mann mit einem Gesichtsausdruck, als sei er der Besitzer, hielt mit beiden Händen den Schraubenschlüssel fest, der den Durchfluss kontrollierte. Ein anderer stand als Vize-Wasserkommandant neben ihm. Um sie herum und entlang des Wasserlaufs bis hin zum Gully stand eine Menschenmenge und schaute zu. Ein dreckiger kleiner Junge schnappte sich ein Stück Papier, das den Bürgersteig entlangwehte, bastelte ein einfaches Papierschiffchen daraus und ließ es im Rinnstein treiben. Alle Blicke folgten interessiert dem Bötchen, schienen ihm Glück zu wünschen, während es durch gefährliche Stromschnellen schoss, sich an einem Zweig verfing, freikam, in den schnellen, tiefen Hauptstrom vordrang, kurz triumphierend auf einer Welle ritt und dann im Gully verschwand.
»Ah!«, machte ein Mann neben Paul, so als wäre er an Bord gewesen.
Paul bahnte sich einen Weg durch die Menschenmenge, die fließend in die Kundschaft der Bar überging, und schaffte es fast bis an den Tresen. Er lehnte sich an ein automatisches Klavier. Anscheinend hatte ihn niemand erkannt, was auch ziemlich überraschend gewesen wäre, denn ganz den Regeln entsprechend, hielt er sich eigentlich immer auf seiner eigenen Seite des Flusses auf und ließ nicht zu, dass sein Name oder ein Bild von ihm in der IliumStar-Tribune erschien.
Am Tresen standen alte Männer, Rentner, zu alt für Armee oder Korps. Vor jedem von ihnen stand ein schales Bier, dessen Glasrand nach Stunden langsamen, gedankenverlorenen Nippens milchig war. Diese Alten kamen früh und gingen spät, und alle anderen mussten über ihre Köpfe hinweg bestellen. Im Fernseher hinter dem Tresen strahlte eine üppige Urmutter von Frau, bewegte bei abgestelltem Ton die Lippen aufgeregt und schlug Eier in einer Rührschüssel auf. Die alten Männer schauten zu, klapperten ab und zu mit den Gebissen und leckten sich die Lippen.
»Entschuldigung«, sagte Paul schüchtern.
Keiner machte ihm Platz. Ein fetter ergrauender Collie lag zusammengerollt unter dem Barhocker des alten Manns direkt vor Paul, fletschte zahnlos und knurrte träge.
Vergeblich winkte Paul dem Barkeeper. Er trat von einem Fuß auf den anderen und erinnerte sich an die vollautomatische Bar, die Finnerty, Shepherd und er in ihrem jugendlichen Leichtsinn entworfen hatten. Überraschenderweise war der Besitzer einer Restaurantkette daran interessiert gewesen. Fünf Häuser weiter von hier hatten sie ihren Prototyp eingerichtet, mit Münzautomaten und endlosen Servierfließbändern, Entkeimungsstrahlern zur Luftreinigung, mit gutem gleichmäßigen Licht, mit stetiger, sanfter Musikberieselung vom Band und Sitzen, die von einem Industrie-Anthropologen entworfen worden waren, um dem Durchschnittsmann größtmöglichen Komfort zu bieten.
Der erste Tag war eine Sensation gewesen, die Warteschlange reichte ein paar Blocks weit. Nach einer Woche war die Neugier allerdings befriedigt, und an einem guten Tag schauten vielleicht fünf Kunden vorbei. Dann hatte fast nebenan dieser Schuppen hier aufgemacht, eine Staub- und Bakterienschleuder von einem viktorianischen Pub, mit schlechtem Licht, dürftiger Belüftung und einem unhygienischen, ineffektiven und womöglich unehrlichen Barkeeper. Der Schuppen war vom ersten Tag an ein Erfolg.
Endlich bemerkte ihn der Barkeeper. Als er Paul sah, legte er seine Rolle als Moralapostel und Streitschlichter ab und verwandelte sich in einen unterwürfigen Gastgeber wie der Barkeeper im Country Club. Einen Augenblick befürchtete Paul, erkannt worden zu sein. Als der Barkeeper ihn aber nicht mit Namen ansprach, ging er davon aus, dass man lediglich seine gesellschaftliche Stellung erkannt hatte.
Nur wenige Männer in Homestead – wie dieser Barkeeper, die Polizisten und Feuerwehrleute, Profisportler, Taxifahrer und besonders begabte Kunsthandwerker – waren nicht von den Maschinen verdrängt worden. Sie lebten unter all den anderen, waren hochnäsig und der Masse gegenüber oft überheblich. Sie fühlten sich den Ingenieuren und Managern auf der anderen Seite des Flusses verbunden, doch dieses Gefühl wurde, nebenbei gesagt, nicht erwidert. Dort herrschte der allgemeine Eindruck vor, dass diese Leute nicht zu klug waren, um durch Maschinen ersetzt zu werden, sondern dass es sich einfach nicht rechnete. Kurz gesagt, war ihr Anflug von Überlegenheit vollkommen ungerechtfertigt.
Jetzt hatte der Barkeeper gemerkt, dass Paul ein Jemand war, und machte eine Riesenschau daraus, alle anderen spüren zu lassen, sie könnten zur Hölle fahren, während er Paul bediente. Das bemerkten die anderen, drehten sich um und glotzten den so bevorzugten Neuankömmling an.
Paul bestellte mit leiser Stimme eine Flasche irischen Whisky und bemühte sich, nicht aufzufallen, indem er sich vorbeugte und den alten Collie tätschelte. Der Hund bellte und sein Besitzer drehte sich auf dem Hocker zu Paul um. Der alte Mann war genauso zahnlos wie sein Hund. Pauls erster Eindruck war rotes Zahnfleisch und riesige Pranken – als wäre alles andere schwach und farblos.
»Der tut niemandem was«, entschuldigte sich der alte Mann. »Regt sich nur ein bisschen darüber auf, dass er alt und blind ist und nie weiß, was eigentlich vor sich geht.« Er strich mit seinen Pranken über die fetten Flanken des Hundes. »Er ist ein braver alter Hund.« Dann sah er Paul nachdenklich an. »He, ich kenn Sie doch.«
Paul schaute besorgt nach dem Barkeeper, der im Keller verschwunden war. »Tatsächlich? Ich bin schon ein- oder zweimal hier gewesen.«
»Nein, nicht hier«, sagte der alte Mann laut. »Im Werk da drüben. Sie sind der junge Doktor Proteus.«
Das bekamen eine Menge Leute mit, und die beiden Männer, die gleich neben Paul standen, musterten ihn unverhohlen und verstummten, um jedes Wort mitzubekommen.
Der alte Mann war offenbar ziemlich taub, denn seine Stimme war unberechenbar laut, dann wieder leise. »Kennen Sie mich nicht, Doktor?« Er machte sich nicht über Paul lustig, sondern bewunderte ihn zutiefst und war stolz darauf, beweisen zu können, dass dieser angesehene Mann und er sich kannten.
Paul wurde rot. »Nicht dass ich mich erinnere. Von der alten Schweißanlage vielleicht?«
Der alte Mann fuhr sich selbstkritisch mit der Hand übers Gesicht. »Ah, nicht mehr genug von dem alten Gesicht vorhanden, dass mein bester Freund mich erkennt«, sagte er gut gelaunt. Er reckte seine Hände die Handfläche nach oben vor. »Aber schauen Sie sich die hier an, Doktor. Noch bestens in Schuss, so ein Paar gibt es nirgendwo noch mal. Haben Sie selbst gesagt.«
»Hertz«, sagte Paul. »Rudy Hertz.«
Rudy lachte und sah sich triumphierend im Raum um, so als wollte er sagen: »Seht ihr? Rudy Hertz kennt Doktor Proteus, und Proteus kennt Hertz! Wie viele von euch können das von sich behaupten?«
»Und das ist der Hund, von dem Sie mir erzählt haben? Vor zehn, fünfzehn Jahren?«
»Der Sohn davon, Doktor«, lachte Hertz. »Ich war damals kein Anfänger mehr, oder?«
»Sie waren ein verdammt guter Mechaniker, Rudy.«
»So ist es. Und zu wissen, dass kluge Leute wie Sie so etwas über Rudy sagen, also, das bedeutet mir viel. Das ist alles, was ich noch habe, Doktor. Das und den Hund.« Rudy rüttelte am Arm seines Nachbarn, eines kleinen, untersetzten, schweren, scheinbar weichen Mannes mittleren Alters mit einem schlichten runden Gesicht. Seine Augen wurden durch eine äußerst dicke, beschlagene Brille vergrößert. »Hast du gehört, was Doktor Proteus über mich gesagt hat?« Rudy deutete auf Paul. »Der klügste Mann in ganz Ilium sagt so etwas über Rudy. Vielleicht ist er sogar der klügste Mann im ganzen Land.«
Paul flehte zu Gott, der Barkeeper würde sich beeilen. Der Mann, den Rudy geschüttelt hatte, sah Paul nun mürrisch an. Paul schaute sich schnell im Raum um und sah überall nur Feindseligkeit.
Der verwirrte Rudy Hertz glaubte, er würde Paul einen Gefallen tun, indem er mit ihm vor der Menge angab. Rudy war senil, erinnerte sich nur an seine beste Zeit, war aber nicht in der Lage, sich daran zu erinnern oder zu begreifen, was nach seinem Ruhestand geschehen war …
Doch die anderen, diese Männer in ihren Dreißigern, Vierzigern und Fünfzigern wussten es sehr genau. Die Jüngeren in der Sitznische, die beiden Soldaten und die drei jungen Frauen, waren wie Katharine Finch. Sie konnten sich nicht mehr an die Zeit erinnern, als alles anders gewesen war, konnten sich kaum einen Reim darauf machen, was früher gewesen war, auch wenn ihnen nicht notwendigerweise gefiel, wie es jetzt war. Doch die anderen, die ihn anstarrten, erinnerten sich. Sie waren die Randalierer gewesen, die Maschinenstürmer. In ihren Blicken lag keinerlei Androhung von Gewalt, aber ein Unmut, der Wunsch ihm klarzumachen, dass er dort eingedrungen war, wo man ihn nicht haben wollte.
Und noch immer kehrte der Barkeeper nicht zurück. Paul konzentrierte sich auf Rudy und kümmerte sich nicht um die anderen. Der Mann mit den dicken Brillengläsern, den Rudy aufgefordert hatte, Paul doch zu bewundern, starrte ihn weiter an.
Paul redete dummes Zeug über den Hund und darüber, wie gut Rudy sich doch gehalten hätte. In seiner Hilflosigkeit wurde ihm klar, dass er zu dick auftrug und allen Anwesenden, die vielleicht noch Zweifel hatten, bewies, dass er ein unaufrichtiger Esel war.
»Trinken wir auf die alten Zeiten!«, sagte Rudy und erhob sein Glas. Er bemerkte nicht, dass sein Vorschlag auf Schweigen stieß und er allein trank. Er schnalzte mit der Zunge, blinzelte vor sehnsüchtiger Erinnerung und leerte sein Glas mit Schwung. Dann knallte er es auf den Tresen.
Paul lächelte glasig und beschloss, kein Wort mehr zu sagen, denn jedes weitere Wort wäre ein Fehler gewesen. Er verschränkte die Arme und lehnte sich an die Tasten des automatischen Klaviers. In der Stille des Pubs gab das Klavier einen schwachen Misston ab, der zu nichts verging.
»Trinken wir auf unsere Söhne«, sagte der Mann mit der dicken Brille plötzlich. Er klang überraschend hoch für einen Mann, der so aussah, als hätte er eine volltönende Stimme. Diesmal erhoben sich mehrere Gläser. Nach dem Trinken drehte sich der Mann mit dem freundlichsten Lächeln zu Paul um und sagte: »Mein Sohn ist gerade achtzehn geworden, Doktor.«
»Wie nett.«
»Er hat noch sein ganzes Leben vor sich. Ein wunderbares Alter, achtzehn.« Er hielt inne, so als würde er auf eine Reaktion auf seine Bemerkung warten.
»Ich wäre auch gern wieder achtzehn«, meinte Paul lahm.
»Er ist ein guter Junge, Doktor. Nicht gerade die hellste Leuchte. Genau wie sein alter Herr, das Herz am rechten Fleck, und er möchte das Beste aus dem machen, was er draufhat.« Wieder eine erwartungsvolle Pause.
»Mehr können wir alle nicht tun«, sagte Paul.
»Also, wo schon mal so ein kluger Mann wie Sie hier ist, könnte ich Sie wohl dazu bringen, mir einen guten Rat für den Jungen zu geben? Er hat gerade seinen Nationalen Allgemeinen Klassifizierungstest gemacht. Er hat bis zum Umfallen dafür gelernt, aber es hatte keinen Zweck. Er war nicht gut genug fürs College. Es gab nur siebenundzwanzig Plätze für sechshundert Bewerber.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich kann es mir nicht leisten, ihn auf eine Privatschule zu schicken, und jetzt muss er sich entscheiden, was er aus seinem Leben machen will. Wofür soll er sich entscheiden, Doktor: die Armee oder die Widerlichen Wracks?«
»Für beides spricht einiges, nehme ich an«, sagte Paul unbehaglich. »Aber ich kenne mich da nicht gut genug aus. Vielleicht könnte jemand anderes, Matheson vielleicht, könnte …« Er ließ den Satz unvollendet. Matheson war der für die Prüfungen und Stellenbesetzungen verantwortliche Manager in Ilium. Paul kannte ihn flüchtig, mochte ihn aber nicht sonderlich. Matheson war ein einflussreicher Bürokrat, der seine Aufgabe mit dem Anstrich eines Hohepriesters erledigte. »Ich könnte Matheson anrufen, wenn Sie wollen, und ihn fragen, dann lasse ich Sie wissen, was er gesagt hat.«
»Doktor«, sagte der Mann jetzt verzweifelt und ohne jeden Unterton von Missmut, »gibt es denn im Werk nichts, was der Junge tun kann? Er ist ungeheuer geschickt mit den Händen. Er hat eine Art Instinkt für Maschinen. Geben Sie ihm eine, die er noch nie zuvor gesehen hat, und in zehn Minuten hat er sie auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Er liebt diese Art von Arbeit. Gibt es denn nichts im Werk …?«