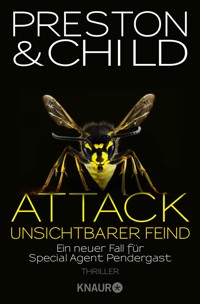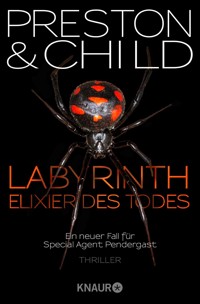18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
Pageturner-Garantie: der 22. Thriller mit dem Kult-Ermittler Aloysius Pendergast! Im fesselnden Abenteuer-Thriller »Poison – Schwestern der Vergeltung« lassen die Bestseller-Autoren Preston & Child ihre Helden auf ein explosives Finale mit dem wahnsinnigen Serienkiller Enoch Leng zusteuern. Ein verzweifelter Deal wird gebrochen Constance Greene stellt sich Enoch Leng, Manhattans gefährlichstem Serienmörder, und will dadurch das Leben ihrer Schwester erkaufen – doch sie wird verraten und mit leeren Händen abgewiesen. Eine raffinierte Falle wird gestellt Leng weiß nicht, dass Constance Hilfe von Diogenes Pendergast erhält. Als Kleriker getarnt versteckt sich der Bruder von Aloysius Pendergast in New Yorks berüchtigtem Slum Five-Points. Von dort aus manipuliert er die Ereignisse, beobachtet jeden Zug von Leng und wartet auf seine Chance zuzuschlagen. Ein rachsüchtiger Engel lässt sich nicht abschrecken Während Aloysius Pendergast alles dransetzt, die labile Constance vor ihrem selbstmörderischen Rachefeldzug zu bewahren, will sie um jeden Preis ihre geliebte Schwester retten und Leng brutal ermorden. Doch Leng ist ihr stets einen Schritt voraus und hat eine Überraschung für sie alle … Action-Thriller mit einem hoch spannenden Mix aus Mystery, Drama und historischen Elementen Die amerikanischen Thriller-Stars Douglas Preston und Lincoln Child bieten auch im 22. Fall für FBI-Special-Agent Pendergast wieder alles auf, was Millionen Fans weltweit lieben: gefährliche Rätsel, persönliche Verstrickungen und atemlose Action. Die Thriller-Reihe mit den mysteriösen Fälle von Agent Pendergast ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Relic – Museum der Angst - Attic – Gefahr aus der Tiefe - Formula – Tunnel des Grauens - Ritual – Höhle des Schreckens - Burn Case – Geruch des Teufels - Dark Secret – Mörderische Jagd - Maniac – Fluch der Vergangenheit - Darkness – Wettlauf mit der Zeit - Cult – Spiel der Toten - Fever – Schatten der Vergangenheit - Revenge – Eiskalte Täuschung - Fear – Grab des Schreckens - Attack – Unsichtbarer Feind - Labyrinth – Elixier des Todes - Demon – Sumpf der Toten - Obsidian – Kammer des Bösen - Headhunt – Feldzug der Rache - Grave – Verse der Toten - Ocean – Insel des Grauens - Bloodless – Grab des Verderbens - Death – Das Kabinett des Dr. Leng - Poison – Schwestern der Vergeltung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Poison - Schwestern der Vergeltung
Ein neuer Fall für Special Agent Pendergast. Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Frauke Czwikla
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein verzweifelter Deal wird gebrochen ...
Constance Greene stellt sich Enoch Leng, Manhattans gefährlichstem Serienmörder, und will dadurch das Leben ihrer Schwester erkaufen – doch sie wird verraten …
Eine raffinierte Falle wird gestellt ...
Leng weiß aber nicht, dass Pendergasts Bruder Diogenes ihr seine Hilfe angeboten hat. Als Kleriker getarnt versteckt er sich in New Yorks berüchtigtem Five-Points-Slum. Von dort aus manipuliert er die Ereignisse, beobachtet jeden Zug von Leng und wartet auf seine Chance zuzuschlagen.
Ein rachsüchtiger Engel lässt sich nicht abschrecken ...
Doch während Pendergast alles dransetzt, um die labile Constance vor ihrem selbstmörderischen Rachefeldzug zu bewahren, will sie um jeden Preis ihre geliebte Schwester retten und Leng brutal ermorden. Leng ist ihr aber einen Schritt voraus und hat eine Überraschung für sie alle ...
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Bewahren Sie bitte Haltung …
PROLOG
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
TEIL EINS
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
TEIL ZWEI
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
TEIL DREI
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
Epilog
Bewahren Sie bitte Haltung …
PROLOG
1
Diogenes Pendergast warf sich in letzter Minute in das Zeitportal. Es schleuderte ihn mit solcher Gewalt in die Vergangenheit – ins New York City des Jahres 1881 –, dass er auf das dreckige Kopfsteinpflaster der Gasse stürzte. In einer instinktiven Bewegung drehte er sich um, rollte ab, um die Wucht des Aufpralls abzufangen, wobei er sich von Kopf bis Fuß mit Schlamm und Pferdemist beschmierte. Er kam rechtzeitig auf die Beine, um einen letzten Blick auf das Zeitportal zu erhaschen, das schwach schimmernd verblasste. Leise fluchend musterte er flüchtig seine verdreckte Kleidung, aber daran konnte er im Moment nichts ändern. Das Wild, das er verfolgte, war kurz zuvor durch das Portal gesprungen … und jetzt fort. Ihm durfte keinesfalls gestattet werden, im New York des neunzehnten Jahrhunderts zu verschwinden. Diogenes hob die lederne Reisetasche auf, die ihn stets begleitete – und die er beim Sturz hatte fallen lassen –, und eilte aus der Gasse auf die belebte New Yorker Kreuzung. In seiner eigenen Ära nannte man diesen Ort Times Square, doch in dieser primitiven Zeit trug er noch den Namen des Ackers, der er einst gewesen war: Longacre. Er merkte sich die Sackgasse, aus der er gekommen war – ein schmieriges Schild wies sie als Smee’s Alley aus –, und musterte auf der Suche nach seinem Mann die Droschken und dämmrigen Ladenfronten, während er den heftigen Gestank des Kohlenrauchs einatmete. Dort war er: Gaspard Ferenc eilte im Strom der Menge den Broadway hinunter.
Schnellen Schritts machte er sich an die Verfolgung. Dass Ferenc merkte, dass er verfolgt wurde, bereitete ihm keine Sorgen – der Dummkopf wusste nicht einmal von Diogenes’ Existenz, geschweige denn, dass er ihn seit Wochen ausspionierte … oder ihm durchs Zeitportal gefolgt war.
Warum er Ferenc zurück durch die Zeit folgte, war etwas, worüber er später nachdenken würde. Im Moment war er einfach seltsam begeistert, seine eigene jämmerliche Welt hinter sich gelassen zu haben.
Schon bald hatte er Ferenc eingeholt und fiel hinter ihm in Gleichschritt. Der Mann trug ein lächerliches Sammelsurium an Kleidungsstücken, offensichtlich aus allem Verfügbaren zusammengesetzt, das nach neunzehntem Jahrhundert aussah: rot kariertes Holzfällerhemd, schwarze Cargohose und Doc Martens. Immerhin hatte er versucht, sich seinem unbekannten Vorhaben gemäß zu kleiden; Diogenes war keine Zeit für solche Vorbereitungen geblieben. Der Dung an seiner Kleidung war auf perverse Weise ein Gottesgeschenk, denn er half, den schwarzen Rollkragenpullover und die Hose zu verdecken, die er getragen hatte, während er versteckt in den Tiefen des Anwesens seines Bruders am Riverside Drive lebte. Seine unpassende Kleidung würde noch mehr Aufsehen erregen als die von Ferenc.
Diogenes blieb vor einem Lokal stehen, wischte mit der Hand über die Tafel, die Schweinsfüße anpries, und verschmierte den Kreidestaub im Gesicht. Er hoffte, dass der Bleicheffekt ihn wie einen Darsteller in einer der im Theaterviertel dieser Tage so beliebten »Varieté«-Neuheiten aussehen ließ. Dann nahm er die Verfolgung von Ferenc den Broadway entlang erneut auf und erleichterte unterwegs zwei wohlhabende Herren um ihre Brieftaschen und Taschenuhren.
Ferenc betrat eine Pfandleihe ein Dutzend Blocks südlich von Longacre. Diogenes tauchte in eine nahe gelegene Schneiderei und erwarb hastig ein Hemd, einen Havelock-Mantel und einen Hut und zog alles an. Seine Ledertasche war so abgewetzt und unscheinbar, dass sie keiner weiteren Tarnung bedurfte. Er knöpfte den Mantel bis oben zu, zog sich die Hutkrempe ins Gesicht und trat wieder hinaus. Als er an der Pfandleihe vorbeischlenderte, sah er, wie Ferenc eine Jade-Figurine – allem Anschein nach aus der Familiensammlung der Pendergasts entwendet – für ein paar Scheine, einen Umhang und eine Mütze verkaufte. Er verließ die Pfandleihe und eilte weiter nach Süden, Diogenes dicht hinter ihm.
Was hatte Ferenc im Sinn? Die Rätselhaftigkeit seines Vorhabens und die Plötzlichkeit seines Aufbruchs faszinierten Diogenes. Offensichtlich war es geplant, und vermutlich ging es um eine Menge Geld – Gier, wusste er, gehörte zu Ferenc’ Schwächen –, aber was hatte er vor? Ferenc konnte, ohne es zu wissen, alles für Diogenes ruinieren, und das Klügste wäre, den Mann sofort zu töten. Doch neben anderen, eher nebulösen Gedanken hielt ihn seine Neugier davon ab. Er wollte wissen, was der kleine Plan des Manns beinhaltete.
Es dauerte nicht lange, bis Diogenes erkannte, was er vorhatte. Ferenc überquerte ein paar Minuten später die 26th Street und betrat die New York Federal Bank of Commerce. Nachdem er kurz an einem der Pulte für das Ausfüllen von Formularen verharrt hatte, stellte er sich in der Schlange an einem der Schalter an. Diogenes reihte sich in der daneben ein. Kurze Zeit später hatte Ferenc den Schalter erreicht und wurde bedient. Doch praktisch sofort erwies sich die von ihm beabsichtigte Transaktion als problematisch; sein Kassierer verließ das vergitterte Fenster, kehrte zurück, verschwand … und kam dann mit einem Vorgesetzten wieder. Doch nicht einmal dieser konnte Ferenc zufriedenstellen.
Diogenes hatte sich unterdessen dicht genug herangeschoben, um den Wortwechsel zu belauschen, und der geheimnisvolle Schleier um Ferenc’ schmutzigen kleinen Plan löste sich rasch auf. Der Mann versuchte, hundert Dollar in zeitgenössischen Scheinen gegen fünfundzwanzig der seltenen Vier-Dollar-Münzen, bekannt als »Stellas«, einzutauschen – doch die Bank besaß leider nur zwei, beide mit Mängeln behaftet.
Diogenes spürte Verachtung in sich aufsteigen. Dieser komplexe und gefährliche Ausflug in die Vergangenheit, in der ein Mann von Einfallsreichtum und Kühnheit so viel erreichen konnte, diente letztlich nur dem schnöden Mammon. Er wollte diese seltenen Münzen mit zurück ins einundzwanzigste Jahrhundert nehmen und mit gewaltigem Profit verkaufen – und versagte jetzt schon kläglich. Diogenes’ amüsierte Verachtung mischte sich mit an Verärgerung grenzender Enttäuschung. Er würde den kleinen Mann töten, sobald sich die Gelegenheit bot.
Er beobachtete, wie sich Ferenc, voller Wut über das Scheitern seines Plans, Luft machte, indem er eine Frau hinter sich in der Schlange beleidigte. Eine Wache eilte herbei, und im folgenden Handgemenge sah man eine billige Digitaluhr an Ferenc’ Handgelenk, die er offensichtlich vergessen hatte abzunehmen. Das fremde Objekt verwandelte das unbedeutende Gezänk in einen absurden Aufruhr, an dessen Ende der glücklose Ferenc in Handschellen in einer stahlverstärkten Grünen Minna abtransportiert wurde. Diogenes, der mit der restlichen Menge zuschaute, hörte einen der Polizisten sagen, dass der Mann ins Bellevue Hospital gebracht wurde. Während sich die Türen des Wagens hinter ihm schlossen, brüllte Ferenc, dass er aus der Zukunft kam … und rief Pendergasts Namen.
Diogenes – dem es wie Mithridates gelungen war, sich gegen nahezu alles zu wappnen – war tief verstört, Ferenc so leichtsinnig rufen zu hören. Er und seine stammelnden Erklärungen konnten alles verraten und ruinieren.
Diogenes winkte eine Droschke heran und folgte dem Polizeiwagen. Was für ein kompletter Idiot Ferenc doch war. Jeder gute Numismatiker hätte ihm verraten können, dass es sich bei den Stellas um Probeprägungen handelte, die niemals für den Umlauf freigegeben worden waren und die man normalerweise bei keiner Geschäftsbank erwerben konnte. Während er der Grünen Minna folgte, dachte Diogenes über die Ironie nach, dass ein Mann wie Ferenc – brillant genug, um bei der Entwicklung des Mars Rover mitzuwirken oder wie in diesem Fall eine Maschine zu reparieren, die in der Lage war, Paralleluniversen zu durchqueren – bei einem törichten Versuch, schnellen Reichtum zu erlangen, scheiterte, weil er zu eitel war, sich ausreichend vorzubereiten. Sic transit gloria mundi.
2
Nach einer viertelstündigen Fahrt durch die geschäftigen Straßen voller Fuhrwerke hielt der Polizeitransport an einem gesicherten Hintereingang des Bellevue – einem Gebäudekomplex, der eher an die Bastille als an ein Krankenhaus gemahnte.
Die Droschke, in der Diogenes saß, hielt auf der gegenüberliegenden Straßenseite, als Ferenc ins Krankenhaus verfrachtet wurde und die Eisentüren hinter ihm zufielen.
»Zwanzig Cent, wenn Sie so gut sein wollen, Mister«, teilte der Kutscher Diogenes mit.
»Ich würde gern eine Weile warten, wenn Sie gestatten«, erwiderte Diogenes, der seine Sprechweise an den ne varietur-Rhythmus der 1880er anpasste. »Womöglich bedarf ich noch Ihrer Dienste.« Damit reichte er dem Mann einen Silberdollar, der sich noch eine Stunde zuvor am Broadway in der Tasche eines beleibten Herrn befunden hatte.
»In Ordnung, Chef«, sagte der Mann, mehr als glücklich, mit einem bereitwillig zahlenden Fahrgast die Zeit zu vertrödeln.
Diogenes starrte auf die schwere Metalltür, hinter der Ferenc verschwunden war. Ein höchst unglücklicher Umstand. Er hätte ihn umbringen sollen, als sich die Gelegenheit bot – seiner eigenen perversen Neugier nachzugeben hatte schon früher zu Problemen geführt.
Er bedachte die Situation. Da man Ferenc als Gefangenen ins Bellevue und nicht zur nächsten Polizeiwache gebracht hatte, wusste Diogenes, dass er in die Irrenabteilung eingewiesen wurde. Was sollte er angesichts dessen unternehmen? Er konnte immer noch versuchen, den Mann umzubringen. Das würde eine Tarnung erforderlich machen, er musste sich als Pfleger oder Putzkraft ausgeben und Zugang zur richtigen Abteilung erlangen. Nichts davon stellte ein echtes Problem dar; kritisch war nur die knappe Zeit.
Zeit … Zeit, wie wahr. Er warf einen Blick nach unten auf seine Hose und die Schuhe – die einzigen Bekleidungsstücke, die noch aus seiner eigenen Zeit stammten und die dank des Schlamms und des Mantels bisher nicht aufgefallen waren. Dabei bemerkte er unter dem Schlamm an den Hosensäumen und den Sohlen der Arbeitsstiefel ungewöhnliche Brandspuren. Er wusste, dass Ferenc es geschafft hatte, diese infernalische Maschine mit einer Art Zeitschaltuhr zu versehen, die das Portal lange genug offen hielt, damit er die Münzen beschaffen und zurückkehren konnte. Aber diese seltsamen Brandspuren zusätzlich zum Rumpeln und dem Qualm, der aus der Maschine aufstieg, wie Diogenes beobachtet hatte, als er Ferenc durch das Portal folgte …
Sein Gedankengang wurde von einer großen schwarzen Pferdekutsche, einem Landauer, unterbrochen, der vor einem anderen, für die Angestellten des Krankenhauses reservierten Eingang vorfuhr. Der Schlag sprang auf, und ein Mann in eleganter Aufmachung stieg aus. »Elegant« war noch untertrieben: Der Mann trug einen langen, schwarzen Gehrock mit gestärktem weißen Kragen, eine breite Seidenkrawatte mit Diamantnadel und eine geknöpfte Weste, auf der eine goldene Uhrenkette einen schimmernden Bogen beschrieb. An seinem linken Aufschlag war ein Orchideengesteck – eine purpurne Dendropia auf einem Farnwedel – befestigt.
Doch Diogenes war besonders an seinem bleichen Adlergesicht mit den tief liegenden saphirblauen Augen hinter der Brille mit rechteckigen Gläsern, dem hellblonden Haar und den gemeißelten Zügen interessiert, die Mitglieder seiner eigenen Familie auszeichneten. Seine Miene wirkte abwesend, abgelenkt, vielleicht auch eisig.
Diogenes wusste sofort, dass dies Professor Enoch Leng sein musste, berühmt für seine neue Methode zur Behandlung von Geisteskrankheit, der Gehirnoperation. Außerdem trug er noch einen anderen, sogar noch distinguierteren Namen: Antoine Leng Pendergast, Spross der alten Familie aus New Orleans und Urgroßonkel von Diogenes.
Er sah zu, wie der Konsultierende Chirurg hinter den Mauern des Bellevue verschwand.
Was zuvor wie eine unangenehme Entwicklung gewirkt hatte, entpuppte sich nun als schlimmstmögliche. Diogenes war sicher, dass Leng innerhalb kürzester Zeit Gaspard Ferenc kennenlernen würde, den »Verrückten«, der behauptete, aus der Zukunft zu stammen … und nach einem Mann namens Pendergast rief, der ihn retten sollte.
Nun war es sinnlos für ihn, ins Krankenhaus einzudringen. Alles hing davon ab, was Leng als Nächstes tat. Obgleich der Kutscher abwehrend meinte, das wäre nicht nötig, schnippte Diogenes ihm einen zweiten Silberdollar zu und wartete.
Es war noch keine Stunde verstrichen, als Ferenc, kaum fähig zu gehen, aus dem Angestellteneingang auftauchte und ein junger Mann ihm in Lengs Kutsche half, dicht gefolgt von Leng. Innerhalb von Sekunden rumpelte die Kutsche davon – und Diogenes wies seinen Kutscher an, ihr mit etwas Abstand zu folgen.
Lengs schimmernde Kutsche wandte sich Richtung Süden durch die ärmeren Viertel der Stadt und erreichte schließlich Five Points, New Yorks berüchtigtsten Slum: ein Labyrinth enger Gassen und schmutziger Hinterhöfe, in denen die verzweifeltsten und verkommensten Einwohner der Stadt lebten. Die Tatsache, dass eine Kutsche wie die Lengs unbehelligt durch diese Kloake der Laster und des Elends fahren konnte, sprach Bände. Mittlerweile verdiente Diogenes’ Kutscher seine zwei Dollar, indem er eine unübersehbare Pistole zog und damit gewährleistete, dass ihr weniger elegantes Vehikel nicht angegriffen wurde.
Lengs Landauer fuhr an einem neugotischen Bau an der Catherine Street vor. Eine unappetitliche Menge hatte sich vor dem Eingang versammelt, angezogen von dem vergoldeten Schild über dem Eingang: SHOTTUMS KABINETT DER NATURWUNDER UND KURIOSITÄTEN. Die Kutsche blieb einen Moment stehen, während Leng ausstieg, einen Arm schützend um den willenlosen Ferenc gelegt. Doch statt das Kabinett durch den Haupteingang zu betreten, verschwand er rasch durch eine Seitentür.
Diogenes befahl seinem Kutscher, an eine sicherere Stelle am Ende des Blocks zu fahren, und wartete. Er wusste eine Menge über seinen Vorfahren Enoch Leng. Er wusste, dass sich unter Shottums Kabinett – und großen Arealen von Five Points – eine weitläufige Ansammlung von Tunneln und Gängen befand, Überreste eines aufgegebenen Wasserwerks, die Leng heimlich für seine schaurigen Experimente umfunktioniert hatte.
Leng an diesen Ort zu folgen wäre wesentlich gefährlicher, als ins Krankenhaus zu schleichen. Aber die Kutsche des Mannes blieb vor dem Eingang stehen. Was immer geschehen mochte, es würde bald sein.
Nach einer weiteren Stunde wurde Diogenes’ Geduld belohnt. Aus dem Seiteneingang trat ein hässlicher, missgestalteter Mann, der eine Gestalt vor sich her über das schlammige Pflaster und zu Lengs Kutsche schob. Die Gestalt war in eine Wolldecke gehüllt, aber man konnte kurz weiblich wirkende Füße – blass und nackt – erkennen, ehe sie in die Kabine verfrachtet wurde. Der Mann bellte einen Befehl, und die Kutsche fuhr an und rauschte einen Moment später an Diogenes’ Droschke vorbei.
Als Diogenes noch überlegte, ob er ihr folgen sollte, erschien in rascher Bewegung Leng persönlich und eilte die Straße hoch. Zunächst dachte Diogenes, er würde die Kutsche einholen wollen, als wäre sie versehentlich ohne ihn aufgebrochen, und wies seinen Fahrer an, ihm zu folgen. Doch nein, Leng war nur auf dem Weg zu einer nahe gelegenen und weniger gefährlichen Durchgangsstraße, Ferry Street, in der sich ein Droschkenstand befand. Leng winkte eine heran, stieg ein und fuhr die Kaianlagen entlang Richtung Norden.
Diogenes musste seinem Fahrer keine Anweisungen mehr erteilen – der Mann ließ bereits die Zügel schnalzen und trieb das Pferd an.
Lengs Droschke bewegte sich rasch Richtung Uptown. Die Gassen wurden breiter und verliefen in einem Gittermuster, als sie den moderneren Teil der Stadt erreichten. Einige Minuten später wurde Lengs Droschke langsamer, und Diogenes erkannte, wohin er wollte. Bemerkenswert, dachte Diogenes, wie schnell es Leng gelungen war, Ferenc die Information zu entreißen.
»Langsam jetzt«, sagte Diogenes leise. »Und seien Sie ein braver Bursche, fahren Sie an den Rinnstein hier links und warten.«
»Schon erledigt, Boss«, erwiderte der Droschkenkutscher.
Er beobachtete, wie Leng aus der Droschke stieg und den Gehweg entlanghuschte, wobei er immer wieder stehen blieb, um in Gassen zu spähen, die vom Broadway zum Longacre Square abzweigten. Leng suchte zweifelsohne nach einer bestimmten Gasse – der mit dem Portal –, und Diogenes’ Herz erstarrte zu Eis.
Mittlerweile hatte Leng die Seventh Avenue überquert – durch die Pfützen watend, wobei seine kostspielige Kleidung mit Schlamm und Dung bespritzt wurde – und verschwand in einer Gasse auf der anderen Seite: der dreckigen Sackgasse namens Smee’s Alley.
»Sie warten hier«, sagte Diogenes, schwang sich hinaus und hastete zu derselben Gasse. In der Einmündung wurde er langsamer und spähte unter dem Vorwand, nach seiner Taschenuhr zu fingern, hinein. Er sah Leng, der sich umschaute und einen Spazierstock mit Goldgriff in alle Richtungen schwenkte, als suchte er nach etwas Unsichtbarem. Das Portal war Gott sei Dank nicht wieder aufgetaucht.
Nach ein paar Minuten schlenderte Diogenes, dessen ärgste Befürchtungen sich gelegt hatten, an der Sackgasse vorbei zu einer Grog-Pinte in der Nähe, wo er sich setzen und Lengs Aktivitäten durch eine von Fliegenschiss starrende Scheibe beobachten konnte.
Der Mann ging erst in eine Richtung, dann in eine andere, wobei er ein Dutzend Mal stehen blieb und sich umschaute; mal starrte er hoch an einer der mit Werbung gepflasterten Fassaden, mal presste er die Hände an die Backsteinmauern oder bückte sich, um das Pflaster zu mustern, während er mit seinem Stock darauf klopfte oder ihn kreuz und quer durch die Luft schwenkte. Der Nachmittag neigte sich, und Winterdämmerung senkte sich über die Stadt. Schließlich gab Leng – offensichtlich frustriert – auf, verließ die Gasse, winkte mit einer Krümmung seines Zeigefingers, die Diogenes an Tizians Johannes der Täufer erinnerte, eine Droschke heran und wurde rasch von der Dunkelheit verschluckt.
Diogenes hätte ihm folgen können, entschied sich jedoch dagegen. Ferenc war selbstverständlich tot oder würde es bald sein – und Leng hatte von ihm alles bekommen, was er brauchte. Was bedeutete, dass Leng über Pendergast, Constance und die Zeitmaschine Bescheid wusste. Er wusste, wo das Portal erschienen war, und hatte danach gesucht. Es wäre katastrophal gewesen, wenn es ihm gelungen wäre, damit ins einundzwanzigste Jahrhundert zu springen … denn das Schicksal seiner Welt, seiner eigenen Welt, stand auf dem Spiel. Diogenes dankte der Vorsehung, dass das Portal fort war. Er hegte den starken Verdacht, dass Ferenc die Maschine auf höchste Leistung gefahren und sie zu lange eingeschaltet gelassen hatte, während er in diesem Paralleluniversum unterwegs war. Schon als er Ferenc durch das Portal folgte, war die Maschine eindeutig überhitzt gewesen. Vermutlich war sie ausgebrannt und das Portal fort, vielleicht für immer.
Aufgrund seiner Konzentration auf die unmittelbare Gefahr war Diogenes nicht in den Sinn gekommen, dass er womöglich – zusammen mit den anderen – auf ewig hier festsaß.
Er verließ die Pinte und stieg in die wartende Droschke.
»Wohin jetzt, Boss?«
Diogenes schwieg einen Moment und überdachte seine neue Lage. Portal oder nicht, es gab einiges, was er bewerkstelligen musste. Das Wichtigste zuerst: Er musste im Geist ein Schachbrett aufbauen, die Stellung der Figuren überdenken und seinen nächsten Zug planen. Und dafür brauchte er eine Operationsbasis. Leng wusste nicht nur, dass Constance Greene hier war, sondern auch sein eigener Bruder Aloysius. Und dieses Wissen machte den Mann unendlich gefährlich.
Doch es gab etwas, das Leng nicht wusste.
Diogenes räusperte sich. »Guter Mann«, sagte er, »kennen Sie zufällig jemanden, der Zimmer vermietet? Vorzugsweise ruhig und abseits gelegen, vielleicht in einem Viertel, in dem man sich darauf verlassen kann, dass sich die Leute um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern?«
»So jemanden kenne ich tatsächlich, Sir«, sagte der Mann und ließ erneut die Zügel schnalzen.
3
Eine Meile weiter nordwestlich balancierte Lieutenant Commander Vince D’Agosta vom NYPD unsicher auf dem Sturz unter einem Fenster im ersten Stock eines Anwesens an der Ecke Fifth Avenue und Forty-Eigth Street. Er hatte in der Hoffnung auf ein heimliches Eindringen die raue Fassade erklommen, war jedoch nicht mehr so überzeugt von seinem Vorhaben. Die unregelmäßigen Steinquader, rechteckige Formen in der Dunkelheit, waren eiskalt. Und es war dunkel – in der Fifth Avenue war es finsterer, als er sich je hatte vorstellen können. Das war gut und schlecht. Gut, weil sein lahmer Kletterversuch weder von Fußgängern noch vorbeifahrenden Droschken beobachtet werden konnte; schlecht, weil er selbst kaum sah, was er tat.
Er blickte zu dem offenen Fenster mit den wehenden Vorhängen im zweiten Stock hoch. Lengs Igor-ähnlicher Helfer, der sadistische Scheißkerl namens Munck, war gerade eben auf demselben Weg hochgeklettert, hatte das Fenster aufgebrochen und war ins Haus eingedrungen – hatte also genau das getan, was D’Agosta auf Pendergasts Geheiß verhüten sollte.
Er nahm den nächsten Stock in Angriff, zog sich erst mit der Hand hoch, stützte dann die Füße auf dem Fenstersturz ab und erreichte so eine Stelle, an der nur die herausragenden Steine und der bröcklige Verputz Halt boten. Er versuchte, sein Herzklopfen zu ignorieren, und zog sich hoch, dann hielt er inne, um zu Atem zu kommen, sorgsam darauf bedacht, nicht nach unten zu schauen, während seine Muskeln von der ungewohnten Anstrengung zitterten und zuckten.
Sie dürfen sich unter keinen Umständen Constance zu erkennen geben, hatte Pendergast gesagt. Falls Munck auftaucht, halten Sie ihn auf. Möglicherweise müssen Sie ihn töten. Tja, er hatte ihn nicht aufgehalten: Munck war wie ein Fassadenkletterer die Mauer hoch und ins Haus geglitten, ehe D’Agosta in seinem Versteck auf der anderen Straßenseite reagieren konnte. Und doch durfte D’Agosta Constance Greene nicht warnen. Das hätte alles verdorben.
Was sollte er jetzt tun? Versuchen, sich den Hals zu brechen?
Nicht einmal zwei Meter trennten ihn von dem Fenster im zweiten Stock, doch die Steinquader boten wenig Möglichkeiten, sich festzuhalten und hochzuhieven. Trotzdem musste er weiter, sonst ging ihm die Kraft aus und er stürzte ab.
Er bewegte sich zur Ecke seines gefährlichen Hochsitzes über dem Fenster im ersten Stock. Daneben befand sich ein Ring, den die Maurer in den Stein getrieben hatten. Ohne noch einmal nachzudenken, nahm er alle Kraft zusammen, sprang, reckte sich und packte den Ring. Er zog sich hoch, brachte seinen Fuß hinein, tastete blind nach dem abfallenden Fenstersims über sich und schaffte es, sich am Holzrahmen des Fensters festzuklammern. Plötzlich begann der Verputz unter seinen Füßen zu bröckeln, und in blinder Panik machte er einen brutalen Klimmzug, zog sich über die Schwelle und fiel kopfüber in den dunklen Raum dahinter. Dort blieb er mit pochendem Herzen, verschrammten Händen und Knien und nach Atem ringend auf dem Boden liegen.
Angefangen hatte das alles mit einem Streit mit seiner Frau Laura. Sie war gegangen – und einem zornigen Impuls folgend hatte er Pendergast besucht und wider besseres Wissen zugesagt, ihm zu helfen. Letzten Endes hatte die kleine Auseinandersetzung ihn aus seinem komfortablen Leben im einundzwanzigsten Jahrhundert ins neunzehnte Jahrhundert gestürzt, wo er nun auf der Jagd nach einem mörderischen Scheißkerl, der eigentlich schon seit hundert Jahren tot sein sollte, keuchend auf dem Boden lag.
Scheiße am Stiel, er sollte besser voranmachen. Er rappelte sich in dem finsteren leeren Zimmer auf, zog seinen .45er aus der Tasche, schlich auf Zehenspitzen zur Tür und öffnete sie lautlos.
Dahinter lag ein eleganter Flur – und auf dessen Boden ein regloser Mann, dessen Blut im Teppich versickerte. Munck hatte bereits jemanden umgebracht.
Eine Tür neben D’Agosta öffnete sich, und eine in einen Umhang gehüllte Gestalt trat heraus – Munck. Er hielt ein kleines Mädchen am Nacken gepackt. Sie war geknebelt, ihre Augen so groß wie Untertassen. Munck drehte sich um, erblickte D’Agosta und setzte ihr umgehend ein Messer an die Kehle.
»Lassen Sie die Waffe fallen«, befahl er D’Agosta flüsternd.
D’Agosta erstarrte.
»Jetzt«, sagte Munck und stach dem Mädchen mit der Messerspitze ins Fleisch.
D’Agosta streckte den Arm aus und ließ die Waffe am Abzug baumeln.
»Auf den Teppich«, sagte der Mann.
D’Agosta kniete sich gehorsam hin.
»Ich verschwinde jetzt«, sagte Munck. »Falls Sie Alarm schlagen, ehe wir aus der Haustür sind, schneide ich ihr die Kehle durch.«
Der Mann senkte das Messer vom Hals des Kindes, als er begann, rückwärts auf die Treppe zuzugehen. Und in diesem Moment wusste D’Agosta, dass ihm – entgegen den Anweisungen, die er erhalten hatte – keine andere Möglichkeit blieb, als zu handeln.
Er sprang vorwärts und stürzte sich auf den Mistkerl, der zur Seite sprang, mit dem Messer ausholte und D’Agostas Unterarm aufschlitzte, als dieser die Waffe abwehrte. Munck, der das Mädchen weiter gepackt hielt, taumelte, fand seine Balance dann wieder und holte erneut mit dem Messer aus, in der Absicht, es D’Agosta in den Rücken zu stoßen. Doch das Mädchen behinderte ihn, und das gestattete D’Agosta, seinen Arm hochzureißen und den Stoß abzufangen. Er knallte Muncks Unterarm gegen die Wand, und das Messer flog davon.
Wieder bewegte Munck sich rückwärts in Richtung Treppe und zerrte das Kind mit sich. In diesem Augenblick wurde ein Ziervorhang zur Seite gerissen, und aus einer dahinter verborgenen Tür tauchte eine Frau auf. Einen Schürhaken schwingend, stürzte sie auf Munck zu.
»Meurs, bâtard!«, schrie sie.
Munck, das Mädchen fest an sich gepresst, hob in einem seltsamen, kriegerischen Salut die linke Hand und verdrehte dabei sein Handgelenk. Man hörte Stahl klirren, und plötzlich schossen drei lange, dünne Klingen unter seinen Fingern hervor: eine Sprungfederklaue, verborgen an seinem Unterarm. Die Frau schwang den Schürhaken, doch Munck duckte sich, holte mit dem Arm aus und schlitzte ihr brutal den Leib auf. Als sie stürzte, griff Munck mit animalischer Geschwindigkeit D’Agosta an, der in einem verzweifelten Versuch, den Schlag abzuwehren, herumwirbelte, dennoch – obwohl die blutige Klaue D’Agosta knapp verfehlte – traf ihn das Metallgehäuse an der Schläfe. D’Agosta taumelte zurück, vor seinen Augen blitzten grelle Lichter, und er stützte sich an der Wand ab, um nicht zu fallen. Der Mann stürmte die Treppe hinunter und zerrte das Mädchen grob mit sich. D’Agosta, der wieder zu sich kam, hob seine Waffe vom Boden auf und torkelte zum Absatz.
Er hörte, wie das Haus zum Leben erwachte. Als er den Absatz erreichte, sah er Munck, das Mädchen hinter sich herzerrend, durch den Vorflur und die erste der beiden auf die Straße führenden Türen hasten. D’Agosta hob die Waffe, zögerte jedoch, da er den Mann nicht risikolos ins Visier nehmen konnte, ohne das Mädchen zu treffen.
Plötzlich rauschte eine Gestalt mit erhobenem Stilett aus dem dunklen Salon – Constance –, grauenerregend in der lautlosen Geschwindigkeit ihres Angriffs. Munck erreichte die Außentür und packte den Griff, riss sie auf, doch Constance warf sich dagegen und schloss sie wieder; D’Agosta sah Stahl blitzen, und Munck torkelte mit einem Aufschrei zurück, eine Wunde im Gesicht. Doch dann riss er sich zusammen, warf sich auf Constance und schlitzte mit seiner albtraumhaften Waffe ihren Messerarm auf. Das Stilett flog davon. Wieder riss er die Tür auf und rannte mit dem Mädchen in die kalte Dezembernacht. Constance, aus deren Ärmel Blut quoll, klaubte ihren Dolch vom Boden auf und setzte zur Verfolgung an.
D’Agosta versuchte, ihr hinterherzulaufen, aber als er die Schwelle erreichte, zwang ihn ein aufwallendes Schwindelgefühl, innezuhalten … und zuzusehen, wie Munck in die Kabine einer schnittigen Kutsche kletterte, die soeben vor dem Anwesen vorgefahren war. Eine im Handschuh steckende Hand zog Munck und das von ihm umklammerte Mädchen hinein, und dann trabten die Pferde an, galoppierten gefährlich schnell die Fifth Avenue hinunter und verschwanden in der winterlichen Dunkelheit. Er sah Constance die Treppe hinunter und bis zur Straßenecke rennen, wo sie im schmutzigen Schnee auf die Knie sank und vor Zorn und Schmerz schrie, die blutigen Hände in die Nacht gereckt, das Stilett im Licht der Gaslaternen glitzernd.
Alles um ihn begann sich zu drehen, und D’Agosta spürte, wie er auf der Schwelle zusammenbrach. Dunkelheit umfing ihn, und er verlor den Kampf darum, bei Bewusstsein zu bleiben.
Er war nicht sicher, wie viel Zeit vergangen war, doch es konnte nicht lange gewesen sein. Er lag auf dem Boden im Salon und blickte zu Constance auf, deren violette Augen vor Zorn glühten.
Man hörte schwere Stiefeltritte, und ein Kutscher erschien auf der Szene. »Euer Gnaden, Ihr seid verwundet!«, rief er mit schwerem irischen Akzent.
»Murphy, sehen Sie nach Féline«, befahl Constance. »Und suchen Sie Joe und beschützen ihn. Es könnten noch andere im Haus sein.«
Weitere Dienstboten tauchten auf, verängstigt von dem Aufruhr. Constance starrte noch immer D’Agosta an, ihr furchterregender Blick ließ ihn seinen hämmernden Kopf vergessen, die schreckliche Situation … alles. Er wollte etwas sagen, erklären, aber er konnte nicht klar genug denken. Stattdessen kämpfte er sich in eine sitzende Haltung, während sich alles um ihn drehte.
Ein Dienstmädchen versorgte Constance’ verletzten Arm und verband ihn mit Leinen. Sie hielt ihr Stilett nun in der anderen Hand und richtete es auf D’Agosta. »Ehe ich Sie umbringe«, sagte sie mit leiser, zitternder Stimme, »verlange ich eine Erklärung.«
D’Agosta rang noch immer um Worte. Während Constance sich zu ihm herabbeugte und er sich seltsam unbeteiligt fragte, ob sie ihm wirklich die Kehle aufschlitzen würde, hörte er aus der Ferne die klappernden Hufe eines galoppierenden Pferds – und dann, wesentlich lauter, ein Hämmern an der Eingangstür.
»Aufmachen!«, ertönte ein Schrei von draußen.
Constance fuhr bei der Stimme zusammen, durchquerte dann den Eingangsbereich und riss die Haustür auf. Davor stand Pendergast, erschöpft keuchend.
»Du!«, war alles, was sie sagte.
Pendergast schob sich an ihr vorbei, sah D’Agosta, eilte hinüber und kniete sich neben ihn. »Haben sie Binky?«, fragte er.
D’Agosta nickte.
Während Pendergast D’Agostas Wunde untersuchte, sprach er in kaltem Ton mit Constance. »Du und ich sollten uns nie in dieser Welt treffen«, sagte er. »Aber da es nun geschehen ist, solltest du lieber alles erfahren – und zwar rasch. Leng weiß von der Maschine. Er weiß, wer du bist. Er weiß, dass du aus der Zukunft gekommen bist, um ihn zu töten. Er weiß alles.«
Constance starrte ihn an. »Unmöglich.«
»Absolut möglich«, sagte Pendergast. »Wir müssen uns rüsten. Es gilt, keine Zeit zu verlieren.«
»Er hat Binky entführt –«
»Er ist dir – und mir – ständig einen Schritt voraus gewesen. Und das ist nur der Anfang. Zorn ist ein Luxus, den du dir jetzt nicht leisten kannst. Deine Schwester ist in größter Gefahr. Wir müssen –«
Ein zögerndes höfliches Klopfen an der Tür unterbrach ihn.
Alle drehten sich zu dem Geräusch.
»Scheint eine Lieferung, Euer Gnaden«, sagte der Butler, der seine Haltung wiedergewonnen hatte, mit einem Blick durch den Türspion.
»Schicken Sie sie fort«, rief Constance.
»Nein«, sagte Pendergast, zog seine Waffe, stellte sich neben die Tür und zielte auf den Eingang. Er nickte dem Butler zu. »Öffnen Sie.«
Ein livrierter Bote stand auf der Schwelle, in der Hand ein hübsch verpacktes, mit Schleife und duftenden weißen Lilien verziertes Geschenkpaket. »Lieferung für Ihre Gnaden, die Herzogin von Ironclaw«, sagte er.
Constance starrte den Mann an. »Was zum Teufel ist das?«
»Es liegt eine Nachricht dabei, Madam«, sagte der Lieferant, der mit weit aufgerissenen Augen die Szene vor sich betrachtete.
Sie entriss ihm das Paket, klemmte es unter den Arm und zog den Umschlag heraus, riss ihn auf und entnahm ihm eine Karte mit schwarzem Rand. Sie starrte darauf und erbleichte. Dann ließ sie die Karte fallen, riss die goldene Verpackung herunter, warf die Blumen zu Boden und enthüllte einen kleinen Mahagonikasten. Sie hob den Deckel. D’Agosta sah es silbern aufblitzen. Constance griff hinein und nahm eine silberne Urne heraus, dann ließ sie den Kasten fallen. Sie hob die Urne mit beiden Händen vor ihr Gesicht und starrte auf das gravierte Schild auf der Wölbung. Einen Moment war alles still … und dann glitt die Urne durch ihre tauben Finger und krachte auf den Boden, der Deckel flog davon, und die über den Boden rollende Urne zog eine Spur grauer Asche hinter sich her. Schließlich kam sie an D’Agostas Bein zum Stillstand, mit der Gravur nach oben. Blinzelnd las er sie, seine Sicht war noch immer verschwommen, doch die in das Silber geätzten Worte waren deutlich und klar zu erkennen:
MARY GREENE
GESTORBEN AM26. DEZEMBER1880
IM ALTER VON19JAHREN
ASCHE ZU ASCHE
STAUB ZU STAUB
4
D’Agosta lehnte in einem Ohrensessel und beobachtete, wie die aufgehende Sonne vergeblich versuchte, durch die Läden zu dringen, die den Salon in Dunkelheit hüllten.
In den Stunden, die seit dem Überfall dahingekrochen waren, war das Haus in eine Schockstarre verfallen. Die von Munck aufgeschlitzte Féline war von Pendergast genäht und verbunden worden. Zudem hatte er ihr ein Antibiotikum gespritzt, das er aus dem einundzwanzigsten Jahrhundert mitgebracht hatte. Der Kutscher Murphy hatte den Toten – den Hauslehrer der Kinder – in den Keller getragen und ihn unter einem vor Kurzem gelegten Ziegelboden vergraben. Joe, Constance’ Bruder, war oben, ein Dienstmädchen sah nach ihm. Die übrigen Dienstboten hatten sich in ihre Kammern zurückgezogen, bis auf den Butler Gosnold, der darauf bestand, weiter seinen Dienst im Salon zu versehen.
Die Urne und die verstreute Asche waren aufgefegt und weggeräumt worden. Die Begleitkarte jedoch befand sich noch immer dort, wo Pendergast sie nach dem Lesen ihres Inhalts hingelegt hatte: auf einem Beistelltisch neben D’Agosta. Die ganze lange Nacht hatte D’Agosta sich nicht durchringen können, sie zu lesen. Doch während der Himmel draußen stetig heller wurde, wandte er schließlich schmerzerfüllt den Kopf in Richtung des Tischs, streckte den Arm aus und hob sie auf.
Meine liebste Constance,
mit der Versicherung meines Beileids überreiche ich Ihnen die Asche Ihrer älteren Schwester, begleitet von meinem Dank. Die Operation war höchst erfolgreich.
Ihr Plan war von Beginn an verzweifelt. Ich ahnte, dass Sie mich hintergehen würden, doch auf welche Weise Sie mich betrügen würden, gab mir Rätsel auf. Und dann, mirabile dictu, wurde das Instrument, das den genauen Plan enthüllen konnte, ins Bellevue eingeliefert und gelangte von dort in meine Hände.
Sie haben das Elixier; ich habe Sie, oder genauer: Ihr jüngeres Ich. Geben Sie mir die Formel, die wahre und vollständige Formel, und das Mädchen wird unverletzt zu Ihnen zurückkehren. Und damit wären unsere Geschäfte abgeschlossen. Bis auf eine Sache. Diese Welt ist nicht die Ihre; sie gehört mir. Sie und die, die Ihnen gefolgt sind, werden umgehend in Ihre eigene Welt zurückkehren – oder die Konsequenzen tragen.
Sie werden unsere Vereinbarung bestätigen, indem Sie eine Kerze in eine blaue Laterne stellen und diese im Fenster des südöstlichen Schlafzimmers im dritten Stock aufhängen. Ich werde mich dann mit weiteren Anweisungen mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sollte ich das Signal nicht innerhalb von 48 Stunden erhalten, wird die junge Constance das Schicksal ihrer älteren Schwester erleiden.
Bis zu unserem nächsten Schriftwechsel verbleibe ich
Ihr ergebener etc.
Dr. Enoch Leng
D’Agosta fluchte leise und legte die Nachricht beiseite.
Nach der Flucht Muncks in der Kutsche war Constance weißglühend vor Zorn gewesen und hatte – davon war D’Agosta überzeugt – am Rand des Wahnsinns gestanden. Ihre wilde Hysterie war das Verstörendste, das er jemals beobachtet hatte. Pendergast hatte geschwiegen, sein Gesicht eine bleiche marmorne Maske. Er hatte ihren Verwünschungen und Beschuldigungen gelauscht, ohne etwas zu entgegnen. Und dann hatte er sich erhoben, nach Féline gesehen und stumm die Säuberung des Mordschauplatzes und die Beseitigung der Leiche überwacht. Jedermann schien stillschweigend übereingekommen zu sein, die Behörden herauszuhalten – was, wie D’Agosta wusste, unweigerlich zur Katastrophe führen würde.
Und nun saßen die drei im Salon, versunken in eine Kombination aus Trauer, Schuldgefühlen und Schock, während ein neuer und ungewisser Tag vor den geschlossenen Fensterläden herankroch.
Nach ihrer Tirade war Constance abrupt in lang anhaltendes Schweigen verfallen. Nun verschwand sie nach oben. Zehn Minuten später kehrte sie zurück, ein kleines abgewetztes Notizbuch in der Hand.
Sie wandte sich an den Butler, der noch immer am Eingang zum Salon stand. »Zünden Sie ein Licht in einer blauen Laterne an und stellen Sie diese ins Fenster des letzten Schlafzimmers auf der rechten Seite im dritten Stock.«
»Jawohl, Euer Gnaden.« Gosnold verschwand.
»Nur einen Moment«, sagte Pendergast. Er wandte sich an Constance. »Ist das die echte Formel zur Lebensverlängerung – das Arkanum?«
»Hast du geglaubt, als Einziger im Besitz einer Kopie zu sein? Eins hast du vergessen: Ich war dort, als er es entwickelt hat.«
»Du hast demnach die Absicht, Lengs Anweisungen zu gehorchen? Du willst ihm das Arkanum geben – was ihm gestatten wird, seinen Plan auszuführen?«
»Es spielt keine Rolle, ob er das Arkanum hat. Er wird nicht lange genug leben, um es zu benutzen. Dafür werde ich sorgen.«
Pendergast verlagerte sein Gewicht auf dem Sessel. »Glaubst du nicht, dass Leng deine Absicht bereits erahnt?«
Constance starrte ihn an. »Das spielt keine Rolle.«
»Ich fürchte doch. Leng weiß alles und ahnt alles voraus. Ob du es nun zugibst oder nicht, er ist weitaus gerissener als jeder von uns. Nicht nur das – er weiß, dass ich hier bin. Er weiß, warum wir hier sind. Er wird vorbereitet sein, was immer du tust – was immer wir tun.«
»Das wird er nicht«, erklang plötzlich eine leise Stimme aus der Dunkelheit. »Nicht auf mich.«
In der rückwärtigen Tür des Salons flammte ein Streichholz auf.
Und dann trat eine Gestalt herein, während sie sich eine lachsfarbene, in einem Ebenholzhalter steckende Lorillard-Zigarette anzündete. Die Flamme erhellte das bleiche Gesicht, die Adlernase und die hohe glatte Stirn, den ingwerfarbenen Bart und die beiden Augen – das eine braun, das andere milchig blau – von Diogenes Pendergast.
D’Agosta war wie betäubt. Niemand sprach. Diogenes Pendergast kann nicht hier sein, dachte er, nicht in diesem Paralleluniversum, nicht im Jahr 1880. Doch dort stand er.
Im allgemeinen Schweigen streifte Diogenes seinen Mantel ab und warf ihn über eine Sessellehne, nahm Platz und legte bedächtig seinen Hut auf den Beistelltisch. »Ich bitte um Entschuldigung, Frater. Wie ungezogen von mir, einfach so hereinzuplatzen. Ich hätte geklopft, aber ich wollte nicht stören, deshalb schien es mir das Beste, einfach einzutreten. Was für eine entmutigende Situation«, fuhr er fort, seine Stimme wie geschmolzene Butter, die auf Honig träufelt. »Und du hast recht, wenn du sagst, dass unser verehrter Ahne auf alles vorbereitet ist, was immer ihr tun mögt. Doch ist es genau das, was meine Gegenwart zu einem Glücksfall macht.«
»Wie bist du hierhergelangt?«, fragte Pendergast gereizt.
Die Spitze der Zigarette glühte rot auf, als Diogenes daran zog, und Nelkenduft waberte durch den Salon. »Man hat sozusagen die Gartenpforte offen gelassen. Am Riverside Drive, wo dieser ungehobelte Wissenschaftler eure Maschine benutzt hat, um sich zu bereichern. Übrigens ist besagte Maschine leider nicht länger funktionsfähig.«
Nicht funktionsfähig? Die Information versetzte D’Agosta trotz der nonchalanten Weise, in der sie überbracht wurde, in Angst.
Diogenes unterbrach sich kurz, um an seiner Zigarette zu ziehen und eine Rauchwolke auszustoßen. »Diese Welt ohne Elektrizität ist ziemlich barbarisch«, bemerkte er in demselben schmelzenden Ton, den er seit seinem Erscheinen anschlug. »Doch wenigstens weiß man noch nichts von Lungenkrebs.«
»Warum«, fragte Constance so eisig, dass man mit ihrer Stimme Stickstoff hätte gefrieren können, »sollten wir auch nur daran denken, uns noch einmal mit dir einzulassen?«
»Liebste Constance, gestatte, dass ich dir eine Frage stelle«, erwiderte Diogenes. »Was kann ich am besten?«
Constance zögerte nicht. »Morden.«
Diogenes klatschte beifällig. »Exakt. Mörder von Hoffnungen, Träumen, Liebe, doch ganz besonders von menschlichen Wesen.« Er drückte seine halb gerauchte Zigarette im nächsten Aschenbecher aus, als wollte er seine Aussage unterstreichen, nahm dann eine neue und steckte sie in den Halter. »Und nun«, er wandte sich an Pendergast, »eine Frage an dich: Erinnerst du dich an meine letzten Worte in jener Nacht, in der ich in den Sümpfen der Florida Keys verschwand?«
Pendergast zögerte nur einen Moment, dann zitierte er: »Ich bin der Tod.«
»Ausgezeichnet. Meine genauen Worte. Ich bin so froh, endlich in der Lage zu sein, denen, die ich liebe, einen Gefallen zu erweisen. Einen einzigartigen Gefallen.« Er zündete ein Streichholz an. »Ich bin gekommen«, sagte er, »um euer Racheengel zu sein.« Dann schüttelte er die Flamme aus und lachte in sich hinein, ein leiser, unheilschwangerer Klang, der ewig zu tönen schien, ehe er erstarb und sich erneut Schatten und Stille über den Raum senkten.
TEIL EINS
DUNKELHEIT FÄLLT
5
Allmählich erlangte Proctor das Bewusstsein wieder. Als Erstes spürte er, dass er auf einem harten Betonboden lag. Als Zweites die Schmerzen.
Er regte sich nicht. Instinkt und Training hatten ihn gelehrt, in einer unerwarteten Gefahrenlage wie dieser nicht zu zeigen, dass er bei Bewusstsein war, ehe er sich einen größtmöglichen Überblick über die Situation verschafft hatte.
Er nutzte die Schmerzen als Werkzeug, um seinen Zustand abzuschätzen. Zögernd fuhr er mit der Zunge durch den Mund, schmeckte Blut und Dreck. Ein Zahn war abgesplittert, und seine Nase fühlte sich an, als könnte sie gebrochen sein.
Ohne sich durch eine wahrnehmbare Bewegung zu verraten, spannte er seine Glieder eins nach dem anderen, von den Ellbogen bis zu den Fingerspitzen, von den Hüften bis zu den Zehen. Anscheinend insgesamt funktionsfähig; abgesehen von seiner Nase und vielleicht einem Jochbeinbogen schien nichts gebrochen.
Dann atmete er langsam und vorsichtig tief ein. Kein Pneumothorax.
Noch langsamer schlug er erst ein Auge auf, dann das andere. Obwohl blutverschmiert, waren seine Augen in Ordnung, seine Sicht nicht beeinträchtigt. Ebenso sein Gehör.
Er blieb zehn Minuten lang reglos liegen, während seine Sinne wieder volle Kapazität erlangten und seine letzte bewusste Erinnerung zurückkehrte. Ferenc, der Dreckskerl. Er hatte in Proctors Konsole eine Sprengfalle versteckt, die ein Betäubungsmittel oder Nervengift verströmte … während die Maschine auf Hochtouren lief und das Portal offen stand.
Er war überzeugt, dass Ferenc nicht hier war; dass der Mann die Maschine benutzt hatte. Der Raum war still – tatsächlich zu still –, und der üble Gestank von verschmorten Leitungen und Elektronik hing in der Luft.
Proctor machte sich bereit. Dann rollte er sich mit hoher Geschwindigkeit auf den Rücken, ballte die Fäuste und zog die Knie an, wobei er den Kopf leicht vom Boden abhob, um die Schmerzen an Wange und Nase zu minimieren. Trotzdem war der Schmerz, den die plötzlichen Bewegungen auslösten, enorm. Er ignorierte ihn und schaute sich um. Keine Spur von Ferenc.
Jetzt wusste Proctor, dass er die Maschine benutzt hatte. Vorsichtig kam er auf die Beine, sah nach seiner Waffe, zog den Stuhl von seinem Arbeitstisch in die Mitte des Raums und setzte sich.
Er starrte die Maschine an. Ein rauchendes Wrack.
Es zählte nicht mehr, dass er erfolgreich jedes einzelne Teil dieser Maschine in der originalen Anordnung von Savannah in diesen Kellerraum des Anwesens am Riverside Drive transportiert hatte. Es zählte nicht mehr, dass er einen Wissenschaftler aufgetrieben hatte, der sie reparieren konnte – Ferenc –, ihn nicht nur überzeugt hatte, die Arbeit zu übernehmen, sondern ihn auch im Auge behielt, bis endlich Pendergast und sein Freund D’Agosta das Portal durchqueren konnten. Es zählte nicht mehr, weil er seinen Arbeitgeber im Stich gelassen hatte. Er hatte zugelassen, dass dieser Wurm Ferenc ihn übertölpelte, ihn lange genug außer Gefecht setzte, um die Maschine zu nutzen.
Und wegen dieses Versagens saßen Pendergast und die anderen nun in diesem Paralleluniversum im Jahr 1880 fest.
Er sah auf die Uhr. Er war einige Stunden weggetreten gewesen. Warum war Ferenc nicht zurückgekehrt? Die Maschine lief die ganze Zeit auf Hochtouren, ja, mehr als das. Vielleicht war das Wiesel auf der anderen Seite des Portals aufgehalten worden. Vielleicht war er gestorben. Auf jeden Fall konnte er jetzt nicht mehr zurück: Die Maschine hatte sich überhitzt und war implodiert. Proctors Kenntnis der Vorrichtung beschränkte sich auf die Kontrollen an den Konsolen. Ferenc hatte als Einziger am Innenleben der Maschine gearbeitet; als Einziger über genug Wissen verfügt, um sie zu reparieren.
Nicht, dass eine Reparatur möglich schien.
Proctor blieb noch einen Augenblick sitzen, den Blick fest auf das Wrack gerichtet. Dann stand er auf, trat, ohne sich noch einmal umzuschauen, zur Tür, öffnete sie und verschwand in den dämmrigen Fluchten des Kellers.
6
Gosnold erschien wieder im Salon und verbeugte sich knapp. »Euer Gnaden, die blaue Laterne wurde wie gewünscht im Fenster platziert.«
D’Agosta sah, wie Constance’ Hand sich fester um das kleine Notizbuch klammerte. Nun wieder bei klarem Verstand, machte er den Mund auf. »Was haben Sie vor, Diogenes?«, fragte er.
»Der sture Polizist kommt direkt zum Punkt«, sagte Diogenes, zog an seiner Zigarette, legte den Kopf zurück und blies den Qualm an die Decke. »Ich will meine Aktivitäten seit meiner Ankunft zusammenfassen. Sie werden sie interessant finden. Ich habe diesen angeheuerten Wissenschaftler Ferenc beobachtet, als er seinen unausgegorenen Plan durchführte. Er schaltete Proctor aus und benutzte selbst die Maschine. Ich war dort, ich habe alles gesehen – und aus einem Impuls heraus sprang ich ihm hinterher durch das Portal. Eine unüberlegte Handlung, die ich vermutlich bereuen werde. Ich landete auf dem Longacre Square im Pferdedung – ein angemessenes Willkommen im neunzehnten Jahrhundert. Und dann beging ich einen Fehler: Ich habe Ferenc nicht auf der Stelle umgebracht. Stattdessen folgte ich ihm zu einer Bank, in der er sich seltene Münzen beschaffen wollte, aber die Sache vermasselte, einen Aufruhr verursachte und behauptete, aus der Zukunft zu stammen. Selbstverständlich verfrachtete man ihn ins Bellevue, wo er zu meinem Bedauern von Leng entdeckt wurde.«
Er zog wieder an seiner Zigarette.
»Leng brachte Ferenc vom Bellevue in seinen Unterschlupf in Five Points. Man kann sich vorstellen, was dort passierte. Überflüssig zu erwähnen, dass der brave Doktor nun all unsere Geheimnisse kennt: die Maschine, den Standort des Portals, den wahren Grund für eure Anwesenheit hier – einfach alles. Seine erste Reaktion bestand darin, zum Longacre Square zu rasen und das Portal zu suchen. Ohne Erfolg, wie ich erfreut mitteilen kann. Könnt ihr euch einen aufs einundzwanzigste Jahrhundert losgelassenen Leng vorstellen? Das war Ferenc’ einzige gute Tat: die Maschine zu übersteuern und damit zu zerstören, sodass Leng sie nicht nutzen kann. Wir selbstverständlich auch nicht.«
Er stieß ein freudloses Lachen aus, bei dem D’Agosta Schauer über den Rücken liefen. Er schaute hinüber zu Constance und in ihr zu einer eisigen Maske erstarrtes Gesicht.
»Sie haben immer noch nicht erklärt, warum Sie hier sind«, sagte D’Agosta. »Warum uns helfen?«
»In Wahrheit? Nun gut. Womöglich war meine Nutzung des Portals nicht ganz so impulsiv, wie ich vorgegeben habe. Während ich meinen Bruder ausspionierte – meine Lieblingsbeschäftigung in den vergangenen Jahren –, sah ich die Wunder dieser Maschine und erkannte gleichzeitig eine eigentümliche Gelegenheit. Die Welt dort drüben«, er schnippte Asche über seine Schulter, als läge die Zukunft in dieser Richtung, »ist nur noch von grotesken Erinnerungen erfüllt. Hier ist eine neue Welt, in der ich unbekannt bin und keine Geschichte habe.«
Darüber schüttelte D’Agosta den Kopf – behutsam.
»Erst danach wurde mir bewusst, dass ich ein weiteres Ziel an diesem Ort habe – Leng. Ich wünsche ihn zu entfernen. Er ermordete die Schwester einer Frau, die mir teuer ist«, dies mit einem Blick auf Constance, »und entführte ihre Doppelgängerin. Abgesehen davon ist Leng der Abscheulichste der Pendergasts, ein Fleck auf dem Familienwappen. Und auch wenn es mich traurig stimmt, darauf hinzuweisen, aber du, Bruder, hast versagt. Deine Einmischung hier hat Katastrophen und Tragödien beschworen. Es scheint nur recht, dass ich derjenige bin, der die Dinge in Ordnung bringt.«
»Wie genau lautet denn Ihr Plan?«, fragte D’Agosta. »Er hat Binky. Und jeder Zug gegen ihn bedeutet, ihren Tod zu riskieren. Denken Sie daran, was er Mary angetan hat.«
Abrupt sprang Constance auf, das Notizbuch noch immer fest umklammert. »Gosnold, bitte bringen Sie Joe zu mir.«
Der Butler ging und kehrte kurz darauf mit Joe zurück. Der Junge schaute verängstigt drein, war aber gleichzeitig bemüht, gelassen zu erscheinen. D’Agosta fragte sich, was er gehört und gesehen haben mochte; er ließ sich so wenig anmerken, dass es unmöglich zu erkennen war.
Constance kniete vor dem Jungen nieder und ergriff seine Hand. »Joe«, sagte sie leise, »ich kann nicht alles erklären, was passiert ist – weil ich es selbst noch nicht weiß. Aber du weißt bereits genug. Etwas Unerwartetes, sehr Schlimmes ist geschehen. Nun muss ich die Dinge in Ordnung bringen. Ich werde wohl bald zurück sein, oder … einige Zeit fortbleiben.«
Sie hielt inne. Joes Miene war undurchdringlich.
»Diese beiden Männer«, sie wies auf D’Agosta und Pendergast, »sind zuverlässig. Du kannst ihnen vollkommen vertrauen. Féline desgleichen – und Mr Murphy. Diesen vieren – und niemandem sonst.«
Der Junge schaute ausdruckslos.
»Der da heißt Pendergast. Und das da ist D’Agosta.«
Der Junge blickte schweigend von einem zum anderen.
»Hallo, Joe«, sagte D’Agosta, unsicher, was angebracht war. »Du kannst Vinnie zu mir sagen.«
Der Junge reagierte nicht, nur sein Kiefer verspannte sich leicht.
Constance ergriff mit ihrer bandagierten Hand sanft seinen Arm, und einen Moment lag Stahl in ihrer Stimme. »Hast du verstanden, Joe? Um was immer Pendergast und, äh, Vinnie dich bitten, gehorche bitte. Sie haben nur dein Bestes im Sinn.«
Joe nickte knapp.
»Und nun«, sie küsste ihn auf den Scheitel, »muss ich aufbrechen. Ich weiß, du wirst stark sein – für deine Schwester und für mich. Mr Pendergast war mein Beschützer … einst. Er wird dich gemeinsam mit Vinnie beschützen, solange ich fort bin.«
Kurzes Zögern, dann wieder ein Nicken.
Constance erhob sich. »Gosnold, holen Sie meinen Reiseumhang und sagen Sie Murphy, er soll die Kutsche vorfahren.« D’Agosta sah, wie sie das kleine Notizbuch in die Tasche Constance’ steckte.
Gosnold verbeugte sich, zog sich zurück und erschien einen Moment später mit dem schweren Umhang, den sie entgegennahm und umwarf. Einige Minuten danach fuhr die Kutsche vor, Murphy auf dem Bock. Gosnold hielt ihr die Tür auf.
D’Agosta sah Pendergast an, doch der blieb vollkommen still, sein Gesicht wie Marmor. Warum sagte oder tat er nichts?
»Sie wollen doch nicht etwa zu Leng, oder?«, fragte D’Agosta Constance schließlich.
Constance drehte sich mit glühendem Blick zu ihm um. »Selbstverständlich.«
»Aber seine Anweisungen wegen der Lampe … das ist irre.«
»Vielleicht.« Mit wehendem Umhang rauschte sie durch die Tür und erklomm die Stufen der Kutsche. Als Gosnold hinter ihr den Eingang schloss, hörte D’Agosta, wie sie Murphy zurief: »Zur Post Road …«
Die Tür schloss sich.
»Zum Teufel noch mal!« D’Agosta wandte sich an Pendergast. »Wir können sie doch nicht einfach so gehen lassen!«
Endlich machte Pendergast den Mund auf. »Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Sie bringt ihm das Arkanum.«
D’Agosta blickte zwischen Pendergast und Diogenes hin und her. »Und Sie finden das in Ordnung?«
»Nein«, sagte Pendergast.
»Aber Sie haben sie fahren lassen!«
»Hatten Sie denn den Eindruck, man hätte sie aufhalten können?« Pendergast zog eine Augenbraue hoch.
Diogenes lachte. »Frater, du und ich kennen das Temperament dieser Frau.«
»Aber –« D’Agosta schluckte. »Nach all der sorgfältigen Planung, nach all dem, was wir … Was denkt sie sich bloß!«
»Vincent«, sagte Pendergast müde, »sie denkt nicht. Aber wir müssen es ihr gestatten, wie impulsiv und überhastet auch immer sie agiert. Das schulden wir ihr. Natürlich wird sie scheitern. Aber wenn sie zurückkehrt – falls sie zurückkehrt –, wird sie in einem Zustand sein, den niemand von uns sich vorstellen kann. Und was dann passiert, steht völlig offen.« Er atmete tief ein. »Wir müssen uns auf den Sturm vorbereiten.«
7
D’Agosta traute seinen Ohren nicht. Sein Kopf hatte wieder begonnen zu hämmern, und er lehnte sich im Sessel zurück, um den Schmerz zu lindern. Das war verrückt. Wie sollten sie, gestrandet in einer fremden Welt, Constance in den Griff bekommen, Binky retten, Leng töten – und dann wieder nach Hause gelangen?
Er wandte sich an Diogenes. »Sie sagten, die Zeitmaschine sei kaputt. Wie kaputt?«
»Sie meinen, können wir sie benutzen, um zurückzukehren?«, fragte Diogenes. »Wie ich schon sagte, ließ dieser Narr Ferenc den Pegel auf Maximum stehen, als er durchging. Ich nehme an, das war so geplant, um ihm genügend Gelegenheit zu geben, seinen Plan zu verwirklichen und zurückzukehren. Die logischste Erklärung ist, dass der Mann einfach nicht rechtzeitig zurückkehrte, um die Energie zu drosseln – und die Maschine überlastete.«
»Dann stecken wir hier fest?«
»Es sei denn, Proctor kann sie reparieren«, sagte Pendergast.
»Proctor?«, rief D’Agosta. »Er ist der Chauffeur! Wie soll er eine Zeitmaschine reparieren?« Er spürte, wie das Grauen ihn überwältigte. Laura – er würde sie niemals wiedersehen. Das einundzwanzigste Jahrhundert, das New York, das er liebte – nie wieder.
»Mein lieber Vincent«, sagte Pendergast kühl, »ich würde Ihnen raten, sich momentan nicht mit solch existenziellen Fragen zu beschäftigen.« Er stand auf. »Ehe noch Schlimmeres passiert, sollten wir als Erstes die unserer Obhut Anbefohlenen in Sicherheit weit weg von hier bringen. Gosnold, würden Sie Joe nach oben bringen, während wir beraten, was getan werden muss?«
»Sehr wohl, Sir.«
»Ich kann allein gehen«, sagte Joe kühl.
»In diesem Fall pack eine Tasche für dich mit warmer Kleidung, einem Buch und einem Kartenspiel. Du wirst auf Reisen gehen.«
Joe drehte sich steif um und lief nach oben.
D’Agosta wandte sich an Pendergast. »Was soll Leng davon abhalten, Constance umzubringen, nachdem er das Arkanum hat?«
»Zum einen sein misstrauisches Naturell – falls die Formel manipuliert wurde, könnte er sie noch brauchen. Zum anderen glaube ich, dass Constance ein Druckmittel gegen ihn hat.«
»Was für ein Druckmittel?«
»Constance weiß eine Menge über Leng – und wichtiger noch, sie kennt seine Zukunft.«
»Was ich nicht verstehe«, sagte Diogenes, »ist Folgendes: Wenn diese Welt mit der unseren identisch sein soll, nur dass sie in der Vergangenheit des Jahres 1880 liegt, was ist dann dieses Monstrum, das am südlichen Rand des Central Park errichtet wird? So etwas hat es in der Vergangenheit unserer Welt nie gegeben.«
D’Agosta hatte es selbst gesehen, während einer Kutschfahrt mit Pendergast bei seinem ersten Ausflug hierher – ein hässliches, im Bau befindliches Gebäude, das aussah wie ein zehn Stockwerke hoher Schornstein. Er hatte einfach angenommen, dass es wie so viele andere Bauten in Manhattan im Lauf der Zeit verschwunden war.
Pendergast machte eine wegwerfende Geste. »Betrachtet es als Himbeerkern im Gebiss des Raum-Zeit-Kontinuums. Darüber zu spekulieren, wie präzise diese Welt der unseren ähnelt, ist momentan reiner Luxus – sie ist ihr verdammt ähnlich. Joes Sicherheit ist jetzt das wichtigste Thema.«
D’Agosta schaute Pendergast an, der sich ungeduldig vorbeugte. Bildete er sich das ein, oder hatte der Agent gerade geflucht?
»Joe ist in großer Gefahr«, fuhr Pendergast fort. »Das Haus wird zweifellos überwacht, und wir müssen äußerst klug vorgehen.« Er wandte sich an den Butler. »Gosnold, guter Mann, wären Sie so freundlich, eine Nachricht an das nächstgelegene Bestattungsinstitut zu schicken, dass wir die Leiche von Mr