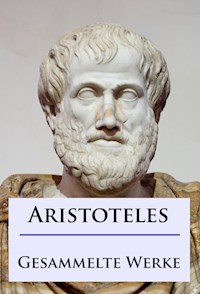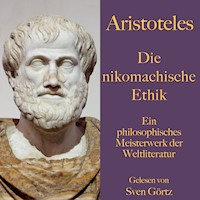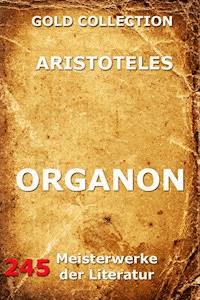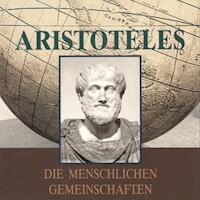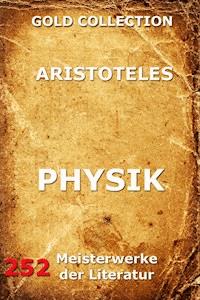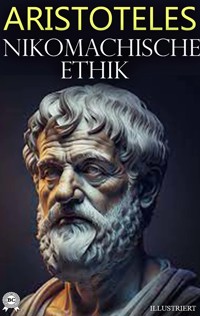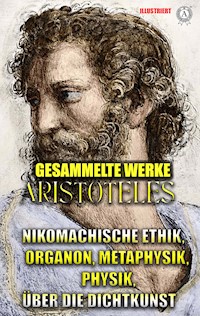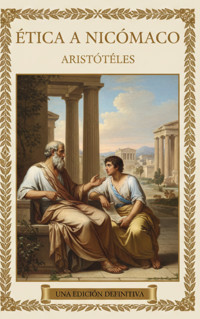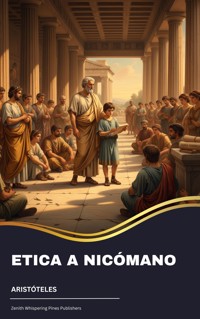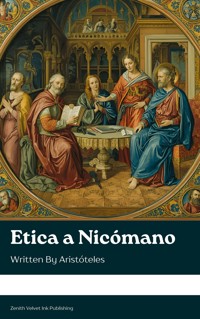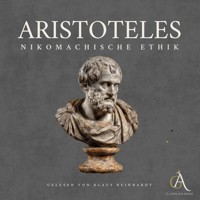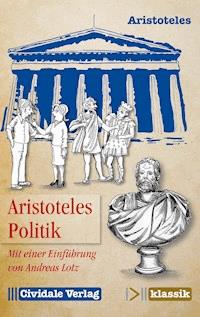
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cividale Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cividale klassik
- Sprache: Deutsch
Ist die „Politie“ die bessere Demokratie? Dürfen Arme und Tugendlose so viel zu sagen haben wie Reiche und Tugendhafte? Und kann ein Gemeinwesen überhaupt noch stabil sein, wenn die Unterschiede zwischen arm und reich zu groß werden? Wie wichtig ist ein breiter Mittelstand für einen funktionierenden Staat? Erstaunlich aktuell, wenngleich nicht mehr überall modern, sind Aristoteles' vielschichtige Antworten auf diese und viele andere Fragen. Zentrale Fragen des politischen Denkens, die er vor weit über 2.000 Jahren gestellt hat! Als einer der ersten Theoretiker behandelt der antike Philosoph zunächst einmal grundsätzliche Fragen: Warum bilden Menschen Staaten? Welche Staatsformen gibt es? Welche von ihnen sind „gut“, welche „entartet“? Wie sollte eine Verfassung aussehen? Der Mensch lebt nicht zufällig in Staaten, sondern ist dazu bestimmt. Die Sprache ermöglicht es ihm dabei, Vorstellungen von Gut und Böse, von gerecht und ungerecht zu entwickeln und diese mit anderen zu teilen. Es sind Feststellungen wie diese, die dem Werk zu seinem Status als Klassiker verholfen haben. Die Ausgabe richtet sich an alle, die sich für die Grundlagen unserer Gesellschaft interessieren und einen leicht verdaulichen Zugang wünschen. Das Besondere: • Eine Leseempfehlung für die wichtigsten Kapitel. • Zeitgenössische Einordnung durch Andreas Lotz. Der Diplompolitologe forscht und lehrt als kooptiertes Mitglied im Sonderforschungsbereich „Transformation der Antike“ an der Humboldt Universität zu Berlin. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich der Politischen Theorie und Ideengeschichte. • Literaturliste mit weiteren Leseempfehlungen. • Natürlich der vollständige Text der „Politik“ in neuer Rechtschreibung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aristoteles
POLITIK
Übersetzung: Dr. theol. Eug. Rolfes
Mit einer Einführung von Andreas Lotz
Der Autor
Aristoteles, geboren 384 v. Chr., gestorben 322 v. Chr., gilt als großer Philosoph und als Begründer der Logik. Seine analytische Vorgehensweise richtete er auf alles und jedes – unter anderem auf die Ethik, den Staat, die Tiere, das logische Denken und die Rhetorik.
Zwischendurch unterrichtete er Alexander den Großen und gründete eine eigene philosophische Schule in Athen. Und natürlich kam er nicht als großer Philosoph auf die Welt, sondern musste sich auch erst einmal ein bisschen Wissen aneignen – das tat er als Schüler Platons an dessen Akademie.
Der Autor der Einführung
Andreas Lotz ist Diplompolitologe und kooptiertes Mitglied im Sonderforschungsbereich "Transformation der Antike" an der Humboldt Universität zu Berlin. Er forscht und lehrt schwerpunktmäßig im Bereich der Politischen Theorie und Ideengeschichte.
1. Auflage
© Cividale Verlag Berlin, 2015
Kontakt: [email protected]
Website: www.cividale.de
ISBN 978-3-945219-09-6
Titelbild: Nina und Christoph von Herrath, www.cvh-graphic-design.de
Lektorat: Carola Köhler
Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
A. Einführung
1. Einleitung
2. Der Wandel der Gemeinschaftsformen im antiken Griechenland
2.1 Das mykenische Königtum
2.2 Die homerische Gesellschaft
2.3 Krisen und Wandel: Die griechische Welt vom 8. bis 6. Jahrhundert v. Chr.
2.4 Eunomia: Solons Reformen
2.5 Die Reformen des Kleisthenes
2.6 Attische Demokratie: Aufstieg und Niedergang
3. Das vollkommene Leben und der Mensch als „Zoon politikon“
3.1 Die Polis und das gute Leben
3.2 Worin unterscheiden sich die verschiedenen Formen der Herrschaft?
Exkurs: Aristoteles’ politische Ökonomie
3.3 Der Mensch als politisches Lebewesen
4. (Staats-)Verfassungen: Kritik, Analyse, Klassifikation
4.1 Einwände gegen den Lehrer: Aristoteles’ Kritik an Platons Staatsentwurf
4.2. Was ist eine (Staats-)Verfassung?
5. Resümee
6. Inhaltsübersicht und Lektüreempfehlungen
7. Literatur
7.1. Verwendete Primärliteratur
7.2. Kommentierte Sekundärliteratur
7.3 Weitere verwendete Literatur
8. Endnoten
B. Aristoteles. Politik
Erstes Buch
1252a
1252b
1253a
1253b
1254a
1254b
1255a
1255b
1256a
1256b
1257a
1257b
1258a
1258b
1259a
1259b
1260a
1260b
Zweites Buch
1261a
1261b
1262a
1262b
1263a
1263b
1264a
1264b
1265a
1265b
1266a
1266b
1267a
1267b
1268a
1268b
1269a
1269b
1270a
1270b
1271a
1271b
1272a
1272b
1273a
1273b
1274a
1274b
Drittes Buch
1275a
1275b
1276a
1276b
1277a
1277b
1278a
1278b
1279a
1279b
1280a
1280b
1281a
1281b
1282a
1282b
1283a
1283b
1284a
1284b
1285a
1285b
1286a
1286b
1287a
1287b
1288a
1288b
Viertes Buch
1289a
1289b
1290a
1290b
1291a
1291b
1292a
1292b
1293a
1293b
1294a
1294b
1295a
1295b
1296a
1296b
1297a
1297b
1298a
1298b
1299a
1299b
1300a
1300b
1301a
Fünftes Buch
1301b
1302a
1302b
1303a
1303b
1304a
1304b
1305a
1305b
1306a
1306b
1307a
1307b
1308a
1308b
1309a
1309b
1310a
1310b
1311a
1311b
1312a
1312b
1313a
1313b
1314a
1314b
1315a
1315b
1316a
1316b
Sechstes Buch
1317a
1317b
1318a
1318b
1319a
1319b
1320a
1320b
1321a
1321b
1322a
1322b
1323a
Siebtes Buch
1323b
1324a
1324b
1325a
1325b
1326a
1326b
1327a
1327b
1328a
1328b
1329a
1329b
1330a
1330b
1331a
1331b
1332a
1332b
1333a
1333b
1334a
1334b
1335a
1335b
1336a
1336b
1337a
Achtes Buch
1337b
1338a
1338b
1339a
1339b
1340a
1340b
1341a
1341b
1342a
1342b
A. Einführung
1. Einleitung
Das von dem US-amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama zu Beginn der 1990er Jahre vorhergesagte „Ende der Geschichte“ lässt auf sich warten. Seine Zuversicht, es gäbe eine geschichtliche Bewegung hin zur liberalen Demokratie, die eine historisch zwangsläufige Entwicklung sei, mutet mittlerweile absurd an. Der gewissermaßen unvermeidliche historische Ablauf, den er dabei beschreibt, ähnelt einem Inklusionssog: Nach und nach würden die verschiedenen Streitpunkte und Widersprüche im homogenen Universalstaat liberaler Prägung aufgehoben, der sich als das Ordnungsmodell weltweit durchsetzen würde.i Spätestens seit der Banken- und Finanzkrise von 2007 und den darauffolgenden Protesten erweist sich die als notwendig behauptete Verbindung von Demokratie und Kapitalismus jedoch als brüchig.ii Da Demokratie und Kapitalismus jeweils von unterschiedlichen Prinzipien geleitet werden – für Erstere gelten Allgemeinwohlorientierung, politische Gleichheit sowie Verfahren konsensueller oder majoritärer Entscheidungsfindung, während Letzterer für Eigentumsrechte, ungleiche Besitzverhältnisse, individuelle Gewinnorientierung und hierarchische Entscheidungsstrukturen steht – ist die Verbindung zwischen diesen beiden keine „naturgegebene“ (Merkel 2014).
Schon einige Jahre vor dieser weltweiten ökonomischen Krise hatte der britische Sozialwissenschaftler Colin Crouch beschrieben, dass die liberale Demokratie zum Zustand der „Postdemokratie“ hin tendiert. In der Postdemokratie gebe es zwar nach wie vor Wahlen, „die sogar dazu führen, dass Regierungen ihren Abschied nehmen müssen, in dem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. Die Mehrheit der Bürger spielt dabei eine passive, schweigende, ja sogar apathische Rolle, sie reagieren nur auf die Signale, die man ihnen gibt. Im Schatten dieser politischen Inszenierung wird die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht: von gewählten Regierungen und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten.“iii
Das heißt, bestimmte demokratische Institutionen sind zwar formal weiterhin intakt, doch die politische Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern verkommt zu einer Marketingangelegenheit: Nach Crouch greifen die politischen Eliten auf bestimmte Techniken der politischen Manipulation zurück, mit deren Hilfe sie die sogenannte öffentliche Meinung ermitteln können, ohne dass diese Prozesse jedoch durch die Bürger zu kontrollieren sind. Gleichzeitig werden die Parteiprogramme immer oberflächlicher, und die politischen Botschaften ähneln Werbeslogans: „Werbung ist keine Form des rationalen Dialogs. Sie baut keine Argumentation auf, die sich auf Beweise stützen könnte, sondern bringt ihr Produkt mit speziellen visuellen Vorstellungen in Verbindung. […] Ihr Ziel ist es nicht, jemanden in eine Diskussion zu verwickeln, sondern ihn zum Kauf zu überreden. Die Übernahme dieser Methoden hat den Politikern dabei geholfen, das Problem der Kommunikation mit dem Massenpublikum zu bewältigen; der Demokratie selbst haben sie damit jedoch einen Bärendienst erwiesen.“iv In der Konsequenz durchdringt die marktwirtschaftliche Logik nach und nach alle Bereiche des (öffentlichen) Lebens, gestaltet das Denken um und zersetzt die Grundlagen des demokratischen Gemeinwesens.v Durch die Ökonomisierung unterschiedlichster Lebensbereiche verwandelt sich der Bürger in einen Konsumentenvi bzw. wird zu einem „unternehmerischen Selbst“vii umgeformt.
Vor derartigen Prozessen in der politischen Entwicklung eines Gemeinwesens warnte vor mehr als zweitausend Jahren bereits Aristoteles in seiner wichtigsten staatstheoretischen Schrift, der Politik (gr. Politika „Dinge, die das Gemeinwesen betreffen“). Dieses in acht Bücher aufgeteilte, uns nur fragmentarisch überlieferte Werk, das nach der aristotelischen Einteilung der praktischen Wissenschaft zuzurechnen ist, knüpft an Aristoteles’ Nikomachische Ethik an – was die normative Prägung der Politik erklärt – und behandelt solche Themen wie politische Anthropologie, legitime und illegitime Staatsverfassungen oder auch Ökonomie.
Gleich zu Beginn unterscheidet Aristoteles zwischen der „natürlichen“ Hauserwerbsökonomie und der auf (schrankenlose) Geldvermehrung ausgerichteten Handels- und Gelderwerbswirtschaft und zeigt die Gefahr auf, die das Eindringen der Profitlogik in das Denken und Handeln der Bürger darstellt: Wenn Tugenden und Fertigkeiten nur als Mittel zum Gelderwerb gelten, dann werden sie hinsichtlich ihrer sozialen Funktion entwertet – eine Entwicklung, die auf Dauer die politische Gemeinschaft gefährdet (Pol. I, 1257b–1258a).viii An anderer Stelle beschreibt der antike Philosoph die negativen Folgen einer unverhältnismäßigen Vermögensvermehrung durch wenige. Dabei vergleicht er den Staat mit einem Körper und weist darauf hin, dass das übersteigerte Wachstum von Extremitäten nicht nur den Gesundheitszustand eines Wesens gefährden, sondern auch aus dieser überproportionalen Vermehrung unter Umständen ein anderes Lebewesen hervorgehen könne – wodurch ein Umschlagen von Quantität in Qualität erfolge. Dementsprechend bestehe eine der Gefahren für einen demokratisch geprägten Staat in der wachsenden Zahl der Reichen oder in der unverhältnismäßigen Vergrößerung der Vermögen: beide Entwicklungen führten dazu, dass die Demokratie in Oligarchie umschlage (Pol. V, 1302b–1303a).
Die Spaltung innerhalb der polis (urspr. „Burg“, später „Stadt“, „Staat“, für Aristoteles auch gleichbedeutend mit „Bürgerschaft“) verläuft Aristoteles zufolge entlang des Gegensatzes zwischen Arm und Reich (etwa Pol. III, 1279b–1280a; Pol. V, 1301b–1302a). An der Doppeldeutigkeit des Wortes dēmos (urspr. „Dorfgemeinde“) wird sichtbar, dass die polis kein harmonisches Ganzes ist: Denn dēmos bezeichnet einerseits die Bürgerschaft als Ganzes und meint andererseits die Armen bzw. die Vielen.ix Diese sind somit Teil des gesamten Volkes, stehen aber auch für das ganze Volk – mit ihrem gewissermaßen leeren Eigentum der gleichen Freiheit,x an dem nicht nur sie, sondern alle einen Anteil habenxi: „[D]en Reichtum haben wenige, an der Freiheit aber nehmen alle teil“ (Pol. III, 1280a).
Eine strukturell ähnliche Unterscheidung führt Wolfgang Streeck ein, der die Prozesse der „politischen Entmachtung der Massendemokratie“ seit den späten 1970er Jahren beschreibt, die sich seiner Meinung nach auch als „eine Geschichte des Ausbruchs des Kapitals aus einer sozialen Regulierung“ lesen lassen. Im „demokratischen Schuldenstaat“xii, dessen Politik den Ansprüchen zweier unterschiedlicher Kollektive ausgesetzt ist, gibt es auf der einen Seite das Staatsvolk, das aus Bürgern besteht, die national organisiert sowie an ein Staatsgebiet gebunden sind. Sie verfügen über bestimmte, unveräußerliche Rechte, wie zum Beispiel das Wahlrecht. Dafür sind sie dem demokratischen Staat Loyalität schuldig, einschließlich der Abführung von Steuern. Auf der anderen Seite richtet das Marktvolk seine Forderungen an die staatliche Politik, dessen Mitglieder lediglich vertraglich an den jeweiligen Nationalstaat gebunden sind, „als Investoren statt als Bürger. Ihre Rechte dem Staat gegenüber sind nicht öffentlicher, sondern privater Art: nicht aus der Verfassung resultierend, sondern aus dem Zivilrecht. Statt diffuser und politisch erweiterbarer Bürgerrechte haben sie gegenüber dem Staat spezifische, vor Zivilgerichten grundsätzlich einklagbare und durch Vertragserfüllung ablösbare Forderungen.“xiii Streecks Abhandlung zielt auf die gleiche Spannung, die bereits in Aristoteles’ Analysen zum Ausdruck kommt: Es geht um zwei sich widerstreitende Logiken innerhalb eines Gemeinwesens oder Staates, die jeweils über unterschiedliche Anrechte sowie bestimmte Gerechtigkeitsvorstellungen verfügen und entsprechende Rechte geltend machen, damit jedoch die soziale und politische Stabilität der Gesamtheit gefährden (siehe dazu etwa Pol. III, 1280a; V, 1302a).
Das analytische Rüstzeug, das Aristoteles’ Politik bietet, ist somit bei achtsamer Anwendung keineswegs veraltet. Ebenso aktuell sind sein Hinweis auf die Bedeutung einer breiten Mittelschicht für ein stabiles Gemeinwesen sowie seine Warnungen vor der Erosion der gesellschaftlichen Mitte: „Dass aber ein Staat aus solchen Mittelexistenzen der Beste ist, liegt zutage. Er allein ist frei von Aufruhr; denn wo der Mittelstand zahlreich ist, da entstehen am wenigsten Aufstände und Zwiste unter den Bürgern“ (Pol. IV, 1296a). „Der Gesetzgeber muss aber immer den Mittelstand in seine Verfassung mit aufnehmen; macht er die Gesetze oligarchisch, so muss er ihn mit berücksichtigen; macht er sie demokratisch, so muss er ihn für sie zu gewinnen suchen. Wo die Gesamtheit des Mittelstandes beide Extreme oder auch nur eines von ihnen überwiegt, da kann die Verfassung von Dauer sein“ (Pol. IV, 1296b).
Ähnliche Vorstellungen einer Bedrohung der gesellschaftlichen Mitte kamen in Europa am Ende des 20. Jahrhunderts auf und schlugen sich in einer wachsenden Literatur über die Spaltung der Gesellschaft nieder.xiv Dabei wird nicht zuletzt der gesamtgesellschaftliche Nutzen der Integrationsleistung der Mitte sowie deren Anpassungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft hervorgehoben. Denn eine starke und zugleich adaptionsfreudige Mitte ermöglicht es Gesellschaften, den sich verändernden Umständen bzw. Anforderungen auf angemessene Weise zu begegnen. Gerade diese Erkenntnis wird auf Aristoteles zurückgeführt.xv
Die Gegenwartsrelevanz der aristotelischen Politik erschließt sich nicht sofort. Dazu bedarf es einer geduldig-genauen Lektüre sowie der Kenntnisse antiker Gemeinschaftsformen, deren sozialer Konflikte sowie der Regierungsweisen im antiken Griechenland. Da all diese Aspekte in die Abhandlung Aristoteles’ einfließen und von ihm analysiert und kritisch verarbeitet werden, beginnt die vorliegende Einleitung mit einer historischen Darstellung des antiken Griechenlands, die zum besseren Verständnis der Politik beiträgt. Anschließend soll der Zugang zum Text durch eine Betrachtung der konzeptionellen Grundlagen und Argumentationsweisen erleichtert werden. Vor diesem Hintergrund wird auf die Bedeutung der Politik für die Gegenwart abschließend nochmals kurz eingegangen.
2. Der Wandel der Gemeinschaftsformen im antiken Griechenland
2.1. Das mykenische Königtumxvi
Die polis, jene spezifische Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Antike, und das rationale Denken sind hinsichtlich ihrer Genese miteinander verflochten. Die Voraussetzungen für ihre Entstehung wurden auf lange Sicht durch den Untergang des mykenischen Königtums geschaffen, dessen soziopolitische Organisation und dessen Wirtschaftssystem der zentral gelenkten Herrschaftsordnung der großen Königreiche des Vorderen Orients glichen: Alle Fäden des sozialen Lebens liefen im Palast zusammen, der nicht nur der politische und ökonomische Mittelpunkt war, sondern auch eine administrative, militärische sowie religiöse Rolle spielte.xvii
Die Person des Königs umfasste alle Momente der Macht. Seine Autorität dehnte sich auf sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens aus, das er mithilfe eines Verwaltungsapparates, der aus Schreibern, königlichen Inspektoren und Würdenträgern des Palastes bestand, kontrollierte und reglementierte. Bis in alle Einzelheiten überwachte und regelte die königliche Verwaltung die Herstellung, den Austausch und die Verteilung der Güter, wodurch der Herrschaftsbereich zu einem Ganzen zusammengefügt wurde. Der Palast bestimmte nicht nur über die Zirkulation von Produkten, Arbeiten und Dienstleistungen, die Verwaltungsbeamten kontrollierten auch das Militärwesen – angefangen bei der Bereitstellung der Waffen bis zur Zusammensetzung der Einheiten. Sie standen in einem persönlichen Gefolgschaftsverhältnis zum Autokraten, zu dessen Befugnissen nicht zuletzt die Aufsicht über das religiöse Leben gehörte. Demnach waren sie nicht im Staatsdienst tätig, sondern dienten dem Königxviii, den sie mit wa-na-ka titulierten – eine Bezeichnung, die bei Homer als wanax vorkommt, wobei das W am Wortanfang meistens wegfällt.
Homer gebrauchte daneben ein anderes Wort für König: basileus, das auf qa-si-re-u zurückgeht.xix Mit diesem Ausdruck wurden Grundherren auf dem Land bezeichnet, die neben den Aristokraten der Hofgesellschaft und der gehobenen Palastverwaltung die lokale Führungsschicht bildeten. Die basileis waren Vasallen des (w)anax und hatten deshalb auch eine gewisse Verwaltungsverantwortung. Einerseits waren sie in den doppelten Kreislauf von Abgaben und Gratifikationen eingebunden. Andererseits agierten sie, im Vergleich zu den Palastbeamten, verhältnismäßig unabhängig, ebenso wie die ländlichen Gemeinschaften. Diese dörflichen dēmen verfügten jeweils über Gemeineigentum und regelten im Einklang mit den Traditionen sowie den örtlichen Hierarchien bestimmte Probleme, wie die Verteilung der Feldarbeit, Nachbarschaftsbeziehungen und Weideverhältnisse. Die relative Autonomie der Dorfgemeinden wurde ferner am Rat der Alten – ke-ro-si-ja – sichtbar, in dem die Vorstände der einflussreichsten Familien saßen. Die einfachen Dorfbewohner, der dēmos im eigentlichen Sinne, waren bestenfalls Zuhörer der Reden, die in jener Versammlung gehalten wurden. Sie drückten durch zustimmendes oder unzufriedenes Gemurmel ihre Meinung aus, die von den Ratsmitgliedern zwar vernommen wurde, ohne jedoch bei ihnen tatsächlich Gehör zu finden.
2.2 Die homerische Gesellschaft
In der Zeit zwischen 1250 und 1150 v. Chr. wurde der gesamte östliche Mittelmeerraum von einer Reihe von Zerstörungen erschüttert.xx Dadurch brach das System der Palastökonomie vollständig zusammen. Die Führungsschicht der mykenischen Gesellschaft wurde weitgehend vernichtet, die Bevölkerung dezimiert. Der kulturelle und technische Niedergang war gewaltig: „Man verzichtet auf Menschen- und Tierdarstellungen, es gibt kein hohes Niveau und kaum noch steinerne Bauten; den kleinen Gegenständen geht jede Feinheit ab, ebenso werden Gemmen nicht mehr gearbeitet. Luxusartikel und alle nicht wirklich notwendigen Importwaren sind regelrecht verschwunden.“xxi
Für mehrere Jahrhunderte folgte das sogenannte „Dunkle Zeitalter“ – dunkel deshalb, weil in dieser Zeit kaum ‚materielle Kultur‘ hervorgebracht wurde und es mithin an Überresten mangelt, die Licht in die damaligen Verhältnisse bringen könnten. Außerdem ging mit dem Zusammenbruch des mykenischen Königtums die Schrift verloren, die in den Palastökonomien zur sozialen Organisation gebraucht worden war. Die mykenische Gesellschaft war zweifellos weit entwickelt gewesen, gleichwohl war sie nicht völlig ‚geschichtlich‘. Die hinterlassenen schriftlichen Zeugnisse lassen zwar erkennen, was die Menschen taten, jedoch geht daraus nicht hervor, weshalb sie auf ebendiese Weise handelten oder warum sie anderes unterließen, das heißt, welche Umstände sie dazu brachten, etwas nicht zu tun.xxii Historisch wird die griechische Welt daher erst mit der Ilias und der Odyssee Homers, deren Entstehung ins 8. Jahrhundert v. Chr. zu datieren ist. In diesen beiden Versdichtungen kommen sowohl gesellschaftliche Verhältnisse, wirtschaftliches Handeln, politische Ordnungen, kulturelle und religiöse Gegebenheiten als auch bestimmte Formen des Denkens, Fühlens und Verhaltens zum Ausdruck.xxiii Obwohl darin gewisse Merkmale der mykenischen Vergangenheit erkennbar sind, spiegeln Homers Epen vor allem seine eigene Zeit und deren gesellschaftliche Institutionen wider.xxiv
Die darin beschriebene Gesellschaft kennzeichnet eine hierarchische Unterscheidung:xxv Auch wenn es noch keine unüberwindliche Standesschranke zwischen den Aristokraten (aristoi) und den übrigen Gemeindegenossen gibt, lässt sich eine Kluft zwischen den beiden sozialen Gruppen beobachten, die weder durch Heirat noch – aufgrund der starren ökonomischen Verhältnisse – durch wirtschaftliche Tätigkeitxxvi überbrückt werden kann. Nur in seltenen Fällen, etwa aufgrund zufälliger Ereignisse im Verlauf von Beutezügen und Kriegen, wird dieser gesellschaftliche Abstand aufgehoben. Jenseits dieser Trennungslinie, insbesondere in Bezug auf die Gemeinen, gibt es zwar noch weitere gesellschaftliche Gliederungen, diese bleiben aber größtenteils verschwommen: „Nicht einmal der Gegensatz zwischen Sklave und Freiem hebt sich in voller Schärfe ab.“xxvii Der Unterschied zwischen einem Aristokraten und einem gewöhnlichen Grundbesitzer besteht vor allem in der unterschiedlichen Größe ihrer Haushalte (oikoi) sowie meistens in der Qualität des Bodens: Die Adligen hatten nicht nur mehr, sondern in der Regel auch besseres Land.
Der frühe griechische Adel war keine Geblütsaristokratie: „Nur selten ist ein oikos in eine mehrere Generationen umfassende Abstammungslinie eingebettet.“xxviii Die Abkunft von einem Adligen war ohne Zweifel eine gute Voraussetzung, jedoch keine notwendige Bedingung für die eigene Stellung als Aristokrat. Der weitaus wichtigere Faktor für eine aristokratische Existenz war die individuelle Tüchtigkeit (arēte). Die Zuerkennung des Aristokratenstatus durch die Gesellschaft beruhte auf dem Erbringen bestimmter Leistungen, über die der Anspruch auf eine gehobene soziale Stellung öffentlich legitimiert wurde.xxix Die unabdingbare Voraussetzung und das entscheidende Merkmal der aristokratischen Existenz war der Reichtum: „Das Vermögen des oikos ist die Grundlage und Zeichen des sozialen Status zugleich.“xxx So korrelierte die Größe eines oikos mit der Zahl der Gefolgsleute (therapontes), die in einem Haushalt unterhalten werden konnten, was im Wesentlichen darüber bestimmte, wie groß die jeweilige Macht eines Hausherrn (kyrios) war. Da die Aristokraten über den meisten Besitz verfügten, besaßen sie im Prinzip auch die gesamte Macht.xxxi
Der oikos war die soziale und wirtschaftliche Grundeinheit der griechischen Gesellschaft.xxxii In ökonomischer Hinsicht war er vor allem eine Verbrauchseinheit zur Befriedigung materieller Bedürfnisse des Hausherrn sowie seiner (Gefolgs-)Leute und umfasste nicht nur Personen, sondern auch Sachen.xxxiii Die Mehrheit der Grundbesitzer verfügte über wenig Land, das zudem oftmals eher karg war, sodass ihr Leben vor allem in mühevoller Arbeit bestand. Der Besitz von Boden sicherte ihnen aber die Position als vollgültiges Mitglied der Gesellschaft. Wer hingegen keinen eigenen Haushalt hatte, war als Landloser von einem Arbeitgeber abhängig beziehungsweise als Handwerker auf Aufträge anderer angewiesen und befand sich somit in einer sozialen Minderstellung.xxxiv
Diese ungebundenen, das heißt zu keinem oikos gehörenden Lohnarbeiter (thētes) führten ein Leben, das sich kaum von dem eines Bettlers unterschied. Homer veranschaulicht die miserable Stellung des thēs im Gesellschaftsgefüge in einer Unterhaltung zwischen Achilleus und Odysseus in der Unterwelt. Nachdem Odysseus den toten Achilleus gerühmt und erklärt hat, dass dieser sogar im Hades der erste sei, erwidert der Schatten des Heros: „Lieber wollt’ ich als Tagelöhner (thēs) den Acker bestellen, bei einem armen Mann, der nicht viel hat an Besitztum, als über alle die Toten, die hingeschwundenen, herrschen.“ (Hom. Od. 11, 489–491, Übersetzung: R. Hampe). Achilleus konnte sich demzufolge keinen niedrigeren sozialen Status und keine minderwertigere Existenz als die eines thēs vorstellen. Daher ist auch die Frage des Eurymachos an den als Bettler verkleideten Odysseus, ob dieser nicht als ein thēs bei ihm arbeiten möchte, nichts als eine Beleidigung. Kaum verhohlener Spott ist bereits in Eurymachos’ Erklärung enthalten, er werde genügend Lohn auszahlen, denn dessen konnte kein thēs sicher sein. Der wahre Hohn jedoch lag in seinem Angebot selbst.xxxv
Die Perspektive, aus der die Welt in Homers Dichtung gesehen wird, ist die Sicht einer Führungsschicht. Der Stoff von Ilias und Odyssee sowie das Ambiente der Epen, die Denk- und Fühlweise der Figuren sowie deren Umgangsformen spiegeln vorrangig und überwiegend die Ideale und Werte der Aristokratie wider. So erwähnt Glaukos im Aufeinandertreffen mit Diomedes die Mahnung seines Vaters, stets der Beste zu sein und die anderen zu übertreffen (Hom. Il., 6, 208), und bringt damit die aristokratische Grundhaltung zum Ausdruck. Das Kriegerethos des Adels war darauf ausgerichtet, den individuellen Ruhm sowie das Ansehen der jeweiligen Geschlechter (gene) zu mehren. Die aristoi waren bestrebt, ihre rein persönliche Überlegenheit darzustellen, sich aus der Gemeinschaft hervorzuheben und derart die eigene Machtposition zu festigen.xxxvi Ihre Verhaltensformen waren Ausdruck einer Kultur des Wetteiferns: agon.xxxvii Dabei ging es darum, die arēte – persönliche Vortrefflichkeit – eines Aristokraten im Wettstreit einer Prüfung zu unterziehen und mithin seine timē – Ansehen bzw. Ehre – zu erhöhen.xxxviii
Dies geschah in erster Linie durch den Beweis körperlicher Überlegenheit. So wird Odysseus im Land der Phaiaken aufgefordert, bei Wettkämpfen mitzumachen, denn: „[…] gibt es doch für einen Mann, solange er lebt, keinen größeren Ruhm als das, was er mit seinen Füßen ausrichtet und mit seinen Armen!“ (Hom. Od. VIII, 147–148, Übersetzung W. Schadewaldt). Nachdem er deutlich gemacht hat, dass er an den sportlichen Spielen nicht teilnehmen möchte, wird Odysseus von Euryalos als ein Mann des Handels geschmäht: ein Händler zu sein bedeutet, sich nicht aufs Kräftemessen zu verstehen und mithin kein Mann von arēte zu sein. Diese Beleidigung kann und will Odysseus nicht auf sich sitzen lassen: er nimmt einen Diskus und schleudert ihn viel weiter als die übrigen Wettkämpfer. Anschließend erklärt er, dass er bereit sei, es in jedweder Disziplin mit jedem beliebigen Phaiaken aufzunehmen. Durch den Beweis seiner körperlichen Leistungsfähigkeit und das herausfordernde Auftreten hat er sich als Aristokrat zu erkennen gegeben.
Die Adligen wetteiferten miteinander jedoch nicht nur in Leibesübungen bzw. Kämpfen, sondern auch in Großzügigkeit. Insbesondere bei der Behandlung von Fremden galt es, großzügig zu sein und die Gäste nicht ohne Geschenke (xenia) abreisen zu lassen. Gastfreundschaft sowie das Geben und Nehmen von Geschenken dienten zum einen dazu, überlokale und überregionale Verbindungen zwischen den adligen oikoi herzustellen sowie ein Netz gegenseitiger Verpflichtungen zu knüpfen. Zum anderen konnte dergestalt Ruhm und Ehre erworben werden, denn „[a]m Ausmaß der Gaben orientiert sich die Bewertung des Gebenden“xxxix. Ferner stellte der Adel seine Tüchtigkeit im Kampf mit dem Wort unter Beweis. Der Platz, auf dem aristokratische Redeturniere stattfanden, war die agora, die sich so zur Stätte politischer Kommunikation entwickelte.
Wenngleich in dem Bild, das Homer von Odysseus’ Königreich auf Ithaka entwirft, gewisse Züge der mykenischen Herrschaftsstrukturen erkennbar sind – der basileus als Oberhaupt des Gemeinwesens, die Versammlung bestehend aus dem impulsiven Adel sowie dem demos im Hintergrund –, ist die königliche Macht des listenreichen Helden nicht mit der absoluten Befehlsgewalt des (w)anax zu vergleichen. Nicht einmal eine derart einflussreiche und angesehene Gestalt wie Agamemnon, der Anführer des gesamtgriechischen Heeres, besitzt bei Homer so viel Macht, dass er Achilleus nach ihrem gemeinsamen Streit dazu bewegen kann, sich wieder ins Kampfgeschehen einzumischen. Erst nachdem sein Gefährte Patroklos von Hektor umgebracht wird, nimmt Achilleus, von Rachegelüsten getrieben, wieder an den Kriegshandlungen teil.xl
Agamemnon war zweifellos ein sehr mächtiger basileus, jedoch war er nur einer von vielen. Seine Position ähnelte dem Verhältnis zwischen den einzelnen basileis und den lokalen Aristokraten. Ein basileus war etwas mehr als ein primus inter pares. Er befand sich zwar in einer Machtposition, doch konnte er sich nicht ohne Weiteres über die öffentliche Meinung hinwegsetzen.xli Die Herrschaft (archē) konzentrierte sich demnach nicht in den Händen eines beinahe göttlichen Königs,xlii sondern sie hatte sich von seiner Person gelöst und wurde im Laufe der Zeit zum umkämpften Objekt der politischen Auseinandersetzungen. Das Zerbröckeln der souveränen Herrschaft zeigte sich besonders deutlich an Athen, wo es seit der mykenischen Epoche keine einschneidende Zäsur in der Entwicklung gab.xliii
Der Verfassungsgeschichte Athens – Athēnaion politeia – zufolge, deren Zusammenstellung durch Aristoteles (oder zumindest durch seine Schule) erfolgte, wurde zunächst das Amt des polemarchos, Befehlshaber des Heeres, eingerichtet, wodurch der basileus seine militärische Funktion verlor. Später kam das Archontat hinzu. Die neun Archonten wurden anfänglich für zehn Jahre gewählt, danach jedes Jahr ersetzt. Am Amt des Archonten zeigt sich begrifflich die Lösung der archē von der königlichen Person sowie eine neuartige Auffassung von Herrschaft: „Die archē wird aufgrund menschlicher Entscheidung und nach einem Auswahlverfahren, das Konfrontation und Diskussion voraussetzt, jedes Jahr von neuem delegiert.“xliv Die Einrichtung von Ämtern und Gremien, die zunehmende Aufspaltung und Abgrenzung der Zuständigkeiten innerhalb der polis-Führung, die Reglementierung der Voraussetzungen für die Bekleidung von Ämtern sowie die Befristung der Amtszeiten etc. können nicht darüber hinweg täuschen, dass die polis-Institutionen im archaischen Griechenland sehr fragil waren, weil sie von der Führungsschicht, der Aristokratie, nie wirklich als solche angenommen und anerkannt wurden. Deren Aktivitäten erfolgten selten im Rahmen dieser Institutionen, denn das Handeln des Adels beruhte in erster Linie und überwiegend auf dem Wettbewerbsethos und wurde durch die permanente Konkurrenz um Ansehen und Vorrang motiviert. Die Aristokratie orientierte sich nicht an den Bedürfnissen ihrer jeweiligen polis,xlv sondern primär am aristokratischen Wertesystem. „In archaischer Zeit gab es in Griechenland also zunächst kaum institutionell geregelte und verankerte Macht, sondern primär institutionell ungebundene Machtausübung durch einzelne Aristokraten.“xlvi
2.3 Krisen und Wandel: Die griechische Welt vom 8. bis 6. Jahrhundert v. Chr.
Im achten Jahrhundert v. Chr. kam es zu einem erheblichen Bevölkerungsanstieg. Die bestehenden dēmen dehnten sich aus, daneben entstanden neue Siedlungen. Der nutzbare Boden wurde knapper und damit wertvoller. Der Nahrungsbedarf wuchs und konnte langfristig trotz der Intensivierung des Ackerbaus nicht gedeckt werden. „Je wertvoller das Land wurde, umso größer wurde zugleich der soziale Abstand zwischen denen, die Land besaßen, und denen, die das knappe Land nicht mehr ernähren konnte. Der Streit um Land entbrannte daher auch innerhalb der Gemeinden zwischen den Aristokraten wie zwischen ihnen und den Nicht-Aristokraten, deren soziale Existenz durch den Hunger der Aristokraten nach dem reich machenden Land in vielen Fällen bedroht wurde. Derartige Probleme hatte es bis dahin nicht gegeben, und in zunehmendem Maße hielten die überkommenen Ordnungsprinzipien des Zusammenlebens für sie keine Lösungen mehr bereit.“xlvii Hinzu kam die stete Gefahr, dass sich Spannungen zwischen widerstreitenden gesellschaftlichen Gruppen – vor allem die Konflikte innerhalb der Aristokratie – in gewaltsamen Zusammenstößen (staseis)xlviii entluden. Derartige Auseinandersetzungen waren keine ausschließlich durch die Geschichte der jeweiligen poleis bedingten Konflikte, sondern eine strukturell vorhandene Bedrohung des Gemeinwesens.xlix
Eine der Möglichkeiten, dem Bevölkerungsdruck zu begegnen, bestand darin, angestammte Siedlungsgemeinschaften zu verlassen und sich andernorts niederzulassen. Das geschah sowohl in Form von Binnenkolonisation als auch durch Gründungen von Niederlassungen, die in räumlicher Ferne von den Ursprungssiedlungen lagen. Eine ‚Kolonie‘ (apoikia) blieb zwar ihrer ‚Mutterstadt‘ gefühlsmäßig und nicht selten auch religiös verbunden, war jedoch von Anfang an als unabhängige Gemeinde gedacht.l Im Unterschied zu vielen anderen poleis nahm Athen als Gemeinde an der Kolonisationsbewegung nicht teil – was allerdings nicht bedeutet, dass nicht einzelne Athener in auswärtige Auswanderungsunternehmen involviert waren.li Die Binnenkolonisation des weiten Territoriums Attikas konnte eine Zeitlang den Bevölkerungsdruck auffangen, doch ab einem gewissen Zeitpunkt traten die gesellschaftlichen Missstände offen zutage. Die aus der Bevölkerungszunahme resultierenden Probleme wurden durch das geltende Erbrecht verstärkt: Die Aufteilung des Bodens unter den Erben bedeutete angesichts des rapiden Wachstums der Bevölkerung, dass die Grundstücke schon nach wenigen Generationen stark verkleinert waren, was die Versorgung ihrer Besitzer gefährdete.lii Viele Bauern mussten deshalb Darlehen aufnehmen, die sie jedoch nicht begleichen konnten. Gab es bei einem Schuldner nichts zu holen, was den Gläubiger in irgendeiner Weise zufriedenstellen konnte, dann bestand für ihn die Möglichkeit der Personalexekution: der Schuldner haftete mit seinem Körper und wurde zum Schuldsklaven, der auch verkauft werden konnte.liii
Auf diese Weise gerieten viele Bauern in dauerhafte soziale und wirtschaftliche Abhängigkeit – sie wurden zu hektemoroi. Ein hektemoros war gezwungen, einen bestimmten Anteil seiner Erzeugnisse regelmäßig sowie auf Dauer an seinen Gläubiger zu entrichten. Die Schuldsklaverei war keinesfalls ein neues Phänomen. Betraf sie zuvor jedoch nur einzelne Bauern, litten nun große Teile der bäuerlichen Bevölkerung unter ihrem Joch. Die einschneidende gesellschaftliche Spaltung sowie die ständige Furcht vor dem wirtschaftlichen und mithin sozialen Abstieg führten zu Aufruhr und dem Ruf nach Reformen.
Im Zuge dessen wurde 594 v. Chr. der einer adligen Familie entstammende Solon zum Archon berufen und mit umfassenden Vollmachten ausgestattet. Seine Ernennung zeigt, dass es auch unter den Aristokraten solche gab, die die Bedrohung des athenischen Gemeinwesens wahrnahmen und zu Zugeständnissen bereit waren. Solons erste Maßnahme war die sogenannte ‚Lastenabschüttelung‘ (seisachtheia), ein Schuldenerlass, durch den die verschuldeten Bauern wieder zu freien Eigentümern ihres Landes wurden. Neben weiteren Maßnahmenliv unterband er den Einsatz des Leibes als Sicherheitspfand bei säumigen Schuldnern, indem er den Gläubigern das Recht nahm, auf die Person des Schuldners zugreifen zu können. Auf diese Weise verhinderte Solon, dass zukünftig die Grundlagen des Gemeinwesens durch abhängige Bauernschaft untergraben wurden. Stattdessen bildete der freie Bauernstand fortan das Rückgrat der athenischen Bürgerschaft.
2.4 Eunomia: Solons Reformen
Solon erkannte, dass die herkömmliche Ordnung nicht mehr funktionierte. Die Krise des athenischen Gemeinwesens trat als dysnomia, als Zustand schlechter Gesetzlichkeit, in Erscheinung: weder wurden die ungeschriebenen Regeln des Zusammenlebens eingehalten noch entsprachen sie den gesellschaftlichen Realitäten. Auf den Umstand, dass die mündlich tradierten Rechtsbräuche wenig galten, reagierte Solon, indem er den Athenern geschriebene Gesetze gab und diese öffentlich auf der agora aufstellen ließ.lv Neben anderen Regelungen erließ er Vorschriften, die gegen das Zurschaustellen der luxuriösen Lebensführung der Aristokraten gerichtet waren.lvi
Diese Bestimmungen spiegeln nicht zuletzt die damalige moralische Kritik am anmaßenden Auftreten und verschwenderischen Verhalten des Adels wider.lvii Das Ideal der sophrosyne, des richtigen Maßes und der Wahrheit, die in der Mitte liegt, wird der maßlosen hybris der Aristokraten, also deren Anmaßung, gegenübergestellt, die sich insbesondere an ihrer pleonexia zeigt, dem Wunsch, mehr als den eigenen Teil zu haben. Der Idee vom rechten Mittelmaß entspricht die Vorstellung von einer politischen Ordnung, die das Gleichgewicht zwischen widerstreitenden sozialen Elementen herstellt und verfeindete Kräfte miteinander versöhnt. Für solch einen Ausgleich zwischen der Minderheit der Adligen, die gesellschaftliche Veränderungen ablehnten, und dem in Aufruhr geratenen demos trat eine mesoi genannte Schicht von Bürgern ein, der auch Solon selbst angehörte: Es waren diejenigen Athener, die sich der Mitte der Gesellschaft, das heißt keinem der gesellschaftlichen Extreme, zugehörig fühlten und zur Mäßigung aufriefen.lviii
Das richtige Verhältnis zwischen den antagonistischen Positionen, das angemessene Maß an gesellschaftlicher Macht zwischen den sich feindlich gegenüberstehenden Gruppierungen herzustellen sowie deren unterschiedliche Einstellungen so weit wie möglich aufeinander abzustimmen – das war die schwierige Aufgabe, die Solon mittels einer Klasseneinteilung zu bewältigen suchte. Sein Reformziel war die Errichtung einer eunomia, einer guten Ordnung, die auf der homonoia, der Eintracht als einer Harmonie von Proportionen, beruhen sollte.lix Durch die Neukonstituierung der Bürgerschaft sollte die isotes, Gleichheit zwischen den Bürgern, und somit eine Konsolidierung des athenischen Gemeinwesens geschaffen werden. Es handelte sich um eine hierarchische, wesentlich proportionale Gleichheit: die Rangfolge des gesellschaftlichen Ansehens beruhte auf der Messung der erzeugten Agrarprodukte.
Worin bestand diese Gleichheit? Sie drückte sich zuallererst in der Grundlage für die Teilnahme an Volksversammlung und Rechtsprechung aus: im Recht der persönlichen Freiheit, das nicht zuletzt besagte, dass es fortan keine sozialen, politischen oder rechtlichen Abhängigkeiten unter den Gemeindegenossen geben sollte, sowie in der Gleichheit vor dem Gesetz. Aus dem Recht zur Mitwirkung an der politischen Gemeinde erwuchsen aber auch Pflichten, die jedem Bürger seiner ökonomischen Leistungsfähigkeit gemäß auferlegt wurden. So konnten sich die ersten drei Vermögensklassenlx eine Kriegsausrüstung leisten und waren mithin voll militärpflichtig. Die polis-Ämter waren den Mitgliedern dieser Klassen vorbehalten, während die unterste Klasse der thētes, die sich weder ein Schlachtross noch eine Hoplitenrüstung leisten konnten, zu keinem Amt zugelassen war.
Wiewohl das Entstehen der Hoplitenphalanxlxi nicht gegen die Aristokratie gerichtet war – im Gegenteil, der Wandlungsprozess hin zu dieser militärischen Organisation wurde anfangs gerade von den kampferfahrenen Adligen vorangetrieben und getragen –,lxii erwuchs aus der Kampfformation, bei der die kollektive Anstrengung und das Durchhalten als Gruppe entscheidend war, seitens der nichtadligen Kämpfer Kritik an den Verhaltensformen der Aristokraten. Dabei wurde deren Streben nach Mehrung des individuellen Ansehens bzw. der Macht sowie deren Bemühen um das Hervortun aus der Gemeinschaft der rückhaltlose Einsatz für die polis gegenübergestellt. Die Kühnheit der Adligen, die im Zustand der lyssa, einer Art kämpferischer Raserei, ihre rein persönliche Überlegenheit im Einzelkampf zu beweisen suchten, wurde von den nichtadligen Hopliten abgelehnt – es zählten nunmehr der standhafte Mut und die Selbstbeherrschung, ohne die der Zusammenhalt der Phalanx nicht möglich gewesen wäre. Denn die Funktion der Kämpfer im System der Phalanx resultierte nicht aus ihren gesellschaftlichen bzw. ökonomischen Beziehungen zueinander, sondern aus der funktionalen Zuordnung der Kampfformation: In der Phalanx standen Adlige und Nichtaristokraten nebeneinander, Schild an Schild, als Gleiche.lxiii Diese Art der Kriegsführung hatte erhebliche Auswirkungen auf gesellschaftliche Gleichheitsvorstellungen.
2.5 Die Reformen des Kleisthenes
Obwohl Solon die soziale Freiheit der nichtaristokratischen Athener wiederherstellte, änderten seine sozialpolitischen Maßnahmen wenig an der Sozialstruktur. So blieben die gesellschaftlichen Voraussetzungen des aristokratischen Handelns weitgehend unberührt. Die Adligen konnten nach wie vor ihr „Ideal der Arestie bis zu dem Anspruch hin verfolgen, die Vorherrschaft in der Gemeinde zu erringen“lxiv. Obschon sie fortan die Mittel zur Erringung politischer Dominanz nicht durch soziale und ökonomische Ausbeutung ihrer Mitbürger gewannen und sich stattdessen äußere Ressourcen zunutze machten, änderte sich an ihrem Machtstreben sowie an der Bereitschaft des Volkes, sich für aristokratische Machtkämpfe einspannen zu lassen, weiterhin wenig. Die Stabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse währte somit nicht lange. Die staseis brachen erneut aus und führten nicht selten zur tyrannis.
Die von Solon geschaffene Gleichheit betraf die gesellschaftliche Sphäre, und zwar insbesondere die Gleichheit vor dem Recht. Dadurch verstanden sich die Bürger als homoioi, als Gleichartige. Allerdings dominierten die Aristokraten nach wie vor das politische Geschehen.lxv „Politische Gleichheit konnte eben erst wirksam werden, wenn breite Schichten der Bürgerschaft mit dem Adel so weit brachen, dass sie die Polis selbst in die Hand nehmen konnten […]. Und erst und nur in der politischen Gleichheit konnten die Bürger über den Anspruch, hómoioi zu sein, hinaus wenigstens in bestimmter Hinsicht wirklich Gleiche werden.“lxvi Soziopolitische Veränderungen hin zur „breiten Lagerung der Macht“lxvii, das heißt hin zur Einbeziehung breiterer Bevölkerungsschichten in die politischen Entscheidungsprozesse, erfolgten erst im Zuge der Phylenreform Kleisthenes’,lxviii fast ein Jahrhundert nach den Reformen Solons.
Kleisthenes, der dem aristokratischen Geschlecht der Alkmeoniden entstammte, wurde durch den Tyrannen Hippias exiliert und war nach dessen Sturz in eine stasis mit Isagoras verwickelt. Als dieser gegen den Willen Kleisthenes’ zum archon gewählt wurde, suchte jener die Unterstützung des demos, indem er ihm seine Reformpläne unterbreitete. Die Reaktion seiner aristokratischen Gegner war heftig: Sie riefen Hilfe aus Sparta und vertrieben Kleisthenes mit seinen Anhängern aus Athen. Anschließend versuchten sie, ein oligarchisches Regime zu errichten, in dem künftig 300 Familien die polis beherrschen sollten. Dagegen regte sich gewaltiger Widerstand seitens der Athener: In der Folge war der spartanische König Kleomenes I. mit seinen athenischen Verbündeten gezwungen, sich auf der Akropolis zu verschanzen. Nach zweitägiger Belagerung durch die Bürger Athens kapitulierten sie und bekamen freien Abzug gewährt, woraufhin Kleisthenes nach Athen zurückkehren konnte.
Welche Ordnung fand er vor? Die attische Bürgerschaft war in drei verschiedenen Abteilungen organisiert: Sie gliederte sich in vier Phylen, die jeweils aus mehreren Phratrien bestanden,lxix die sich wiederum aus verschiedenen Geschlechtern (Gene) und Kultvereinen zusammensetzten. Mithilfe dieser Aufteilung wurde einerseits die Verteilung von Rechten und Pflichten vorgenommen – wie etwa das Heeresaufgebot, denn die Armee war phylenweise gegliedert. Andererseits wurde der Bürger auf diese Weise, vor allem durch die Zugehörigkeit zu einer Phratrie, in engere und weitere Solidaritäten eingebunden. Er konnte demnach in den verschiedenen Gruppen auf Unterstützung durch die Genossen bei der Vertretung seiner Interessen innerhalb der Gesamtgemeinde hoffen.lxx Kleisthenes’ Reform bestand nun nicht in der Beseitigung der alten, sondern in der Errichtung einer neuen Ordnung, parallel zu den bestehenden Strukturen der Bürgerschaft. „Soweit die neuen Körperschaften aber die Aufgaben der alten Institutionen übernahmen, starben diese praktisch von selbst ab.“lxxi
Kleisthenes’ Neuordnung beruhte auf den Demen, den kleinsten politischen Körperschaften, die soweit wie möglich entsprechend den vorhandenen Siedlungseinheiten formiert wurden, wodurch eine Aufwertung der seit jeher maßgebenden Zugehörigkeitsstrukturen erfolgte. Denn Kleisthenes übertrug verschiedene Funktionen auf diese Subsysteme, die sich fortan als lokale Selbstverwaltungseinheiten mit eigenen Gemeindeversammlungen und -kassen, eigenen Beamten, Kulten und Priestern konstituierten. „In diesem Rahmen und vor diesem Forum – in dem die Angehörigen mittlerer und unterer Schichten zumindest numerisch der Oberschicht auf jeden Fall überlegen gewesen sein dürften – wurden in Zukunft alle lokalen Angelegenheiten im Kreise der Demengenossen diskutiert und verbindlich entschieden.“lxxii Ferner teilte Kleisthenes Attika in drei Regionen ein: in die Stadt Athen samt der näheren Umgebung, das Küstenland und das Binnenland. In jeder Region fasste er die Demen zu zehn Abteilungen, Trittyes, zusammen. Dadurch erhielt er 30 Demengruppen, aus denen er anschließend zehn Phylen bildete, deren Zusammenstellung durch Los bestimmt wurde. Welches Prinzip stand hinter dieser relativ komplizierten Ordnung? „Jede Region sollte in jeder Phyle vertreten sein. Und umgekehrt: keine Phyle sollte besondere lokale Interessen repräsentieren, jede sollte vor allem nur ein Zehntel der Bürgerschaft sein, […], die in sich möglichst gleichartig sein sollte. Nichts sollte den Phylengenossen gemeinsam sein als ihre Bürger-Eigenschaft.“lxxiii
Eine weitere institutionelle Neuerung Kleisthenes’ war die Einrichtung eines Volksrates, boule genannt. Er verknüpfte den Rat aufs engste mit der Bürgerschaft, indem er diesen strukturell an das Phylensystem koppelte: Die boule setzte sich aus 500 Mitgliedern zusammen, das heißt, jede Phyle war mit 50 erlosten Bürgern vertreten, die das Amt des Ratsherren für ein Jahr bekleideten. Der Volksrat trug wesentlich zur Herstellung „bürgerlicher Gegenwärtigkeit“lxxiv bei, weil durch ihn die attische Bürgerschaft gewissermaßen indirekt anwesend war. Denn ein Ratsherr vertrat höchstens 60 männliche erwachsene Bürger, womit bereits mittelgroße Dörfer drei bis vier Ratsmitglieder stellen konnten. Die Ratsmitglieder verließen ihre Herkunftsorte, um in Athen zu wirken, und kehrten nach dem Ende ihrer Amtszeit dorthin zurück. Dadurch erfüllte der Volksrat die Vermittlungsfunktionen zum einen zwischen dem politischen Geschehen in Athen und dem Leben in den einzelnen Demen sowie zum anderen zwischen den verschiedenen Teilen der Bürgerschaft. Ferner konnten weite Kreise der mittleren Schichten vermöge ihrer Mitgliedschaft in der boule Bekanntschaften knüpfen und Verbindungen unter den führenden Kreisen herstellen. Das heißt, sie konnten als Ratsherren das auf- und ausbauen, was die Aristokraten seit langer Zeit besaßen und woraus ihre Überlegenheit in bestimmten Situationen erwuchs.lxxv
2.6 Attische Demokratie: Aufstieg und Niedergang
Die Theten, deren politische Mitwirkungsrechte eingeschränkt waren, erlangten erst im Zuge der Perserkriege im 5. Jahrhundert v. Chr. gleichberechtigte politische Teilhabe. Sie mussten nämlich als Ruderer an den Kriegsschiffen, den Trieren, Dienst verrichten. Die Ausbildung, die sie für diese Aufgabe erhielten, stand dem Training der Hopliten in nichts nach. Und da die Flotte eine entscheidende Rolle beim Sieg über die persischen Truppen spielte, forderten die Theten, um ihren Beitrag zum Ausgang des Krieges wissend, mehr politische Rechte. Ihr politischer Aufstieg war mit der Ausweitung der athenischen Vormachtstellung zur See verbunden. Athen entwickelte sich zu einer maritimen Macht und geriet zunehmend in Konflikt mit der Landmacht Sparta. Die Spannungen zwischen den beiden poleis wuchsen sich zu bewaffneten Auseinandersetzungen aus: Es begann der sogenannte Peloponnesische Krieglxxvi (431 v. Chr. bis 404 v. Chr.), der mit der Kapitulation Athens endete. Darauf folgte die Gewaltherrschaft von 30 Oligarchen, die jedoch nur acht Monate dauerte – nach einem Aufstand, der von Thrasybulos, einem attischen Strategen, angeführt wurde, wurde die Demokratie wieder eingeführt.
Die politischen Auseinandersetzungen innerhalb der attischen Demokratie wurden hingegen verbal ausgetragen – wer bei demokratischen Abstimmungen erfolgreich sein wollte, musste daher in seiner Rede überzeugend sein. Das Wissen um wirksames Reden wurde zu einem gefragten Gut. Die Sophistenlxxvii – Wanderlehrer, die über besonderes Wissen auf verschiedenen Gebieten verfügten und zumeist gegen Bezahlung Unterricht erteilten – erklärten die Rhetorik zu einer erlernbaren Fertigkeit, zu einer Kunst (technē), die von ihnen gelehrt werden könnte. Manche, wie etwa Protagoras, von dem der berühmte Homo-Mensura-Satzlxxviii stammt, gingen noch weiter und boten Unterweisung in politischem Fachgeschick an. So erklärt er, in dem nach ihm benannten Dialog Platons, dass das Lernziel seines Unterrichts zum einen das Wissen um die beste Verwaltung des oikos und zum anderen die Geschicklichkeit im politischen Handeln und Reden (politikē technē) umfasse (Plat. Prot. 318e–319a).
Im letzten Kapitel seiner Nikomachischen Ethik nimmt Aristoteles kritisch auf die Unterrichtsankündigungen der Sophisten Bezug und hinterfragt die Herkunft ihres angeblichen Wissens. Er hält ihnen vor, dass sie, obwohl sie sich am politischen Leben nicht beteiligten, also mit dem Gegenstand ihres Unterrichts nicht in Berührung kämen, dennoch behaupteten, die Staatskunst lehren zu können. Wenn sie jedoch wüssten, was im politischen Bereich wirklich vorgehe und welche Kenntnisse und Fertigkeiten dort vonnöten seien, würden sie politisches Handeln nicht auf Rhetoriklxxix und gesetzgeberische Fähigkeiten nicht auf die bloße Auswahl und Zusammenstellung bester Gesetze reduzieren (Eth. Nik. X 10, 1181a1f, 11–19). Aus der Sicht Aristoteles’ wurde die Staatskunst demzufolge mangelhaft behandelt, weshalb er ankündigt, sich mit politischen Fragen zu beschäftigen – ein Vorhaben, das er in seiner Politik in die Tat umsetzt, die bei der kleinsten polis-Einheit, dem oikos, sowie bei den grundlegenden Fragen nach der Natur des Menschen ihren Ausgang nimmt.
3. Das vollkommene Leben und der Mensch als „Zoon politikon“
Zu Beginn der Politik stellt Aristoteles die grundlegende Bedeutung des Politischen für den Menschen dar. Seiner analytisch-synthetischen bzw. resolutiv-kompositiven Methode entsprechend – ein Ganzes wird zunächst in seine Teile zergliedert und anschließend wieder zusammengesetzt – geht er dabei vom einzelnen Menschen sowie vom einzelnen Haushalt (oikos) aus. Der mehr als 2000 Jahre alte Text vermag bei geduldiger Lektüre nach wie vor in seinen Bann zu ziehen. Die Mischung aus genauer Beobachtung, Polemik, Verweisen auf verschiedenartige Texte sowie logischer Fragestellung und Argumentation hat auch nach vielen Jahrhunderten an Faszination nicht eingebüßt.
Am Anfang des ersten Buches der Politik entfaltet Aristoteles drei Theoreme:lxxx 1.) Die politische Gemeinschaft ist die oberste unter den menschlichen Gemeinschaften und strebt nach dem obersten Gut (Pol. I, 1252a). 2.) Ein Gebieter von Sklaven (despotēs), ein „Hausvorstand“ (oikonomikos), ein König (basilikos) und einer (politikos), der am Regieren der polis beteiligt ist, unterscheiden sich nicht nur im Hinblick auf die Quantität der Beherrschten, sondern auch hinsichtlich der Qualität ihrer Herrschaft (Pol. I, 1252a). 3.) Der Mensch ist von Natur aus ein „Zoon politikon“, ein politisches Lebewesen (anthrōpos physei zōon politikon) (Pol. I, 1253a sowie III, 1278b).
Die anthropologische Grundthese, derzufolge Menschen mit ihren typischen Tätigkeiten nach dem streben, was ihnen als gut erscheint,lxxxi stellt den Ausgangspunkt der aristotelischen Überlegungen dar. Individuelle und gemeinschaftliche Handlungen werden demnach mit dem Zweck vollzogen, ein bestimmtes Gutlxxxii (agathon) zu erlangen. Dabei stellt der Philosoph heraus, dass viele Güter um anderer Güter willen angestrebt werden: So erlernen Menschen einen Beruf nicht nur deshalb, weil sie diesen ausüben wollen, sondern auch um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Solche Strebensziele lassen sich mithin hierarchisch ordnen und potenziell ins Endlose fortsetzen, womit das Streben jedoch leer und nutzlos wäre (Eth. Nik. I, 1094a). Daher muss es, so Aristoteles, ein höchstes Gut geben, das nicht wegen einer anderen Sache, sondern um seiner selbst willen erstrebt wird und sich nicht durch ein zusätzliches Gut vergrößern lässt: das Glück (Eth. Nik. I, 1097a). Für ihn besteht das glückliche Leben nicht zuletzt in einem der Tugend verpflichteten, politischen Leben (vgl. Eth. Nik. X, 1178a-1179a).
3.1 Die Polis und das gute Leben
Ähnlich wie das glückliche Leben als höchstes Gut alle anderen Güter enthält, so schließt die polis als oberste Gemeinschaft die anderen menschlichen Gemeinschaften ein. Sie ist um des bloßen Lebens willen entstanden, stellt Aristoteles heraus, besteht jedoch um des glücklichen bzw. vollkommenen Lebens willen (Pol. I, 1252b). Er knüpft damit an seinen philosophischen Lehrer Platon an,lxxxiii der in seiner Politeia erklärt, dass der einzelne Mensch anderer Menschen bedarf, weil er sich selbst nicht genügt (vgl. Rep. II, 369b). Aristoteles erweitert den Platon’schen Kooperationsgedanken, indem er nicht nur ökonomische Motive der Vergemeinschaftung wie Arbeitsteilung und Lebenserleichterung berücksichtigt. So stellt er zwei Formen gegenseitiger Abhängigkeit heraus, die ihm zufolge „von Natur aus“ sind und aufgrund deren der Mensch nicht vereinzelt lebt, sondern vielmehr auf andere Menschen angewiesen ist. Diese Dependenzarten sind auf die Befriedigung der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse gerichtet: a) Der Fortpflanzung wegen seien Frauen und Männer aufeinander angewiesen. b) Zur Sicherung der Selbsterhaltung bestehe ein notwendiges Verhältnis zwischen dem Herrschenden und dem Beherrschten. Diesen Formen gegenseitiger Abhängigkeit entsprängen die oikia, die ersten natürlichen menschlichen Gemeinschaften, und die den oikos konstituierenden hierarchischen Beziehungenlxxxiv zwischen Ehemann und Ehefrau, Herr und Sklave, Vater und Kind.
Die Hierarchie innerhalb des oikos
Nach Aristoteles ist der freie Mann den übrigen oikos-Mitgliedern übergeordnet. Er rechtfertigt dieses asymmetrische Verhältnis mit dem Verweis auf die Natürlichkeit der Ungleichheit: „[D]er Gegensatz von Herrschendem und Dienendem tritt überall auf, wo etwas aus mehreren Teilen besteht und eine Einheit bildet, […]. Und dieses Verhältnis von Ober- und Unterordnung findet sich bei den beseelten Wesen auf Grund ihrer ganzen Natur. […] Was aber die sinnlich belebten Wesen betrifft, so bestehen sie zunächst aus Leib und Seele, von welchen beiden das eine naturgemäß herrscht, während das andere dient. Das Naturgemäße muss man aber an denjenigen Dingen ablesen, die sich in ihrem natürlichen Zustand befinden, nicht an denen, die verderbt sind“ (Pol. I, 1254a). Zur Dominanz des Mannes über die Frau bemerkt er lapidar, dass jener eher zur Führung geeignet sei als diese.lxxxv Die Frau vermöge zwar, im Unterschied zum Sklaven, zu überlegen und zu planen, jedoch sei dieses Vermögen bei ihr nicht voll wirksam.lxxxvi Die gesellschaftliche Unterordnung der Frau ist demnach für Aristoteles kein kontroverses Thema. Diskussionswürdiger erscheint ihm die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Sklaverei. Er behandelt diese im Rahmen der Untersuchung der Haushaltsführung, die insbesondere die Fähigkeit zum Besitzerwerb einschließt. Besitz sei ein Teil des Haushalts sowie ein Werkzeug zum Leben, weil ohne die notwendigen Mittel ein glückliches Leben nicht geführt werden könne, so Aristoteles. Er fährt fort, dass Besitz „eine Vielzahl von Werkzeugen“ (Pol. I, 1253b) sei. Besitzstücke seien demzufolge Werkzeuge. Der Sklave sei beseeltes Besitzstück und mithin beseeltes Werkzeug. Es gäbe Werkzeuge, die zum Herstellen von Dingen verwendet würden. Der Sklave sei jedoch ein Werkzeug, das dem Handeln diene, denn das Leben bedeute Handeln und nicht Produzieren. Aristoteles leugnet nicht, dass es Sklaverei aufgrund von Übereinkunft gibt – zum Beispiel Kriegsgefangene, die gewaltsam zu Sklaven wurden. Zugleich betont er, dass es daneben Sklaven gibt, deren gesellschaftliche Stellung „vorteilhaft und gerecht“ (Pol. I, 1255a) sei. Seine Begründung dieses hierarchischen Verhältnisses lautet, dass in der gesamten Natur im Hinblick auf das Zusammengesetzte das Prinzip gelte, dass es einen herrschenden und einen beherrschten Teil gäbe. So sei der Mensch aus Körper und Seele, wobei diese über jenen herrsche, außer bei denjenigen Menschen, die in keiner guten Verfassung seien, weil bei ihnen der Körper die Seele dominiere, was „schlecht und naturwidrig“ (Pol. I, 1254b) sei. Ebenso sei eine gleichmäßige Herrschaft der Leidenschaften und der Vernunft oder gar eine Umkehrung der Dominanz der vernünftigen über die affektiven Seelenteile für alle schädlich. Somit ist nur unter der Herrschaft der Vernunft ist das gute Leben möglich.
3.2 Worin unterscheiden sich die verschiedenen Formen der Herrschaft?
Implizit greift Aristoteles die Auseinandersetzung zwischen Sokrates und Thrasymachos in Platons Politeia auf, in deren Verlauf die These zurückgewiesen wird, dass jede Herrschaft lediglich für die Herrschenden von Vorteil sei. Stattdessen wird das Wohl der Beherrschten als der Zweck jeglicher Herrschaft herausgestellt (Rep. I 338b ff., IX 590 d). Aristoteles bemerkt diesbezüglich, dass nur die Regierung der Freien über Freie diejenige Herrschaft sei, in der zugunsten der Beherrschten regiert werde (vgl. etwa Pol. I, 1255b; VII, 1333a). Und wenngleich der Vorteil in der despotischen Herrschaftsbeziehung zwischen dem Herren und dem Sklaven augenscheinlich für beide gleich sei, bestehe dieses Verhältnis „nichtsdestoweniger zum Vorteil des Herrn, und zum Vorteil des Sklaven besteht sie nur mitfolgender Weise,lxxxvii insofern nämlich als, wenn der Sklave umkäme, auch die Herrschaft ein Ende haben müsste.“ (Pol. III, 1278b). Anders ausgedrückt: Aristoteles behauptet nicht, dass der Sklave ohne den Herrn nicht überlebensfähig sei, oder dass er seinen Vorteil nicht erkennen könne, denn sonst wären die Barbaren, die ihm zufolge von sklavischer Natur sind (Pol. I, 1252b), schlichtweg ausgestorben. Der Philosoph schließt den Sklaven zudem nicht völlig von der Vernunft aus. Er spricht ihm lediglich das planende Vermögen und die entsprechende Entscheidungskraft ab (Pol. I, 1260a). Obwohl der Sklave keine Vernunft besitzt, kann er gleichwohl auf sie hören und sie vernehmen und hat somit Anteil an ihr (Pol. I, 1254b; I, 1260b; III, 1333b).
Worin liegt nun für den Sklaven im despotischen Herrschaftsverhältnis der Nutzen? Es gibt, so Aristoteles, „eine gegenseitige Freundschaftlxxxviii zwischen einem Sklaven und einem Herrn, die beide ihren Stand von Natur verdienen“ (Pol. I, 1255b). Der Sklave ist demzufolge nicht nur ein Befehlsempfänger, vielmehr nimmt er am Leben des Herrn als dessen Werkzeug teil. Seine charakterliche Haltung wird durch die Tugendhaftigkeit seines Herrn beeinflusst (vgl. Pol. I, 1260b), denn die Überlegenheit des Herrn ist vornehmlich ethischer und nicht so sehr intellektueller Natur. Der Herr partizipiert als Bürger an einer Ordnung – polis –, für die Tugendhaftigkeit tragend ist und die in ethischer Hinsicht höherwertiger als der Haushalt ist, dem der Sklave angehört. Indem jedoch der Sklave durch seinen Dienst dem Herrn die Teilnahme am politischen Leben ermöglicht, hat er gewissermaßen indirekten Anteil an der polis. Der Nutzen für den Sklaven besteht demnach zum einen in seiner charakterlichen Umgestaltung sowie zum anderen in der Möglichkeit, am Werk eines vollkommeneren Wesens teilzuhaben.lxxxix
Die Herrschaft über die Frau, die zwar zu überlegen und zu planen vermag, ohne jedoch diese Fähigkeit in vollem Umfang zu besitzen, ist von der Herrschaft über den Sklaven verschieden, der nicht über das planende Vermögen und die entsprechende Entscheidungskraft verfügt. Der Unterschied ist nicht nur ein quantitativer – der Hausvorstand ist üblicherweise mit einer Frau verheiratet, besitzt jedoch nicht selten mehrere Sklaven –, sondern betrifft vor allem die Qualität der Beherrschten. Ein König hingegen regiert über Untertanen, das heißt über die Hausvorstände, die von der Regierung ausgeschlossen sind. Die Regierung über freie Bürger, die ihrerseits regierungsfähig sind und sich an den Belangen der polis beteiligen, unterscheidet sich von den genannten Arten der Herrschaft auf grundverschiedene Weise. Denn es handelt sich um eine Gemeinschaft von Freien und Gleichen: Herrschende und Beherrschte sind trotz der Ungleichheit an Besitz und somit Macht als Bürger der polis gleich und regieren einander als Freie im steten Wechsel.xc
Exkurs: Aristoteles’ politische Ökonomie
Der Nutzen der despotischen Herrschaftsbeziehung besteht für den Herrn in der Bewältigung der Lebensnotwendigkeiten mithilfe von Sklavenarbeit. Die Sklaverei ist für den Herrn zwar von Vorteil, jedoch nicht unbedingt wirtschaftlich notwendig.xci Wiewohl die wirtschaftlichen Gründe für die Einrichtung der Sklaverei nicht zu leugnen sind, stellt der Einsatz von Sklaven in der Antike nicht zuletzt den bewussten Versuch dar, „das Arbeiten von den Lebensbedingungen auszuschließen, unter denen Menschen das Leben gegeben ist. Was dem menschlichen Leben mit anderen Formen tierischen Lebens gemeinsam ist, galt als nicht-menschlich.“xcii Die Notwendigkeit des antiken Sklavendienstes liegt weniger im Bedarf billiger Arbeitskräfte, sondern rührt vor allem aus der Geringschätzung körperlicher Arbeit,xciii die laut Aristoteles die Freien „zur Ausübung und Betätigung der Tugend“ untauglich macht, „da sie den Geist der Muße beraubt und ihn erniedrigt“ (Pol. VIII, 1337b).xciv
Aristoteles stellt heraus, dass sich durch die Bewältigung der Lebensnotwendigkeiten ein Handlungsraum eröffnet, in dem der Mensch nicht mehr der Notdurft des Lebens unterworfen ist, sondern zusammen mit anderen frei handeln kann. Diese Behauptung beruht zum einen auf der Annahme einer „unveränderlichen Ordnung der Bedürfnisse“xcv, deren Befriedigung möglich sei, und zum anderen auf der Voraussetzung einer „geschlossenen Eigentumsordnung“xcvi. Aristoteles geht demzufolge davon aus, dass es bestimmte Bedürfnisse gibt, die notwendigerweise innerhalb des oikos zu befriedigen sind, damit politisches Leben möglich ist. Und er begreift die polis als eine soziale Austauschgemeinschaft, die nur bei Beibehaltung einer bestimmten ökonomischen Struktur weitgehend konfliktfrei bleibt. Das bedeutet nicht, dass er jede wirtschaftliche Tätigkeit, die einen Überschuss über die Subsistenzversorgung hinaus erzielt, grundsätzlich ablehnt. Der Reichtum als solcher wird nicht verurteilt – entscheidend ist der richtige Umgang mit ihm. „Der zulässigen Ökonomie entsprechen nicht Gewinn-, sondern Gebrauchsmotive.“xcvii Der rechte Gebrauch des Reichtums besteht in Verkauf oder Schenkung, das heißt in Freigebigkeit gegenüber der polis sowie gegenüber Freunden. Handel, der aus Notwendigkeit und nicht zu Profitzwecken betrieben wird, ist aus der Sicht Aristoteles’ eine zulässige wirtschaftliche Tätigkeit und gehört in den Bereich der Handels- und Gelderwerbswirtschaft (kapelikē chrematistikē), die er von der Hauserwerbswirtschaft (oikonomikē chrematistikē) unterscheidet.
Der Zweck der Ökonomie besteht nach Aristoteles darin, den Bürgern politisches Handeln zu ermöglichen. Das Mittel dafür ist der Besitz, der durchaus vergrößert werden darf. Entsprechend richten sich seine Ausführungen an die Bürger, „deren Aufgabe es ist, alle jene Dinge zu beschaffen und bewahren, die für die Gemeinschaft in Haus und Staat zum Leben nützlich und notwendig sind.“ Diese Güter stellen seiner Meinung nach den „wahre[n] Reichtum“ dar. „Denn was an derartigem Besitz erfordert wird, um für ein vollkommenes Leben zu genügen, ist nicht ohne jede Grenze, […]. Das Maß ist wohl gesetzt, wie für die anderen Künste ja auch. Denn kein Werkzeug irgendeiner Kunst ist nach Menge oder Größe unbegrenzt. Der Reichtum aber ist nichts anderes als eine Menge von Werkzeugen für die Haus- oder Staatsverwaltung“ (Pol. I, 1256b). Während die Bürger demnach mittels richtiger Verwaltung des Besitzes das gute Leben zu erreichen suchen, haben die Händler und Kreditverleiher als Ziel ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit den Gelderwerb bzw. die -vermehrung – ein tendenziell maßloses Tun. Damit ist aber das, worauf die Handels- und Gelderwerbswirtschaft gerichtet sind, zum einen kein eigentliches Ziel, zum anderen findet dabei eine Umkehrung von Zweck und Mittel statt: die Vermehrung des Vermögens wird vom Mittel für tugendhaftes Leben zum eigentlichen Zweck. Darin liegt aus der Sicht Aristoteles’ eine ernsthafte Gefahr für den inneren Zusammenhalt der polis: „Wenn die Logik des Profits die Oberhand gewinnt, werden selbst die Institutionen der Polis von ihr infiziert, und darin wird das Ende der politischen Tugend bestehen.“xcviii
3.3 Der Mensch als politisches Lebewesen
Die Formulierung, der Mensch sei ein zōon politikon, gehört zu den bekanntesten Aussagen Aristoteles’xcix und ist über die Jahrhunderte gewissermaßen zu einer der bedeutendsten Sentenzen der Sozial- und der Politischen Philosophie geworden. Die Häufigkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der dieser Satz verwendet wurde und wird, erwecken den Anschein, die Bedeutung der aristotelischen Formulierung sei klar und unproblematisch. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass das Verstehen dieser Sentenz durchaus voraussetzungsvoll ist.
Aristoteles argumentiert in der Politik, „dass der Staat zu den von Natur bestehenden Dingen gehört und der Mensch von Natur ein staatliches Wesen ist, und dass jemand, der von Natur und nicht bloß zufällig außerhalb des Staates lebt, entweder schlecht ist oder besser als ein Mensch, […] Denn er ist gleichzeitig von Natur ein solcher (staatsloser Mensch) und ‚nach dem Kriege begierig‘, indem er isoliert dasteht wie ein Stein im Brett. Dass aber der Mensch mehr noch als jede Biene und jedes schwarm- oder herdenweise lebende Tier ein Gemeinschaftswesen ist, liegt zutage. Die Natur macht, wie wir sagen, nichts vergeblich.“ (Pol. I, 1253a). Was an seinen Aussagen auffällt, ist zunächst die Betonung des Umstandes, dass der Mensch von Natur aus zum Zusammenleben in einem Staat drängt, außerdem die Kontrastierung von vorpolitischer Lebensweise einerseits sowie göttlichen Wesen und Tieren andererseits.
Was versteht Aristoteles nun unter ‚Natur‘? Für ihn ist ‚Natur‘ „lediglich ein Kollektivwort, der Inbegriff aller Gegenstände und Prozesse, einschließlich der sie bestimmenden Gesetzmäßigkeiten, bei denen es Selbstbewegungen gibt“c. Er begreift ‚Natur‘ nach dem Vorbild biologischer Abläufe: Es gibt Anfang, Ablauf sowie Ziel einer Entwicklung, die von einem den Dingen innewohnenden Prinzip angetrieben wird. Aristoteles hat ein wesentlich teleologisches Verständnis von ‚Natur‘, die für ihn die Bestimmung und den Zweck der Dinge ausmacht.
Anders ausgedrückt: Das Wesen der Dinge zeigt sich aus der Sicht Aristoteles’ vor allem in ihrer finalen Ausformung.ci Das bedeutet, dass erst der in einer staatlichen Gemeinschaft lebende Mensch zur Vollendung gelangen kann. Die Verbindung zwischen Mann und Frau sowie die daraus entstehende Familie, ebenso wie die aus mehreren Haushalten bestehende Dorfgemeinde, sind natürlich im Sinne der Notwendigkeit des Überlebens. Diese Gemeinschaften unterscheiden sich von der polis jedoch nicht nur in quantitativer Hinsicht, sondern vor allem in der Qualität des Zusammenlebens. Denn erst im staatlichen Verband verwirklicht sich der wesenseigene Sinn für Gerechtigkeit des Menschen. Zudem ist es ihm erst in der polis möglich, in Selbstgenügsamkeit zu leben. Wer sich hingegen nicht an das Recht des Staatsverbandes halten und somit nicht in Gemeinschaft leben kann oder ein autarkes Leben ohne Mitbürger führt, der ist für Aristoteles entweder ein Tier oder ein Gott.
In seiner zoologischen Schrift Historia Animalium unterscheidet der Philosoph zwischen herdenhaft und solitär lebenden Tieren.cii Die Herdentiere lebten sowohl gemeinschaftlich als auch zerstreut, wobei der Mensch diesbezüglich eine Zwischenstellung einnehme: „In Gemeinschaften leben diejenigen, die eine bestimmte Tätigkeit gemeinsam verrichten, was nicht alle Herdentiere tun. In Gemeinschaften leben der Mensch, die Biene, die Wespe, die Ameise und der Kranich. Von diesen leben die einen unter einem Anführer, die anderen sind anführerlos; […]. Sowohl von den herdenhaft als auch von den solitär lebenden Tieren leben einige ortsgebunden, andere ziehen umher.“ (Hist. An. I, 488a1–14). Demnach ist nicht nur der Mensch ein Gemeinschaftswesen, sondern auch andere herdenhafte Lebewesen sind politika, das heißt sie leben in polis-ähnlichen Assoziationen. Inwiefern ähneln ihre Gemeinschaften dem menschlichen Zusammenleben in der polis? Das entscheidende Merkmal dafür ist Aristoteles zufolge das Verrichten gemeinsamer Tätigkeit, die Kooperation, und nicht die Ortsgebundenheit oder das Vorhandensein von Herrschaftsverhältnissen.
Welche Bedeutung hat die Aussage Aristoteles’, der zufolge „der Mensch in höherem Grade ein staatenbildendes Lebewesen ist als jede Biene oder irgendein Herdentier“ (Pol. I 2, 1253a7, Übersetzung O. Gigon)? Damit meint er nicht, dass im Grunde genommen nur der Mensch ein zōon politikon sei und diese Bezeichnung anderen herdenhaften Tieren in geringerem Maße oder überhaupt nicht zukäme, denn damit würde er seinen eigenen zoologischen Ausführungen widersprechen.ciii Weshalb trifft die Bezeichnung ‚zu einem Staat gehörend‘ dennoch eher auf den Menschen als auf jedes andere schwarm- oder herdenweise lebende Tier zu? Weil der Mensch, so Aristoteles, als einziges Lebewesen die Sprache (logos) besitzt. „[D]ie Stimme gibt zwar ein Zeichen von Schmerz und Freude, deswegen ist sie auch den übrigen Lebewesen verliehen, denn ihre Natur gelangte bis zu der Stufe, dass sie Empfindung von Schmerz und Lust haben und diese untereinander anzeigen, die Sprache (logos) dient aber dazu, das Nützliche und Schädliche, und daher das Gerechte und Ungerechte, darzulegen. Denn dies ist den Menschen gegenüber den anderen Lebewesen eigentümlich, allein ein Empfinden für Gut und Schlecht, Gerecht und Ungerecht und anderes zu haben. Die Gemeinschaft in diesen Dingen begründet aber den Haushalt und Staatsverband“ (Pol. I 1, 1253a 9–18, Übersetzung E. Schütrumpf). Der Mensch kooperiert demnach ebenso wie die herdenhaften Tiere mit seinesgleichen, äußert dabei jedoch nicht nur Unmut oder bloße Zustimmung über die gemeinschaftliche Leistung, sondern hat die Fähigkeit, weil er im Besitz von logos ist, die Art des Zusammenlebens und -handelns zu bewerten, zu kritisieren und nötigenfalls zu verändern.
In anderen seiner Schriften, die keinen zoologischen Charakter haben und sich ausdrücklich auf den Bereich des menschlichen Lebens beziehen, grenzt Aristoteles die ‚politische Natur‘ des Menschen weiter ein. Bei der Behandlung der Frage, ob Freundschaft zum glücklichen Leben dazugehöre oder ob ein glücklicher Mensch, der scheinbar im Besitz von den notwendigen Gütern und mithin autark sei, aufgrund seiner augenscheinlichen Unabhängigkeit keine Freunde brauche, betont Aristoteles in der Nikomachischen Ethik, dass die Menschen „für die Gemeinschaft der Polis und von Natur für das Zusammenleben bestimmt“ seien (Eth. Nik. IX 9, 1169b19, ähnlich bereits Pol. I, 1097b). Er hebt die Unmöglichkeit des glücklichen Lebens ohne Freundschaft hervor und kontrastiert damit das gesellschaftliche Leben mit der Existenz in der Vereinzelung.
Im VII. Buch der Eudemischen Ethik führt er aus, dass „der Mensch nicht nur ein für die Polisgemeinschaft, sondern auch für die Hausgemeinschaft bestimmtes Wesen“ sei (Eth. Eud. VII 10, 1242a). Aristoteles fährt mit der Betonung des Umstandes fort, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen sei, das von Natur aus an die gebunden sei, die ihm verwandt seien. Auch dann, wenn keine polis existierte, gäbe es dennoch Formen von Gemeinschaft, insbesondere die Hausgemeinschaft.civ Das Besondere am Menschen sei aber, dass er in seinem Streben nach gemeinschaftlichem Leben nicht nur auf seine Familie bzw. den eigenen Haushalt bezogen bleibe, sondern sich sein Menschsein innerhalb der Polisgemeinschaft entfalte. Damit stellt Aristoteles das Zusammenleben und -handeln innerhalb der polis – das heißt die ‚politische Natur‘ des Menschen – im exklusiven Sinn dem Leben in anderen menschlichen Gemeinschaften gegenüber. Im inklusiven Sinn behandelt er die Polisgemeinschaft und die auf sie gerichtete Natur des Menschen, indem er die polis