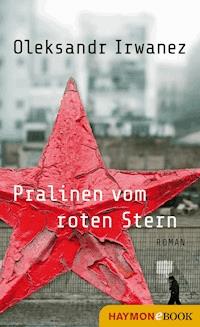
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine geteilte Ukraine: Zurück in die Zukunft? Schauplatz Ukraine: der zerbrochene Osten Europas Eine im Nordwesten des Landes gelegene Stadt wird durch eine Mauer in zwei Zonen geteilt - in das zur Westukrainischen Republik gehörende Riwne und in Rowno. Rowno ist Teil der Sozialistischen Ukrainischen Republik, in der man nicht nur politisch, sondern auch sprachlich in die sowjetische Vergangenheit zurückgekehrt ist. Verbunden werden die beiden Teile nur durch einen schmalen Korridor. Reine Fiktion? Oder ein mögliches Zukunftsszenario? Reise in die alte Heimat - ohne Garantie auf Rückkehr Schlojma Ezirwan hat einen Namen in der ukrainischen Literaturgeschichte. Schon lange vor der Teilung war er im ganzen Land bekannt. Nun, kurz vor der Premiere seines neuesten Theaterstücks in Riwne, besucht er seine in Rowno verbliebene Familie: eine Reise in die eigene Vergangenheit, zu den Orten seiner Kindheit, Jugend und ersten Liebe. Aber gleichzeitig auch eine gefährliche Reise in eine Gegenwart, die an die Zustände in der Sowjetunion erinnert: Anstatt in Ruhe seine Verwandten besuchen zu können, wird Schlojma Ezirwan von zwei Agenten der Inneren Sicherheit gekidnappt. Ein groteskes Abenteuer nimmt seinen Lauf. Was hat man mit ihm vor? Und welche Rolle spielt dabei sein kritischer Roman "Die Mauer"? Die geteilte Ukraine als Fiktion bedrohlich nahe an der Realität? Eine Fahrt vom Westen in den Osten, vom Heute ins Gestern - oder vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Ereignisse in der Ukraine: eine Reise in die Zukunft? Mit Russlands Annexion der Krim 2014, dem Ausruf der "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk und dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine 2022 bekommt Oleksandr Irwanez' satirischer Roman brisante und tragische Aktualität. Gleichzeitig greift der Autor einen brennenden Missstand unserer Zeit auf: die prekäre Situation kritischer Künstler*innen und Journalist*innen in nur vordergründig demokratischen Staaten. Eine spannende Satire, deren Absurdität von der Realität eingeholt zu werden droht. Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil Mit einem Vorwort von Jurij Andruchowytsch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oleksandr Irwanez
Pralinen vom roten Stern
Roman
Aus dem Ukrainischen von
Ein Blick hinter die Mauer
Vorwort von Juri Andruchowytsch
Fans von James Joyce haben ihren Bloomsday, und zwar am 16. Juni.
Fans von Oleksandr Irwanez könnten – im Falle eines Falles – ihren Schlojma-Tag immer am 17. September haben.
So wie der Bloomsday jedes Jahr in Dublin stürmisch gefeiert wird, so könnte der Schlojma-Tag zweifellos in Riwne zelebriert werden. Nun hat die Stadt Riwne für die Ukraine bei weitem nicht die Bedeutung von Dublin für Irland, doch der Schriftsteller Oleksandr Irwanez verlieh der Stadt mit seinem Roman eine beachtliche, zumindest literarische Bedeutung.
Die Gemeinsamkeit beider Romane ist offensichtlich, denn es geht sowohl im Roman von Joyce als auch in dem von Irwanez um einen Tag mit einem konkreten Datum. Der Unterschied liegt freilich darin, dass Joyce das Jahr genau bestimmte: 1904. Irwanez gibt keine genaue Jahreszahl. Die Handlung des Romans spielt nicht wie bei Joyce in der Vergangenheit, sondern „quasi“ in naher Zukunft. Warum ich eben das Wörtchen „quasi“ verwendet habe, wird im Weiteren klar werden.
Vorläufig aber noch ein paar Worte zum Datum 17. September. Oleksandr Irwanez und ich gehören einer Generation von Ukrainern an, die in Sowjetschulen Sowjetgeschichte lernten und deshalb gezwungen waren, sich diesem Datum gegenüber ehrfürchtig zu verhalten. Denn am 17. September 1939 marschierten die Kampfverbände der Roten Armee in das Territorium der östlichen Regionen der Zweiten Polnischen Republik ein und besetzten sie nach kurzer Zeit vollständig. Damit halfen sie ihrem Verbündeten, dem Dritten Reich, das polnische Staatswesen zu liquidieren. Dank dieser Tatsache vereinigten die Sowjets „quasi“ (schon wieder dieses Wörtchen!) die ost- und westukrainischen Gebiete zu einer einzigen ukrainischen sozialistischen Republik (URSR) mit der Hauptstadt Kiew und noch einer Haupthauptstadt Moskau.
So wurde der 17. September zu einem Datum mit gegensätzlichem Sinn. Einerseits ein ganz besonderer „Tag der ukrainischen Einheit“, freilich irgendwie ein Fake, denn die Einheit war kommunistisch und vor allem erzwungen, und anderseits signalisiert er den Beginn der totalitären Unterwerfung der westukrainischen Gebiete und Repression gegen die lokale Bevölkerung im großen Stil durch die Bolschewiken.
Ein sprechenderes Datum hätte der Autor für die Handlung seines Romans kaum wählen können.
*
Aufgrund biographischer Umstände ist der Autor dieser Zeilen in nicht geringem Maße an der Entstehungsphase von „Riwne-Rowno“, wie „Pralinen vom roten Stern“ im ukrainischen Original betitelt ist, beteiligt gewesen. Der Roman ist Olav Münzberg, einem deutschen Gegenwartsautor gewidmet, der Prosa, Lyrik und Publizistik verfasst und darüber hinaus – was besondere Aufmerksamkeit verdient – im Laufe mehrerer Jahrzehnte zu einem „Wahl-Westberliner“ und für mich zum heldenhaften Führer (im Sinne eines Stadtführers) während meines ersten Aufenthalts in dem eben wiedervereinigten Berlin Ende 1993 wurde. Der Zufall wollte es, dass wir uns ungefähr nach einem Jahr auf einer internationalen Schriftstellerkreuzfahrt begegneten und zwar auf einem sechsstöckigen griechischen Kreuzfahrtschiff mit dem wohltönenden Namen „World Renaissance“. Während des unruhigen Geschaukels über drei Meere machte ich Olav mit meinen beiden besten Freunden und Bubabisten – Wiktor Neborak und den Autor des vorliegenden Romans – bekannt. Irwanez hatte im darauf folgenden Jahr 1995 die Chance, selbst nach Berlin zu kommen. Zu seinem Glück führte ihn kein anderer durch die Stadt als eben Olav Münzberg. Er zeigte ihm nicht nur die Stadt, sondern auch die Mauer. Zwar existierte sie quasi nicht mehr, aber in den Erzählungen von Olav wurde sie sehr existent. (Das Wörtchen „quasi“ wird immer markanter und in diesen Aufzeichnungen werde ich es sicher weiter verwenden).
*
Nun werden wir noch einen Schritt weiter in die Vergangenheit in Richtung des seltsamen Begriffs „Bubabisten“ machen, dem ihr sicher schon eure Aufmerksamkeit zugewendet habt.
Der Autor dieser Zeilen kennt nämlich den Autor dieses Romans schon seit Februar 1985. Damals waren wir junge Dichter und es fehlte uns in der damaligen Dichtung ganz entschieden Burleske, Balahan (resp. Jahrmarktskunst) und Buffonade. Und so nannten wir unser Dichter-Trio Bu-Ba-Bu. Der Dritte im Trio war der schon erwähnte Wiktor Neborak.
Im Großen und Ganzen handelte es sich um ästhetische Subversion. Wir hatten uns fest vorgenommen, die herrschenden Grenzen des Anstands in der Dichtung zu verschieben. Unsere Performance zwischen 1987 und 1992 war legendär und wurde zum markantesten Phänomen dieser wunderseltsamen Zeit. Das Sowjetsystem ging unter und zerfiel quasi von selbst und die ukrainische Unabhängigkeit wurde geboren. In dieser ganzen Geschichte sahen wir uns nicht nur als Zeugen und Chronisten, sondern auch als die eigentlichen Propheten des Künftigen.
An dem Abend, als in Berlin die Mauer endgültig niedergerissen wurde, traten wir mit unseren Gedichten auf der Bühne der überfüllten Theater meiner Heimatstadt auf. Wir verwandelten die Stadt in eine offene Stadt in völligem Einklang damit, wie die Berliner ihre Stadt öffneten. Es war eine parallele, ideal überblendete Aktion.
Die aktive Phase des Bubabismus endete wohl ungefähr damals, als ich den Autor dieses Romans Olav Münzberg vorstellte. In dem Jahr feierten wir ausgelassen das hundertjährige Bu-Ba-Bu-Jubiläum (entsprechend dem Alter von uns Dreien 34+33+33=100) sowie den Abschluss der Vorbereitungen für unsere erste Anthologie. Damit konnten wir uns verabschieden und unterschiedliche Wege gehen.
Der Weg von Oleksandr Irwanez führte großteils über Theaterstücke. Nein, nein, er hörte schon aus Prinzip nicht auf, Gedichte zu schreiben, wie auch der Autor dieser Zeilen. Mit seinen Theaterstücken hatte er einige außergewöhnliche Erfolge. Zum Teil solche, dass man seine Werke auf deutschen Bühnen deutlich eher inszenierte als auf ukrainischen. Ein Echo dieses Theater-Weges findet der Leser dieses teilweise autobiographischen Romans im Hauptstrang der Handlung.
Der Roman wurde aus diesen Theaterstücken geboren. Es kursierten seit Ende der 1990er Jahre Gerüchte über ihn. Als ich meinen alten Kumpel Oleksandr 2001 für einen ganzen Monat wieder in Deutschland begegnete, und zwar in der für kreative Arbeit geradezu idealen Künstlervilla „Waldberta“, wurde der Roman in der Ukraine gerade zum Druck vorbereitet. Zur Taufe des Buchs fuhr ich im Februar 2002 nach Riwne und las dabei die letzten Seiten des Manuskripts in einem halbdunklen, schmutzigen und winterlich kalten Wagon der ukrainischen Eisenbahn.
Das reale Land des Autors sowohl innerhalb als auch außerhalb des Eisenbahnwagons schien sich so ganz und gar nicht von jener im Roman dargestellten, erbärmlichen Sozialistischen Republik Ukraine zu unterscheiden.
*
Die Spezifik dieser Zeit lag in der Annäherung an eine gewisse Grenze: Nach ausdauernden, aber letztlich erfolglosen Protestaktionen, die eine „Ukraine ohne Kutschma“ als Ziel hatten, begann das übliche Abgleiten des offiziellen Kiews in die Arme Russlands mit seinem neuen und geheimnisvollen Präsidenten, hinsichtlich dessen (Who is Mr. Putin?) wir nicht die leisesten Zweifel hatten: Mr. Putin is a fucking KGB-crap. Vor diesem Hintergrund entfaltete sich eine beispiellose Kampagne im Parlamentswahlkampf, in dem schließlich überhaupt zum ersten Mal die oppositionelle Demokratie gewann.
Das machte eine neu entstandene gesellschaftliche Qualität in der Ukraine sichtbar und versprach auch neue gesellschaftliche Perspektiven. Nach etwa zweieinhalb Jahren erschien diese neue Perspektive massenhaft auf dem zentralen Platz der Hauptstadt, dem Unabhängigkeits-Majdan, in einem durch und durch intensiven Orange.
Der Roman von Irwanez, der ja im Vorfeld der Orangen Revolution mit ihrem kategorischen Sein oder Nichtsein geschrieben worden war, konnte durchaus als Antiutopie verstanden werden oder, auch solche Genres gibt es, als eine Roman-Prophezeiung.
Die Vorgeschichte des Romans verweist auf eine nicht näher genannte politische Katastrophe, wegen der die Ukraine in zwei Teile gespalten wurde: in eine prorussische SRU (Sozialistische Republik Ukraine), die einen beträchtlichen Teil des ehemaligen ukrainischen Territoriums einnimmt, sowie die prowestliche Westukrainische Republik. Die Spaltung der Ukraine verläuft auch quer durch die Heimatstadt des Autors und des Romanhelden. Aus einer Stadt werden zwei Städte: das zum Westen gehörende Riwne und sein Gegenpart, das sozialistische Rowno. Die einst zusammengehörende Welt wird nach dem bekannten Berliner Muster aus den Jahren 1961–1989 durch eine Mauer geteilt.
Das Romansujet erzählt einen Tag aus dem Leben des Schlojma Ezirwan, eines Schriftstellers und Bewohner des Westsektors, den er freilich im Ostsektor verbringen muss, da er seine Verwandten besuchen will.
*
Lässt sich aus heutiger Perspektive, besonders im Zusammenhang mit der militärischen Auseinandersetzung mit Russland und ihren Marionetten in den östlichen Landesteilen der Ukraine, der Roman „Riwne-Rowno“ tatsächlich als Roman-Prophezeiung bezeichnen?
Auf den ersten Blick schon. Seit dem Frühjahr 2014 (12 Jahre nach dem ersten Erscheinen des Romans) kann man in der Ukraine eine territoriale Spaltung beobachten. Natürlich kann man einwenden, dass die territoriale Verteilung genau umgekehrt wie im Roman ist. Das heißt, „unsere SRU“ ist ziemlich klein und „unsere Westukrainische Republik“ gleicht der Westukrainischen Republik im Roman ganz und gar nicht, da sie etwa 90 Prozent des ehemaligen Territoriums mit den südlichen, zentralen und östlichen Gebieten mit der Hauptstadt Kiew und deren wichtigsten Metropolen (Dnipro, Odessa, Charkiw) umfasst und nicht nur, wie im Roman, einige westukrainische Gebiete.
Das bedeutet, die Prophezeiung hat sich, wenn überhaupt, nur teilweise erfüllt, und zwar vor allem in einem Sinn: Tatsächlich wird ein kleines Gebiet nicht mehr von Kiew kontrolliert. Allerdings entgegen der Prophezeiung nicht aus westlicher Sicht, sondern aus der östlichen. Und dass es überhaupt existiert, hat nur die unmittelbare militärische Intervention Russlands ermöglicht und auch dessen weitere Existenz wird nur vom russischen Militär gesichert. Übrigens genauso wie im Roman die Existenz des demokratischen und freien Riwne durch die Anwesenheit eines begrenzten Kontingents von NATO-Soldaten (einem polnischen Bataillon) gesichert wurde.
Und an dieser Stelle ist es nun höchste Zeit, das Allerwichtigste zu erwähnen: Hat Oleksandr Irwanez tatsächlich in die Zukunft geblickt? Ist der Platz dieser Quasi-Antiutopie tatsächlich auf dem gleichen Bücherregal, auf dem sich die warnenden Werke von Orwell, Huxley oder Lem befinden?
Irwanez’ Roman handelt von der Vergangenheit. Das heißt, die Reise des Helden auf die andere Seite der Mauer erscheint nicht nur als Bewegung durch den Raum, sondern vielmehr und in größerem Maß durch die Zeit. Es ist eine Rückkehr in die Vergangenheit – in eine böse, komische, absurde, primitive, totalitäre, soz-realistische parodiehafte Vergangenheit. Die Zeit, das wird deutlich, scheint manchmal „quasi“ stehenzubleiben oder rückwärts zu laufen.
Als Ergebnis haben wir die karikierte SRU und ihre abscheuliche Stadt Rowno – eine fast schon zeitlose Verdichtung alles Sowjetischen, Anachronistischen und Abgestorbenen.
Und doch handelt es sich auch um ein Territorium der Nostalgie, Erinnerung, Sentimentalität, um eine Zone der verlorenen Zeit, die man unerwartet wiederfindet, einen Raum der Rekonstruktion von Träumen, die man, wie es schien, damals, in der Kindheit, ein für alle Mal ausgeträumt hatte – so wie der Autor des Romans und der Autor dieser Zeilen.
Und auch sonst haben der Autor und ich ein gemeinsames Land, nämlich eines, in dem nicht nur böse Träume von Zeit zu Zeit wiederkehren können.
Rowno: Gebietszentrum der Sozialistischen Republik der Ukraine. Einwohnerzahl: 120.000 (Volkszählung 2001); Industriezentrum mit Landmaschinenbau und Textilindustrie.
Durch die Intervention einiger europäischer Staaten und die Unterstützung reaktionärer Kräfte der Westukrainischen Republik wurde der Westteil der Stadt Rowno, der untrennbarer Bestandteil der Sozialistischen Republik der Ukraine ist, okkupiert und zu einem Verwaltungsgebiet der UNO gemacht. Laut Volkszählung vom September 2001 leben im Westsektor von Rowno 150.000 Einwohner. Die Wirtschaft des Westsektors kennzeichnet alle Unzulänglichkeiten und Fehlentwicklungen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung wie hohe Arbeitslosigkeit, Inflation und Korruption. Im Westsektor gilt die Währung der Westukrainischen Republik. Die Sozialdemokratische Partei des Westsektors von Rowno hat eine lange demokratische und nationale Tradition und zählt 2400 Mitglieder.
aus: Kleine Enzyklopädie der ökonomischen Geographie der Sozialistischen Republik der Ukraine. Polit-Verlag Kiew.
An einem bereits fortgeschrittenen Morgen eines herrlichen Septembertages erwachte der Schriftsteller Schlojma Ezirwan mit einer seltsamen Vorahnung. Er hatte ein Traumgesicht gehabt, undeutliche Bilder, die Phantome tanzten noch durch das schlaftrunkene Hirn und verloren sich dabei immer tiefer im Unbewussten, sie ließen sich weder festhalten, noch wollten sie vollends verschwinden. Abrupt setzte er sich im Bett auf, entledigte sich des offenen Pyjamahemds, das sich um seine Achsel gewickelt hatte. Das gelbliche Sepia eines Kastanienblattes klebte von außen an der Fensterscheibe und glitt ganz allmählich hinab. Durch das geöffnete Klappfenster zog pfeifend ein Lüftchen.
Der Schriftsteller wühlte sich aus der Decke und schlappte barfuß zum Fensterbrett. Mit den tastenden Bewegungen eines Blinden fand er die Zigarettenschachtel und das Feuerzeug. Jetzt vor allem: nicht den Filter anzünden, sondern den Tabak … Ahh, auch die Äuglein gehen schon etwas auf. So. Und was jetzt? Nebel im Kopf, Nebel vorm Fenster. Ja, ja, die dritte Flasche mit Maulwurf zu kippen war überflüssig … auch die zweite war eigentlich nicht nötig. Sei’s drum. Ist halt passiert. Irgendwo dort im Schrank war Aspirin.
In der Küche plumpste etwas auf den Fußboden. Bonifaz war vom Tisch gesprungen. Was macht der denn wieder auf dem Tisch … Noch gestern … Ähh, wie ätzend. Da sind sie, die Folgen des Leichtsinns und lockeren Lebens. Es ist zwei Wochen her, seit Oksana ihm eine wütende Nachricht auf dem Tisch hinterlassen hatte: „Wenn dir deine Arbeit so wichtig ist, dann können wir ja eine Zeit lang getrennt leben.“ Sie war durch den KlewanTransit-Korridor zu ihren Eltern in ein ruhiges Dorf in Wolhynien entschwunden. Schlojma hatte nur die Achseln gezuckt: Getrennt heißt getrennt …
Der Eurowecker am Kopfende des Bettes piepste. Tatsächlich – 07:47. Sieben mal sieben im Quadrat. Abergläubisch, mein lieber Schlojma, abergläubisch bist du dein ganzes Leben von Kindesbeinen an. Die Aspirintablette ploppte ins Wasserglas und tänzelte gurgelnd zwischen Bläschen auf und nieder. Der Kaffee zischte wie eine Schlange, als er in der Dscheswa nach oben kroch. Von hinten stupste ihn Bonifaz ans Knie. Hast Hunger, Katerchen? Ich nehme nur den Kaffee vom Herd. Ich habe da Whiskas für dich, mehr als eine halbe Dose. Vom Geruch der Fleischmasse kam ihm fast das Kotzen. Da hast du deinen gestrigen Johnnie Walker! … Ahh, es lässt nach. Das Aspirin wirkt schon. Dann kann ich jetzt Kaffee trinken.
Während er einen Keks zerbröselte, blickte der Schriftsteller Ezirwan aus dem Küchenfenster. Der Nebel hatte sich ein wenig gelichtet, die gelblichen Umrisse der Kastanien im Innenhof traten hervor. Weiter hinten war eine Hofhälfte vom Parkplatz des Hotels Europäischer Hof abgezäunt, dort patrouillierte zwischen schwarzen und silbernen Limousinen ein hoch aufgeschossener Wächter im grauen Frack. Näher zum Haus befanden sich unter den Kastanien einige metallene Bänke, im Boden verschraubt, vom Morgentau bedeckt, und bei den Bänken ein Sandkasten, aus dem ein vergessenes blaues Kindereimerchen ragte. Sechs viergeschossige Häuser drängten sich im Karree und umschlossen den Hof. Rechts, im abgeschlossenen Winkel des Hofes befanden sich in bläulichen Morgentau gebadet drei Autos mit einheimischen Nummernschildern, Eigentum der reicheren Hausbewohner.
Die Nächte sind schon kalt geworden, schwirrte es ihm durch den Kopf, es wäre Zeit, in den Wald, in die Pilze zu gehen, in Wolhynien. Nach der Premiere sollte ich Georg und Isabella dazu einladen.
Doch nach einem Moment trat hinter dem Zifferblatt die Realität sichtbar, geradezu plastisch hervor: Das ist ja heute! Heute ist Premiere! Um halb zehn ist das Treffen mit Maulwurf im Theater. Und jetzt ist es schon fünf, nein sechs vor neun. Bleibt also noch eine Viertelstunde zum Rasieren. Und da muss ich schon hetzen. Gut, dass das Theater gleich nebenan ist, nur über die Straße …
Der Schriftsteller Schlojma Ezirwan schluckte den restlichen Kaffee runter, stellte die Tasse scheppernd in die glänzende Spüle, in der sich bereits Gläser, Töpfe und anderes Geschirr stapelte … Nach der Premiere, ich wasch das alles nach der Premiere ab …, brummelte er vor sich hin und ging, nicht mehr schlurfend, sondern schon festen Schrittes, ins Bad.
Zehn Minuten später, während er sich noch das Gesicht abtupfte, verließ er das Bad und verbreitete eine Duftwolke des guten alten Rasierwassers Old Spice. Aus der Garderobe wählte er ein weiß-blau gestreiftes Hemd und eine graue Anzughose. Er zögerte einen Moment und nahm dann eine neue Jeansjacke vom Kleiderbügel. Smoking und Fliege sind erst heute Abend dran …
Schlojma tappte noch ein, zwei Minuten gedankenverloren durch die Wohnung, steckte hier seinen Geldbeutel ein, fand dort die Zigarettenschachtel und wieder woanders Schlüssel, Taschentuch, Feuerzeug und andere Kleinigkeiten. Im Vorzimmer kramte er nochmals alles hervor und kontrollierte, ob er auch nichts vergessen hatte. Dort schaltete er noch den Anrufbeantworter ein und brummte in Richtung Kater: „O.k., Boni, jetzt bist du hier der Chef!“, zog die Tür hinter sich zu und stand im Treppenhaus. Während er sich eine Zigarette anzündete, bemerkte er mit einem Seitenblick, dass in dem Metallbriefkasten an der Wand links etwas Weißes durch die kleinen Löcher des Metalltürchens leuchtete. Hmmm, die Post ist heute schon durch … Kann das bis zum Abend warten? … Nein, ich schau lieber nach. Wo ist denn der Briefkastenschlüssel? … Da ist er ja. Na, was haben wir im Kasten? Weiter hinten befanden sich einige Zeitungen und Reklamen mit den üblichen Angeboten der Supermärkte, vorne jedoch, gleich wenn man die Klappe öffnete, die weit aufschwang und schief in den Angeln hing, befand sich ein weißer Briefumschlag mit den Briefmarken der SRU, der Sozialistischen Republik der Ukraine, abgestempelt in Rowno. In der Adresszeile:
Genosse Ezirwan Sch. W.,
Westsektor Rowno,
Polubotkostraße, Haus 8, Whg. 45.
So stand es da. Und in der Absenderzeile:
Gebietsamt für inneren und äußeren Reiseverkehr der Bevölkerung der SRU des Gebiets Rowno.
Der Stempel war zwei Wochen alt, 2. September, oder besser gesagt 2. Sentiabr, wie man dem verschmierten Stempel entnehmen konnte. Naja, innerhalb von ein und derselben Stadt, von dort hinter der Mauer über die Mauer hierher, hatte der Brief ganze zwei Wochen gebraucht. Und der Stempel aus dem Westteil stammt von heute Morgen. Ganz normal. Also … was schreiben die …
An der Klebestelle war der Umschlag wellig und schief mit einer Masse verklebt, die wie Wachs aussah – um nicht einen unangenehmeren Vergleich zu wählen. Schlojma riss den Umschlag einfach am kurzen Ende auf. Der Inhalt bestand aus einem zweimal gefalteten Blatt braunen Büropapiers, das von innen auch noch mit dem Umschlag verklebt war. Ezirwan löste also das Blatt aus dem Kuvert, indem er behutsam daran zog und es dabei hin- und herbewegte. Dann faltete er das abgeschabte Papier auseinander, auf dem unter dem Amtssiegel des Gebietsamts für Inneren und Äußeren Reiseverkehr und dem vorgedruckten und dann durchgestrichenen „Genosse“ ein ukrainischer Text folgte, der auf einer russischen Schreibmaschine verfasst war, so dass der Buchstabe „e“ für die ukrainischen Buchstaben „e“ und „je“ stand, und die Zahl „1“ den Buchstaben „i“ und „ji“ ersetzte.
Genosse Ez1rwan Schlojma,
wohnhaft 1n der Stadt Rowno, Westsektor, Polubotkostraße, Haus 8, Whg. 45, Geb1etsamt für 1nneren und äußeren Re1severkehr der Bevölkerung der SRU des Geb1ets Rowno te1lt 1hnen m1t, dass S1e gemäß des tr1lateralen Abkommens über den Status des Westsektors der Stadt Rowno und entsprechend den D1enstvorschr1ften der Grenzübergänge d1e Erlaubn1s für e1nen 1-täg1gen (e1ntäg1g) Besuch der Stadt Rowno am Donnerstag, den 17. September von 10 – 19 Uhr haben. Grenzübergang Nr. 1, Len1nstraße, D1enstantr1tt 10 Uhr.
Ober1nspektor Rowno OBUSWMN
Unleserliche Unterschrift
(Koltunetz)
*
Nachdem Schlojma das Schreiben überflogen hatte, blickte er unruhig auf die Datumsanzeige seiner Armbanduhr: Sept. 17 Thursday. Ja, das war heute. Das hatte gerade noch gefehlt. Aber er musste unbedingt fahren.
Er stopfte den Umschlag samt Schreiben in die Tasche und eilte fast laufend auf die Straße, hastete nach links, querte die Polubotkostraße gerade an der Stelle, wo sie mit der ziemlich kurzen Pravdastraße zusammenlief – wobei die daran anschließende Straße der Freiheit im Ostteil der Stadt verblieben war –, entkam dabei nur knapp der stumpfen Nase des Trolleybusses Nummer 3, wich dann einem orange glänzenden Kanaldeckel aus und lief schließlich eine Asphaltrampe hoch zum Hintereingang des Stadttheaters. Er grüßte den Pförtner, ging den Flur entlang und nahm den Aufzug für Angestellte, fuhr in den zweiten Stock, wo sich gegenüber dem Fahrstuhl das Vorzimmer und Büro des Regisseurs befanden. Der Star der westeuropäischen Bühnen, der Gastregisseur Georg Maulwurf wartete in seinem Büro auf Ezirwan. Er stützte den Kopf mit dem zerzausten Haarkranz auf den Händen …
Als Schlojma eintrat, nickte der Gastregisseur zwar grüßend, doch seine Augen blickten leiderfüllt.
Schlojma rief von der Schwelle: „Guten Morgen.“
„Tobryj … ranok!“, gab Maulwurf mit einer gequälten Pause zwischen den Wörtern den Gruß zurück. „Da hab’n wir’s gestern ja krachen lassen.“
„Entschuldige, ich wurde etwas aufgehalten.“ Schlojma wollte sich gar nicht erst auf eine Analyse des Absturzes einlassen.
„Vielleicht … war die … ähh … dritte Flasche zu viel …“
„Oohhh ja-a-a!“ Maulwurf rollte die Augen und ließ den Kopf auf die Tischplatte sinken. Nach wenigen Sekunden hob er schon etwas erleichtert den Kopf. „Kleich sollte Isabella gommen. Fyr die letzten Apsprachen. Tobryj?“
„Dobryj, gut, gut …“ Schlojma wollte es nicht lange hinauszögern und entschied, die Situation gleich zu klären.
„Georg, ich hab gerade die Erlaubnis von drüben erhalten. Na, von da drüben aus Rowno. Die Erlaubnis, meine Verwandten zu besuchen. Gerade für heute. Falls ich dir … nun, wenn ich nicht unbedingt anwesend sein muss …“
„Tu musst mir gar nichts“, antwortete ihm der Gastregisseur mit einer noch immer gequälten Stimme, „… nur, hast tu Alka Seltzer?“
In diesem Moment öffnete sich mit einem gedehnten Quietschen die Bürotür und es erschien Isabella Stolz – die Primadonna der süddeutschen Bühnen, der aufgehende Stern der Theater Bayerns und Baden-Württembergs.„Ha-allo!“, zwitscherte sie, lächelte breit und musterte aufmerksam Schlojma und Maulwurf. „Tag“, entgegnete Schlojma hastig und gab Maulwurfs Frage an sie weiter. „Hast du vielleicht Alka Seltzer?“
„Aber ja, ja, natürlich …“ Sie stellte schwungvoll ihre Handtasche auf dem Tisch ab, die sich dadurch weit öffnete.
„Was so alles in eine Frauenhandtasche passt“, dachte Schlojma, während er beobachtete, wie Isabella zwischen Schlüsseln, einer Puderdose, Lippenstiften, einer Packung Tempos, mehreren Kassenzetteln und anderem Krimskrams schließlich Tabletten in Silberfolie herausfischte.
„Bitte.“ Sie hielt sie Schlojma hin.
„Das ist für Georg“, sagte Schlojma und die Schauspielerin reichte sie dem Regisseur.
Der legte sie vor sich ab, goss sich bedächtig ein Glas Wasser ein und blickte dann zu Isabella und Ezirwan, schließlich brummte er in seinem schrecklichen Ukrainisch: „Zetzt euch, waz stäht ihr rum?“
Isabella rückte einen Stuhl heran, setzte sich und packte den auf dem Tisch verstreuten Krimskrams ihrer Handtasche wieder ein. Schlojma, der hinter ihr stand, angelte sich eine Zigarette aus der Packung. Schon die dritte heute …, überlegte er.
„Ich hab gestern entgültich das Licht … also die Peleuchtung gerechelt.“ Maulwurf trank gut ein Viertel des Glases leer und schmatzte dann, während er auf den Inhalt des Gefäßes blickte. Dann trank er mit einem Schluck den Rest und seine hellen Augen blickten aus dem Fenster. Er nickte dabei. Sein Blick verlor sich jenseits des Daches vom Radissonhotel Theater. Er sagte: „Tu willst also da rüberfahren?“
„Wie?! Was gibt’s? Schtscho dijetsja?“ Isabella drehte munter ihr hübsches Köpfchen. „Wer fährt wohin?“
Ukrainisch konnte sie besser als Maulwurf, schließlich sollte sie hier auf Ukrainisch spielen. Deshalb stimmte die Grammatik fast immer und den deutschen Akzent hörte man kaum.
„Er vill rüberfahren …“ Maulwurfs Zunge löste sich allmählich. „Er hat ein Einreisefisum. Zum Pesuch seiner Verfandten …“
„Oh! Prima …“ Isabellas Augen glänzten freudig auf, rundeten sich aber gleich darauf erschrocken. „Aber … hmm … wenn du nicht zurückkommst … von dort …“
„Aber nei-in“, entgegnete Schlojma langgezogen, während er die Zigarette aus dem Mund nahm. „Ich bin ihnen noch nie in die Quere gekommen, und überhaupt. Für was könnten die mich brauchen?“
Maulwurf hielt sich plötzlich die Hand vor den Mund und ließ – auch durch den Mund – überflüssige Luft entweichen. Schlojma blickte ihn mitleidig an, er kannte das. Maulwurf wechselte jetzt ins Deutsche: „Dann lasst uns schnell das Wichtigste besprechen. Ich habe gestern endgültig über Beleuchtung und Sound entschieden. Und außerdem habe ich noch eine interessante Idee … ihr werdet sehen.“
Schlojma und Isabella blickten den Regisseur bestürzt an. „Eine interessante Idee“ am Tag der Premiere, wenn alles bereits vorbereitet ist, tausendmal geprobt, geübt, eingeschliffen. Das muss wirklich schon etwas ganz Außergewöhnliches oder Spektakuläres sein. Inzwischen war Maulwurf aufgestanden.
„Kommt mit!“, sagte er ziemlich gebieterisch und lenkte seine Schritte in Richtung Tür.
Isabella erhob sich, zögerte einen Moment, ließ ihre Handtasche dann aber über der Stuhllehne baumelnd zurück. Schlojma ging als Letzter. Maulwurf wälzte sich vorwärts und nachdem er den Liftknopf gedrückt hatte, wandte er sich zur Schauspielerin und zum Dramaturgen um. Als sich die Lifttüren hinter ihnen geschlossen hatten, angelte der Gastregisseur ein Schlüsselchen aus der Tasche, und nachdem er den entsprechenden Schlitz gefunden hatte, steckte er ihn in einen der Knöpfe auf dem Schaltfeld.
Komisch, ich habe noch nie bemerkt, dass es hier im Lift so einen Knopf gibt, dachte Ezirwan, während er den Vorgang beobachtete. Inzwischen rauschte die Kabine abwärts. Es dauerte etwas länger als die übliche Fahrt zum ersten Untergeschoss.
„Wir fahren in den Keller …“, meinte Isabella fragend und konstatierend zugleich, richtete den Blick nach oben und blickte dann von Schlojma zu Maulwurf und wieder zurück. „Warum?“
„Kenau!“ Maulwurf lachte. „Ich muss euch vas zeiken. Tas ist mein überraschender Einfall. Tie Rebellen im tritten Akt kommen nicht einfach hinter den Kulissen hervor, sondern aus dem Untergrunt, von unterhalb der Pühne. Mir ist das heute Nacht eingefallen …“ Der Regisseur warf Schlojma einen verschwörerischen Blick zu. „Nachdem wir uns verabschiedet hatten.“
„Da konntest du noch über die Vorstellung nachdenken?“ Er sagte das mit aufrichtiger Bewunderung.“
„Ich tenke die ganze Zeit darüber nach.“ Maulwurfs Lächeln verschwand, der Fahrstuhl stoppte, die Türen gingen auf.
Vor ihnen erstreckte sich ein Kellergang, lang, schmutzig, dunkel, mit verstaubtem Zementfußboden. Der Regisseur ging entschlossen voran, bog um eine Ecke in einen weiteren unterirdischen Korridor und beschleunigte seine Schritte. Isabella kam ihm kaum hinterher. Schlojma fiel ein wenig zurück, machte lange Schritte und blickte vom Fußboden nach allen Seiten. Rechts an der Wand erschien eine Metalltür mit einem blinden Fensterchen und einem Nummernschloss. Aha, ein Tresor, keine Tür, dachte Schlojma und aus den Augenwinkeln sah er noch ein englischsprachiges Schild, das mit den Großbuchstaben ATTENTION! begann. Da haben wir die Europäisierung, zum Teufel mit ihr, wegen der Anwesenheit von zweihundert ausländischen, na ja polnischen Soldaten tauchen selbst in den Kellergewölben des Theaters Schilder in ihrem Globenglisch auf …
Inzwischen hatten sie das Ende des Korridors erreicht. Maulwurf zog noch eine Eisentür auf und die drei befanden sich im großen Viereck eines fast leeren Saales, in dem nur einige Holzbänke entlang der Wände standen. Außerdem gab es eine Metalltreppe, die direkt unter die Decke führte. Maulwurf stand zufrieden da. Die Arme in die Hüften gestemmt, zeigte er mit den Augen oben auf den Durchschlupf und sagte:
„Wir sind unter der Pühne. Tas ist der Gang zum Orchestergraven!“
„Und deshalb hast du uns hierher geschleift? Auch so ein … Einfall.“
Schlojma begann zu frieren, er erinnerte sich, dass er zum Frühstück nur einen Keks und einen Kaffee gehabt hatte. Er brauchte jetzt Frühstück. Doch Maulwurf, der nun auf Deutsch weiterredete, ließ sich zu Isabella gewandt lang und breit darüber aus, wie die bewaffneten Rebellen auf die Bühne stürmen und wie die Heldin, eine TV-Moderatorin, ein Live-Interview mit dem Anführer der Terroristen macht. Georg rotierte mit den Armen wie ein Ventilator, Schlojma konnte aus dessen schnellem Redefluss nur „links“ und „rechts“ und noch „zum Beispiel“ heraushören. Isabella nickte brav und streute ihre Fragen in schwäbischem Dialekt ein. Hmm, das ist schon so eine Zicke, dieses deutsche Porzellanpüppchen, dachte Schlojma mit einer für ihn selbst überraschenden Gereiztheit. Was habe ich denn auf einmal gegen Isabella? … Und aus der Tiefe tauchte der Gedanke an das Einreisevisum für drüben auf, an den damit verbundenen Ärger und all die Scherereien … Wahrscheinlich bin ich deshalb so gereizt …
Verärgert und genervt sein durfte er auch wirklich. Die äußerst komplizierten Ein- und Ausreisemechanismen des Grenzübergangs an der Mauer regelt für den Westsektor ein trilaterales Abkommen. An den beiden Übergängen zum Osten, die sich dort befinden, wo die Hauptstraßen die Mauer kreuzen, also an der Einheits- und dann im Osten Leninstraße und der Bandera- und dann weiter Moskauer Straße sollte ein uneingeschränkter und freier Grenzübergang für die Bürger der Sozialistischen Republik Ukraine und der Westukrainischen Republik möglich sein. Das galt als Transitverkehr und erleichterte sämtliche Prozeduren ungemein. Aber für die Bewohner von West-Riwne existierten schier unglaubliche Einschränkungen und Verbote. Die SRU, die West-Riwne umgab, sozusagen einschloss, musste die Verräter und Parasiten irgendwie bestrafen, die es sich direkt vor ihrer Nase unter dem Schutz feindlichen Militärs bequem machten. Zwar bestand diese Truppe überwiegend aus einer polnischen Kompanie Fallschirmjäger und einigen Deutschen – technisches Personal und Verbindungsoffiziere –, was freilich das kommunistische Parteiorgan von Rowno Rote Flagge nicht daran hinderte, vom Westsektor ausschließlich als von einem besetzten Territorium zu sprechen.
Einer eigentlich zufälligen Inspektion der NATO auf dem Tutschinskyj-Truppenübungsplatz, die mit dem russisch-ostukrainischen Vorstoß aus dem Osten zeitlich zusammenfiel, verdankt West-Riwne seine Existenz. Die in Panik geratenen europäischen Offiziere rasten in ihren Jeeps gerade noch rechtzeitig ins Stadtzentrum und aus der Kommandozentrale, bereits auf der anderen Seite der Brücke über die Ustja, konnten sie mit Brüssel Kontakt aufnehmen. Die Brüsseler Generäle stuften die Situation nach ihren Beratungen und der Nachricht, dass die legitim gewählte Regierung der Ukraine bereits von Kiew nach Lemberg geflohen war, als äußerst ernst ein. Vier augenblicklich entsandte dickbäuchige Militärtransporter, randvoll mit Soldaten in Tarnanzügen, setzten nach anderthalb Stunden plump auf der Betonpiste des Flughafens von Riwne auf, der sich glücklicherweise gerade im westlichen – oder besser gesagt im südwestlichen Teil der Stadt befand. Das Militär der eben erst ausgerufenen Sozialistischen Republik Ukraine hielt seinen Vormarsch durch die Stadt mitten im Zentrum an, als sie die Antennen der Funkstationen der französischen und belgischen Fallschirmjäger bemerkte, die hinter den in Reih und Glied aufgerichteten Sandsäcken auf der anderen Seite des Majdan der Unabhängigkeit aufragten. Einige Monate später durchschnitt Riwne eine Mauer.
Von Ost-Riwne aus, oder besser gesagt Rowno, wie die Stadt nun wieder auf gut Russisch und wie zu Sowjetzeiten hieß, war der Zugang zum Westsektor „problemlos und frei zu passieren“, so die Meldungen des kommunistischen Parteiorgans Rote Flagge. Das nutzten die höheren Kader der Bezirksleitung der Partei und die Angehörigen der Spezialdienste von Rowno ziemlich oft, so zwei-, dreimal im Monat. Sie reisten immer zu zweit und ohne Ehefrauen ein. Dabei stellten sie sich großzügig Bewilligungen für Dienstreisen zum ZK der Kommunistischen Partei von West-Riwne aus, verpflegten sich in den Hotelzimmern mit den mitgebrachten Fisch- und Fleischkonserven und die bewilligten Dienstreisemittel wurden für Vergnügungen und Geschenke ausgeben. Eingekauft wurde in den billigen Supermärkten rund um das Stadion. Kleidung, Schuhe, Parfüm und Autoradios. Sie richteten keinerlei besonderen Schaden an, so dass sich die Stadtverwaltung von Riwne auch nicht weiter für diese Besucher interessierte, sie wurden als unvermeidliches Übel akzeptiert. Die Aufmerksamkeit konzentrierte sich in erster Linie auf die Westtouristen, die in Scharen kamen, um mit eigenen Augen die Mauer zu sehen, die Europa nun von neuem teilte, sie zu fotografieren und zu berühren. Weltweit nahmen die Reiseagenturen Ukraine-Rundfahrten ins Programm, die schlicht und einfach von Berlin nach Riwne führten und dann weiter nach Lemberg, Uschhorod, Tschernowitz und in andere Städtchen der West-Ukrainischen Republik. „Vorwärts in die Vergangenheit!“, lockte es in den Reiseprospekten.
Ich muss Jeans kaufen, überlegte Schlojma, doch dann zuckte er unangenehm berührt zusammen. Was denn für Jeans? Fünf Jahre hast du deine Verwandten nicht gesehen, hmmm, seit damals, als du in jener fatalen Sommernacht in der Jubiläumsstraße zu Besuch warst und dort übernachtet hast. Am Morgen fuhren keine Trolleybusse mehr, die Stadt war geteilt. Nicht nur die Trolleybusse, gar keine Verkehrsmittel fuhren mehr. Die Blockade dauerte über zwei Jahre, danach ließ man euch, die Westler, vereinzelt in den Ostteil eurer Stadt. Während der ganzen Zeit hast du zwei kurze Briefe von der Mutter bekommen, ein kariertes Doppelblatt aus einem Heft, das mit schwarzen Zensurstempeln verschmiert war. Du ahnst ja nicht einmal annähernd, wie die Menschen jetzt dort leben, was sie arbeiten und brauchen.
Endlich setzten sich Isabella und Maulwurf unter lebhaftem deutschem Geplapper in Richtung Ausgang des unterirdischen Saals in Bewegung. In ihrem Gespräch waren immer wieder ukrainische Worte, sogar ganze Sätze vernehmbar. Dies waren freilich Textfragmente aus dem Theaterstück Programmvorschau auf übermorgen von Schlojma Ezirwan, das vom Theatergenie Georg Maulwurf höchstpersönlich inszeniert wird und heute Abend hier, gerade über ihren Köpfen mit Isabella Stolz in der Hauptrolle als Fernsehmoderatorin Olesja aufgeführt werden wird. Dieses Theaterstück hatte Schlojma – eigentlich für ihn selbst unerwartet – in jenem Jahr geschrieben, als drei seiner Komödien, die er selbst Lesetheater betitelte, mit unerwartetem Erfolg nicht einfach nur über die Bühnen Deutschlands, Frankreichs und Hollands gingen, sondern vielmehr über sie hinwegfegten. Maulwurf brachte eine dieser Komödien auf die Bühne der Münchner Kammerspiele, wo sie sich kennen lernten. Schlojma kam zur Premiere, am gleichen Abend betranken sie sich und schlossen Freundschaft. Georg interessierte sich leidenschaftlich für die Situation in beiden Teilen der Ukraine und besonders für die geteilte Stadt Riwne. Bei der ersten Gelegenheit besuchte er die Stadt, hinterließ einen bleibenden Eindruck beim Stadtrat und dank seines klingenden Namens bekam er die Möglichkeit, das Stück im Freien Theater von Riwne zu inszenieren – wie das ehemalige GebMusDramTheater nun offiziell hieß.
Nachdem die Finanzierung der Aufführung vom Kulturamt West-Riwnes zugesagt worden war, beschränkte sich Maulwurf zum allgemeinen Erstaunen auf die örtliche Schauspieltruppe, freilich schikanierte er sie ziemlich, stritt fortwährend mit ihnen, terrorisierte sie richtiggehend. Nur für die Besetzung der Hauptrolle lud er Isabella ein, die noch nicht ganz dreißig Jahre alt war und doch schon auf allen Bühnen Europas und auch ein wenig darüber hinaus bekannt war, da sie es fertiggebracht hatte, auch in zwei oder drei Hollywood-Melodramen mitzuspielen. Die Boulevard-Presse vom Typ Riwner Abendzeitung berichteten ziemlich ausführlich von ihrer Ankunft im Westsektor. Während der Theaterproben und Vorbereitungen des Stücks ließ die Presse die Schauspielerin in Ruhe, denn Isabella besuchte weder Nachtclubs noch gab sie skandalöse Erklärungen ab oder hielt sich Liebhaber. Sie machte sich daran, intensiv und gründlich Ukrainisch zu lernen, und bereits nach einem Monat sprach sie ziemlich ordentlich, sogar mit leichtem polesischem Dialekt. So rief sie einmal Schlojma an, und als dessen Frau Oksana ihr mitteilte, dass er nicht zuhause sei, schockierte Isabella ihre Gesprächspartnerin mit einer derart breiten polesischen Aussprache, dass Schlojma danach der Kragen platzte und er Isabella empfahl, sie solle gefälligst nicht die Marktweiber nachäffen, die Schmuggelware verkauften, sondern sich lieber an Radiosprecherinnen und Fernsehmoderatorinnen halten.
Die Premiere wurde von Maulwurf mit dem ihm eigenen Pomp angekündigt. Er hatte für den heutigen Abend Journalisten von Presseagenturen aus allen Teilen der Welt eingeladen, riesige Reklameplakate, die Big Bords mit Isabellas Lockenkopf fielen bereits an der ersten Kreuzung von Riwne jedem ins Auge. Kabel-TV sendete auf allen Kanälen jede halbe Stunde einen halbminütigen Spot mit der Ankündigung der lang erwarteten Premiere. Für Maulwurf war es eine Riesenchance. Das Theaterstück eines Autors aus Riwne genau an jenem geographischen Punkt zu inszenieren, an dem die Pufferzone wie ein Keil in den Osten ragt! Gerade recht, denn sein schrilles und skandalöses Image, das er über die Jahre eifrig gepflegt hatte, begann in letzter Zeit ein wenig zu verblassen.
Jetzt schnaufte und ächzte das Enfant terrible der westeuropäischen Bühnen freilich die Kellergänge zum Lift entlang. Auf halben Weg neben einer Metalltür mit Glasfensterchen blieb er auf einmal stehen, drehte sich zu Schlojma um und fragte mit gerötetem Gesicht: „Hast du eine Zigarette?“





























