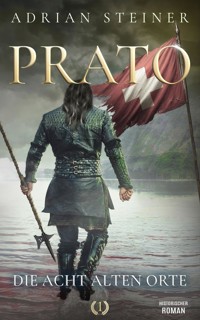6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Militär
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Schweiz im frühen 15. Jahrhundert … Folgen Sie dem jungen Krieger Prato aus dem Land Uri, der im Ringen der Eidgenossen und Mailänder um Macht und Besitzungen zu einem der mächtigsten Männer der Eidgenossenschaft aufsteigt …
Klappentext:
Während Prato zum Hauptmann der Haustruppen von Chur aufsteigt, ziehen die Eidgenossen in den Krieg gegen Mailand um den Ort Bellinzona. Auch Prato lechzt nach mehr Einfluss und Vermögen. Er hofft, dank des Krieges zum reichen Söldnerführer aufzusteigen, und so verlässt er Chur und führt seine Männer in den Süden – und damit geradewegs in eine unerbittliche Feldschlacht …
Freuen Sie sich auf das packende Finale des Prato-Zyklus, das den eidgenössischen Räuberkönig direkt in die Schlacht bei Arbedo im Jahr 1422 katapultiert. Geschickt verwebt der Autor das Schicksal seines Protagonisten mit den historischen Ereignissen rund um die Entscheidungsschlacht zwischen Eidgenossen und Mailändern. Zudem liefert er mit zahlreichen Zitaten aus historischen Quellen wieder spannende Hintergründe zu seiner Geschichte.
Holen Sie sich jetzt das fulminante Finale des Prato-Zyklus!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Adrian Steiner
Prato
Band 3
Die Wirren des Krieges
Aus der Reihe
Schweizer Mittelalter-Saga
EK-2 Militär
Hinweis
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Karte
Kapitel 1: Via Mala
Kapitel 2: Norantola
Kapitel 3: Die Schlacht
Kapitel 4: Rückkehr
Glossar
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Impressum
Hinweis
Dieser Roman behandelt die Alte Eidgenossenschaft im frühen 15. Jahrhundert und spielt somit hauptsächlich in der heutigen Schweiz. Auch ist der Autor Schweizer. Für maximale Authentizität folgt der Text den Regeln der Schweizer Rechtschreibung; so gibt es beispielsweise kein ss. Die Guillemets (französische Anführungszeichen) werden umgekehrt dargestellt: «»
Das heisst, aus Sicht eines Deutschen oder Österreichers sind sie umgekehrt dargestellt – für Schweizer ist die Darstellung in diesem Buch üblich.
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leserin, lieber Leser,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein Familienunternehmen aus Duisburg und jeder einzelne unserer Leser liegt uns am Herzen!
Mit unserem Verlag EK-2 Publishing möchten wir militärgeschichtliche und historische Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Haben Sie Anmerkungen oder Kritik? Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen besonders gefallen hat oder wo Sie sich Verbesserungen wünschen. Welche Bücher würden Sie gerne in unserem Katalog entdecken? Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns und unsere Autoren.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Ihr Team von EK-2 Publishing
Karte
Abbildung 1: Schweizerkarte um 1400: Prato I - Die acht alten Orte (Nach Faden, 1799)
Kapitel 1: Via Mala
A
ngelo hämmerte immer noch lautstark gegen die Tür und liess mich wissen, dass der Stadtrat nach mir verlangte. Ich wälzte mich gequält aus dem warmen Bett und legte meine Kleidung an. Es war ein eisiger Morgen, weshalb ich zusätzlich einen Umhang um meine Schultern legte.
Es stellte sich heraus, dass Margreth durch ihre Arbeit als Magd alle Kammern kannte und mich gestern schwankend in diese hier geführt hatte. Dabei handelte es sich um das prunkvolle Gemach des Generalvikars und war mit einem aufwändig gemusterten Teppich geschmückt; in einer Ecke stand ein reich verziertes Schreibpult. Ausserdem verfügte es über einen eigenen Abort und eine separate Feuerstelle. Jedoch dachten wir am zurückliegenden Abend anscheinend nicht mehr daran, ein Feuer zu entfachen, sondern entschieden uns dazu, uns gegenseitig im Bett aufzuwärmen. Nun wurde ich mit dieser Kälte im Zimmer gestraft.
Trotzdem raffte ich mich zusammen und schritt schliesslich wankend zur Tür. Ich blickte nochmals zu Margreth zurück, die nackt im Bett lag und mir hinterherblickte.
«Ich werde später nach dir rufen lassen», sagte ich und damit ging ich zur Tür hinaus.
Draussen erwartete mich ein grinsender Angelo, da ich wohl doch ziemlich mitgenommen aussah.
Gemeinsam schritten wir in den Innenhof des Schlosses. Ich atmete die frische Morgenluft tief ein und sah mich um. Der Platz war mit Bechern und umgeworfenen Stühlen übersät. Am Boden lagen die Leichen der Habsburger verstreut. Daneben andere reglose Männer, von denen ich hoffte, dass sie nicht tot waren.
Angelo berichtete mir, dass es während der Nacht keine Vorkommnisse geben habe. Einige Bewohner des Schlosses hätten hinaus in die Stadt und andere herein in den Hof gewollt. Jedoch verschwanden sie wieder, als man ihnen sagte, dass die Tore gesperrt seien. Einige Betrunkene wollten sich wohl Zugang zum Stall verschaffen, um sich an bestimmten Geistlichen zu rächen, jedoch hielten meine Krieger sie ab.
Beim Hoftor angekommen, erhaschte ich heimlich einen Blick über die Mauer auf die Stadtseite, ohne selbst gesehen zu werden. Dort konnte ich einige Mitglieder des Stadtrates erkennen, die aufgeregt die Köpfe zusammensteckten. Natürlich wollten sie immer noch wissen, was geschehen war, und vor allem, wie es nun weitergehen würde. Ich wies Angelo an, sie wegzuschicken. Ich war nicht bereit, ein solches Gespräch vor dem Frühstück zu führen.
Petrus Duremberger und Johannes Moser waren natürlich bereits seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen und versuchten eine gewisse Ordnung wiederherzustellen. Sie wiesen die Bediensteten an, ihre Ämter auszuführen, brachten den gefangenen Geistlichen im Stall Decken sowie etwas zu essen. Sie verlangten auch mit dem Stadtrat zu sprechen, jedoch wies ich meine Männer an, dies nicht zuzulassen.
«Erst wenn ich es erlaube», sagte ich ihnen. Sie wiesen Diener an, die Leichen der Habsburger wegzuschaffen, das Blut aufzuwischen und das Mobiliar wiederherzurichten.
Langsam erwachten die Menschen am Hof wieder zum Leben, die einen mehr, die anderen weniger. Es hatten sich einige Liebschaften und Feindschaften gebildet. Jedoch wollte ich mich nicht darum kümmern und wies Lupi und Veit an, die Männer wieder in den gewohnten Trott zu bringen.
Als ich etwas Käse und Brot ass, suchten Petrus und Johannes mich auf. Sie verlangten, dass ich zumindest jene Ehrhaften unter den Geistlichen freilassen würde. Einige von ihnen seien bereits alt und schwächlich. Im Stall sei es kalt und feucht und der eisige Wind ziehe durch die Ritzen zwischen den Brettern. Ich stimmte zu, was jene Geistlichen anbelangte, die sie vor Ort behalten wollten.
«Und was soll mit dem Generalvikar und seinen Anhängern geschehen?», wollte ich von ihnen wissen. Petrus und Johannes sahen sich bedrückt an, bevor Johannes zögerlich antwortete: «Wir haben darüber gesprochen …», begann er, nahm sich dann aber wieder zurück.
«Und?», forderte ich ihn auf weiterzusprechen.
«Wir wollen sie nicht hierbehalten. Der Generalvikar geniesst immer noch eine gewisse Autorität. Er könnte sich zurück an die Macht bringen. Genau diesen Fehler haben wir vor einigen Jahren gemacht, als der Hof bereits einmal gestürmt wurde.»
Ich nickte neugierig und wollte wissen, wohin diese Andeutungen führen würden. «Also?», fragte ich.
«Wenn wir sie laufen lassen», begann Petrus, «werden sie in ein anderes Bistum gehen und dort genau berichten, was hier passiert ist. Man wird überall wissen, dass Chur eine gottlose Stadt ist, die zurechtgewiesen werden muss. Es werden so lange Krieger kommen, bis aller Widerstand in der Stadt gebrochen wird und der Generalvikar wieder seinen Posten erhält», erklärte Petrus.
«Das Beste wäre also», fuhr Johannes fort und bekreuzigte sich, «wenn sie einfach verschwinden würden, für immer. Dann können wir die Vorkommnisse geheim halten. Wenn ein Bote von einem anderen Bistum erscheint, könnten wir von einer Grippe berichten, die einige unserer Kollegen dahingerafft hat.»
Ich staunte über die Skrupellosigkeit der beiden. Jeder Mann hütete sich davor, in einen Streit mit einem Geistlichen zu geraten. Einem Geistlichen Leid zuzufügen, wurde mit schlimmen Strafen geahndet. Zwar seien alle Menschen vor der Kirche gleich – hiess es – jedoch nahmen sich die meisten Kleriker Sonderrechte heraus. Ich überzeugte mich davon, dass den beiden klar war, was sie verlangten und ob sie wirklich bereit waren, die Schuld dieses Blutbades auf ihre Schultern zu laden. Aber sie waren sich sicher. Und mir kam plötzlich eine Idee, wie ich das Ganze für mich nutzen konnte.
«Ich werde es tun», antwortete ich ihnen. Aber das war keine kleine Sache, und das wussten sie. Niemand sonst würde sich eine solche Tate aufbürden wollen. Und ich wusste ganz genau, was ich im Gegenzug verlangen würde.
«In den nächsten Tagen wird ein Bote hier eintreffen», begann ich, «dieser Bote soll direkt zu mir gebracht werden und mit niemandem sonst sprechen.»
Johannes kniff die Augen zusammen. Natürlich wusste er, welcher Bote gemeint war, denn er war an der Versammlung des Stadtrates beteiligt gewesen, in der ich beschuldigt worden war, Luzern ausgeraubt zu haben. Daraufhin hatte ich zu meiner Verteidigung behauptet, dass ich im Appenzell stationiert gewesen sei. Was natürlich nicht stimmte. Und genau das vermutete nun auch Johannes.
«Ihr wart in Luzern!», stellte er vorwurfsvoll fest, «und wollt den Boten vom Appenzell abfangen, weil er berichten würde, dass Ihr nie dort wart.»
Als er geendet hatte, ging ich nicht darauf ein, sondern verlangte: «Ausserdem soll ein Bote mit einem offiziellen Schreiben vom Generalvikar nach Luzern entsandt werden, der bezeugt, dass ich zum Zeitpunkt des Raubs von Luzern hier in Chur verweilt habe.»
Johannes Moser war schockiert über dieses Geständnis und murmelte: «Wie konntet Ihr nur … Mich so zu belügen und unsere Brüder in Luzern um ihre Ersparnisse zu bringen?»
Wieder ging ich nicht darauf ein und wartete ab, bis Johannes meinte: «Der Generalvikar wird dieses Schreiben niemals aufsetzen.»
«Ich bin sicher, der neue Generalvikar wird es tun», antwortete ich und schaute ihm in die Augen. «Denn wenn ich eurer Bitte nachkomme und Bruno von Habsburg töte, wird Chur einen neuen Generalvikar brauchen.»
Beide sahen mich weiterhin gefasst an. Ich hatte also nichts Neues angesprochen. Natürlich hatten sie darüber gesprochen, wer das Amt übernehmen sollte, wenn wir Bruno von Habsburg töten würden. Nach einer Weile nickte Johannes und sagte: «Ich werde der neue Generalvikar sein», und fügte dann hinzu: «Ich werde der Stadt Luzern schreiben, dass Ihr, Herr A Pro, die ganze Zeit über hier in Chur verweiltet.» Ich war zufrieden und wir besiegelten unser geheimes Abkommen mit einem Handschlag.
Ich hoffte, dass dieses Schreiben in der Stadt Luzern überzeugen würde. Und auch wenn es nicht jeden Zweifel beseitigen konnte, so sollte es mir doch helfen. Ich wollte nicht den Rest meines Lebens auf der Flucht sein. Ich wollte meine Schwester Elss befreien und mich dann irgendwo niederlassen können. Wenn ich in der Eidgenossenschaft jedoch als Geächteter galt, konnte ich nirgendwo mehr Land kaufen. Ich hätte keine Rechte mehr.
Meine Taten lasteten schwer auf mir. Auch wenn ich den Raub in Luzern mit dem Schreiben glaubhaft abstreiten und man mir die Überfälle auf die Nauen nicht beweisen konnte, so war da immer noch Grinau. Und dort gab es genügend ehrenhafte Männer, die bezeugen konnten, dass ich den Turm ausgeraubt hatte. Allein diese Tat würde reichen, um vor dem Landgericht mit dem Tode bestraft zu werden. Ich musste damit anfangen, meinen Ruf zu reparieren.
Später nach dem Gespräch mit Johannes Moser und Petrus Duremberger rief ich meine engsten Berater zusammen: Veit, Lupi, Felis und Tus.
«Wie ist die Stimmung auf dem Hof? Wollte jemand raus?», fragte ich Lupi auf Italienisch.
«Einige wollten durch das Tor hinaus, Herr. Aber wir konnten sie problemlos davon abhalten. Die Zugänge sind weiterhin gesperrt.»
Ich nickte. Das war gut.
«Du musst mit dem Stadtrat sprechen», meinte Veit. «Die stehen seit gestern fast ununterbrochen vor dem Tor und wollen wissen, was vorgefallen ist.»
Ich überlegte, was nun zu tun wäre. Natürlich hatte ich mir das bereits vor der Einnahme des Schlosses überlegt. Jedoch hatten sich nun auch einige Umstände geändert.
«Wir müssen sie hineinlassen, damit sie sich davon überzeugen können, dass alles in Ordnung ist», meinte Felis. «Wenn sie im Ungewissen sind, wissen wir nicht, was sie als Nächstes unternehmen werden. Vielleicht benachrichtigen sie den Bischof Naso im fernen Krieg und fordern Verstärkung an, weil sie denken, dass wir den Hof für uns eingenommen haben.»
Er hatte recht. Ich musste dem Stadtrat versichern, dass ich das Schloss für sie eingenommen hatte und es nicht für mich behalten wollte.
«Gut. Sagt der Menge vor dem Tor, dass wir den Stadtrat morgen früh empfangen werden, um über die Übergabe des Hofs an die Stadt Chur zu beraten. Der Rat soll sich bei Sonnenaufgang vor dem Tor versammeln.»
Mir fiel auf, dass sich Tus nicht am Gespräch beteiligte. Er war zu einem mürrischen Mann verkommen. Und langsam wurde ich seiner überdrüssig.
So kam es auch, dass ich ihn nicht in meine Pläne einweihte. Ich wollte auch meine Gefolgsmänner, die Livinier, aus meiner Abmachung mit dem neuen Generalvikar Johannes Moser heraushalten. Und so waren es nur ich, Veit und Felis, die die blutige Aufgabe übernehmen würden.
Wir hatten in der Zwischenzeit den alten Generalvikar Bruno von Habsburg und seine Gefolgsleute sowie alle anderen käuflichen Priester aus dem Stall in den tiefsten Keller des Schlosses gebracht.
Bevor wir anfingen, liess ich nochmals Johannes Moser und Petrus Duremberger kommen. Ich versicherte mich, dass unsere Abmachung galt: Ich würde für sie die Männer im Verlies töten und sie würden mich dafür gegenüber Luzern verteidigen. Sie waren einverstanden. Sie hatten sich bereits mit dem Gedanken angefreundet, die neuen Schlossherren zu sein. Niemand gab freiwillig Macht ab.
Auch einige Diener und andere Bewohner des Hofs wurden von Petrus und Johannes ausgewählt; auch sie sollten sterben. Sie wollten sichergehen, dass keiner der alten Führung übrigblieb.
Auch im Bistum Chur sass das Messer bei Laien wie bei Klerikern recht locker, und man hat den Eindruck, dass gerade Priester gefährlich lebten. Johannes Moser, selbst ein Priester, hatte einen Berufsgenossen umgebracht, Petrus Duremberger hatte gleich mehreren Priestern blutende Verletzungen beigebracht und sich im Heiligen Jahr 1450 zur Absolution selbst nach Rom begeben, Emanuel von Malans hatte einen Mönch zusammengeschlagen. (Schmugge, 2002)
Als der Tag sich dann dem Ende neigte und die dunkle Nacht sich ankündigte, war es so weit. Ich stand auf, worauf Veit und Felis mich ansahen. «Du willst also wirklich wehrlose Männer töten? Noch dazu Priester?», fragte mich Veit.
Auch mich plagten Zweifel. Ich fürchtete mich davor, nach meinem Tod für alle Zeit im Höllenfeuer zu schmoren. Doch es musste getan werden und ich beruhigte mich damit, dass jene Männer im Verlies keine ehrlichen Männer seien.
«Das sind keine Priester, Veit», antwortete ich ihm, «das sind Halunken, die das Gewand eines Priesters tragen. Sie unterscheiden sich nicht von anderen Männern.»
Ich sah in die Gesichter der beiden und konnte erkennen, dass sie nicht überzeugt waren. «Es sind nicht einmal ehrliche Männer. Sie haben die armen Menschen in der Stadt geschröpft und tyrannisiert. Wir tun hier nur Gottes gerechtes Werk.»
Natürlich glaubten sie selbst nicht so recht an das, was ich sagte. Doch auch sie wussten, dass es notwendig war. Wir hatten den ganzen Nachmittag über unsere Waffen geschärft. Es war Zeit.
Also machten wir uns auf zum Keller. Ich befahl Lupi, die Treppe, die zu den Zellen hinunterführte, zu bewachen – niemand sollte herunterkommen. Wir hatten all die Verräter in einen kleinen Raum gestopft, der durch eine stabile Holztür abgeschlossen war. Vor der Tür sahen wir drei uns nochmals an. Wir nickten einander zu und schliesslich öffnete ich die Tür.
Wir betraten den Raum und sofort begann der alte Generalvikar zu jammern: «Was fällt euch ein? Ihr könnt uns doch nicht hier unten einsperren. Wartet nur, bis ich dem Bischof von den Vorfällen berichte! Ich verlange, dass ihr uns sofort freilasst.»
Veit, Felis und ich standen nun im Raum und schlossen die Tür hinter uns. Die Gefangenen wichen wie Vieh vor dem Wolf zurück, so weit es ihnen möglich war. Vor uns befanden sich etwa sechs Fuss freier Raum, dahinter standen sie in einem Halbkreis, wobei der sich Generalvikar schützend vor seine Schäfchen stellte. Zumindest das musste man ihm anrechnen.
«Habt ihr gehört, lasst uns sofort frei», sagte er. «Was glaubt ihr, was das hier für ein Ende nehmen wird? Ihr könnt uns nicht für immer hier unten eingesperrt halten.»
Die Stimmung war angespannt; ich wartete auf irgendein Zeichen. Es ist das eine, einen Mann im Kampf zu töten, aber etwas anderes, auf hilflose Menschen einzustechen. Die meisten davon noch alt, schwach, bemitleidenswert. Nicht einmal gepanzert. Ich sah die weichen Leiber vor mir und wusste, dass es in dem bevorstehenden Kampf nicht auf Muskelkraft ankommen würde.
«Sie sind nicht hier, um zu verhandeln», schrie ein Priester nach Luft schnappend. «Sie sind hier, um uns zu töten! Schaut doch nur, die Waffen, die sie in den Händen halten.»
Augenblicklich kam Panik auf. Jeder versuchte nach hinten zu fliehen, doch es war kein Platz. Es wurde geschrien und gelärmt.
Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, ehe die Totgeweihten das gesamte Schloss wecken würden. Also spannte ich meine Muskulatur an und rammte den Spitz meiner Hellebarde in die Brust des Generalvikars.
Veit und Felis taten es mir gleich und die ersten drei Männer gingen blutend zu Boden. Sofort herrschte ein heilloses Durcheinander in der kleinen Kammer. Jeder versuchte andere vor sich zu stossen, um sich vor unseren herniedergehenden Klingen zu schützen. Schon bald roch es nach Scheisse. In der Panik und in dem Gerangel konnte ich keinen Mann sauber töten. Vor mir befand sich eine Masse aus Körpern, bei der ich nicht mehr unterscheiden konnte, welcher Teil zu wem gehörte, so eng standen die Männer beisammen. Das Beil meiner Hellebarde traf den vordersten Mann, worauf der gequält zu Boden ging und sich dort seinem Todeskampf hingab. Mir blieb keine Zeit, ein zweites Mal für einen Gnadenstoss zuzustechen, da ich bereits auf den nächsten der dicht gedrängten Körper einschlagen musste. Blut spritze in alle Richtungen und ein metallischer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus.
Leider war es auch noch nicht vorbei, als endlich alle am Boden lagen. Denn niemand stirbt gerne und so klammerte sich jeder an das Leben, das er doch so mochte. Auch das ist in einer Schlacht anders. Man trifft seinen Gegner, der geht zu Boden und man selbst geht weiter. Man bleibt nicht stehen und wartet, bis das letzte Fünkchen Leben den Körper verlassen hatte. Also mussten wir weiter auf die Körper am Boden einstechen. Einige mussten wir mit den Füssen zur Seite rollen, um den Darunterliegenden den Gnadenstoss zu verpassen.
Am Ende war die kleine Kammer gefüllt mit – soweit ich mich erinnere – 15 toten, entstellten Körpern. Der Boden war blutgetränkt, sodass unsere Stiefel nass waren. Veit und ich sahen uns an. Im Kampf kommt man in einen Blutrausch, denn wenn man den Gegner nicht tötet, tötet er dich. Dieser Blutrausch stellte sich hier nicht ein. Wir empfanden es als abstossend und insgeheim waren wir alle erleichtert, als es endlich vorüber war.
Mittlerweile kann ich sagen, dass ich diese Nacht bereue. Ich habe in meinem Leben viele Gräueltaten begangen, aber diese eine Nacht sehe ich auch jetzt noch klar vor mir.
Damals war ich jung und machte mir keine grossen Gedanken darüber, als Johannes Moser mich darum bat, die Geistlichen zu töten. Ich dachte mir, was soll schon dabei sein? Männer sterben jeden Tag, wieso sollten diese Kerle also nicht heute sterben? Erst, als die Tat vollbracht war, wusste ich, dass ich etwas getan hatte, was mich länger verfolgen würde, als mir lieb war.
Weil ich niemanden einweihen wollte, lag es an uns Dreien, die Sauerei zu beseitigen. Wir mussten die Leichen fortschaffen und das viele Blut mit Wasser wegwischen. Also packten wir den ersten Toten und trugen ihn aus dem Keller hoch. Danach gingen wir mit ihm ins Schloss, zu dem kleinen, geheimen Ausgang, durch welchen der Generalvikar vor zwei Nächten geflohen war. Wir hatten dort bereits vorher einen Karren postiert, in den wir jetzt den ersten Toten warfen. Es dauerte lange, bis wir alle 15 Leichen hinaufgetragen und in den Karren gelegt hatten. Danach holten wir ein Pferd aus dem Stall und spannten es vor den Karren.
Auch wenn es eine finstere Nacht war, versicherten wir uns, dass niemand draussen vor dem Tor stand. Sobald wir uns sicher waren, öffneten wir es und Felis ging mit dem Karren voller Toten hinaus. Er wusste, was zu tun war. Johannes Moser erzählte von einer nahegelegenen, tiefen Schlucht. Also begab sich Felis dorthin und warf die leblosen Körper hinunter. Bis sie jemand dort finden würde, hätten die Tiere bereits an ihnen genagt und man würde nicht mehr erkennen, um wen es sich handelte.
Veit und ich reinigten in der Zwischenzeit den kleinen Raum und danach uns selbst. In ein paar Stunden würde der Stadtrat in den Hof kommen, um sich zu vergewissern, dass wir nicht die Macht behalten, sondern das Schloss der Stadt übergeben wollten.
Am Morgen öffneten wir also das Tor und liessen die Stadträte eintreten. Wir begrüssten einander distanziert und wogen uns schätzten uns ab. Die Umstände hatten sich geändert. Letztes Mal stand ich in ihrer Versammlung als Reisender und Verdächtiger, der vielleicht die Stadt Luzern ausgeraubt hatte. Sie hatten die Macht innegehabt und über mein Schicksal entscheiden wollen, sobald der Bote vom Appenzell eintreffen würde.
Nun hatte ich den Hof von Chur eingenommen und hielt ihn mit meinen Männern besetzt. Ich liess alle meine Kämpfer in voller Kriegsmontur beim Tor antreten, sodass die Herren an ihnen vorbeigehen mussten. Ich war mir sicher, dass dieser Anblick sein Übriges tat. Auch ich hatte mich mit meinem Katzbalger gerüstet und trug meinen Lentner. Wir standen als eine Einheit vor den Stadträten, während Delio mein Wappen mit den kämpfenden Hunden in die Höhe hielt.
Sie wussten, dass ich mich als Söldner ausgegeben hatte, jedoch glaubten vielleicht nicht alle, dass meine Männer wirklich vor der Stadt stationiert waren.
Da auch Johannes Moser und Petrus Duremberger anwesend waren, begaben sich die Herren zunächst zu den ihnen vertrauten Gesichtern und begannen leise mit ihnen zu sprechen. Das war nicht in meinem Sinne und so verkündete ich: «Willkommen im Hof, meine Herren. Bitte folgt mir ins Schloss, wo wir uns unterhalten können.»
Ich winkte die beiden Kleriker Johannes Moser und Petrus Duremberger zu mir. Schweigsam folgten uns die Räte ins Schloss.
Ich nahm die beiden Kleriker kurz zur Seite und sagte leise: «Vergesst nicht unsere Abmachung. Ich habe meinen Teil gestern Nacht erfüllt. Alle sind tot. Nun verlange ich eure Unterstützung. Denn vergesst nicht, wir alle kennen nun die jeweils düstersten Geheimnisse unseres Gegenübers.»
Sie nickten zustimmend.
Im Saal roch es noch immer nach Erbrochenem von unserem Fest, obwohl Petrus die Diener beauftragt hatte, den Raum zu säubern. Vielleicht merkten die Räte es, jedenfalls liessen sie sich nichts anmerken. Sie alle hatten eine grimmige Miene aufgesetzt. Wir setzten uns an eine vorbereitete Tafel.
«Wo ist der Generalvikar?», wollte einer von ihnen unvermittelt wissen.
«Meint Ihr Bruno von Habsburg?», fragte ich und sagte dann: «Er ist leider unabkömmlich. Aber wir hielten gestern eine Wahl ab, bei der unser Johannes Moser zum neuen Vikar ernannt wurde» Ich zeigte auf Johannes.
Ein Raunen ging durch die Anwesenden.
«Was ist mit Bruno von Habsburg geschehen?» Alle Blicke fielen auf Johannes Moser. Dieser antwortete: «Bruno von Habsburg war bereits vor der Befreiung durch Herr A Pro gesundheitlich angeschlagen. Eine Grippe plagt ihn und fesselt ihn ans Bett.»
Das war die erste Lüge, eine schlechte Lüge, jedoch fiel ihm wohl auf die schnelle nichts Besseres ein. Und zugegeben, mir auch nicht. Wahrscheinlich hätten wir uns auf dieses Gespräch besser vorbereiten sollen, jedoch war mir nicht der Sinn danach. Ich war jung und ungestüm und wollte mich nicht mit theoretischen Fragen aufhalten. Bruno von Habsburg gab es nicht mehr und viel mehr konnte man nicht dazu sagen. Doch den Stadträten reichte diese Erklärung wohl nicht.
«Haltet Ihr uns für Narren? Wir haben Bruno von Habsburg in der letzten Woche noch in der Messe gesehen», meinten sie und wollten nach einigen Augenblicken von Johannes Moser wissen: «Sind das eure Worte oder die von Herr A Pro?»
«Wagt Ihr es, an meinen Worten zu zweifeln? Auch ich bin Mitglied im Stadtrat, genau wie Ihr», verteidigte sich Johannes Moser.
«So lasst mich einen Blick auf den Vikar werfen», sagte der Arzt Gallus Brunhold. «Wenn er hier im Schloss liegt, kann ich ihm vielleicht helfen.»
Johannes Moser schwieg, da er nicht wusste, was er dazu sagen sollte. Ich hingegen wurde dieser sinnlosen Diskussion überdrüssig und liess mit klarer Stimme verlautbaren: «Bruno von Habsburg ist tot. Er ist gestern Abend seiner Krankheit erlegen.»
Sofort begannen die Männer laut durcheinander zu sprechen:
«Ganz offensichtlich habt Ihr ihn getötet», schrie jemand über die lauten Stimmen hinweg.
«Wir haben ihn nicht getötet, er hat seinen Tod selbst zu verantworten», antwortete Johannes Moser.
Das stimmt sogar, dachte ich.
«Starb er durch eure Hand?», rief ein Ratsmitglied, «ja oder Nein?»
Mittlerweile waren die meisten der Herren wieder von ihrem Stuhl aufgesprungen und redeten wild durcheinander. Ich verlor endgültig die Geduld und schlug mit der Faust auf den Tisch. «Ruhe», lärmte ich, «setzt euch.»
Ich nickte Lupi zu, der meine Männer bedrohlich zu den Räten vortreten und diese wieder auf ihre Stühle drücken liess.
Sofort wurde es ruhig im Saal. Nach ein paar Atemzügen begann ich: «Bruno von Habsburg ist tot. Daran können wir nichts mehr ändern. Jedoch haben wir bereits einen neuen Generalvikar bestimmt, euren Ratskollegen Johannes Moser. Seid Ihr nicht zufrieden mit dieser Wahl? Ein Vikar, der bürgernah und noch dazu im Stadtrat vertreten ist? War euch der Tyrann Bruno von Habsburg denn so lieb und teuer, dass Ihr ihn euch zurückwünscht? Ihn und seine Steuern?»
Es herrschte Schweigen im Saal, bis jemand sagte: «Ihr habt den Hof eigenmächtig eingenommen. Das war rechtswidrig. Der Rat hat nicht dafür gestimmt.»
«Ich habe die Männer dazu und war zur rechten Zeit am rechten Ort», entgegnete ich.
«Weil Ihr aus Luzern fliehen musstet?», fragte ein Rat schnippisch.
Anstatt zu antworten, bedachte ich ihn mit einem grimmigen Blick, sodass der Fragensteller zusammenzuckte. Auch meine Männer bemerkten, dass meine Stimmung kippte.
«Wir müssen wissen, ob wir es mit einem Ehrenmann oder mit einem Gauner zu tun haben», sagte ein anderes Ratsmitglied.
An meiner Stelle antwortete Johannes Moser: «Der Bote aus Appenzell erreichte mich am Vortag und konnte die Geschichte von Herr A Pro bestätigen. Er war also nicht in Luzern.»
Und das war die zweite Lüge von Johannes Moser.
Die Räte murmelten untereinander, nach einiger Zeit kamen sie wohl zu dem Schluss, das Beste aus der Situation zu machen. Es war geschehen, der bischöfliche Hof eingenommen. Wenn jetzt nicht alle zusammenstehen würden, käme die Wahrheit ans Licht und Bischof Naso würde unzählige Krieger nach Chur schicken, um die Aufständischen zur Vernunft zu bringen.
Also fragte ein Mietglied: «Also gut. Und wie geht es jetzt weiter, Herr A Pro? Bleiben Eure Männer hier und halten den Hof besetzt?»
«Ja», antwortete ich.
«Ich wusste es doch», rief jemand und zeigte mit dem Finger auf mich.
«Meine Männer bleiben vor Ort, bis die Ordnung wiederhergestellt ist. Danach übergeben wir den Hof an die Stadt und ziehen weiter in den Süden, so wie es immer unser Vorhaben gewesen ist.»
Die Räte schienen sich zu beruhigen, denn kurz darauf begannen sie über die Zukunft von Chur zu reden. Bestimmt glaubten sie nicht all unsere Lügen. Doch sie wollten sie glauben, es war einfach zu verlockend. Diese Männer hatten sich monatelang im Verborgenen getroffen, um über Steuern, Banntage und Gesetze zu diskutieren, die sie ohne fremde Hilfe nie würden durchsetzen können.
Jetzt bot ich ihnen die Möglichkeit, über all das zu bestimmen. Die Lügen waren einfach zu süss. Schon bald war vergessen, aus welchen Gründen ich den Hof übernommen hatte. Die Männer stürzten sich darauf, eine neue Regierung zu bilden. Ich begann mich zu langweilen, blieb aber weiterhin vor Ort, um mich zu vergewissern, über was gesprochen wurde.
Ich schreckte ein Mal aus meinem Dahindösen auf, als besprochen wurde, wie man den Umbruch am Hof gegen aussen erklären könnte. Nach einer Weile meinte ich: «Bleibt dabei: Eine Grippe ging um und der Generalvikar sowie ein paar andere wären daran gestorben.»
Das war nichts Aussergewöhnliches, die Menschen starben andauernd an Grippen oder anderen Krankheiten.
Sie beschlossen, dass sie Boten zu allen Herren entsenden mussten, um den Gerüchten zuvorzukommen. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn der Bischof oder der König selbst erfahren würde, dass einige Bürger einen heiligen Hof gestürmt und den Vikar und andere Geistlichen in einem Kampf niedergemetzelt hatten. Der König würde sich sicher auf die Seite der Kirche stellen und so lange Soldaten nach Chur senden, bis der Hof wieder unter geistlicher Verwaltung stand.
Aber nicht nur der König und der Bischof, nein, auch sämtliche adligen Herren des Grauen Bundes mussten angeschrieben werden. Mit grosser Sicherheit würden sie sowieso bald erfahren, was wirklich geschehen war. Aber es musste zumindest versucht werden, den Schein zu wahren. Mindestens Hans von Rhäzüns, ein mächtiger Adliger nahe der Stadt Chur, würde spätestens in ein paar Tagen erfahren, was tatsächlich geschehen war. Und er würde wahrscheinlich wütend sein, dass die Stadt Chur so eigenmächtig gehandelt hatte, wo er doch sein ausdrückliches Interesse bekundet hatte.
Nach dieser ersten Versammlung kamen die Räte noch mehrmals im Festsaal zusammen. Sie sprachen weiterhin über die Neuorganisation der Stadt. Sie waren aufgeregt, denn das erste Mal konnten sie selbst über ihr Schicksal bestimmen, und ich glaube, sie machten es gut. Sie schienen an das Wohl der Bürger zu denken und nicht in erster Linie an ihr eigenes Glück.
Bereits drei Tage nach dem Erstürmen des Hofes kam während einer solchen Versammlung mit den Zunftvorstehern einer meiner Männer zu mir und flüsterte mir ins Ohr, dass der Adlige Hans von Rhäzüns vor dem Hoftor stehe und Einlass verlange.
Ich entschuldigte mich bei der Versammlung und bat die Räte, ohne mich fortzufahren. Ich liess sie absichtlich über unseren Gast im Ungewissen, da ich den Herrn von Rhäzüns zunächst allein gegenübertreten wollte.
Ich begab mich zum Hoftor, liess meine Männer hinter dem Tor Aufstellung nehmen und befahl es zu öffnen. Sobald das Tor ausreichend geöffnet war, stürmte er auf seinem Pferd herein. Er hatte wohl beabsichtigt, den Hof überfallartig an sich zu reissen. Doch meine Männer, die in voller Kampfausrüstung Aufstellung bezogen hatten, versperrten ihm den Weg. Sein Pferd bäumte sich auf und so kam er abrupt zum Stehen. Er gab sich nicht die Mühe vom Ross abzusteigen, sondern nahm sich alle Zeit der Welt, um sich mit grimmiger Miene am Hof umzusehen.
Natürlich war er nicht allein gekommen. Zwei Ritter flankierten ihn. Ich stand direkt vor seinem Pferd und starrte ihn an. Irgendwann fragte er herrisch: «Wer hat hier das Sagen?», worauf ich antwortete, dass ich es sei.
«Dann seid Ihr also der Herr A Pro?»
Ich nickte. «Der bin ich.»
«Mit Euch habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Was fällt Euch Bastard ein, den Hof zu erstürmen?»
Ich betrachtete ihn ausdruckslos. «Wir konnten den Hof einnehmen und wir haben es getan.»
«Ihr Würmerschiss. Ihr seid kein Adliger! Wie kommt Ihr auf die Idee, in fremden Herren Ländern ohne Erlaubnis Krieg zu spielen?»
Meine Männer rüsteten sich hinter mir zum Kampf. Ich hörte, wie ihre Waffen zurechtgerückt wurden.
«Ich habe im Namen der Stadt gehandelt. Also habe ich mit Erlaubnis der entsprechenden Herren gehandelt», antwortete ich, immer noch ruhig.
«Ach ja? Wo befindet sich der Werksmeister? Lebt er noch oder habt Ihr ihn auch getötet?»
«Natürlich lebt er noch. Wenn ich gegen das Gesetz gehandelt hätte, wieso habe ich Euch dann das Tor geöffnet?», fragte ich und konnte eine gewisse Verärgerung nicht länger verbergen.
«Wo befindet sich der Werksmeister? In der Stadt hat man mir gesagt, er sei hier.»
Ich nickte Felis zu. «Hol den Stadtrat.»
Dann wandte ich mich wieder Hans von Rhäzüns zu. «Der Stadtrat hält in diesem Augenblick eine Versammlung über die Neuorganisation der Stadt ab.»
«Ach, und warum wurde ich nicht gerufen? Warum wird eine Versammlung im Geheimen abgehalten? War das auch Euer Einfall?»
Ich sagte nichts mehr. Dieser Mann war aufgebracht und ich wollte es den Stadtherren überlassen, ihn zu beruhigen.
Der Rat erschien auf dem Platz. Trotz Zusage, dass der Werksmeister noch lebte, schien Hans von Rhäzüns überrascht, den Rat lebendig anzutreffen.
«Geschätzter Stadtrat», grüsste er die Männer mit einem angedeuteten Nicken.
Werksmeister Fridolin Abkling grüsste zurück: «Herr von Rhäzüns.»
«Was zum Teufel ist hier geschehen? Wieso ist ein Bote zu mir gekommen und berichtet von einer Grippe, die den Generalvikar dahingerafft hätte?»
Die Männer des Rats sahen einander unwohl an, bis der Werksmeister antwortete: «Der Vikar ist gestorben, zusammen mit ein paar anderen Geistlichen.»
«Das weiss ich selbst. Aber inzwischen weiss jeder, dass es einen Aufstand gegeben hat. Sagt der Würmerschiss die Wahrheit? Hat er den Hof in Eurem Namen erstürmt?»
Johannes Moser antwortete: «Ja, das hat er.»
Hans von Rhäzüns sass schweigend auf seinem Ross und sah abwechslungsweise mich, den Rat und meine Männer an. Er nahm sich Zeit, um zu überlegen, was nun zu tun sei.
«Wieso wurde ich nicht informiert? Habe ich euch nicht meine Hilfe angeboten? Ihr hättet meine Männer nehmen können anstelle die eines Fremden.» Er nannte mich nicht mehr Würmerschiss, das sah ich als einen Fortschritt an.
Wieder war es der Werksmeister, der antwortete: «Wir wollten keinen Streit innerhalb des Grauen Bundes provozieren. Der Bund ist das einzige, das die Täler zusammenhält. Wir konnten nicht riskieren, dass ihr uns helft und dabei den Beschluss des Bundes missachtet. Also haben wir einen Aussenstehenden um Hilfe gebeten.»
Nach einer Weile nickte er. «Und was wird nun besprochen?»
«Wie die Stadt nun geführt werden soll», antwortete der Werksmeister.
«Und der da ist dabei, ich aber nicht?», wollte Hans von Rhäzüns wissen, während er auf mich zeigte.
«Nein, er ist nicht dabei», log der Werksmeister, «Herr A Pro sichert den Hof, bis wir wieder stabile Verhältnisse hergestellt haben.»
Nun grinste er. «Befürchtet ihr die Rache der Habsburger? Befürchtet ihr vielleicht, sie werden die Lüge mit der Grippe am Ende doch nicht glauben?»
«Wir hoffen uns wird Glauben geschenkt, denn es ist die Wahrheit», sagte Johannes Moser.
Der Herr von Rhäzüns antwortete: «Dafür müsst ihr aber alle Zeugen beseitigen.» Er sah sich um und zog seine eigenen Schlüsse. «Der Generalvikar Bruno von Habsburg ist also tot. Wo sind alle anderen Habsburger, die mit ihm am Hof waren?»
«Wir haben sie ins Verliess geworfen», antwortete ich. Sofort wandte er sich mir feindselig zu.
«Und wie lange gedenkt Ihr sie dort zu lassen? Ihr werdet sie niemals freilassen können. Sie müssen getötet werden!»
Daran hatte ich noch nicht gedacht, aber er hatte recht. Gerüchte würden sich ohnehin fortpflanzen, da konnten wir keine Zeugen gebrauchen. Wir erzählten jedem Händler, jedem Boten und jedem Reisenden, dass der Generalvikar einer Grippe erlegen sei, um den Gerüchten möglichst entgegenzuwirken.
Ich nickte, um ihm zu zeigen, dass ich ihm beipflichtete. Wir mussten die Habsburger Soldaten töten. Meine Einsicht stimmte ihn wohl etwas freundlicher.
«Was ist mit den Ländereien, die mir durch den Bischof gestohlen wurden?», fragte er. Also zeigte er endlich, was er wirklich begehrte. Er wollte als Erster am Hof sein, um seine Ansprüche geltend zu machen.
«Wir versichern Euch, dass wir Euch rufen werden, wenn der Rat über Ländereien ausserhalb Churs berät», sagte der Werksmeister. «Im Moment jedoch geht es uns darum, Steuern, Strafen und dergleichen zu bestimmen.»
Er nickte. «Ich werde dem König eine Nachricht zukommen lassen, in der ich von der Grippe berichte und versichere, dass alles seine Richtigkeit hat.»
Damit drehte er sein Pferd um und machte sich auf den Weg aus dem Hof hinaus. Er hielt dann aber doch noch ein Mal inne und sagte: «Ihr wisst, was ich will … nur das, was mir rechtens gehört, die Ländereien Domleschg und Heinzenberg. Beratet darüber. Ich werde wiederkommen.»
Ich winkte Johannes zu mir und wollte von ihm wissen, wo diese Ländereien genau lägen.
«Das Domleschg ist das Tor in den Süden. Es ist das Gebiet vor der Via Mala. Es beherbergt den schnellsten Weg über die Berge in den Süden, oder besser gesagt durch die Berge hindurch. Der Weg führt dort durch eine tiefe Schlucht, die nur sehr schlecht begehbar ist. Wenn ihr in den Süden nach Bellinzona wollt, müsst ihr ebenfalls durch die Schlucht gehen. Gott bewahre.»
Als die Verhältnisse nach weiteren Versammlungen geklärt schienen, bestand ich darauf, zusammen mit Johannes Moser den Brief an Luzern zu verfassen. Ich liess ihn mir vorlesen und befand ihn als zielführend.
«Für diese Lüge werde ich in der Hölle schmoren», hörte ich Johannes Moser murmeln.
«Vielleicht Vater, aber gegen den kaltblütigen Mord, den wir begangen haben, ist das eine kleine Sünde. Ausserdem ist Luzern eine reiche Stadt; für sie war es ein kleiner Verlust.»
«Warum habt ihr es überhaupt getan?», fragte mich Johannes Moser. Von allen Stadträten war er mir der Vertrauteste und man konnte vielleicht sagen, dass sich eine Art Freundschaft zwischen uns entwickelt hatte. Trotzdem überlegte ich mir gut, was ich preisgeben wollte.
«Es war nie meine Absicht gewesen die Stadt auszurauben. Ich bin mit Veit nach Luzern gegangen, um Proviant und Waffen zu kaufen. Ich hatte das nötige Geld, um alles redlich zu kaufen. Aber durch einen Streit beim Kaisern hat man uns angegriffen und wir mussten uns verteidigen, wobei aber Veit gefasst wurde, während ich fliehen konnte.»
Ich hielt inne und erinnerte mich an die Geschehnisse. «Veit hat die Büttel zurückgehalten, damit ich fliehen konnte, weil er wusste, dass ich ihn später befreien würde. Und das habe ich getan. Es war reiner Zufall, dass Veit in den Wasserturm gebracht wurde, in dem die Stadt Luzern auch ihr Vermögen aufbewahrt.»
«Ihr hättet es auch einfach da liegen lassen können …», deutete Johannes Moser an.
«Und warum hätte ich das tun sollen?», fragte ich. «Ich habe Männer und deren Frauen und Kinder zu versorgen.»
Johannes Moser nickte schliesslich und wir entsandten kurz darauf einen Boten in Richtung Luzern.
Die weiteren Tage am Hof waren äusserst angenehm. Ich erinnere mich an gutes Essen, Wein und Feste. Vielleicht war es nicht genau so, wie ich es in Erinnerung habe, jedoch waren ich und meine Männer nun offiziell Gäste am Hof.
Ich residierte weiterhin im Zimmer des ehemaligen Generalvikars. Johannes Moser versuchte das Zimmer für sich zu beanspruchen, da er nun der neue Vikar war und er schliesslich das Recht auf das Zimmer gehabt hätte. Jedoch behielt ich das Zimmer für mich und tröstete ihn damit, dass wir bald fortgehen würden und er die prunkvolle Stube noch bis ans Ende seiner Tage geniessen könnte. Er verstand und fand ein anderes Zimmer, das fast genauso geräumig war.
Ich verbrachte viel Zeit mit Margreth. Wir teilten jede Nacht das Bett miteinander und auch am Tage begleitete sie mich oft. Sie war froh über unsere Anwesenheit, denn so konnte sie der geplanten Hochzeit entgehen. Obwohl ich sie in der ersten Nacht nicht gefragt hatte, ob sie bei mir sein wolle, blieb sie danach freiwillig bei mir. Sie schien gerne Zeit mit mir zu verbringen. Ich vermutete jedoch, dass sie die Macht an meiner Seite mehr genoss. Für begrenzte Zeit war sie das Burgfräulein, die Frau an der Seite des Pannerherrn, die Königin am Hof.
Sie war ein aufgestelltes Mädchen, das viel lachte, weshalb sie bei den anderen am Hofe beliebt war. Sie konnte mir sagen, wie die Stimmung unter den Dienern und Mägden war. Und sie versicherte mir, dass die meisten sich immer noch nicht an unserer Anwesenheit stören würden. Im Gegenteil, es hatten sich wohl einige Liebschaften zwischen den Mägden und meinen jungen Männern ergeben.
Dies wiederum führte zwangsläufig zu Feindschaften, weil sich ein Höfling übergangen fühlte, als seine Auserwählte einen meiner Kämpfer auserkoren hatte. Solche Streitereien vermochte Petrus Duremberger als Hofmeister jedoch stets zu schlichten. Solange niemand getötet wurde, hielt ich mich aus diesen Belanglosigkeiten heraus.
Neben dem angenehmen Leben am Hof kam mir meine Stellung an der Seite des neuen Generalvikars Johannes Moser zugute. Wir verstanden uns gut und er hielt mich auf dem Laufenden, was die Korrespondenz mit anderen Herren anbelangte.
Ich wollte um jeden Preis verhindern, dass ich mit dem Raub in Luzern in Verbindung gebracht wurde, während Johannes Moser keine andere Erklärung für den Tod des Generalvikars Bruno von Habsburg duldete, als dass ihn eine Grippe dahingerafft hätte.
Die Priester sendeten laufend Briefe aus mit den jüngsten Meldungen, doch die meisten Boten kamen aus den anderen Bistümern, aus Basel und von der Territorialabtei Einsiedeln nach Chur.
Also trafen von vielen verschiedenen Orten laufend Neuigkeiten in Chur ein. Die meisten Boten sprachen der neuen Führung des Hofes die Unterstützung ihres Herrn aus. Man bedauere den Tod von Bruno von Habsburg und einigen anderen Männern aus seiner Gefolgschaft. Dass die Grippe seltsamerweise fast ausschliesslich Angehörige des Hauses Habsburg dahingerafft hatte, erwähnte niemand.
Die letzten Gefechte der Habsburger gegen die Eidgenossenschaft lagen noch nicht lange zurück. Bei Näfels und in den Appenzeller Kriegen hatten die Habsburger gegen die Eidgenossen gekämpft und bei der Eroberung des Aargaus war dann die Stammburg der Habsburger von den Eidgenossen eingenommen worden. Ich vermutete also, dass der Tod einiger Habsburger die meisten Herren nicht sonderlich bedrückte.
Einer dieser Boten brachte am Neunten des Monats Mai einen für mich wichtigen Brief, der Nachrichten zu Bellinzona und den Mailänder enthielt. Üblicherweise sendete Johannes Moser einen Jungen nach mir, der mich in seine Räumlichkeiten rufen liess, wenn eine solche Nachricht eingetroffen war.
An diesem Nachmittag aber kam er höchstpersönlich und nach Luft schnappend über den Hof gerannt, als ich mit meinen Männern den Kampf exerzierte.
«Herr A Pro», rief er bereits von Weitem und fuchtelte mit den Armen über seinem Kopf. Ich wartete, bis er mich erreichte.
«Uri und Unterwalden haben ein Panner nach Faido entsandt», sagte er, während er sich mit seinen Händen auf den Knien abstützte.
«Was sagt Ihr da?», rief ich überrascht. Faido lag vor Bellinzona. Ein kalter Schauer überkam mich. Waren wir etwa zu spät? Hatte die Eidgenossenschaft zu den Waffen gerufen und ihre Krieger vielleicht schon südlich des Berges zusammengezogen, während wir es uns in Chur bequem machten? Würden wir den Krieg verpassen?
«Erzählt mir genau, was in dem Schreiben steht», forderte ich Johannes Moser auf.
«Folgt mir», antwortete er mir stattdessen und führte mich ins Schloss zurück.
In seiner Kammer angekommen, las er mir die Nachricht vor. Wäre Elisabeth hier gewesen, hätte sie mir vorlesen können, so jedoch war ich auf Johannes angewiesen. Ich schämte mich nicht dafür, dass ich nicht lesen konnte, denn ich war ein Krieger und kein Gelehrter. Ich verstand mein Handwerk und sie das ihre.
Aber die Nachricht enthielt nicht viele weiterführende Informationen. Die Acht Orte konnten sich noch immer nicht zu einem gemeinsamen Vorgehen durchringen, zu verschieden lagen die Interessen der einzelnen Länder. Niemand wollte seine Männer in die Schlacht führen, wenn nicht einmal klar war, ob eidgenössischer Besitz überfallen worden war. Bellinzona gehörte Uri und Unterwalden, es war ihr alleiniges Untertanengebiet. Die anderen Orte würden nicht stark von einem Sieg in diesem Kampf profitieren.
Nun jedoch hatten Uri und Unterwalden im Alleingang ein Panner Soldaten nach Faido geschickt. Anscheinend wollten sie nicht mehr länger warten. Oder vielleicht ging es darum, einen schlagkräftigen Beobachtungsposten im Süden zu etablieren, der die Truppenbewegungen der Mailänder ausspionieren konnte? Es blieb ungewiss, denn der Brief gab die Gründe für Uris und Unterwaldens Entschluss nicht preis.
Ungeachtet dessen waren mit diesem Schritt ganz klar die ersten Truppen gegen den Feind ausgerückt.
Trotz dieser großen Gefahr war es rein unmöglich, die eidgenössischen Orte zu einem geeinigten Vorgehen zu bewegen. In Faido standen im Mai 1422 die Truppen von Uri und Unterwalden. (Von Liebenau, 1886)
Ich überlegte mir, ob nun bereits der Zeitpunkt für mich gekommen war, um weiter in den Süden zu ziehen.
«Wie lange dauert die Reise von hier durch jene gefährliche Schlucht Via Mala bis nach Bellinzona?», wollte ich von Johannes wissen.
«Drei oder vier Tage. Durch die Schlucht könnt Ihr nicht schnell gehen. Jeder unüberlegte Schritt kann dort den Tod bedeuten. Aber wenn Ihr sie erst überwunden habt, ist es danach ein breiter, angenehmer Weg. Ihr müsst immer noch viele Schritte aufsteigen, jedoch könntet ihr dort Pferde benützen.»
Ich entschied gegen einen übereilten Aufbruch. Wenn ich ein klares Ziel im Süden gehabt hätte, wäre ich vielleicht sofort aufgebrochen. Doch ich war mir nicht sicher, ob die Freiherren von Sax in Mesocco meine Hilfe überhaupt wollten. Wenn nicht, würden wir dort unten im Wald hocken und verrotten, anstatt in einem Schloss auf die Schlacht zu warten. Ich entschloss mich, in Chur zu bleiben.
In diesen geborgenen Tagen am Hof erinnerte ich mich an meine Zeit als Säumer an der Seite von Jakob zurück. Ich blickte auf die umliegenden Berge. Jetzt im Mai sahen sie majestätisch und freundlich aus. Die Wiesen waren grün, die Bäche plätscherten und Wild trieb sich zwischen den Bäumen herum. Fern waren die Tage, als ich selbst bei Schnee und Sturm den grausamen Berg erklommen hatte. Es waren kalte, anstrengende und triste Tage gewesen. Wie oft hatte ich mich damals gewundert, wohin all die Dinge in den Säcken und Kisten gehen würden. Welche Herren würden diese Gegenstände in ihren Schlössern empfangen?
Nun befand ich mich selbst in solch einem Schloss und erfuhr am eigenen Leibe, wie angenehm das Leben sein konnte. Mit der Zeit lernte ich sogar die Diener und ihre Aufgaben in diesem Hofstaat kennen:
Der Truchsess trug die Speisen auf. Der Schenk und sein Unterbeamter, der Bechermann, waren für die Getränke verantwortlich. Den Küchenmeister hatte ich bereits kennengelernt, der Marschalk war der Oberstallmeister und der Kämmerer bewahrte und verwaltete das Vermögen. Der Kanzler verfasste Texte und war für das geschriebene Recht zuständig.
Es gab sogar Türhüter, die vor den Türen der Obrigkeit standen und darüber entschieden, wem Einlass gewährt wurde und wem nicht. Sie öffneten die Tür und schlossen sie danach wieder. Die Türhüter belustigten mich, da ich diese Aufgabe von allen anderen am Hof als die Sinnloseste empfand. Wie keine andere zeigte sie den Überfluss und so verlangte auch ich nach einem Türhüter, der fortan an meiner Tür stand und sie bediente. Margreth und ich machten uns einen Spass daraus, in der Nacht besonders laut zu sein, sodass er uns hören konnte.
Als sich schliesslich herumgesprochen hatte, dass es eine Veränderung am Hof gegeben hatte, kamen die meisten der umliegenden Herren, um beim neuen Generalvikar ihre Anliegen darzulegen. Jeder versuchte einen Vorteil für sich zu sichern.
Zum Beispiel sprachen sich verschiedene Männer als rechtmässige Herren der Burg Haldenstein aus. Johannes Moser hörte sich alle an, sagte aber keinem zu. Er müsse sich zunächst darüber beraten.
Ich war bei diesen Gesprächen immer anwesend, obwohl ich nicht immer erwünscht war. Meistens hielt ich mich jedoch in einer Ecke versteckt und lauschte von dort. Ich fand es höchst interessant, wie diese Verhandlungen geführt wurden.
Aber niemand war so hartnäckig wie die Familie von Rhäzüns. Meistens kam Hans von Rhäzüns persönlich in Begleitung einer seiner Brüder, und wenn er unpässlich war, schickte er seinen ältesten Bruder. Die wahre Macht aber lag eindeutig bei Hans. Seine Brüder waren keine Schwächlinge, aber nicht so schlau und gerissen wie er. Ausserdem musste ich eingestehen, dass er einiges von der Kunst der Diplomatie verstand. Er mochte mich nicht und knurrte mich jedes Mal an. Ich aber bewunderte ihn.
Eines Tags kamen wir unseren Übungen auf dem Hof nach, als er durch das Tor ritt. Er war wie meist in Begleitung seines jüngeren Bruders Heinrich, der seine uns wohlbekannte verärgerte Miene aufgesetzt hatte. Anstatt die Ratsmitglieder aufzusuchen, blieb er am Hof und lehnte sich lässig gegen einen Stützbalken. Er beobachtete unsere Bewegungen mit einem abschätzigen Grinsen.
Ich gab mir Mühe ihn zu ignorieren. Nachdem er jedoch hörbar laut schnaubte, als ich einen Schlag von Delio abwehrte, reichte es mir.
«Habt Ihr etwas zu sagen, Herr von Rhäzüns?», entfuhr es mir.
«Jedes Weib kann mit der Hellebarde besser umgehen als Ihr», antwortete er.
Inzwischen hatten alle Männer in Hörweite aufgehört mit den Übungen. Der junge Herr Rhäzüns war Gehorsam gewohnt. Er war es gewohnt, keine Widerrede zu erhalten. Ich aber hatte keinesfalls vor, ihm diesen Gefallen zu tun. Ich streckte ihm die Hellebarde entgegen.
«Dann wollt Ihr uns vielleicht zeigen, wie man es richtig macht, Herr?»
Sein Grinsen erstarb und wich einem gehässigen Ausdruck.
«Wie könnt Ihr es wagen, mich infrage zu stellen?»
Ich verzichtete auf eine Antwort und streckte ihm weiterhin die Waffe entgegen. Doch er rührte sich nicht und wusste offensichtlich nicht genau, was er sagen sollte. Er wollte wohl keine Niederlage in der Öffentlichkeit riskieren.
«Die Hellebarde ist die Waffe eines Bauerntölpels. Das Schwert ist die Waffe des Adels», sagte sein älterer Bruder Hans, dessen Nähern ich nicht bemerkt hatte. Heinrich entspannte sich etwas und war sichtlich froh, dass Hans sich einmischte.
Heinrich sah keinesfalls schwächlich aus. Ich war mir sicher, dass er als kleines Kind mit einem Holzschwert herumgerannt war und seinem Vater und den älteren Brüdern nacheiferte. Er genoss wahrscheinlich auch Unterricht im Schwertkampf durch einen erfahrenen Kämpfer.
«Dann beehrt uns mit Euren Fertigkeiten im Schwertkampf! Natürlich stelle ich keinen angemessenen Gegner für Euch dar, jedoch habe ich bereits mit Holzschwertern geübt», entgegnete ich.
Das stimmte natürlich nicht. Arnold Schick hatte uns in Flüelen auch mit dem Schwert kämpfen lassen. Ebenso mit Katzbalgern und den blossen Händen. Meine Lieblingswaffe aber blieb immer die Hellebarde. Der Adel und die Herren führten Schwerter mit sich, weil sie kostbar waren. Kein Bauer konnte sich ein Schwert leisten. Ein Schwert bedurfte der ausgefeilten Handwerkskunst eines fähigen Schmiedes. Die Klinge musste ausgewogen sein, sie durfte nicht zu hart und nicht zu weich sein, um im Kampf gegen andere Schwerter nicht zu brechen.
Eine Hellebarde dagegen bestand schlicht gesprochen aus einem Holzstock mit einem Beil daran. Und darum war sie einfacher und billiger herzustellen.
Ausserdem besass die Hellebarde meiner Meinung nach viele Vorteile gegenüber einem Schwert: Man hatte eine grössere Reichweite, konnte damit Reiter vom Pferd reissen und mit dem Spitz Kettenhemden durchschlagen. Wenn man das Beil mit genügend Kraft schwang, konnte man sogar Plattenpanzer so eindrücken, dass die Knochen dahinter brachen.
Meine Männer brüllten und jubelten inzwischen, angestachelt von Veit. Heinrich zögerte merklich und sah sich nach seinem Bruder um. Der jedoch starrte zurück und zuckte mit den Schultern. Hans wusste, dass sich sein ungestümer, junger Bruder in eine missliche Lage manövriert hatte. Er konnte jetzt keinen Rückzieher mehr machen, noch konnte der ältere Bruder den jüngeren heraushauen, ohne ihn zum Gespött zu machen.
Vielleicht dachte Hans auch, dass es seinem kleinen Bruder guttun würde, eine Lektion zu erhalten. All das ging mir durch den Kopf, bis Heinrich sich endlich auf mich zubewegte.
Delio reichte uns je ein Übungsschwert, als eine in Tücher eingewickelte Waffe, und einen runden Holzschild. Ich vertraute auf meine Fähigkeiten und hoffte auf den Sieg. Ich wollte ihn demütigen und vor meinen Männern Stärke beweisen.
Ich erinnerte mich an Arnold Schick. Er hiess uns bei einem Zweikampf stets einen kühlen Kopf zu bewahren: «Ihr müsst euch auf den Kampf einstellen. Stellt euch vor, euer Gegenüber hätte eure Tochter geschändet. Steigert euch in diese Wut hinein, bis ihr jede Angst vergesst und nur noch den Tod eures Gegners herbeisehnt. Wenn ihr an diesem Punkt angelangt seid, geht wieder einen kleinen Schritt zurück und versucht diese Wut so weit zu unterdrücken, bis ihr erneut klar denken könnt. Messt euren Gegner ab, schätzt ihn ein und dann geht entschlossen gegen den Bastard vor und tötet ihn.»
Und das tat ich nun. Ich wollte seinem verwöhnten, hochnäsigen Hintern eine Lektion erteilen. Ich erinnerte mich an all die Stunden auf dem Berg, in denen ich die Kostbarkeiten genau solcher Herren für einen Hungerlohn durch den knietiefen Schnee schleppen musste. Diese Männer glaubten, sie wären etwas Besseres.
Ich spürte, wie die Wut in mir aufstieg. Trotzdem versuchte ich ruhig zu bleiben und beobachtete Heinrich. Er hielt den Schild hoch und versuchte sich hinter ihm in Deckung zu bringen. Ich fragte mich, wie lange er diese Position wohl halten könnte. Wir standen weit voneinander entfernt und ich hielt meinen Schild locker an der Seite. Es war noch nicht nötig, das schwere Stück Holz hochzuwuchten.
Er kam nicht auf mich zu, sodass ich nach einigen Augenblicken auf ihn zuging. Dabei hielt ich den Schild noch bewusst unten und gab mich gelassen. Ich wollte sorglos und zuversichtlich erscheinen. In Wahrheit aber hatte ich Respekt vor Heinrich. Welche Ausbildung hatte er genossen? Vielleicht hatte er eine andere Technik als die mir bekannte erlernt und würde mich überraschen. Aber wieder stellte ich mir sein gefälliges Grinsen vor und beschwor meine Wut.
Unvermittelt vollführte ich einen Satz nach vorn und hob in der Luft meinen Schild. Ich liess ihn hart auf den Schild von Heinrich treffen, sodass er nach hinten stolperte. Er war überrascht über den schnellen Angriff und ich setzte sofort nach und schlug mit der flachen Schwertseite kräftig auf seine Schild-Schulter. Gleichzeitig holte auch er mit dem Schwert aus und versuchte meinen Schild-Arm zu treffen. Da er aber rücklings taumelte, vermochte er nur wenig Kraft in seinen Schlag zu legen. Er konnte seinen Schild nicht mehr oben halten und so rammte ich meinen nochmals kräftig gegen seine nun ungeschützte Front. Er fiel auf den Rücken und ich hielt ihm meine Klinge an die Kehle.