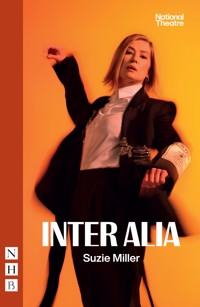1VORHER
Vollblüter. Jede Einzelne. Bereit für das Rennen, alle Muskeln gespannt. Gestriegelt, in teuren, dezenten Designer-Hosenanzügen in Grau oder Dunkelblau, klassischen weißen Blusen, schwarzen Roben. Alle Spitzenjuristinnen haben so einen arroganten Stolz gemein, eine ironische Art, den Raum einzunehmen, eine Umhängetasche quer über die Schulter geschwungen. Der Lippenstift in einem Nudeton oder Rot, nicht zu viel Mascara. Coole Ohrringe und Designerstiefel oder gewagte High Heels, auf einer Überseereise erstanden. Ich studiere sie alle. Schon seit Jahren. Kopiere sie. Ich bin eine geschickte Imitatorin, bis ich irgendwann besser bin im Anwältinsein als jene, denen es angeboren ist. Die Frauen an der Spitze praktizieren das Recht anders als die Männer, subtil anders, und es dauert seine Zeit, bis ich mir ihre verschiedenen Herangehensweisen, sich den Raum zu eigen zu machen, erschlossen habe. All die winzigen Details sprechen eine Geheimsprache und sagen: Hier sind wir, aber wir machen es auf unsere eigene Art, nicht wie die verstockten alten Anwälte von früher. Und diese Details häufen sich, je selbstsicherer man wird, je besser man seine Rolle im Gerichtssaal versteht.
Barrister Bags, Damastbeutel in Purpur oder Blau, sind im Saal verteilt, warten wie loyale Hunde neben ihren Besitzerinnen. Blau für den Nachwuchs, jünger als zwanzig Jahre, Purpur als Ehrenabzeichen, das man als Junior von einem Kronanwalt verliehen bekommen muss. Ich weiß mein Purpur sehr zu schätzen, trage es aber dennoch eher ironisch. Darauf meine Initialen, handgestickt im einzigen zugelassenen Schrifttyp, und auch das Futter der Tasche besteht aus dem einzigen gerichtlich genehmigten Inlettstoff. Einst waren solche Beutel Prestigeobjekte und dienten zum Transport von Schriftsätzen und Gerichtsunterlagen. Vor Jahrhunderten mögen sie praktisch gewesen sein, heute geht es eigentlich nur noch um die Show. Elitäre Symbole, die von Vater zu Sohn zu Sohn weitergegeben werden. Manchmal bekommt auch eine Tochter den Beutel ihres Vaters, aber solche Anwältinnen – die natürlich in einer Juristenfamilie aufgewachsen sind – haben nicht dasselbe komplizierte Verhältnis zu diesen Dingen wie ich. Und sie lieben auch das Gesetz nicht so wie ich. Sie begreifen es nicht als Machtmittel, wie ich es immer getan habe, sie halten sich nicht daran fest. Natürlich wissen sie, dass das Gesetz etwas mit Macht zu tun hat, aber die meisten von ihnen haben es sich darin bequem gemacht wie in einem alten Ledersessel, einem Erbstück, und halten es mehr für eine Familientradition denn für den Schauplatz eines erbitterten Kampfes um Gerechtigkeit.
Diese Frauen sind leicht auszumachen. Meist praktizieren sie kein Strafrecht, nichts Zwielichtiges. Nichts Riskantes. Wenn sie doch Strafsachen behandeln, dann in der Regel die zahmere Variante, und häufig eher aus Neugier als aus Lebenserfahrung, eher aus Faszination als aus dem Bedürfnis heraus, für Mandanten aus den untersten Schichten der sozialen Rangordnung zu kämpfen.
Diejenigen von uns, die sich jenseits der Staffage bewegen, für die der Beutel steht, sind mit einer ledernen Umhängetasche besser beraten: souverän, unprätentiös, ein Symbol dafür, dass wir über die Notwendigkeit eines Schmusedeckchens längst hinweg sind, eine Ehrenmedaille, die wir uns selbst verleihen.
Und doch haben wir ein paar Sachen gemeinsam: die Rosshaarperücke, die unser sorgfältig geschnittenes, in warmen Tönen gefärbtes Haar bedeckt und allen weiblichen Barristern am Ende eines langen Arbeitstages dieselbe unvorteilhafte Sechs-Uhr-Perücken-Frisur verpasst – ein Problem, das unsere Vorväter bei der Festlegung der gerichtlichen Kleiderordnung wohl nicht bedacht haben. Die Männer lassen sich ausschließlich an der Farbe ihrer Krawatten unterscheiden. Hie und da eine ungewöhnliche Brillenfassung oder eine interessante Uhr.
Auf einen Blick erfasse ich alle Gesichter in der Eingangshalle des Gerichts, weiß genau, welche Fälle sie übernommen, gewonnen, verloren haben und welche Fälle heute anberaumt sind. Die Anwesenheit einiger bestimmter Anwälte deutet auf ein Wirtschaftsdelikt hin, Spezialisten in Sachen Unternehmensrecht haben immer die beratenden Solicitors mit Rollwagen voller weißer Aktenordner im Schlepptau.
Und dann sind da wir, die wir mit dem Aufzug zum Strafgericht fahren. Erhobenen Hauptes drehen wir unsere Kreise. Trainiert und rennbereit. Nicht fahrig, sondern gespannt, wie Pferde eben, erregt und rastlos in Erwartung des Startschusses. Wer die Nerven verliert, wird disqualifiziert.
Ich betrete mit meinem Mandanten den Verhandlungssaal, registriere einen Haufen Polizisten, die den Verteidiger der Anklage belagern. Die Staatsanwaltschaft hat Arnold Lathan geschickt. Gut. Ich bin froh, dass er es ist, und wage fast zu behaupten, dass sich der Fall so gewinnen lässt. Ich nicke Arnold kurz zu, er nickt zurück. Mein Blutdruck steigt, doch ich muss mich zurücknehmen, mich bremsen, nicht übermütig werden. Arnold ist immer gut vorbereitet, reagiert aber nicht immer schnell genug, wenn sich die Situation verändert. Von den Polizisten erkenne ich niemanden wieder. Auch das ist gut. Sie haben keine Ahnung, was sie erwartet.
Mein Mandant bleibt zurück. Tony. Ein großer Typ, breit, ich vertrete ihn nicht das erste Mal, aber das erste Mal in einer solchen Angelegenheit. Tonys Anklage lautet auf Diebstahl und Körperverletzung und basiert ausschließlich auf der Aussage eines einzigen Mannes, mit dem er früher einmal Fußball gespielt hat. Eines belasteten Zeugen mit einem heftigen Groll gegen ihn. Er mag Tony nicht, schaut auf ihn herab. Er hat ihn in der Kneipe angesprochen und verschweigt in seiner Aussage die Beleidigungen und Tätlichkeiten, die Tony durch ihn erlitten hat. Die Polizei ist sichtlich überzeugt von den Vorwürfen gegen Tony.
So steht es also. Die Aussage des Zeugen gegen die von Tony.
Tony ist gekleidet, wie ich es ihm aufgetragen habe, sieht aber trotzdem unmöglich aus. Ein Anzug von Primark, ein billiges No-Name-Hemd und eine Krawatte, die er vermutlich irgendwo im Ausverkauf gratis zum Hemd dazubekommen hat. Aber immerhin hat er es versucht. Hat seine ganzen Schlangen- und Messertätowierungen unter einer Schicht Polyester versteckt. Gut. Es ist immer ein Schock für mich, wenn diese harten Typen die Eingangshalle eines Gerichtshofs betreten, unerwartet nervös. Das gilt auch für Tony. Sie beherrschen die Straßen da draußen, selbstsicher und großspurig, lesen alle Zeichen, aber hier drin sind die Zeichen andere, und jedes einzelne davon besagt ihnen: »An diesem Ort hast du keine Macht.« Ich hatte zu Tony gesagt, er soll seine Zahnbürste mitbringen, und heute Morgen im Foyer hat er sie mir dann tatsächlich gezeigt. Er zog sie aus der Jacketttasche, die Borsten voller Flusen vom Innenfutter.
»Tony, das ist doch nur eine Redewendung.«
»Aber Sie haben gesagt–«
»Das ist nur so ein Anwaltsspruch.«
Er hängt mir an den Lippen, versucht herauszufinden, was das alles bedeuten soll.
»Das heißt so viel wie ›Die Polizei hat einiges gegen Sie in der Hand.‹«
»Aber Sie haben doch–«
»Tony, die lassen Sie keine Zahnbürste mit ins Gefängnis nehmen!«
»Nicht?«
Er mustert mich, sucht nach einem Funken Hoffnung.
»Nur keine Panik jetzt.«
Tony hat Angst. Schiss wie ein kleiner Junge. Natürlich. Für ihn ist das keine alltägliche Situation, keine vertraute Umgebung. Er war die ganze Nacht über wach, hat getrunken und gekotzt, musste dieses Hemd bügeln und seine Freundin oder Mutter bitten, ihm die Krawatte zu binden. Wahrscheinlich hat er den Zug in die Stadt genommen und bei McDonald’s um die Ecke gegessen, ohne zu wissen, wo er die kommende Nacht verbringen wird.
Die Lage ist ernst – wenn er verliert, könnte er für einige Jahre einsitzen.
Wenn man ehrlich ist, hilft es, sie ängstlich zu halten. Sie hören dann besser zu, schauen ein wenig mehr zu einem auf, außerdem verschafft es einem im Falle der Niederlage einen Puffer. Sobald sie das Gefängnis als Möglichkeit begreifen, bist du alles, was sie haben. Wenn wir heute ungeschoren hier rauskommen, bin ich sein Lieblingsmensch, fährt er ein, ist es kein Schock. Ich erkenne so viel von meinem Bruder in Tony wieder. Aus der Bahn geraten, in einer furchtbaren Lage, die nur noch schlimmer zu werden droht. Kurz vor der Verhandlung trete ich auf ihn zu.
»Hey, Tony.«
Er springt hastig auf, ich sehe, dass er schwitzt.
»Alles klar?«
»Ja. Ja.«
»Kommt noch jemand zur Unterstützung?«
Er befeuchtet die Lippen mit der Zunge. Er ist erst 25.
»Mum ist unterwegs.«
»Gut.«
Ich bin für ihn das einzig Vertraute in diesem Raum. Von einer Gruppe von Anwälten ertönt Gelächter, ein anderer ruft nach seinem Mandanten. Tony ist umgeben von Macht und Selbstbewusstsein, er selbst besitzt hier drin keins von beidem. Zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, ist sein Blick weich, er hat weder Kaugummi noch Kippe im Mund. Ich sehe das Kind in ihm. Nicht das Arschloch aus dem Polizeibericht, den besoffenen, aus der Fassung geratenen, tobenden Kneipenschläger.
»Glauben Sie, es besteht noch eine Chance, dass Ihre Zeugin auftaucht?«
Er hat eine Exfreundin, die alles beobachtet hat, die bezeugen kann, dass nicht Tony als Erster zugeschlagen hat.
»Kein Plan. Vielleicht. Soll ich sie noch mal anrufen?«
»Machen Sie das. Sagen Sie ihr, wir stehen für zehn auf der Liste.«
Ich weiß, dass es hoffnungslos ist. Sie ist schon den ganzen letzten Monat untergetaucht. Ganz offensichtlich will sie mit dieser Angelegenheit nichts zu tun haben. Sie traut sich nicht, auszusagen. Niemand wird gerne ins Kreuzverhör genommen. Aber immerhin gibt der Anruf Tony etwas zu tun, solange er auf seine Mutter wartet, und mir gibt er die Gelegenheit, die wichtigsten Punkte noch einmal durchzugehen und einen Abstecher auf die Toilette zu machen, um Perücke und Make-up zu richten.
Im Gerichtssaal zieht Tony seinen Stuhl neben mich an den Verteidigungstisch. Ich muss ihn zurechtweisen. Ich schaue ihn an und erkläre, er müsse auf der Anklagebank Platz nehmen, dirigiere ihn hinüber zum Gerichtsbeamten. Er fügt sich kleinlaut, zittert. Der Mann, den der Polizeibericht als gefährlichen, gewaltbereiten Rowdy in einer Bar beschreibt, ist dieser verschüchterte Fünfundzwanzigjährige, der schlottert wie ein kleiner Junge. Die Narrative sind nicht in Einklang zu bringen. Das ist die Wahrheit des Gesetzes. Dann erscheint Tonys Mutter, nimmt in der Mitte des Zuschauerbereichs Platz. Auch sie ist allein. Tippt auf ihrem Handy herum. Ich gestikuliere, versuche ihr zu verstehen zu geben, das Handy auszuschalten. Sie versteht mich nicht. Ich geb’s auf.
Ich drehe mich um und schaue auf die Uhr an der Wand. Im Verhandlungssaal wird es langsam still, der Richter ist zu spät, aber nicht viel. Es ist kurz nach zehn. Ich höre das Getuschel im Zuschauerraum hinter mir, aber jetzt, da ich im Einsatz bin, schiebe ich es in den Hintergrund. Blättere durch meine Unterlagen, gieße Wasser aus dem Krug auf dem Tisch in ein Glas, sortiere meine Notizen.
Diese Energie im Raum bei all meinen Prozessen – der Moment bevor es losgeht, in dem der Raum um mich herum von Aufregung und Furcht durchströmt ist. Hier kann ich meine Fähigkeiten voll ausspielen. Ich bündle alle Energie an einem einzigen Punkt, mache mir den Verteidigungstisch zu eigen. Scheuklappen auf, volle Konzentration voraus. Das Gesicht selbstsicher, nichts preisgeben. So viel von alldem ist Theater. Ich habe alle Details des Falls im Kopf, keine Kapazität für irgendetwas anderes. Ich reiße mich zusammen, nehme mich zurück, halte mein Blut auf genau der richtigen Temperatur. Kurz vor dem Siedepunkt. Warten. Warten. Und dann Peng.
Der Gerichtsbeamte ruft: »Erheben Sie sich.«
Wir springen alle auf. Nicken respektvoll, als der Richter erscheint. Er nimmt Platz, wir ebenfalls. Der Verteidiger der Anklage und ich, aufgekratzt, jeder auf seiner Seite, nehmen jeden Atemzug des anderen wahr, ohne einander Beachtung zu schenken, bis auf ein gelegentliches »Ich verweise auf den Staatsanwalt, Herr Vorsitzender.« Kein Augenkontakt.
Wir haben die Startboxen verlassen, es geht los. Das Rennen ist lang, also halte ich mich im Zaum. Nichts ist schlimmer, als vorzupreschen, aus dem Bedürfnis heraus, einen Punkt zu machen, der auf lange Sicht den eigenen Erfolg untergräbt. Die Vertretung der Anklage eröffnet den Prozess, erhebt sich und wendet sich an die Jury. Am besten für Tony wäre es, wenn die Staatsanwaltschaft gar nicht dazu käme, Anklage zu erheben, weil die Verteidigung die Beweislage infrage stellen und fordern könnte, dass der Richter die Eröffnung des Verfahrens ablehnt. Der Prozess käme dann gar nicht zustande und Tony könnte nach Hause gehen.
Ich habe mein komplettes Vorgehen im Kopf, bin aber jederzeit imstande, den Plan beim ersten überraschenden Kurswechsel der Gegenseite anzupassen. Der Staatsanwalt steht auf und trägt die Anklage vor. Von meinem Tisch aus streift mein Blick das Richterpult, meine Reaktion auf die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft betont nonchalant. Meine Miene gibt nichts preis, ich sitze still, aufrecht, konzentriere mich auf das, was vor mir liegt, gelassen, abwartend, die Nerven bis zum Zerreißen gespannt. Jedes geäußerte Wort wird von mir verarbeitet, geprüft, abgespeichert, während ich Langeweile vortäusche. Atmen. Den Blick sanft halten, aber jede Silbe aufnehmen, jede körperliche Regung interpretieren, immer auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Das Theater dient nicht nur dazu, die Mandanten zu beeindrucken und zu demonstrieren, wer hier das Sagen hat. Es gehört zum Spiel. Ich rücke ein wenig auf dem Stuhl nach hinten, den Kopf leicht schiefgelegt, den Rücken an der Lehne, aber alle Muskeln auf Spannung, bereit zum Sprung.
Dann wittere ich eine Chance. Der Zeuge der Anklage schweift ab, statt einfach die Fragen zu beantworten, liefert er ungefragt Erklärungen. Ich sehe, dass Arnold, der Staatsanwalt, versucht ist, eine Frage zu stellen, um deren Vagheit er weiß. Sein Zögern gibt den Ausschlag. Da tut sich etwas auf, Moment, Moment … noch ein wenig abwarten. Genau das ist eine meiner Stärken, das Warten, die Ruhe davor.
Und dann ist es so weit, mein Instinkt treibt mich an, ich springe auf. Maßvoll, aber entschieden.
»Herr Vorsitzender.«
Ich bündle alles in einem Punkt, alle Augen auf mir. Ich sehe nichts, aber ich spüre den Stimmungswechsel. Aufrecht stehen, warten, der Richter konzentriert sich auf mich. Ich höre meine eigene Stimme.
»Verzeihen Sie, wenn ich mich erhebe, aber ich denke, mein verehrter Kollege von der Staatsanwaltschaft stützt die Beweisführung auf seinen Zeugen. Die Anklage basiert ausschließlich auf der Aussage dieses einen Mannes – eines in den Augen der Verteidigung höchst unglaubwürdigen Zeugen.«
Nachdrücklich und sicher führe ich meine Einwände aus und fordere, dass der Richter die anvisierte Fragestellung nicht zulässt. Der Staatsanwalt versucht, sich nicht aus dem Tritt bringen zu lassen, ich spüre den Impuls, weiterzureden, aber ich unterdrücke ihn. Weniger ist mehr, ich habe meinen Standpunkt vorgebracht, jetzt gilt es, sie im Ungewissen zu lassen. Der Richter hält für einen Moment inne, als hätte er die Energie des Spiels jetzt erst wahrgenommen, sein Blick ruht wieder auf mir. Er kennt mich, hat mich schon in Aktion erlebt. Ist das Respekt? Er sitzt noch nicht lange auf dieser Seite der Richterbank, er schätzt den Kampf, schätzt eine schlagkräftige Argumentation, und meine holt gerade kräftig aus. Er lehnt sich vor. Meinem Antrag wird stattgegeben.
Ja! Innerlich breche ich in Jubel aus, aber ich lasse es mir nicht anmerken. Nicht weit von mir, ebenfalls auf der Verteidigerseite, sitzt Tonys beratender Solicitor. Er ist kaum älter als Tony, von einer schicken Privatschule und er hat den teuersten Haarschnitt im Saal. Ich brauche ihn nicht, aber er denkt, dass ich auf ihn angewiesen bin, überfliegt seine Notizen, um im richtigen Moment bereit zu sein. Als ich wieder Platz nehme, sieht Tony mich von der Anklagebank aus an. Er versteht zwar nicht, dass ich gerade einen wichtigen Fortschritt errungen habe, aber er kann es spüren, eine kleine, unmerkliche Veränderung. Den Mann im Zeugenstand hat Tony früher gut gekannt, aber inzwischen ist von der Freundschaft nichts mehr übrig. Dieser Mann hat eine ziemliche Wandlung hingelegt, seit er und Tony zusammen Fußball gespielt haben. Er trägt ein strenges Aftershave und ist jetzt in der Immobilienbranche tätig, eine Art Makler. Er ist der »Wichser«, gegen den die Tonys dieser Welt immer verlieren. Für Tony verkörpert dieser Typ alles, was bei ihm selbst schiefläuft, ein ganzes Leben erlittener Feindseligkeiten münden in diesem Moment, in dem dieser Zeuge vor Gericht erscheint und versucht, Tony ins Gefängnis zu bringen. Für mich hingegen ist der Zeuge nur der Zeuge, eine einzelne Figur in einem größeren Spiel.
Ich setze mich, während der Staatsanwalt die Zeugenbefragung zum Abschluss bringt, er hat einen Rückschlag eingesteckt und bemüht sich, ihn so gut wie möglich zu kaschieren. Es sitzen noch andere Strafverteidiger im Zuschauerraum, sie warten auf ihre eigenen Verhandlungen, sind hellhörig für die Argumente, neugierig, wie ich als eine von ihnen meine Fähigkeiten ausspiele.
Der Richter ergreift das Wort. »Ihr Zeuge, Miss Ensler.«
Jetzt ist es so weit. Der Zeuge gehört mir. Er atmet ein, misstrauisch, taxiert mich. Er registriert alles an mir, wie ich gekleidet bin, wie ich ihn ansehe, ob ich die Art von Frau bin, die er um den Finger wickeln oder herabwürdigen kann. Meine Neuronen feuern, in meinem Kopf nehmen die Worte Gestalt an.
Der Saal ist still, steht unter Spannung, alle warten auf mich.
Ich genieße den Augenblick.
Ich stehe auf und nehme mir kurz Zeit, schiebe die Robe beiseite und knöpfe meinen Blazer zu. In meinem Kopf höre ich meine eigene Stimme. Ganz ruhig, Tessa, ganz ruhig. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie der Zeuge mich noch immer prüfend mustert. Ich wirke klein auf ihn, jung. Aber richtig einschätzen kann er mich noch nicht. Ich lasse alle eine Sekunde länger zappeln als erwartet, aber nur eine Sekunde, dann lege ich los.
Das Kreuzverhör ist der beste Teil. Hier geht es nur um Instinkt. Ja, man braucht die Informationen, einen mentalen Fahrplan, aber sobald es losgeht, heißt es beweglich bleiben. Flexibel sein. Sich auf einen Rhythmus einlassen.
Ich fixiere den Zeugen. Ich bin bereit, gewappnet für das anstehende Spiel. Der Mann hat keine Ahnung, wen er vor sich hat. Womöglich wurde er sogar vor meinen Methoden gewarnt, aber inzwischen hat er alles wieder vergessen.
Ich stelle ihm eine Frage, er sieht den Richter an und antwortet schnell. Ich stelle dieselbe Frage noch einmal etwas anders, behalte sein Gesicht im Blick, ein Zucken. Er wiederholt seine Antwort mit einer abweisenden Handbewegung in meine Richtung, bevor er hastig den Richter ansieht. Ich wiederhole seine Antwort. Ohne hinzuschauen spüre ich eine Regung des Staatsanwalts neben mir.
Ich spreche die Antwort noch einmal nach, fragend. Der Zeuge sieht mich direkt an, hält mich für verwirrt. Ich blättere durch einen Stapel Unterlagen, lasse ihn glauben, ich hätte den Faden verloren.
Er schaltet sich erneut ein, versucht, seine Antwort zu erklären, sein Ton ist herablassend. Sein Sprechtempo lässt keinen Zweifel daran, dass er denkt: Die ist wohl nicht die Schnellste im Kopf.
Ich höre mich selbst atmen, dann ein kaum wahrnehmbares Kichern von der Staatsanwaltschaft.
Gut. Sehr gut.
Wieder blättere ich durch meine Akte, werfe einen Blick auf Tony in der Anklagebank, er rutscht unbehaglich hin und her. Gut.
Ich stelle eine ähnliche Frage und beobachte, wie der Zeuge sich entspannt. Er schwellt die Brust, sein Blick wandert umher, dann ein Schmunzeln. Die hat ja keinen blassen Schimmer. Ein Blick zum Richter. Keine Regung. Aber dieser Richter hat mich schon erlebt, kennt andere wie mich. Er beobachtet in aller Ruhe die Vorstellung.
Nächste Frage.
Und noch eine.
Wenn ich die Antwort mit besorgter Miene zur Kenntnis nehme, macht das den Zeugen mutig. Er sieht sich im Zuschauerraum um, auf der Suche nach einem Publikum. Sieht mich an. In seinem Blick Herablassung und … ist das eine vage Anzüglichkeit? Ich nicke zu seinen Antworten, blättere immer wieder linkisch durch meine Unterlagen. Ich beäuge ihn, ja … ja.
Ich lasse den Zeugen reden. Zu viel reden. Ich lasse ihn »präzisieren«. Gut so. Mach weiter.
»Vielen Dank, Sir, ich war nicht ganz sicher …«
Und er macht weiter. Er ist ganz in seinem Element. Sein Blick kanzelt mich ab. Die ist wohl ganz frisch von der Uni, die hat nichts drauf, denkt er. Jetzt ist er Wachs in meinen Händen. Er entspannt sich, fühlt sich überlegen. Und so wird er unvorsichtig.
Dann plötzlich sagt er etwas Widersprüchliches.
Ich nicke und schaue verwirrt, lasse ihn erklären, halte mich bereit. Da ist er, der Wendepunkt, noch ein kleines Stück. Er erklärt, und ich nicke, während er sich immer tiefer hineinreitet.
»Ah ja, verstehe. Das ist jetzt etwas klarer …«
Oh, wie bereitwillig er immer weitere Informationen liefert. Es ist viel zu leicht, der Zeuge redet sich um Kopf und Kragen. Ich wage einen kurzen Seitenblick zum Staatsanwalt, sehe, wie er einen Finger an die Stirn legt. Er weiß es. Und ich weiß es, aber der Typ, der sich gerade selbst ins Grab redet, weiß es nicht, er findet einfach kein Ende. Während ich ihn vor meinem geistigen Auge umkreise, nicke ich zustimmend. Bitte um eine weitere Erläuterung.
Der Zeuge ist ja so entgegenkommend! Er tut der armen Frau einen Gefallen. Ich linse kurz zum Richter, mein Gesicht ist eine Maske, aber der Richter weiß Bescheid. Ich wende mich wieder dem Zeugen zu, sehe den Abgrund und lasse ihn blind darauf zurennen. Er hat den Point of no Return längst überschritten, niemand kann ihn jetzt noch retten.
Als er fertig ist, lehnt er sich zurück, Zuversicht blitzt auf seinem Gesicht auf. Ich lasse ihm seinen Eindruck, die Situation zu kontrollieren, die Zügel in der Hand zu haben. Lasse ihn in seinem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit schwelgen.
Dann atme ich ein und aus, ermahne mich, behutsam vorzugehen, die Wirkung sorgfältig auszutarieren.
Der Zeuge verschränkt die Arme. Jetzt blättere ich keine Unterlagen mehr durch, ich stehe ganz still, und doch umkreise ich ihn. Der Richter und die anderen Verteidiger wissen, was jetzt kommt. Insgeheim tut er ihnen leid und doch sind sie mit Begeisterung dabei, lehnen sich nach vorne. Die Leute im Zuschauerraum langweilen sich ein wenig, sie denken, ich wäre inkompetent, sie haben keine Ahnung, was hier vor sich geht. Und auch der Zeuge selbst hat immer noch keinen Schimmer. Keinen. Blassen. Schimmer.
»Entschuldigen Sie, nur der Klarheit halber … Ich hätte da noch eine Frage. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Es würde mir helfen, mir ein vollständiges Bild zu machen …«
Kaum wahrnehmbar verdreht der Zeuge die Augen. Perfekt.Jetzt habe ich ihn genau dort, wo ich ihn haben will. Wenn der Zeuge nur einen Moment lang den Staatsanwalt ansehen würde, der ja direkt neben mir sitzt, würde er merken, dass etwas nicht stimmt. Aber das tut er nicht. Der Staatsanwalt senkt den Blick, schaut auf die Tischplatte. Ich halte inne, lege langsam die vorgetäuschte Verwirrung ab. Ich schaue den Zeugen an.
Stelle meine Frage.
Ein seltsamer Zug gleitet über sein Gesicht, und jetzt sieht er hilfesuchend den Staatsanwalt an, der natürlich nichts sagen kann, ihn aber mit den Augen zur Vorsicht mahnt, ihn förmlich anfleht, nicht in die Falle zu tappen. All das nehme ich wahr und dann feuere ich vier Fragen wie Schüsse auf den Zeugen ab.
Peng. Peng. Peng. Peng.
Auf seinem Gesicht zeichnet sich der Schock ab. Er ist erledigt. Er sieht mich an.
Zum ersten Mal sieht mich der Zeuge. Sieht, wer ich wirklich bin.
Ich beobachte, wie es ihm allmählich dämmert, und dann sehe ich seine Wut. Wut auf mich. Darüber, aufs Kreuz gelegt worden zu sein. Ich stehe aufrecht, zeige ihm meine Macht. Er hat geglaubt, er hätte alles im Griff, aber hier bin ich. Es gefällt mir, wie er mich schon abgeschrieben hatte, wie er die Augen verdreht und mich für mies in meinem Job gehalten hat. All das gefällt mir, weil es in diesen einen Moment mündet. In diesen Moment, in dem ich das Spiel gewonnen habe und er mich ansehen und sich eingestehen muss, dass er völlig unterschätzt hat, mit wem er es zu tun hat.
Das gefällt ihm nicht.
Ich beobachte, wie der Zeuge schwitzend um eine Antwort ringt. Den Zuschauern ist jetzt nicht mehr langweilig. Sie haben gerade ein waschechtes Kreuzverhör erlebt, und zwar ein so fulminantes, wie sie es nur aus dem Fernsehen kennen. Ich spüre ihre Stimmung umschwingen, sie mögen hinter mir sitzen, aber sie betrachten mich jetzt mit Respekt und Neugier. Die ist gut. Aber ich bin noch nicht fertig.
Als Erstes geht mein Blick hinüber zu meinem Mandanten, er starrt mich ehrfürchtig an, hatte längst aufgegeben, jetzt strahlt er, aber ich fahre fort, als hätte ich ihn gar nicht gesehen. Ich bin noch nicht fertig.
»Beantworten Sie bitte die Frage, Mr Bateman.«
Ich sage das in meiner professionellsten Tonlage. Der Zeuge schweigt. Ich koste diesen letzten Moment aus und lasse mir Zeit. Der Staatsanwalt hält den Kopf so tief gesenkt, dass er fast die Tischplatte berührt, seine Anklage ist dahin. Er weiß es, ich weiß es und der Richter weiß es auch, und trotzdem muss die Inszenierung ihr Finale erreichen. In der lieblichsten Stimme, zu der ich fähig bin, hake ich nach.
»Herr Vorsitzender, der Zeuge beantwortet meine Frage nicht.«
Der Richter erinnert Mr Bateman daran, dass er die Frage beantworten muss. Ich drehe mich zu Mr Bateman und warte. Er steht mit dem Rücken zur Wand, und ich warte. Er murmelt irgendetwas. Ich lehne mich nach vorne.
»Verzeihung, das habe ich nicht verstanden.«
Der Richter ergreift das Wort. »Sie müssen für die Aufnahme bitte ins Mikrofon sprechen, Mr Bateman.«
Freundlich lächelnd bedeute ich dem Zeugen mit einer Geste, näher ans Mikro zu gehen. Inzwischen ist Mr Bateman auf der Hut vor mir. Er antwortet.
»Ja, das ist richtig.«
»Dann lautet Ihre Antwort also Ja, Sir?«
Der Richter hat genug – der Mann ist erledigt – und weist mich darauf hin, dass ich meine Antwort bereits erhalten hätte. Das stimmt. Und sie gefällt mir. Auf die Frage des Richters, ob er eine erneute Befragung durchführen möchte, schüttelt der Staatsanwalt nur den Kopf. Er steht nicht einmal mehr auf. Er kann nichts mehr tun, um den Prozess zu retten. Der Richter entlässt den Zeugen, der beim Weg aus dem Zeugenstand versucht, Augenkontakt mit dem Staatsanwalt aufzubauen. Was ist da gerade passiert?
Für mich ist das Ganze hier nicht emotional, es ist nur das Spiel des Gesetzes. Ich erhebe mich erneut und argumentiere, dass es keine Grundlage für eine Verfahrenseröffnung gebe. Wieder versteht Tony nicht, was passiert, spürt aber, dass es etwas Gutes ist. In neutralem Ton wende ich mich an den Richter.
»Ich beantrage die Einstellung des Verfahrens, Herr Vorsitzender.«
Der Richter reagiert schnell und weist die Klage ab. Er erklärt Tony, der Sachverhalt könne nicht nachgewiesen werden, Tony darf gehen. Tony schüttelt den Kopf, strahlt, verlässt den Zeugenstand jedoch erst, als ich ihm ein Zeichen gebe. Während ich meine Unterlagen einpacke, drehe ich mich um und nicke seiner Mutter zu. Auch sie steht auf. Eine Regel unter Strafverteidigern besagt, einen Sieg nicht zur Schau zu stellen. Der Sieger kann am nächsten Tag schon der Verlierer sein. Wir sprechen nicht einmal von Verlieren, zu schwer geht uns das Wort von den Lippen, wir sagen stattdessen »Zweiter werden«.
Heute ist die Verteidigung der Anklage Zweiter geworden.
Ich nicke dem Staatsanwalt anerkennend zu, versuche, ihm nicht direkt in die Augen zu sehen, verstaue meine Unterlagen in der Tasche und hänge sie mir schräg über die Schulter, knöpfe meinen Blazer auf und laufe auf die Tür des Verhandlungssaals zu. Alle, die mich haben siegen sehen, beobachten mich. Ich promeniere, stelle mir vor, wie sie applaudieren. Ein gutes Gefühl. An der Tür angelangt drehe ich mich noch einmal um und nicke dem Richter zu. Tony und seine Mutter sind jetzt rechts und links von mir, ich gebe beiden zu verstehen, ebenfalls zu nicken, und das tun sie. Dieser riesige Rowdy von einem Mann und seine Mutter sind mir hörig. Ich allein dirigiere sie durch dieses fremde System, führe sie auf den Weg nach Hause. Als wir den Saal verlassen haben, wage ich die Inszenierung ein wenig herunterzuschrauben.
»Jetzt können Sie sich die Zähne zu Hause putzen, Tony.«
Er sieht mich fragend an.
»Sie dürfen gehen. Die hatten nichts gegen Sie in der Hand. Es ist vorbei.«
Mir wird klar, dass Tony und seine Mutter, obwohl sie gehört haben, wie der Richter die Klage abgewiesen hat, noch immer nicht recht verstanden haben, wie es eigentlich ausgegangen ist. Tonys Mutter bricht in Tränen aus, packt meine Hand und führt sie an ihr Herz. Ich spüre eine plötzliche Wärme, eine eigenartige Nähe zu dieser Mutter und ihrem Sohn. All das ist zu vertraut. Ich gerate ins Wanken. Diese Mutter, ihr Junge, die Liebe zwischen ihnen. Ihre Erleichterung ist mit Händen zu greifen. Ich frage mich, wie viele schlaflose Nächte sie hinter sich hat, vor lauter Sorge, was heute passieren würde, frage mich, wie sie es aushält. Tony wird nicht das letzte Mal vor Gericht stehen, davon bin ich überzeugt, aber heute kann sie ihr Kind mit nach Hause nehmen. Tonys Mutter lässt meine Hand nicht los, ich lege die andere auf ihre und löse sanft ihren Griff.
»Entschuldigen Sie, ich muss weiter, ein anderes Verfahren vorbereiten.«
Immer schön professionell bleiben. Dann noch ein Blick zu Tony.
»Und was Sie angeht … Sie will ich hier nie wieder sehen.« Das sage ich zu einem erwachsenen Mann, der mich weit überragt. Zu Tony in seinem schlecht gebügelten Hemd, jetzt mit Schweißflecken unter beiden Armen. Er nickt heftig. Nie wieder wird er hier stehen, da ist er sich ganz sicher. Ich weniger. Aber hier und jetzt packt er meine Hand und schüttelt sie. Dieser riesige Rowdy von einem Mann ist voller Respekt für mich. Hier und jetzt bin ich mächtig.
2VORHER
Draußen vor dem Gericht schalte ich mein iPhone an und suche zur Nachbesprechung die Nummer von Alice raus. Alice und ich sind so verschieden, aber dass unsere Büros in der Kanzlei Tür an Tür liegen, sorgt für eine gewisse Intimität. Wir sind Zeuginnen aller Lebensereignisse der jeweils anderen, nehmen genauestens Notiz von Verhandlungsterminen, Prozessen und auch der einen oder anderen Affäre. Von dem Adrenalinrausch nach einem gewonnenen Fall kommt man erst runter, wenn man mit jemandem gesprochen hat, mit einem Zuhörer, der das Spiel kennt. In letzter Zeit ist das etwas heikel, denn bei Alice läuft es nicht so gut.
Ich zögere, bevor ich ihre Nummer wähle.
Es wäre seltsam, mich nicht zu melden, ich weiß, dass sie damit rechnet. Das Freizeichen ertönt und jemand hebt ab, aber die Stimme am anderen Ende ist nicht die von Alice. Es dauert einen Moment, bis mir klar wird, dass Julian dran ist.
»Alice ist gerade auf der Toilette«, sagt er. »Sie hat ihr Handy am Kopierer liegen lassen. Wie ist es gelaufen?«
Ich lächle. »Ich habe gewonnen.«
Ich frage mich, ob ich wohl arrogant klinge. Das ist nicht meine Absicht. Ich muss erst noch verarbeiten, dass ich das Nachgespräch jetzt mit Jules führe. Normalerweise spielt er ein wenig außerhalb meiner Liga, er ist eine Art Held unter den Strafverteidigern, bewegt sich am Gericht wie ein Fisch im Wasser. Ganz in der Nähe hält ein Taxi. Ich springe hinein und lache in den Hörer, als Julian mit leiser Ironie sagt: »Erzähl mir was Neues …«
Ich bitte den Fahrer, mich zum Bahnhof St Pancras zu fahren.
Jules fragt nach Einzelheiten. »Hat deiner ausgesagt?«
»War gar nicht nötig. Ich habe Verfahrenseinstellung beantragt. Den Hauptzeugen hat es komplett zerlegt.«
Er lacht, und er klingt beeindruckt. Ich packe die Perücke in meine Tupperdose, verstaue die Robe im Beutel. Es ist schön, die Neuigkeiten mit jemandem zu teilen, der gerade auch eine Siegessträhne hat. Julian ist ein besserer Verteidiger als Alice, dynamischer. Er kommentiert die Einzelheiten meines Kreuzverhörs. Ich erzähle ihm, der Zeuge habe offenbar geglaubt, er habe es mit einer hirnlosen Idiotin zu tun.
»Großer Fehler. Geschieht ihm ganz recht, er hat eine der Besten unterschätzt.«
Ein Gefühl von Wärme durchzuckt mich. Ich springe aus dem Taxi, aber der Fahrer pfeift mich zurück. »Umsonst kannst du nicht fahren, Schätzchen!«
Ich habe vergessen, zu zahlen, habe vergessen, dass ich nicht im Uber unterwegs war. Peinlich berührt ziehe ich einen Zwanziger aus der Tasche.
»Entschuldigung, hier, der Rest ist für Sie.«
Ich halte kurz inne und füge hinzu: »Mein Onkel zu Hause fährt auch Taxi.«
Der Fahrer lächelt mir zu und winkt. Als ich mich wieder dem Telefonat mit Jules zuwende, fühle ich mich kurz ein bisschen entblößt, aber dann bin ich auch schon wieder ganz in das Gespräch vertieft. Ich habe noch nie mit Julian telefoniert, und ich glaube, wir haben auch noch nie miteinander geredet, ohne dass noch jemand anderes aus der Kanzlei dabei war. Tatsächlich ist Julian niemand, mit dem ich normalerweise Zeit verbringen würde. Und ganz sicher würde ich ihn nicht anrufen und ihm von einem gewonnenen Fall erzählen. Ich bin wie im Rausch, beeile mich, vom Gericht direkt zum Zug zu kommen, um zu meiner Mutter zu fahren.
»Kannst du Alice bitte ausrichten, dass das Memo für den Fall, den sie mir morgen abnimmt, auf meinem Schreibtisch liegt?«
»Sag ich ihr.«
Julian erzählt, er habe den ganzen Tag nur Wirtschaftssachen gehabt, sterbenslangweilig, er wünschte, er könnte mal wieder wie ich in einer richtigen Strafsache vor Gericht stehen. Ich muss die Ticket-App auf meinem Handy öffnen, bevor ich in den Zug steige, und der Lärm übertönt Julians letzte Worte, aber nachdem ich aufgelegt habe, kreisen meine Gedanken noch eine ganze Weile um ihn. Julian ist in diese Welt hineingeboren, er meistert das alles spielend. Sein Vater ist Kronanwalt, sein Pate ebenfalls. Weiter kann man es als Barrister nicht bringen.
Ich werfe den Beutel mit der Robe auf die Gepäckablage und lasse mich auf einen Fensterplatz fallen, meine Umhängetasche zu meinen Füßen. Auf zu Mum. Ich wage zu glauben, dass ich mir langsam aber sicher einen Namen mache. Wenn Julian, einer der gebildetsten, souveränsten Männer am Gericht, mir ein fachliches Kompliment macht, ist das doch wohl ein gutes Zeichen. Ich lächle innerlich, während der Zug den Bahnsteig verlässt.
Ich nehme das Haargummi heraus, schlüpfe aus meinem Blazer und lehne den Kopf ans Fenster.
Der Zug lässt London hinter sich und schlängelt sich durch die vertraute ländliche Gegend. Ich spüre, wie der Glanz meines juristischen Lebens langsam in den Sitz des Abteils sickert. Ein Getränkewagen kommt vorbei, ich nippe milchig weißen Tee und überlege, warum meine Mutter will, dass ich zum Essen komme. Sie ruft nur selten an, meistens hinterlasse ich ihr Nachrichten. Bei der Arbeit kann sie nicht rangehen, die Putzfirma, bei der sie beschäftigt ist, späht ihre Angestellten entweder den ganzen Tag mit einer versteckten Kamera aus, oder sie haben dort einen siebten Sinn dafür, wer im Dienst telefoniert hat. Mum hat panische Angst, ihren Job zu verlieren. Wenn ich wirklich mit ihr reden muss, muss ich noch mal anrufen, sobald der Anrufbeantworter angesprungen ist, beim zweiten Mal hebt sie dann ab. Ich mache das ständig, und es treibt sie in den Wahnsinn. Es ist nur für Notfälle gedacht, aber ich kann nie sicher sein, ob sie gerade bei der Arbeit oder im Supermarkt ist, oder aber zu Hause und meinen ersten Anruf einfach nur verpasst hat. Ich stecke mir meine AirPods in die Ohren, höre ein bisschen Musik und sehe zu, wie die Welt draußen vor dem Fenster vorbeirast.
Als der Zug in Luton einfährt, ist es, als wäre ich wieder die Person von damals, hier gibt es kein Als-ob. Alles ist zu vertraut, alles und jeder. Ich trete aus dem Bahnhof, überlege, mir eine Sausage Roll zu kaufen, verkneife es mir aber. Als ich die High Street entlanglaufe, starrt mich ein kleiner Hund an einer Leine an. Ich starre zurück und lächle, bevor ich mich in Richtung der Wohnanlage durchschlängle, in der ich aufgewachsen bin.
Als Mums Häuserblock in Sicht kommt, mache ich noch einen kurzen Abstecher ich den Laden an der Ecke, wo mir ein vertrauter Duft nach Putzmitteln mit Vanillearoma entgegenschlägt. Hinterm Tresen steht Sharn. Er ist jetzt viel älter, ist schon ewig hier. Ich greife nach einer Flasche Fanta, Mums Lieblingsgetränk, und gehe zur Kasse.
»Abend, Sharn, wie geht’s?«
»Na so was, hallo. Lange nicht mehr gesehen! Ist das wirklich die kleine Tessa Ensler?«
Ich lache.
»Wie schön, dich zu sehen. Ich erzähle den ganzen jungen Leuten, die hier reinkommen, immer, wisst ihr, ein Mädchen aus der Straße hat es nach Cambridge geschafft, und jetzt ist sie Anwältin in London.«
Ich weiß, dass er es nett meint, aber es ist mir unangenehm. Er erinnert sich an noch viel mehr. Er erinnert sich daran, als ich als kleines Mädchen mit aufgeschlagenen Knien hierhergekommen bin, oder mit meinem Bruder Johnny, und wenn ich Glück hatte, mit einer Pfundmünze.
Er erinnert sich an meinen Vater.
Wir unterhalten uns über den neuen Tesco Metro an der Ecke und den Schaden, den er Sharns Geschäften zufügt. Ich nicke mitfühlend, obwohl ich weiß, dass selbst meine Mum, so gerne sie Sharn auch hat, jetzt dort einkauft. Es ist einfach billiger. Vor lauter Schuldgefühlen kaufe ich teure Schokolade. Sharn muss auf eine Leiter steigen, um sie herunterzuholen, und ich frage mich, ob sie wohl schon abgelaufen ist. Er redet immer noch von Cambridge.
»Ich erzähl ihnen alles. Wie du weggegangen bis, um dort Jura zu studieren. Und dass sie das auch schaffen können, wenn sie es nur wollen.«
Ich nicke, aber ich fühle mich unwohl. Ich verdiene inzwischen viel mehr als Sharn. Sharn, der rund um die Uhr arbeitet, mit Kindern, Frau und Mutter in der Wohnung hinter dem Laden lebt. Alle arbeiten sie hier, seine Kinder haben früh angefangen, und obwohl wir dieselbe öffentliche Schule besucht haben, sind wir uns immer aus dem Weg gegangen, weil wir wussten, dass uns eine gewisse Intimität durch den Laden irgendwie zum Verhängnis werden könnte. Ich denke daran, wie traurig das ist. Sie hatten Geldsorgen, na und? Die hatte meine Mutter auch, bevor Dad weggegangen ist, und danach sowieso. Es war zu schwer, mit all dem umzugehen, so viel leichter, die Verbindung einfach zu kappen.
Ich bezahle Fanta und Schokolade, erkundige mich nach Sharns Mutter, die, wie mir kurz darauf wieder einfällt, schon gestorben ist. Ich sage ihm, wie nett sie gewesen sei, denn das war sie wirklich, obwohl ich mich an kein einziges Gespräch mit ihr erinnern kann. Sharns Mutter sprach kein Englisch, aber manchmal sah sie dich an, als verstünde sie deine Traurigkeit in all ihrer Komplexität und Intimität. Beim Gedanken daran, was sie über meine Eltern gewusst haben muss, läuft mir ein Schauer den Rücken hinunter.
4VORHER
Bei Mum angekommen klopfe ich nicht, sondern benutze einfach gleich meinen Schlüssel. Als ich die Wohnung betrete, weiß ich sofort, dass sie gestaubsaugt hat, weil dieser Geruch in der Luft hängt, den unser Staubsauger schon immer hinterlässt. Ich habe mich oft gefragt, wie sie, die den ganzen Tag Büros putzt, es noch erträgt, zu Hause Staub zu saugen. Ich rufe nach ihr.
»Mum?«
Ich gehe in die Küche, wo es aus der Glotze plärrt, irgendetwas über einen, der zu viel Sozialhilfe bezogen hat. Ich hasse den Scheiß, den Mum sich reinzieht, das arme Schwein mit den zu hohen Bezügen wird vor laufender Kamera gedemütigt und beschimpft. Mum steht an der Spüle und schrubbt Gemüse. Ich schalte den Fernseher aus, sie fährt zu mir herum. Immer noch reagiert sie auf Überraschungen im ersten Moment mit Angst.
»Hi, Mum.«
Ich schmeiße Fanta und Schokolade auf den Tisch. Sie lächelt mich an. Müde, erschöpft.
»Ich war früher fertig am Gericht, also dachte ich, ich komme und helfe dir beim Kochen.«
Sie schaut die Fanta an, kneift die Augen zusammen.
»Die ist nicht zuckerfrei, Schatz.«
Verkackt.
»Ist Johnny auch da?«
Sie ignoriert meine Frage und zeigt auf das Gemüse.
»Ich habe die Kartoffeln gekauft, die du so magst.«
Sie reicht mir ein Messer, und ich fange noch im Hosenanzug an zu schnibbeln.
»Wie war dein Tag, Schatz?«
Ich wäge ab, ob ich es ihr erzählen soll. Warum nicht?
»Ich habe einen Fall gewonnen.«
Ihre Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen.
»Ah, also wieder ein Verbrecher zurück auf der Straße, was?«
Was soll ich darauf antworten? Ich schnibble einfach weiter. Schweigen, während das Messer durch Kartoffeln und Karotten gleitet und mit dumpfem schnellem Klacken das Schneidebrett trifft. Mum tupft das Fleisch mit einem Küchentuch ab, legt es aufs Blech. Der Ofen heizt schon vor. Ich wechsle das Thema.
»Dann ist Johnny nicht zu Hause?«
Sie wäscht sich die Hände unter dem Wasserhahn und trocknet sie mit einem Geschirrtuch ab.
»Ich hab was für dich.«
Mum verlässt die Küche. Ich bin verdutzt. Was kann sie denn für mich haben? Sie kommt mit einer Plastiktüte zurück, bleibt vor mir stehen, was ich als Aufforderung verstehe, mir ebenfalls die Hände zu waschen. Dann reicht sie mir zaghaft die Tüte. Verwirrt greife ich danach. Sie kauft mir nie ohne Anlass irgendetwas. Kurz denke ich an ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, aber mein Geburtstag ist schon ewig her.
»Was ist es denn?«
Mum macht einen Schritt zurück, nimmt ihr Feuerzeug vom Fensterbrett und steckt sich eine Zigarette an. Lehnt sich näher ans offene Fenster. Sie ist nervös.
»Hab ich im Ausverkauf entdeckt.«
Ich ziehe eine Bluse aus der Tüte. Sie ist knallpink und aus hundert Prozent Polyester. Ich bin noch mit Verarbeiten beschäftigt, als sie sagt: »Ich dachte mir, das sieht doch aus wie etwas, das eine Anwältin anziehen würde.«
Ihr Stimme wird zum Ende hin leiser, ängstlich. Das ist nichts, was eine Anwältin tragen würde, und ganz sicher nichts, was ich tragen würde. Vor lauter Angst, diese Tatsache preiszugeben, stecke ich all meine Energie in meine gespielte Begeisterung.
»Oh wow, Mum, vielen, vielen Dank!«
Sie ist immer noch unsicher, aber ich wittere auch etwas anderes – Erleichterung, leise Freude.
»Gefällt sie dir?«
Ich halte mir die Bluse an.
»Mum! Die ist toll!«
Ihr Gesicht, die Freude, die ihr das bereitet, treiben mir die Tränen in die Augen. Plötzlich liebe ich diese scheußliche Bluse. Ich ziehe meine eigene Bluse aus und die pinke an, stecke sie in die Anzughose. Das geht einen Schritt über die Reaktion hinaus, die meine Mutter sich erhofft hat, und ich spiele die Nummer perfekt. Stolziere auf und ab. Als ich an ihr vorbeilaufe, ziehe ich sie an mich. Sie kann nichts dagegen tun, erstarrt, sobald sie berührt wird, aber ihr Gesicht hellt sich für einen kurzen Moment auf, bevor es sich verfinstert. Ich bin nah genug, dass sie mir zuflüstern kann.
»Dein Bruder hat sich gestern geprügelt, im Pub.«
Ich bleibe wie angewurzelt stehen.
»Was? Schon wieder?«
Die Nähe zwischen uns ist dahin. Mum hat sich ihrer Sorge und Angst entledigt und sie mir aufgebürdet. Nur äußert sie sich bei mir als Wut. Mum drückt die Zigarette aus, schlüpft aus ihrer Strickjacke. Auf der linken Brust ihrer Uniform prangt ihr Name. June. Sie wäscht sich erneut die Hände und schneidet weiter Gemüse.
»Mum, der endet noch im Knast.«
Sie werkelt eifrig herum. Ich werde nie verstehen, warum sie mir so etwas erzählt, wenn sie doch eigentlich hofft, dass ich nicht darauf reagiere. Das provoziert mich nur noch mehr.
»Was zum Teufel stimmt denn nicht mit ihm? Er sollte einfach mal arbeiten und für sich selbst aufkommen.«
Ich greife nach meinem Messer und lasse die Wut an den Karotten aus. Mum hält das nicht gut aus, aber ich kann nicht anders.
»Was für ein Loser.«
Ich weiß nicht, ob es reiner Instinkt ist oder ein leises Geräusch mich aufhorchen lässt, aber als ich mich umdrehe, steht Johnny in der Tür. Er trägt eine alte Jogginghose und ein T-Shirt. Auf seiner Stirn klebt verschmiertes, getrocknetes Blut, er sieht müde aus. Ich zucke zusammen; niemand will sich mit Johnny anlegen, wenn er in diesem Zustand ist.
Er brüllt mich an. »Sagt wer?«
Ich stehe einfach da. Er kommt auf mich zu, atmet seine Worte auf mich hinunter. Ich bleibe trotzig stehen.
»Sagt die noble Frau Anwältin in ihrer noblen, pinken Bluse.«
Am liebsten würde ich lachen, von wegen noble pinke Bluse, verdammte Scheiße … Das kann ich vor Mum nicht bringen, aber zurückhalten kann ich mich auch nicht.
»Immerhin habe ich einen Job.«
Das macht ihn sauer. Mum schreit.
»Aufhören! Hört beide auf!«
Sie ist sichtlich verängstigt, und Johnny und ich wissen beide, woran das liegt. Das macht mich nur noch wütender auf ihn. Seine Fahne riecht schal und unangenehm, aber ich zucke mit keiner Wimper. Ich weiß, dass er einen Kater von gestern Nacht hat. Ich speie es ihm entgegen.
»Du bist ja immer noch besoffen.«
Mir wird klar, dass Mum mir nur von der Schlägerei erzählt hat, weil ich sein Gesicht sowieso sehen würde. Sie dachte wohl, wenn sie es mir schonend beibringt, würde meine Reaktion gemäßigter ausfallen. Ich habe nie Angst vor Johnny, auch nicht jetzt, wo es vielleicht angebracht wäre. Ich schreie ihm direkt ins Gesicht.
»Was? Willst du mich jetzt schlagen? Ist das jetzt deine Art der Kommunikation?«
Mum stößt einen Schrei aus.
»Schluss damit, alle beide!«
Johnny ist sichtlich schockiert von meinen Worten.
»Ich würde nie eine Frau schlagen.«
Meine Antwort fällt so heftig, schnell und grausam aus, dass ich über mich selbst erschrecke.
»Wieso? Sonst kommst du doch auch ganz nach ihm.«
Johnny sagt, ich solle mich verpissen. Mum ruft mich zur Ordnung. »Es reicht, Tessa.«
Wir wissen alle, dass ich zu weit gegangen bin. Unter Johnnys Zorn entdecke ich Verwirrung und Schmerz. Was ist nur aus uns geworden? Er war doch mein bester Freund. Meine ganze Kindheit über bin ich ihm überallhin gefolgt. Ich saß neben ihm, wenn er jeden Samstag die Zuschauerreihen der Fußball-Live-Übertragung im Fernsehen abgesucht hat, in der Hoffnung, einen ganz bestimmten Everton-Fan zu erspähen. Wir wussten beide, wen er sucht. Ich brachte es nicht übers Herz, ihm zu sagen, dass ich unseren Dad, selbst wenn ich ihn im Fernseher sähe, nicht mehr erkennen würde. Ich spüre einen Anflug von Sehnsucht, aber wir feuern mit Blicken aufeinander, und ich weiche nicht zurück.
»Wann bist du eigentlich so ein Miststück geworden?«
Das versetzt mir einen Stich. Ich spüre, dass Johnny nicht weiß, was er als Nächstes mit seinen Gefühlen anfangen soll; er macht einen Satz zur Anrichte und fegt alles zu Boden. Ein Teller zerschellt, Mum fängt an zu weinen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als meine Sachen zusammenzusammeln.
»Ich … ich geh dann mal lieber.«
Als ich mich auf dem Weg aus der Küche noch einmal umdrehe, lehnt Johnny mit geschlossenen Augen an der Wand. Mum sammelt kleine Stücke von Kartoffeln, Karotten und Brokkoli zusammen.
»Mum? Es tut mir leid.«
Sie schüttelt den Kopf. Ich will alles wiedergutmachen, aber das geht nicht. Das Letzte, was ich sehe, ist meine Mum, wie sie auf allen vieren auf dem Küchenboden herumkriecht. An der Wohnungstür ziehe ich zwei Fünfziger hervor und stecke sie Mum in die Handtasche. Dann gehe ich und ziehe die Tür hinter mir zu.