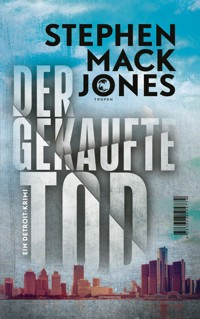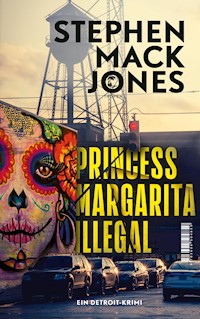
13,99 €
Mehr erfahren.
Eine Leiche treibt im Detroit River. In einem Prinzessinnenkleid. Zur gleichen Zeit schickt die Einwanderungsbehörde Sondereinheiten nach Mexicantown, um Illegale zu deportieren. August Snow, einer gut gekühlten Margarita nie abgeneigt, kocht vor Wut. Höchste Zeit, dass jemand wieder für Gerechtigkeit eintritt ... Die Dinge stehen nicht zum Besten in Mexicantown. Die US-Einwanderungsbehörde macht willkürlich Razzien, die Einwohner leben in Angst. Als eine Leiche aus dem Detroit River gezogen wird, schaltet der Gerichtsmediziner Bobby Falconi seinen alten Freund August Snow ein. Denn die als Prinzessin verkleidete Tote war Opfer sexueller Gewalt und illegal im Land. Offenbar hatte die Einwanderungsbehörde sie aufgegriffen, doch wie ist sie dann im Fluss gelandet? Eine Spur der Korruption tut sich auf, die von der Behörde in die höchsten Kreise der Gesellschaft und zu einem internationalen Menschenhändlerring führt. Zeit für August Snow, die Samthandschuhe abzulegen und für ein bisschen gute alttestamentarische Gerechtigkeit zu sorgen. »Ein Krimi mit einem Blick für soziale Fragen und einem sicheren Gespür für das Genre. Erfrischend anders.« Washington Post
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Stephen Mack Jones
Princess Margarita Illegal
Ein Detroit-Krimi
Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Tropen
Das Zitat auf S. 277 entstammt Octavio Paz’ Das Labyrinth der Einsamkeit, übersetzt von Carl Heupel, Suhrkamp Verlag, 1998, S. 32.
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Lives Laid Away« im Verlag Soho Press, New York
© 2019 by Stephen Mack Jones
Für die deutsche Ausgabe
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net unter Verwendung von zwei Fotos (Straßenszene Detroit: © arcangel/Bjanka Kadic; Graffity: Private Collection © Bam-Bam Billa/Bridgeman Images)
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-50485-9
E-Book ISBN 978-3-608-11863-6
Für die wahren Helden.James und Evelyn L. Jones …… meinen Bruder JR Jones II …… meinen Sohn Jacob, aus dem allmählich der Mann wird,der ich immer sein wollte …Und für euch, die Dreamer …
Ich denke oft: Schatzhäuser müssen sein,wo alle diese vielen Leben liegenwie Panzer oder Sänften oder Wiegen,in welche nie ein Wirklicher gestiegen,und wie Gewänder, welche ganz alleinnicht stehen können und sich sinkend schmiegenan starke Wände aus gewölbtem Stein.
Rainer Maria Rilke,Ich bin nur einer deiner Ganzgeringen
1
Ihre geheime Zutat war Muskatnuss.
Nicht viel – höchstens einen halben Teelöffel –, aber sie bekam damit die gleiche subtile Wirkung hin, wie sie ihr mit geräuchertem ostindischem Paprika oder echtem mexikanischem Chilipulver gelungen wäre.
Ich stand in meiner Küche und rührte langsam einen halben Teelöffel Muskat in meine selbst gemachte Salsa – pürierte Tomaten vom Honeycomb Market, blanchierte und zerkleinerte Tomaten, gehackte Jalapeños, klein geschnittene Paprika, frischer Dill, der Saft einer viertel Zitrone, Knoblauch, Meersalz und grob gemahlener Pfeffer. Außerdem gab ich eine Messerspitze gehackten Koriander hinzu.
Während ich schnippelte, pürierte und Zutaten vermengte, hörte ich in voller Lautstärke eine alte CD meines Vaters: »The Healer«, den Klassiker von John Lee Hooker und Santana. Genau die richtige Begleitmusik für einen verwegen gut aussehenden Schwarzmexikaner, während er einen dürftigen Abklatsch der Salsa seiner Mutter zubereitete. Durch das wirkmächtige Aroma der Salsa und die Musik spürte ich, wie meine Hüften, meine Füße sich im Rhythmus eines langsamen Rumba-Bolero bewegten.
Und jawohl, cabrón.
Ich tanze einen spitzenmäßigen Rumba-Bolero, dank der geduldigen Lektionen meiner Mutter und der jahrzehntelangen Übung, die ich auf einem Dutzend mexikanischer Hochzeiten, einem salvadorianisch-kolumbianischen Hochzeitsjubiläum und vier Quinceañeras erlangt habe.
Im Camp Leatherneck und in der vorgeschobenen Operationsbasis Delhi Beirut in Afghanistan hatte ich frisch verlobten Kameraden, deren Liebsten zu Hause ungeduldig warteten, sogar Salsa- und Rumba-Unterricht gegeben. Nur zu. Fragen Sie Marine Corporal Francis »Franco« Montoya (Seattle, Washington) oder Ex-Marine Sergeant Dwayne »Wee Man« Nixon (Memphis, Tennessee). Marine-Killermaschinen, die ungeniert zugeben werden, dass ich der einzige Mann bin, mit dem sie je richtig gern getanzt haben.
Es war eine Woche her, seit ich Tatina Stadtmüller, meine Fernbeziehung, falls es denn eine war, zum Metro Airport gebracht hatte, weil sie zurück nach Oslo musste, um das letzte Jahr ihres Promotionsstudiums in Kulturanthropologie zu absolvieren. Ich war noch ganz beschwingt von ihrem Besuch. Wie Paulus geblendet, wenn auch nicht von einem hellen Licht, so doch von Rechtschaffenheit und Schönheit.
Noch immer schwebte ihr warmer Duft nach Schokolade und Pfeffer durch mein Haus.
Während Tatina bei mir in Detroit war, hatte ich nicht gewollt, dass sie den schwarzen Chevy Suburban mit dunkel getönten Scheiben bemerkte, der in aller Herrgottsfrühe im Schneckentempo die Markham Street hinunterfuhr. Doch bei zwei nächtlichen Besuchen im Bad war ihr der SUV zufällig aufgefallen.
»Wer ist das?«, fragte sie eines Morgens beim Frühstück.
»Wahrscheinlich jemand, der von der Spätschicht nach Hause kommt.«
Natürlich wusste ich es besser.
Ich wohne in Mexicantown. Der schwarze Chevy Suburban mit den getönten Scheiben war vom ICE – United States Immigration and Customs Enforcement –, der in den nächtlichen Stunden die Straßen nach möglichen »Nestern« und Unterschlüpfen von illegalen Einwanderern absuchte. Ihr offizielles Motto? »Schutz der nationalen Sicherheit und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.«
In Mexicantown haben wir für den ICE ein anderes Motto: Si es marrón, enciérrelo.
»Siehst du nach Latino aus, ist’s mit deiner Freiheit aus.«
2
Mein Gott«, sagte Jimmy Radmon, als er durch die Haustür hereinkam. »Sag, dass ich nicht richtig sehe.«
Ich war dabei, meine inzwischen fertige Salsa mit einem Schöpflöffel in sechs sterilisierte Halbliter-Einmachgläser zu füllen. Celia Cruz hatte gerade ihre sexy Version von »Oye Como Va« beendet. Und jetzt tanzte ich einen Rumba-Bolero auf James Browns »Hot Pants Pt. 1«.
»Du musst Rumba lernen, Jimmy«, sagte ich.
»Wozu muss ich das alberne Gehampel lernen?«, sagte Jimmy, ging um mich herum zum Kühlschrank und nahm eine eisgekühlte Flasche Wasser heraus. Ich hatte immer ein paar Flaschen Wasser nur für Jimmy und Carlos im Kühlschrank. Irgendwie wurden sie nie damit fertig, an meinem Haus kleine Änderungen, Verbesserungen und Ergänzungen vorzunehmen. Mich störte das nicht sonderlich, weil die meisten unsichtbar für mich waren. Eine ihrer letzten Verbesserungen hatte aus meinem Haus quasi einen WLAN-Hotspot für die anderen Häuser auf der Markham Street gemacht. Keine schlechte Sache, da die meisten Wohnviertel in Detroit Internet-Wüsten waren.
Ich fand im Kühlschrank Platz für vier der sechs Einmachgläser Salsa und gab Jimmy zwei. Eins für ihn, eins für seine lieben Vermieterinnen, meine älteren Nachbarinnen Sylvia und Carmela.
»Sie sollten das Zeug verkaufen«, sagte Jimmy, der die Gläser inspizierte. »Octavios original D-City-Salsa. Die ist gut. Besser als gekaufte.«
»Ich denk drüber nach«, sagte ich, obwohl ich wusste, dass ich nicht drüber nachdenken würde.
Zufrieden mit dem Erfolg meiner kulinarischen Mission, nahm ich mir ein Bier – ein Batch Brewing Vienna Lager – und zog mich ins Wohnzimmer zurück. Jimmy folgte mir und langweilte mich beharrlich mit Berichten über den Stand der Renovierung, mit Material- und Ausrüstungswünschen und Zuliefererangeboten. Wir hatten gerade zwei Häuser verkauft – ein freistehendes Backsteinhaus mit drei Schlafzimmern an ein junges Paar, das mit seiner dreijährigen Tochter aus Portland hergezogen war, und eine Doppelhaushälfte mit zwei Schlafzimmern an den Mitarbeiter irgendeiner Wohltätigkeitsorganisation, der seine Haare konsequent in einem Man Bun trug und auf seiner Veranda Yoga machte.
Dann waren da die unvermeidlichen Anfragen von Lokalzeitungen und -zeitschriften.
»Diese Renna Jacobs von der Free Press, Mann, die ruft mich dauernd an«, sagte Jimmy. »Will mit Ihnen darüber reden, dass Sie das Viertel wiederbeleben.«
»Du hast ihr hoffentlich nicht meine Nummer gegeben, oder?«, sagte ich.
»Nein, ich weiß doch, dass Sie mich dann fertigmachen würden.«
»Ganz genau«, sagte ich. »Wahrscheinlich würde ich dich zur Strafe zwingen, auf Chips und Gatorade zu verzichten, und dich mit gesundem Essen zwangsernähren.«
»Mal im Ernst«, sagte Jimmy mit Nachdruck. »Ein bisschen Presse wäre echt gut für das Viertel. Und auch für mich und Carlos. Ich meine, wir müssen dran denken, wie es nach der Markham Street weitergeht, Mr Snow. Wir haben bloß noch ein Haus, das renoviert und verkauft werden muss – was dann?«
Damit hatte Jimmy eine Frage gestellt, die ich seit drei Monaten verdrängte. Es war nie meine Absicht gewesen, die Hausrenovierungen im südwestlichen Detroiter Stadtteil Mexicantown zum Sinn meines Lebens zu machen. Ich wollte bloß mein Viertel – meine Straße – zurück. Vielleicht als Hommage an meine geliebten Eltern. Vielleicht aus Respekt vor einer längst vergangenen Lebensart, die in diesem Moment meinem Gefühl nach nicht mehr Gewicht hatte als Geister, die weit weg von ihren Gräbern herumschweben.
Nach meiner Entlassung aus dem Detroit Police Department und dem anschließenden Prozess, der mir zwölf Millionen Dollar Abfindung einbrachte, hatte ich nichts anderes gewollt, als mich mit meinem angeknacksten Selbst an einen sicheren Ort zurückzuziehen. Das war der einzige Grund, warum ich mein Elternhaus auf der Markham Street überhaupt renoviert hatte – und anschließend die Nachbarhäuser in Richtung Vernor Avenue, der Einkaufsstraße von Mexicantown.
Markham Street – und August Octavio Snow – 2.0.
Jetzt hatte ich zwei gute Männer, für deren Lebensgrundlage ich verantwortlich war.
Und ich hatte keine Antworten für sie.
»Ich denk drüber nach«, sagte ich.
Jimmy warf mir einen Seitenblick zu, der signalisierte, dass er das nicht zum ersten Mal hörte. »Klar, na ja, jedenfalls«, sagte Jimmy, riss ein kleines Stück Papier aus seinem Arbeitsnotizbuch und reichte es mir, »hier ist die Nummer von der Reporterin. ›Die Wiedergeburt eines Stadtteils‹«, beharrte Jimmy. »So nennt die Zeitungsfrau das, was Sie hier im Viertel gemacht haben. Und ich meine, wenn Sie mal mit der reden, würd das vielleicht auch Ihren Ruf in der Stadt ein bisschen aufpolieren, oder?«
Ich fürchtete, dass Jimmy eine Grenze überschritten hatte und auf mein persönliches Minenfeld geraten war.
Aber so war Jimmy nun mal. Ein junger Bursche, der von Natur aus arglos – vielleicht sogar naiv – war und nicht einen bösartigen Knochen in seinem spindeldürren Leib hatte.
»Was für ein Ruf soll das sein, Jimmy?«
»Ex-Cop hat zwölf Millionen vom bankrotten Detroit kassiert und investiert wieder ins bankrotte Detroit«, sagte Jimmy. »Könnte Sie glatt zum Lokalhelden machen. Wär doch nicht schlecht, Mr Snow.«
»Wie gesagt, Jimmy –«
»Ja, ja, ich weiß«, sagte Jimmy. »›Ich denk drüber nach.‹«
3
Wer in meine Straße zieht, muss feiern können.
So sind die Regeln, da gibt’s kein Vertun.
Die Markham Street hatte innerhalb von zwei Monaten drei Neuzugänge bekommen. Da waren die Bergman-Hallseys: Alan und Michael, ein junges Paar aus Portland, Oregon, mit ihrer drei Jahre alten Tochter Kasey. Außerdem Mara Windmere, Marketingmanagerin irgendeines führenden Tech-Unternehmens, die dem urbanen Leben einen amüsanten Hipster-Touch geben wollte. Und Trent T. R. Ogilvy, der Man Bun tragende Brite, der aus Rochester, New York, hergezogen war (wohin er aus Manchester, England, gezogen war). Ogilvy arbeitete für eine in London ansässige internationale Wohltätigkeitsorganisation, deren Ziel es war, Laptops und WLAN in Internet-Wüsten zu bringen. In Detroit gibt es zweifellos reichlich Stadtteile, die diese Bezeichnung verdienen. Zu viele Arbeitslose, die für ihre Jobsuche die Stellenanzeigen in zwei sterbenden Tageszeitungen durchforsten müssen.
»Ich trinke gern ein Glas oder auch fünf«, sagte Trent, als ich bei ihm zu Hause vorbeischaute, um ihn einzuladen. »Ich hoffe, das ist unbedenklich.«
»Nicht nur unbedenklich«, erwiderte ich. »Es wird erwartet.«
Ich fuhr zum Honeycomb Market, um für die Sommerparty der Markham Street in einem Monat eine Bestellung aufzugeben. Wer in Mexicantown wohnt, stattet dem Honeycomb, einer Stadtteil-Institution, mindestens einmal die Woche einen Besuch ab: Pyramiden aus Jalapeños in kräftigen Farben, Mangos, Tomatillos und saftigen Kaktusblättern; Regale voll mit Gewürzen, importierten abgepackten Lebensmitteln aus Lateinamerika; bunte Kaffeedosen und Limoflaschen aus Mexiko und Nicaragua; frische hausgemachte Tortillas und Chorizos und solche Mengen an Mi-Costeñita-Süßigkeiten und Pingüinos-Cupcakes, dass jedem Kind die Augen übergehen.
Ich kam schon als kleiner Junge an der Hand meiner Mutter zum Honeycomb. Das waren die Leute, die meinen Vater, einen Bierbanausen mit einer Vorliebe für die Marke Falstaff, in einen Liebhaber von Negra Modelo und Pacifico verwandelten, der sich zu Weihnachten gelegentlich das für einen Cop notgedrungen heimliche Vergnügen einer geschmuggelten Flasche Noche Buena gönnte.
Er war jedoch nie ein großer Michelada-Freund.
»Wer zum Teufel kommt auf die Idee, Chilisauce und Limettensaft in ein verdammtes Bier zu mischen?«, sagte er, wie ich mich noch gut erinnern kann.
Meine Mutter schüttelte den Kopf, hob drohend einen Zeigefinger und sagte: »Meine Landsleute mischen Chilisauce und Limettensaft in alles! Hast du damit ein Problem, cabeza de burro?«
Für die Straßenparty in diesem Sommer rechnete ich mit mindestens zweihundert Hähnchen- und Schweinefleisch-Tortillas, dreißig Pfund Reis, zwanzig Pfund Bohnenmus und schwarze Bohnen, etwa vierzig Pfund Chorizo-Hack und gewürztes Rinderhack und wer weiß wie viele Würstchen.
An der langen Fleischtheke im hinteren Teil des Supermarkts wartete ich darauf, bedient zu werden.
Und wartete.
Nach fünf Minuten tauchte Nana Corazon-Glouster auf – die Verkäuferin an der Frischfleischtheke.
»Na, wen haben wir denn da!«, sagte sie und grinste breit. »Ich würde ja hinter der Theke hervorkommen und dir einen dicken nassen Kuss geben, aber ich fürchte, dann wirst du süchtig!«
»Diese Lippen? Diese Augen?«, sagte ich. »Ja, die können süchtig machen!«
»Und ob«, sagte Nana lachend. »Was kann ich für dich tun, Augusto?«
»Also«, sagte ich und schaute mich um, »als Erstes kannst du mir Folgendes beantworten: Wo zum Teufel stecken die anderen? Ihr seid doch normalerweise drei, vier Leute hinter der Theke.«
Nana zuckte zusammen, als hätte sie einen freiliegenden Nerv an einem Backenzahn. Leiser sagte sie: »Die Leute haben Angst, Augusto. Die sehen Tag und Nacht die Scheißkerle vom ICE hier rumkurven und denken alle bloß: ›Die kommen mich holen.‹ Ich meine Leute, die seit zehn, zwanzig – fünfzig Jahren Bürger dieses Landes sind! Von unseren Mitarbeitern ist keiner illegal.« Sie senkte die Stimme noch mehr und sagte: »Okay, vielleicht ein oder zwei. Aber keine Drogen, keine Gang-Tattoos! Die kommen pünktlich und arbeiten hart. Die putzen Toiletten, als würden sie Gold polieren, und sie sagen ›Ja, Ma’am‹ und ›Nein, Ma’am‹, ›Bitte‹ und ›Danke‹. Welche Aussicht auf Staatsbürgerschaft haben diese Leute?«
Sie fragte, ob ich irgendwelche Patrouillen gesehen hatte.
Ich erzählte ihr von dem SUV, der spätnachts durch die Markham Street fuhr.
»Und die machen dir keine Angst?«, fragte Nana.
»Nein.«
»Wieso nicht?«
»Weil ich schon so einiges Beängstigendes aus nächster Nähe gesehen hab«, sagte ich. »Afghanistan. Pakistan. Mit mir haben die ein Problem: Sollen wir den nach Mexiko abschieben? Oder zurück nach Afrika schicken?«
Mein kleiner Scherz konnte ihre Sorgen nicht zerstreuen.
»Du warst doch mal Cop«, flüsterte Nana. »Kannst du da nichts machen?«
»Ich glaub, was das angeht, hängen wir alle am Fliegenfänger, Nana.«
»Was ist mit Mrs Gutierrez?«
Elena, die Frau meines Freundes Tomás, war in der ganzen Gemeinde als Streiterin für die Bewohner von Mexicantown und als Verteidigerin der Bürgerrechte im Allgemeinen geachtet. Vor fünf Jahren wollte eine Gruppe von Bürgern und Unternehmern sie als Kandidatin für den Stadtrat des 6. Bezirks aufstellen. Sie lehnte höflich mit der Begründung ab, sie müsse sich um einen Ehemann und eine Enkeltochter kümmern – und sie sei sich immer noch nicht sicher, wer von beiden die meiste Aufmerksamkeit brauche.
»Sie tut schon, was sie kann, zusammen mit ein paar Birminghamer Anwälten, die auf Einwanderung und Einbürgerung spezialisiert sind«, sagte ich. »Und sie hat Meetings mit dem Bürgermeister und Veranstaltungen in der Holy Redeemer Church organisiert. Aber dieser ICE-Sturm ist rasch aufgezogen, mit voller Wucht, Nana. Die Leute wissen noch immer nicht, was sie machen können oder ob sie überhaupt was machen können. Ich weiß es ganz sicher nicht.«
Während ich redete, sah Nana aus, als ob ihre Seele langsam zerquetscht wurde.
»Ich weiß, es wird nicht viel nützen«, sagte ich, »aber falls sie dich holen kommen, setze ich Himmel und Erde in Bewegung, um dich zurückzubringen.« Ich machte große Hundeaugen und einen Schmollmund. »Und wenn sie mich holen kommen, Nana?«
Ein verschmitztes Funkeln kehrte in ihre großen braunen Augen zurück. Sie salutierte zackig und sagte: »Sayonara, Baby!«
Ich lachte vielleicht einen Tick zu laut. »Das ist gemein!«
»Ach, du lässt dir doch gern den Hintern versohlen. Ihr Macho-Typen lasst euch alle gern den Hintern versohlen. Was kann ich denn für dich tun, Augusto?«
Ich gab ihr meine Liste und nannte ihr den spätesten Termin. Jeden Posten auf der Liste quittierte Nanas hübscher Kopf mit einem entschlossenen Nicken. »Wird erledigt, Chef.«
»Das weiß ich doch, Nana.«
Ich warf ihr ein Küsschen zu. Sie fing es aus der Luft und klatschte es sich auf die rechte Pobacke.
Wie jeder andere in Mexicantown ging ich für gewöhnlich zum Honeycomb, um zwei oder drei Sachen zu kaufen, und verließ den Laden dann mit sieben oder acht. Ich dachte, ich könnte ein paar Grundnahrungsmittel besorgen, wo ich schon mal da war. Ein paar Extratüten Tortilla-Chips und ein Pfund von der hausgemachten Guacamole haben noch keinem geschadet.
Während ich durch die schmalen Gänge schlenderte, lief ich zu meiner Verblüffung dem aufgehenden Stern des Dezernats für Kapitalverbrechen der Detroiter Polizei in die Arme: Detective Captain Leo Cowling. Er sah aus, als hätte er sich für die Segelregatta von Port Huron nach Mackinac angezogen: marineblaue Alligatorlederschuhe, cremefarbene Leinenhose, ein strahlend weißes, am Hals offenes Stehkragenhemd und ein cremefarbenes Leinenjackett. Geschmackvoll abgerundet wurde das Outfit durch einen hellbraunen Panamahut mit breitem marineblauem Seidenband. Die Art von teurem Hut, wie sie nur bei Henry the Hatter zu finden war, Detroits exklusivstem Hutmacher.
Sein Gesamteindruck wurde durch die Frau an seinem Arm noch verbessert: groß, schimmernde bronzefarbene Haut, athletisch gebaut, hohe Wangenknochen, wallendes Haar und lange, atemberaubende Beine.
»Na, das nenn ich mal eine Mittwochnachmittagsüberraschung!«, sagte ich, packte Cowlings Hand und schüttelte sie begeistert. Wäre seine umwerfende Begleiterin nicht gewesen, hätte er seine Hand wahrscheinlich losgerissen und versucht, mir mit seiner blamabel langsamen Rechten eine reinzuhauen. So jedoch machte er gute Miene zum bösen Spiel.
»Ähm – ja – was, was machst du denn hier, Snow?«, sagte Cowling.
»Nichts Besonderes!«, erwiderte ich und grinste wie ein Honigkuchenpferd. »Versuch mich bloß ein bisschen als Ladendieb.«
»Ich kenne Sie«, sagte die Frau, die mich mit zusammengekniffenen Augen musterte.
Ich brauchte eine Sekunde, doch dann erkannte ich sie.
Schlagartig fand ich sie nicht mehr so attraktiv.
»Martinez?«, sagte ich. »Interne Ermittlung?«
»Jep«, sagte sie. »Schwamm drüber, okay?«
Widerstrebend gaben wir uns die Hand. Ihr Händedruck verriet, dass sie imstande war, Walnüsse in der Faust zu knacken.
In einem überhasteten Versuch, mich öffentlich zu verleumden, nachdem mich das Department gefeuert hatte, weil ich den kriminellen Machenschaften des ehemaligen Bürgermeisters auf die Spur gekommen war, wurden interne Ermittlungen gegen mich angestellt: Veruntreuung von Polizeigeldern (Stripclubs, Geschenke, Drogen) und unangemessenes Verhalten eines Polizeibeamten. Eine Prostituierte war für die Aussage bezahlt worden, ich hätte sie zu kostenlosem Sex gezwungen und grob angefasst. Ein einfallsloses, klassisches abgekartetes Spiel, das ich dem ehemaligen Bürgermeister und seinem korrupten Sicherheitsteam beim Detroit Police Department zu verdanken hatte.
Die Anschuldigungen der Internen Ermittlung fielen in sich zusammen, als sich keinerlei Ausgaben für Stripclub-Besuche nachweisen ließen und die Prostituierte mich bei einer Gegenüberstellung nicht als ihren Angreifer identifizieren konnte.
Zweimal.
Hilfreich war auch, dass sie, nachdem sie mich das zweite Mal nicht erkannt hatte, aus dem Raum stürmte und schrie: »Für diesen Scheiß zahlt ihr mir viel zu wenig! Fickt euch doch alle!«
»Schwamm drüber«, sagte ich zu Martinez, obwohl mich mein verletzter Stolz noch immer leicht zwickte. Mit einem aufgesetzten Lachen schlug ich Cowling auf die Schulter und sagte: »Nehmen Sie sich vor diesem Burschen in Acht! Ich warne Sie, der klaut Süßigkeiten aus dem Automaten im 14.!«
Martinez, die nicht so genau wusste, was sie von mir halten sollte, entschuldigte sich und ging Richtung Fleischtheke.
»Treibst du’s jetzt etwa auch mit der Internen Ermittlung, Cowling?«, sagte ich mit gespielter Enttäuschung in der Stimme. »Ernsthaft?«
»Du bist ein Riesenarschloch, Snow«, knurrte Cowling.
Ich beugte mich näher zu ihm und flüsterte: »Mischlingsbabys sind wunderhübsch, findest du nicht auch?«
Als ich anschließend durch die für Anfang Juni typische schwüle Hitze zurück zu meinem Cadillac watete, fühlte ich mich ein wenig schuldig, weil ich Cowling aufs Korn genommen hatte: An der linken Seite seines Halses, dicht am Übergang zur Schulter, war eine unübersehbare lange hässliche Narbe von einer Kugel, die sich durch sein Fleisch gebohrt hatte, während er tapfer versuchte, seinen Vorgesetzten, Detective Captain Ray Danbury, vor ein paar sehr üblen Leuten zu schützen. Danbury war gestorben. Cowling bekam die Beförderung, die er immer gewollt und nie ganz verdient hatte. Und wir zwei blieben zurück auf entgegengesetzten Seiten eines Mannes, den wir beide sehr geschätzt hatten.
Seit Danburys Tod hatten Cowling und ich so etwas wie eine stillschweigende Übereinkunft getroffen: Im Andenken an unseren toten Freund würden wir unsere Feindseligkeit gegenüber dem anderen zurückschrauben.
Unsere Begegnung im Honeycomb Market hatte gezeigt, was unter »zurückschrauben« zu verstehen war.
Trotz der drückenden Schwüle und der weißen Mittagssonne, die ihre Haut verbrennende, klimawandelnde Dominanz genoss, dachte ich mir, dass irgendwo doch ein paar Mexikaner unterwegs sein müssten. Nachdem ich meine Einkäufe zu Hause abgeladen hatte, ging ich wieder nach draußen zu meinem Wagen.
Jimmy und Carlos Rodriguez, Jimmys gleichberechtigter Partner bei den Renovierungen und beim Weiterverkauf von Häusern, kamen die Straße herunter, mit glänzender Haut, die Werkzeuggürtel umgehängt wie Pistolengurte von Revolverhelden in einem Spaghetti-Western. Da ich nicht in Stimmung war, über Renovierungspläne, Kosten, Materialien oder Angebote zu reden, steuerte ich rasch auf meinen am Straßenrand geparkten Caddy zu.
»Hey! Mr Snow!«, rief Jimmy.
»Keine Zeit, Jungs!«, sagte ich und winkte. »Muss los!«
Ich schnallte mich an, während ich schon beschleunigte, die Markham Street hinunter, auf den I-75 nach Norden in Richtung City und weg von jeder erwachsenen Verantwortung.
4
Es fällt schwer, über Michigans stickig schwüle Junihitze zu jammern, wenn man sieht, wie schwarze Kinder zusammen mit Kindern deutscher Touristen ausgelassen in den Wasserfontänen auf dem GM Plaza spielen. Oder wie junge Schwarze und Latinos mit nacktem Oberkörper brav hinter in Rollstühlen sitzenden Großmüttern oder Großvätern stehen, während alle zu der kühlen Sprühwasserwolke hinauflächeln, die sich von Isamu Noguchis Horace E. Dodge and Sons Memorial Fountain herabsenkt.
Immer drängen sich Touristen und Geschichtsinteressierte im Schatten von Ed Dwights Denkmal für die Underground Railroad, einer lebensgroßen Skulptur, die eine entflohene Sklavenfamilie auf der letzten Station ihrer beschwerlichen Reise darstellt. Selbst in ihrer in Bronze erstarrten Haltung bietet diese Familie, die über den Detroit River nach Kanada schaut, dem Land der Hoffnung und Verheißung, einen bewegenden Anblick.
Da Detroit größtenteils von versklavten Ureinwohnern und Schwarzen erbaut wurde, hatten diese Entflohenen alles Recht der Welt, sehnsüchtig über den Fluss auf das verheißene Land Kanada zu schauen.
Wer genau hinsieht, entdeckt zu Füßen dieser Skulptur von entflohenen Sklaven einen rötlich braunen Backstein, in dem folgende Worte eingemeißelt sind: Noch immer auf der Suche. Noch immer voller Hoffnung. Die Familie Snow.
Früher einmal hätte die dreieinhalb Meilen lange Detroiter Uferpromenade hinter dem General Motors Renaissance Center ebenso gut an den mythischen Styx grenzen können: Der Fluss war eine postapokalyptische Jauche aus illegal entsorgtem Müll, angeschwemmten Fäkalien und verrotteten Fischen, gewürzt mit einem Spritzer Quecksilber und einer Prise Blei. Verlassene Gebäude entlang des Ufers dienten als Mausoleen für die Leichen der Ermordeten und der vergessenen Obdachlosen. Es war ein offenes Grauwassergrab, wo tote Träume und verlorene Hoffnungen mit dem Bauch nach oben trieben.
Jetzt, da die zaghafte Neubelebung in vollem Gange war, hatte man den Uferbereich in eine malerische, gut gepflegte Grünfläche verwandelt, wo Menschen spazieren gingen, mit Leihfahrrädern fuhren, entspannt zu Mittag aßen und zusahen, wie Segelboote in den Heckwellen von Frachtern kreuzten.
Ein Stück vom RiverWalk entfernt, unweit der Riopelle Street, befinden sich leuchtende Türen, eine rote und eine blaue.
Dahinter liegt eine Welt des Schmerzes.
Ich war in der ersten Etage vom Club Brutus, hinter der roten Tür, auf der das japanische Kanji-Zeichen für Erlösung prangte. Der Club Brutus ist ein Wellness- und Fitnessclub der Luxusklasse mit deckenhohen Panoramafenstern, die Aussicht auf die strahlend weite Fläche des RiverWalk bieten, auf den Detroit River und, am anderen Ufer, auf die weitläufigen Backsteingebäude der Whiskybrennerei von Canadian Club, wo Al Capone und die Purple Gang in der Prohibitionszeit ihre illegalen Alkoholgeschäfte abwickelten. Ich trug einen dunkelblauen Karategi – den traditionellen japanischen Karateanzug – mit dem schwarzen Gürtel.
Dem Clubbesitzer Apollonius »Brutus« Jefferies war es zu verdanken, dass ich außerdem einen Bluterguss knapp unter dem linken Auge trug, der sich in Kürze unansehnlich violett verfärben würde.
»Wow«, sagte Brutus, während wir langsam auf der Matte umeinander herumtanzten. »Von einem jungen Mann hätte ich mehr erwartet.«
»Tja, leider kriege ich gerade genau das, was ich von einem alten Mann erwartet habe«, sagte ich. »Softe Schläge, langsame Kicks und kein Takedown in Sicht. Müsstest du nicht eigentlich besser sein?«
Brutus lachte, während er mich umkreiste. »Junge, ich schlag dich gleich wie ein altes Maultier.«
Brutus Jefferies war schwarz, groß und breit und hatte einen zehn Zentimeter langen Zopf. Mir war nicht klar, ob er mit seiner Mönchsglatze an klassischer männlicher Kahlköpfigkeit litt oder ob er sich die Haare absichtlich so schneiden ließ, weil er zu viele Filme von Akira Kurosawa gesehen hatte.
In dem geräumigen weißen Dojo hingen große rot gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos von Tsutomu Ohshima, Yasuhori Konishi und Gichin Funakoshi. Es gab außerdem rot gerahmte Fotos von schwarzen Karatemeistern – Moses Powell und Ronald Duncan und Fred Hamilton – sowie gerahmte Plakate für schwarze Karatefilme wie Black Dynamite und Freie Fahrt ins Jenseits.
»War überrascht, dass du heute Karate trainieren willst«, sagte Brutus. Schwungvoller rechter Kick. Heftig verwirbelte Luft dicht vor meiner Nase. »Hätte gedacht, du würdest mal wieder ein bisschen boxen wollen. An deinem lahmen rechten Haken arbeiten. Dein Daddy dagegen? Oha, der Mann hatte einen echt guten rechten Haken!«
Boxen war der Schmerz, der sich hinter der blauen Tür verbarg. »Vielleicht ein andermal«, sagte ich. »Im Augenblick muss ich an diesen Techniken arbeiten.«
»Und, was läuft so in Mexicantown?«, fragte Brutus. Rechter Roundhouse-Kick, linker Roundhouse-Kick, Faustschlag, Faustschlag. »Es heißt, die Schwachköpfe vom ICE sind wieder mal auf der Jagd nach frischem Latino-Fleisch.«
Beinfeger, Faustschlag, Reversgriff, misslungener Wurf, Wegstoßen. »Bloß ein paar kleinkarierte Bundespolizisten mit selbst gemalten Dienstausweisen und zu wenig Mumm.«
»Deinen Daddy würde dieser Schwachsinn stinksauer machen«, sagte Brutus. Faustschlag, Kniestoß, Faustschlag, Kick. »Ist es dir egal, wenn sie einen von deinen Nachbarn abgreifen?«
»Ist mir nicht egal«, sagte ich und spürte von dem letzten Kick eine schmerzende Rippe. »Und sollte es dazu kommen, dann lass ich mir was einfallen.« Kick, Kick. Beinfeger. Kein Kontakt. Brutus tänzelte von mir weg. »Bis dahin habe ich meine Sozialversicherungsnummer und meine Entlassungspapiere von den Marines.«
»Das hört sich nicht nach deinem Daddy an«, sagte Brutus. Faustschlag gegen die Brust. Reversgriff. Hüfte in mich reingedreht. Ich landete hart auf der Matte. Rollte mich ab und war wieder auf den Beinen. Noch mehr Rippen pochten.
»Ich bin nicht wie mein Daddy.«
Brutus grinste. »Oh, ich glaube, du bist mehr wie dein Daddy, als dir lieb ist, Grünschnabel.«
Handballen gegen meine Brust. Angriff. Handgelenkgreifen, Drehung. Überschlag. Ich krachte mit meinem ganzen Gewicht hart auf die Matte. Rechte Ferse sauste auf mein Gesicht zu, stoppte dicht vor meiner Nase.
Vorbei.
Brutus zog mich hoch, und wir verbeugten uns voreinander.
Einer von uns war außer Atem und sah ein paar Sterne vor den Augen tanzen.
Brutus war es nicht.
»Besser«, sagte er.
Wir gingen eine weit geschwungene Treppe hinunter ins Erdgeschoss, wo Anwälte und Ärzte, Geschäftemacher und Politiker Gewichte hoben, auf Laufbändern joggten oder auf Stairmastern Stufen hinaufstiegen, während sie CNN, Fox News oder Bloomberg Television guckten. In einem mit einer Glaswand abgetrennten Raum strampelten Leute auf Spinning-Rädern. In einem anderen wanden, krümmten und streckten sich Leute auf Yogamatten.
Ich sah den pummeligen und mürrischen Richter, der den Vorsitz in meinem Prozess wegen ungerechtfertigter Entlassung geführt hatte, wie einen nassen Sack auf einer Bank sitzen und sich den Schweiß von der Stirn wischen.
Er sah mich auch.
Sein kurzer müder Blick ließ mich vermuten, dass er in zig Prozessen seit meinem den Vorsitz gehabt und vergessen hatte, wer ich war.
»Heiliger Strohsack, Brutus«, sagte ich. »Wie viele Großkotze hast du eigentlich hier in deinem Laden?«
»Alle, jetzt, wo du hier bist, Kleiner.«
In Brutus’ verglastem Büro stieg er auf ein Laufband, das hinter einem schmiedeeisernen Stehpult flach auf dem Boden montiert war.
»Ernsthaft?«, sagte ich. »Ein Stehpult mit Laufband?«
»Bewegung ist Leben. Sitzen ist sterben.«
Eine fitte blonde Frau von etwa Mitte vierzig, die ein königsblaues Elasthan-Outfit mit dem Club-Brutus-Logo trug, lächelte mich an und reichte Brutus einen Stapel Post.
»Danke, Geneva«, sagte Brutus, setzte sich dann eine Lesebrille auf und ging rasch die Post durch. »Willst du einen Saft oder so, Snow junior? Smoothie?«
»Danke. Nein.«
»Wirklich nicht?«, sagte Geneva mit einem strahlenden Lächeln. »Wir machen sie frisch und garantiert bio.«
»Ich hätte jetzt eher Lust auf eine große ›Detroiter‹ von Buddy’s Pizza und ein Bier.«
»Sorry«, sagte Geneva lachend auf dem Weg nach draußen. »Damit kann ich nicht dienen.«
Apollonius »Brutus« Jefferies war zur gleichen Zeit wie mein Dad bei der Polizei gewesen. Sie waren gute Freunde gewesen und beim Polizeisport auf Boxwettkämpfen gegeneinander angetreten. Nach zwanzig ehrenvollen Dienstjahren war Brutus von zwei Kugeln getroffen worden. Bei einem missglückten Raubüberfall, den zwei unter Alkohol und Drogen stehende Jugendliche auf ein Bierlokal auf der Woodward Avenue verübt hatten. Nach einer Notoperation hatte Brutus ein Viertel seines Magens, ein Stück seines rechten Lungenflügels und eine Menge Gewicht verloren. Er war mehr tot als lebendig.
Um diesem Schwebezustand zwischen Leben und Tod zu entkommen, kaufte Brutus ein knapp achtzig Quadratmeter großes heruntergekommenes Gebäude an der Jefferson Avenue. Ein paar gespendete Sandsäcke, Boxbirnen und Spucknäpfe und er war im Geschäft – überwiegend mit Cops, die nicht mehr im Dienst waren und denen es schrecklich leidtat mitanzusehen, wie Brutus, der nur noch Haut und Knochen war, sich abmühte, Fünf-Kilo-Hanteln zu stemmen.
Auch mein Vater hatte vielleicht Mitleid mit Brutus gehabt. Aber er ließ es sich nie anmerken.
Brutus schleppte, mühte, kämpfte und betete sich zurück ins Land der Lebenden, eine Fünf-Kilo-Hantel nach der anderen. Und jetzt, zwanzig Jahre später und fünfundsechzig Jahre alt, war er das Paradebeispiel für gesundes Leben, und der Club Brutus das Fitnessstudio, in dem Detroits Elite eine Stange Geld ließ.
Brutus hatte mir den Mitgliedsrabatt für »Freunde und Familie« gegeben, weil er meinen Vater gekannt hatte. Natürlich musste ich mich für das tolle Schnäppchen bereiterklären, benachteiligten Kindern nach der Schule im Herbst Karateunterricht zu geben. Brutus legte noch ein kostenloses Paar Nike-Sportschuhe obendrauf, die mit seinem Logo bedruckt waren.
Ja, ich habe Geld.
Aber mal ehrlich: kostenlose Nikes mit Brutus’ Logo!
»Willst du wirklich nichts von der Salatbar?«, fragte Brutus.
»Klingt gut, aber ich kann nicht«, erwiderte ich, während ich Detroits ein Prozent beobachtete, das versuchte, mit Ellipsentrainern und Spinning-Rädern Unsterblichkeit zu erlangen. »Ich treff mich zum Lunch mit Bobby Falconi.«
»Der farbige Bursche aus der Rechtsmedizin?«
»Genau der«, sagte ich. »Obwohl ich allmählich glaube, dass nur noch alte Schwarze, wie du einer bist, den Begriff ›farbig‹ verwenden.« Ich stand auf, griff über das Pult und schüttelte Brutus’ große, kräftige Hand. »Danke für das Training, alter Mann.«
»Es gibt nix Gutes, außer man tut es, Grünschnabel«, sagte Brutus grinsend. »Und nimm nicht immer die Schulter runter, wenn du attackierst. Mach die Aggression deines Gegners zu deiner Energiequelle. Ruhe ist deine Kraft, mein Sohn.«
»Noch irgendwelche Worte der Weisheit, Sensei?«
»Sag ›bitte‹ und ›danke‹ für kleine Wunder. Und benutze immer ein Kondom.«
Ich duschte, bespritzte mich mit etwas Eau de Cologne C von Clive Christian (nur für den Fall, dass Beyoncé, Christina Aguilera oder Wahu draußen auf mich warteten) und zog ein graues Nautica-Polohemd, eine Buffalo-Jeans und schön abgetragene hellblaue Cole-Haan-Lederslipper an. Auf dem Weg nach draußen lief ich einem meiner neuen Nachbarn in die Arme: Trent T. R. Ogilvy.
»Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, Sie verfolgen mich«, sagte ich.
»Warum sollte ich das tun?«
»Übersteigt der Club Brutus nicht ein wenig die finanziellen Möglichkeiten des Mitarbeiters einer Wohltätigkeitsorganisation?«
»Allerdings«, sagte Ogilvy fröhlich. »Zum Glück hat Mr Jefferies – Brutus – einen Yoga-Lehrer gesucht, und ich hab mich beworben. Sie wären erstaunt, wie großzügig wohlhabende Frauen sein können, wenn sie eine Weile im herabschauenden Hund waren.«
»Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Mr Ogilvy«, sagte ich.
»Gleichfalls, Mr Snow«, sagte Ogilvy. »Ach, und sollten Sie beim Blick in den Rückspiegel zufällig einen acht Jahre alten silbernen Prius sehen, dann bin ich das, der versucht, Ihrem Cadillac zu folgen.«
Ich verließ den Club Brutus und machte mich auf den Weg zum Lunch mit Bobby Falconi.
5
Marie Antoinette machte letzten Sonntag einen Kopfsprung von der Ambassador Bridge.
Die berühmt-berüchtigte französische Königin des 18. Jahrhunderts, Erzherzogin von Österreich und Gattin von König Louis XVI., verfehlte knapp den Bug des Seefrachters Norquist-Jannak, der mit seiner Schüttgutladung von zweiundzwanzig Tonnen Eisenerz fünf Tage zuvor den Hafen von Duluth-Superior verlassen hatte.
Mit einer Endgeschwindigkeit von dreiundsiebzig Meilen die Stunde knallte Ihre Majestät die Königin mit der gepuderten Perücke voran in das stahlgraue Wasser des Detroit River. Die Wucht des Aufpralls brach ihr das Genick und die Augenhöhle, wodurch sie ein Auge verlor. Die riesigen Schiffsschrauben der Norquist-Jannak wirbelten die Königin unter Wasser ein bisschen herum, erwischten den Saum ihres prächtigen Kleides, schredderten Schichten von Unterröcken, ersparten ihr jedoch die Demütigung, in blutige Stücke zerhackt zu werden.
Die Brücke war an dem Tag verstopft gewesen. Nichts Neues; über ein Viertel des Warenaustausches zwischen den USA und Kanada erfolgt über die Ambassador Bridge, die Detroit mit Windsor, Ontario, verbindet. Auf dem fast hundert Jahre alten Bauwerk bilden sich ständig Lkw-Staus.
Bei dem dichten Verkehr auf der betagten Brücke waren die einzigen Augenzeugen wie üblich solche, auf die kein Verlass war. Niemand konnte sich erinnern, gesehen zu haben, wie die französische Königin aus einem Bus, einer Kutsche, einem Van oder Pkw stieg, nur ein einziger Zeuge schwor, sie sei aus einem blauen Toyota Camry gestiegen und dann in den Duty-free-Shop auf US-amerikanischer Seite gegangen, vermutlich um Kuchen und Champagner zu kaufen. Es wurde kein solches Auto gefunden, und keine der Überwachungskameras in den Duty-free-Shops auf US-amerikanischer oder kanadischer Seite hatte eine prunkvoll gekleidete französische Königin aufgezeichnet.
Niemand von der Brückenverwaltung, der US-Grenzpolizei, der Küstenwache oder der Homeland Security hatte irgendetwas Offizielles oder Inoffizielles über Madame Antoinette zu sagen. Die Brücken- und Verkehrsüberwachungskameras auf beiden Seiten – die Gerüchten zufolge genauso alt waren wie die Kameras, mit denen Charlie Chaplin Lichter der Großstadt gedreht hatte – lieferten keinerlei Aufschluss darüber, woher die Königin kam oder was sie vorhatte.
Es wurde vermutet, dass die Königin von jemandem an ihr finales Ziel gebracht worden war, der einen gestohlenen Nexus-Ausweis hatte, mit dem ein schnellerer Grenzübertritt in beide Richtungen möglich war. Vielleicht war der diensthabende Wachmann mehr mit seinem Kreuzworträtsel beschäftigt gewesen als damit, sein zweihundertstes Fahrzeug an dem Tag zu überprüfen.
Eine junge Schwarze, die in einem kleinen Mauthäuschen auf amerikanischer Seite arbeitete, brach offenbar in schallendes Gelächter aus, als sie von zwei Detroiter Cops vernommen wurde. Sie hatten ihr die Frau beschrieben und gefragt, ob sie sich an eine solche Person erinnern könne.
»Ich schätze, an eine durchgeknallte Weiße, die sich als irgendeine Scheißkönigin verkleidet hat, würd ich mich garantiert erinnern«, hatte sie geantwortet.
Bis gestern war noch nicht entschieden worden, ob das Ableben der Königin in die rechtliche Zuständigkeit der USA oder Kanadas fiel. Die Police Departments von Windsor und Detroit hatten miteinander, mit der Homeland Security, mit dem FBI und dem kanadischen Geheimdienst in vollem Umfang kooperiert. Die Personalknappheit bei der Polizei von Windsor und deren Neigung, Detroit die Schuld an allen nordamerikanischen Straftaten in die Schuhe zu schieben, begünstigten letztendlich die Schlussfolgerung, dass die USA für die tote Königin zuständig war.
»Menschenskind, Bobby«, sagte ich schließlich. »Rechtsmediziner kennen die besten Geschichten.«
Bobby – Dr. James Robert »Bobby« Falconi von der Wayne-County-Rechtsmedizin – und ich ließen uns eine große »Detroiter« bei Buddy’s Pizza schmecken – Käse, Peperoni, Tomaten-Basilikum-Sauce, gehobelter Parmesan und eine sizilianische Gewürzmischung zum Niederknien.
Genauer gesagt, ich ließ mir die Pizza schmecken. Bobby stocherte nachdenklich in dem Antipasti-Salat herum, nachdem er mir die Geschichte von Marie Antoinette erzählt hatte.
»Das ist nicht komisch, August«, sagte Bobby. »Ich hab sie obduziert. Sie war achtzehn, höchstens neunzehn. Genau kann ich es nicht sagen, weil absolut nichts über sie zu finden ist: keine zahnärztlichen Unterlagen, nichts in der Fingerabdruckdatei. Als hätte sie nie existiert!« Bobby ließ sich gegen die Rückenlehne der gepolsterten Sitzbank fallen. »Ich lass von einer Bekannten das Kostüm der Toten untersuchen. Sie ist an der Uni Michigan forensische Spezialistin für Fasern und Stoffe.«
»So was kann man studieren?«
»Arbeitet überwiegend mit Archäologen zusammen.« Bobby drehte schon seit fünf Minuten dasselbe Stück Salami auf seiner Gabel. »Untersucht für Auktionshäuser Authentizität und Herkunft von Stoffen. Und berät manchmal die Polizei.«
Ich trank einen Schluck von meinem Zitronenwasser. »Ich nehme an, alle wollen diesen Fall möglichst schnell abschließen, oder?« Bobby schwieg einen Moment und rührte mit einem Strohhalm in seinem Eistee. Dann sah er mich an und sagte: »Mit ›alle‹ meinst du wahrscheinlich deine alten Waffenbrüder beim DPD. Mensch, August – da hat sich einiges verändert, nachdem du gefeuert wurdest. Nach deinem Prozess. Die haben einschneidende Kürzungen vorgenommen. Ich meine, wenn ich nicht einer achtprozentigen Gehaltskürzung zugestimmt hätte, wäre ich jetzt Gott weiß wo. Die könnten morgen hundert neue Streifencops und vierzig Detectives einstellen und wären noch immer unterbesetzt. Es ist echt schlimm, August. Und die Erbsenzähler nehmen jede Erbse unter die Lupe, als wäre es die letzte. Also, ja – alle wollen diesen Fall möglichst schnell abschließen. Irgendeine durchgeknallte Tussi, die sich im zugedröhnten Zustand umgebracht hat.«
»Alle«, sagte ich, »außer dir.«
Bobby sagte: »Ich hatte schon so viele Leichen auf dem Tisch, wie eine Großstadt Einwohner hat. Namensschildchen an den Zeh, aufschneiden und abwiegen. Bericht diktieren. Mittagessen. Das ist mein Tagesablauf.« Er stockte, atmete zittrig ein. »Manchmal – siehst du eine Leiche und willst wissen, was für eine Geschichte dahintersteckt. Das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an – aber manchmal kann ich – spüren –, dass diese Menschen – diese junge Frau – mir ihre Geschichte erzählen wollen.«
Bobby nahm sich die Zeit, etwas von dem Salat und ein kleines Stück Pizza zu essen. Dann warf er seine Serviette auf den Tisch und starrte sie einen langen Moment an. Er blickte zu mir auf und sagte: »Sie wurde vergewaltigt. Systematisch. Mehrfach. Vaginal und anal. Drei verschiedene Spermaproben in ihrem Magen. Zersetzt durch Flusswasser, das beim Aufprall in ihren Körper eindrang.« Er verstummte, lachte dann laut auf.
Mit tragikomischem Timing blieb unsere Kellnerin an unserem Tisch stehen und fragte, ob alles zu unserer Zufriedenheit sei. Ich sagte, wir hätten gern die Rechnung und ob sie uns das restliche Essen einpacken könnte.
Bobby und ich schwiegen, als sie gegangen war.
Dann sagte er: »Verdammte Scheiße, August, ich bin noch immer dabei, die Drogen aufzulisten, die sie intus hatte: Methamphetamine, MDMA, Spuren von Halluzinogenen.« Er lächelte unvermittelt, ein hämisches Halblächeln. »Du warst doch Scharfschütze, nicht? Afghanistan?«
»Ja«, sagte ich mit einem mulmigen Gefühl angesichts der finsteren Richtung, die unser Gespräch einschlug.
»Ich?«, sagte Bobby. »Nachrichtendienst der Army. Irak und Afghanistan. Ich hab, ähm, assistiert bei einigen … ganz speziellen Verhörmethoden bei feindlichen Kämpfern. Besonders beliebt war die sogenannte Achterbahn. Barbituratinjektion in den einen Arm – fünf Minuten später Amphetamininjektion in den anderen Arm. Erst bist du völlig weg, und dann – wumm! – bist du hellwach, mit Herzrasen, Angstschweiß. Nach vier Spritzen würde ein feindlicher Kämpfer gestehen, dass er Kennedy erschossen hat. Oder sein Herz würde platzen wie ein angestochener Luftballon.«
»Wieso erzählst du mir das, Bobby?«
»Weil ich glaube, dass die – wer immer ›die‹ sind – das mit der jungen Frau gemacht haben«, sagte Bobby. »Die sind mit ihr Achterbahn gefahren. Für die war sie bloß ein Spielzeug. Sie war kein Mensch für die. Sie war ein Kauknochen für eine Meute Rottweiler.«
»Was zum Teufel hat sie auf der Ambassador Bridge gemacht?«, sagte ich.
»Du bist der Detective«, sagte Bobby. »Sag du’s mir.«
»Vielleicht sollte sie irgendwohin gebracht werden«, hörte ich mich sagen. »Zu einer anderen Location. Einer anderen Party. Riskant, auch wenn die Kontrollen auf der Brücke beschissen sind. Derjenige, der sie transportiert hat – falls es denn so war –, hatte möglicherweise einen Nexus-Ausweis. Ohne anhalten einfach durch. Hat nicht mit einem Stau gerechnet. Vielleicht ist sie geflohen. Oder sie haben sie aus dem Wagen geschmissen. Jemand, der so schlimm missbraucht wurde und mit so vielen Drogen im Körper – vielleicht haben sie ihr den Selbstmord eingeredet. Das Problem loswerden, ohne selbst Hand anlegen zu müssen.«
»Sie ist Latina«, sagte Bobby fast geistesabwesend.
»Was?«
»Die junge Frau. Sie ist Latina. So viel weiß ich.«
Er griff in seine Jacketttasche und holte ein zweimal gefaltetes Blatt Papier hervor. Er klappte es auseinander und legte es mir hin: die junge Frau auf einem Obduktionstisch, von der Brust abwärts mit einem makellos weißen Laken bedeckt.
Zu Lebzeiten war sie wahrscheinlich sehr hübsch gewesen.
Jetzt sah sie einfach unglaublich blass und unendlich traurig aus.
»Achtzehn oder neunzehn«, sagte Bobby wieder. »Jemandes Tochter. Herrgott noch mal.«
Ich drehte das Blatt mit dem Foto um, damit unsere Kellnerin oder andere Gäste es nicht sahen. Damit Bobby es nicht länger anguckte und sich um seine achtzehnjährige Tochter Miko sorgte, die rund siebenhundert Meilen entfernt in Boston am Berklee College of Music studierte.
»Was soll ich für dich machen, Bobby?«, fragte ich.
»Keine Ahnung. Vielleicht das Foto in deinem Viertel rumzeigen. Sie ist Latina. Vielleicht eine Illegale. Vielleicht kennt sie ja irgendwer in Mexicantown.« Seine müden, roten Augen fanden meine, und er sagte: »Vielleicht sucht jemand nach ihr. Es muss doch jemand nach ihr suchen, oder?«
Ich faltete das grausige Foto zusammen und schob es widerstrebend in die Hosentasche.
»Ich hör mich um«, sagte ich. »Keine Versprechungen.«
»Ich bin zu alt für Versprechungen«, sagte Bobby. »Ich brauche bloß jemanden, der irgendwas unternimmt.«
Unsere sympathische Kellnerin brachte die Rechnung und zwei Behälter zum Mitnehmen. Ich lächelte sie an und sagte: »Für medizinische Zwecke hätten wir auch gern noch zwei Flaschen Founders-Porter-Bier.«
6
Einunddreißig Grad, vierzig Prozent Luftfeuchtigkeit. Luftqualitätsindex bei 163.
Wer wie ich nicht weit vom I-75 South Highway wohnt, atmet praktisch Dieselabgase durch eine nasse Wolldecke ein.
Ich spielte kurz mit dem Gedanken, meine Eltern – die es wesentlich kühler hatten in ihren von Eichen beschatteten Gräbern – zu besuchen, verwarf ihn aber. Trauer macht süchtig. Und als Süchtiger musste ich mir meine Abhängigkeit eingestehen, bevor ich den Blick nach vorne richten konnte.
Und das gelang mir am besten bei meinen Paten Tomás und Elena Gutierrez.
Ich wollte gerade die Stufen zu ihrer Haustür hinaufsteigen, als ich hinter dem Haus Gelächter und Musik hörte. Los Lonely Boys, »Diamonds«.
Tomás und Elena arbeiteten im Garten. Genauer gesagt, Elena arbeitete im Garten, wo sie die Erde umgrub, Unkraut jätete und Beete absteckte, um Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Schnittlauch, Grünkohl und Spinat, Basilikum und Gurken anzubauen.
»Hey«, rief ich Elena zu. »Wieso hilft der Dicke nicht mit?«
Sie lachte. »Er ist dort eine größere Hilfe, als hier, Octavio!«
»Ich hab eine Schaufel«, knurrte Tomás. »Bring mich nicht dazu, dir damit eins überzubraten.«
»Ich freu mich auch, dich zu sehen, Shrek.«
»Willst du einen Kaffee?«
»Wer hat ihn gemacht?«, fragte ich.
»Ich.«
»Verzichte.«
»Pendejo.«
Ich ließ mir dann doch eine Tasse von seinem körnigen, fast kaubaren Kaffee geben, und wir setzten uns auf die Veranda und schauten zu, wie Elena in der brütenden Hitze arbeitete. Sie sah aus wie eine Inka-Prinzessin mit ihrem onyxschwarzen Haar, das ihr in einem dicken Zopf über die rechte Schulter fiel, während ihre bronzefarbene Haut die Strahlen einer Sonne reflektierte, die sie um ihre Schönheit beneidete. Es war, als würden wir uns einen Mythos oder ein Märchen ansehen; ein Tropfen von ihrem Schweiß auf der schwarzen Erde, und es würden Blumen erblühen in Farben, die nur Götter und Göttinnen sehen könnten.
Meine Mutter hatte einige Jahre vor ihrem Tod Elena, ihre beste Freundin, in ihrem Garten gemalt. Vielleicht lag es an der Hitze, aber ich hätte schwören können, dass ich das Leinöl der Farben meiner Mutter, das alte Holz ihrer Palette riechen konnte …