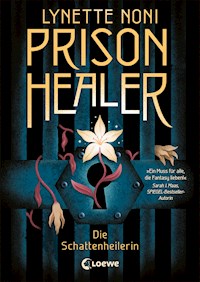
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Prison Healer
- Sprache: Deutsch
Ihre Aufgabe ist es, Leben zu retten. Doch was, wenn sie dafür ihr eigenes aufs Spiel setzen muss? Seit ihrer Kindheit lebt die siebzehnjährige Kiva in Zalindov, dem brutalsten Gefängnis von Wenderall. Als Heilerin kümmert sie sich um alle Insassen. Doch um die Rebellenkönigin zu retten, muss Kiva nicht nur herausfinden, woran Tilda erkrankt ist, sondern sich auch an ihrer Stelle dem Elementarurteil unterziehen: vier Prüfungen, die Tildas Schuld oder Unschuld beweisen sollen. Besteht Kiva, sind beide frei. Sollte sie scheitern, wird nicht nur die Rebellenkönigin sterben … Lass dich hineinziehen in eine einzigartige Fantasywelt! Der spannende Auftakt einer außergewöhnlichen Fantasytrilogie. In Band 1 der Jugendfantasy-ReihePrison Healer begeistert die australische BestsellerautorinLynette Noni mit einem originellen Setting und einer starken Protagonistin. Dabei verknüpft sie die hochaktuellen Themen Seuchen, Krankheiten, Heilen und Suche nach Heilmitteln mit einer fesselnden Geschichte voller Magie und überraschenden Plottwists sowie einer romantischen Liebesgeschichte. Für Fantasyfans und Jugendliche ab 14 Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Zehn Jahre später
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Danksagung
Für Sarah J. Maas –
Danke, dass du so großzügig mit deiner Freundschaft, deiner Unterstützung und deinem Zuspruch bist. Aber hauptsächlich: Danke, dass du an mich geglaubt hast, sogar – und ganz besonders – dann, als ich es selbst nicht konnte.
PROLOG
Der Tod kam mit der Dämmerung.
Das Mädchen pflückte mit seinem kleinen Bruder Jerribeeren in der Nähe des winterlichen Flussufers, während ihr Vater direkt am eisigen Wasser kauerte, um seinen Vorrat an Aloekraut aufzustocken. Die kühlende Paste daraus würden sie später gut gebrauchen können, so zerkratzt wie ihre Hände von den Dornen waren. Das Mädchen spürte den Schmerz jedoch kaum, sondern träumte bereits vom Essen. Denn seine Mutter machte die beste Jerribeermarmelade in ganz Wenderall. Da die silbernen Beeren am süßesten schmeckten, wenn man sie genau in den Stunden des Mondaufgangs erntete, würde das Ergebnis diesmal sogar besonders köstlich werden. Jetzt musste das Mädchen nur noch seinen Bruder davon abhalten, sich einen Großteil der Beeren direkt in den Mund zu stopfen.
Der Korb war kaum zur Hälfte gefüllt, als der erste Schrei die stille Abendluft durchschnitt.
Die Kinder erstarrten – der Mund des Jungen war silbrig verschmiert, die Stirn des Mädchens besorgt gerunzelt. Mit ihren smaragdgrünen Augen sah die Tochter zu ihrem Vater hinüber, der noch immer am eisigen Fluss stand. Statt auf das moosartige Bündel Aloekraut, das er in den Händen hielt, war sein Blick auf das kleine Haus oben auf dem Hügel gerichtet. Er erbleichte.
»Papa, was –«
»Still, Kerrin«, brachte der Mann seinen Sohn zum Schweigen. Er ließ die Heilpflanzen fallen und eilte zu seinen Kindern. »Das waren bestimmt bloß Zuleeka und Torell, die wieder mal wild miteinander spielen. Trotzdem sollten wir lieber nachschauen, ob sie –«
Was auch immer er über die älteren Geschwister der beiden hatte sagen wollen, ging in einem weiteren Schrei unter. Ein Krachen folgte, das bis zum Fluss herunterhallte.
»Papa –«, setzte diesmal die Tochter an. Gleich darauf fuhr sie aber zusammen, als der Vater ihr den Korb so jäh entriss, dass die Beeren in alle Richtungen flogen. Fest umklammerte er ihre Hand. Das Mädchen schaffte es nicht, seinen Satz zu vollenden, da in diesem Moment die Mutter eine schrille Warnung zu ihnen herunterrief.
»Flieht, Faran! Flieht!«
Der Griff des Vaters wurde schmerzhaft. Doch dem Mann blieb keine Zeit, den Worten seiner Frau Folge zu leisten. Soldaten strömten aus dem kleinen Bauernhaus, die Schwerter erhoben. Selbst im Halbdunkel blitzten ihre Rüstungen.
Es waren mindestens ein Dutzend.
So viele.
Zu viele.
Zwischen den dornigen Ranken hindurch ergriff das Mädchen die Hand seines Bruders, dessen vom Jerribeersaft verklebte Finger zitterten. Es gab kein Entkommen. Der eiskalte Fluss in ihrem Rücken war zu tief, die Strömung zu stark, als dass sie ihn hätten queren können.
»Alles wird gut«, sagte ihr Vater mit rauer Stimme, während die Soldaten näher kamen. »Es wird alles gut werden.«
Sie saßen in der Falle.
ZEHN JAHRE SPÄTER
KAPITEL EINS
Kiva Meridan beugte sich über den Jungen, der vor ihr am Behandlungstisch festgegurtet war, und flüsterte: »Tief durchatmen.«
Bevor er auch nur blinzeln konnte, packte sie seinen Arm und drückte die weiß glühende Schneide ihres Messers in seinen Handrücken. Der Junge schrie und wand sich unter ihrem Griff – das taten sie alle. Doch sie hielt ihn bloß noch fester, während sie drei Linien in seine Haut ritzte. Zusammen bildeten sie ein »Z«.
Ein einziger Buchstabe, der ihn als Gefangenen von Zalindov brandmarkte.
Die Wunde würde verheilen, aber die Narbe war für die Ewigkeit.
Kiva arbeitete schnell und präzise und ließ den Jungen nicht eher los, bis der letzte Schnitt gesetzt war. Sie widerstand dem Drang, ihn zu trösten, zu behaupten, nun habe er das Schlimmste überstanden. Er mochte noch jung sein, doch er war alt genug, um eine solche Lüge zu durchschauen. Ab sofort war er das Eigentum Zalindovs und der Metallreif an seinem Handgelenk kennzeichnete ihn als Insassen H67L129. Seine Zukunft hielt nichts Gutes für ihn bereit. Kiva würde ihm keinen Gefallen tun, wenn sie ihm jetzt etwas vormachte.
Nachdem sie Ballicoharz auf die blutende Wunde gestrichen hatte, um Entzündungen vorzubeugen, bestäubte sie die Stelle mit schmerzstillendem Pfefferwurzelpulver. Dann verband sie die Hand des Jungen mit einem Stück Leinen. Leise wies sie ihn an, die Wunde in den nächsten drei Tagen trocken und sauber zu halten. Dabei wusste sie genau, dass das unmöglich wäre, falls er zur Arbeit in die Tunnel, auf eine der Farmen oder in den Steinbruch geschickt werden sollte.
»Halt still, ich bin gleich fertig«, ermahnte sie ihn und tauschte ihr Messer gegen eine Schere. Die Klingen waren ein wenig rostig, aber noch immer so scharf, dass sie Stahl hätten zerschneiden können.
Die Pupillen des Jungen weiteten sich vor Angst; er war bleich und zitterte.
Kiva hütete sich weiterhin, ihm Mut zuzusprechen. Nicht solange in der Tür zur Krankenstation eine bewaffnete Aufseherin stand und sie nicht aus den Augen ließ. Für gewöhnlich genoss Kiva ein relativ hohes Maß an Freiheit und konnte arbeiten, ohne permanent den kalten, wachsamen Blick eines Aufsehers im Nacken zu spüren, doch seit dem Aufstand in der vergangenen Woche war die Atmosphäre angespannt. Ausnahmslos jeder stand unter Beobachtung. Sogar Kiva, die als Getreue des Vorstehers galt – und damit unter ihren Mitgefangenen als Verräterin. Als Informantin. Spionin.
Niemand verachtete Kiva mehr dafür als sie sich selbst, dennoch hatte sie ihre Entscheidung nie bereut.
Ohne auf das Wimmern des Jungen einzugehen, trat sie nun hinter ihn und begann, ihm energisch das Haar zu kürzen. Sie dachte an ihre eigene Ankunft im Gefängnis vor mittlerweile zehn Jahren. Daran, wie entwürdigend es gewesen war, als man sie entkleidet, gewaschen und geschoren hatte. Als sie damals die Krankenstation wieder verlassen hatte, kahlköpfig und mit wund gescheuerter Haut, hatte sie nichts mehr besessen außer der kratzigen grauen Sträflingsuniform, die sie am Körper trug. Trotz allem, was Kiva seither in Zalindov hatte erleiden müssen, waren diese ersten Stunden die schlimmsten gewesen. Allein bei der Erinnerung daran flammte der Schmerz in ihrer eigenen Narbe wieder auf. Unwillkürlich sah sie auf ihr Handgelenk hinab. N18K442 war in ihren Metallreif eingraviert – ihre eigene Identifikationsnummer, die sie niemals vergessen ließ, dass sie nichts und niemand war. Dass ein falsches Wort, eine falsche Tat, ja sogar ein falscher Blick auf die falsche Person im falschen Moment ihren Tod bedeuten konnte.
Zalindov kannte keine Gnade, nicht einmal für Unschuldige.
Erst recht nicht für Unschuldige.
Kiva war gerade sieben Jahre alt gewesen, als sie hierhergebracht worden war. Aber selbst ihr junges Alter hatte sie nicht vor den Grausamkeiten des Gefängnislebens bewahren können. Ihr war klar, dass ihre Atemzüge gezählt waren. Niemand überlebte Zalindov. Es war lediglich eine Frage der Zeit, bis sie all jenen folgen würde, die schon vor ihr gegangen waren.
Natürlich wusste Kiva, dass sie sich im Vergleich zu vielen anderen glücklich schätzen konnte. Insassen, denen die wirklich harte Arbeit zugeteilt wurde, hielten selten mehr als sechs Monate durch, höchstens ein Jahr. Kiva dagegen war jede allzu kräftezehrende Schinderei erspart geblieben. Direkt nach ihrer Ankunft hatte sie einige Wochen lang im Aufnahmetrakt alles an Kleidern und sonstigem Hab und Gut sortieren müssen, das die Aufseher den Neuankömmlingen abnahmen. Später, infolge einer Krankheitswelle, die Hunderte von Leben gefordert hatte, war eine Position in den Werkstätten frei geworden. Dort hatte sich Kiva fortan ums Waschen und Flicken der Wächteruniformen gekümmert. Ihre Finger waren damals wund und blutig von der ätzenden Seifenlauge und den Nadeln gewesen, dennoch hatte sie vergleichsweise wenig Grund zur Klage gehabt.
Jeden Tag aufs Neue hatte sie sich davor gefürchtet, zum Schuften auf die Felder geschickt zu werden. Doch der Befehl war nie gekommen. Stattdessen war sie auf die Krankenstation versetzt worden, nachdem sie einem Wächter geraten hatte, seine Blutvergiftung mit einem Umschlag zu kurieren. Diese Methode hatte sie ihren Vater etliche Male anwenden sehen. Knapp zwei Jahre später war der einzige andere Häftling, der auf der Krankenstation gearbeitet hatte, hingerichtet worden, weil er ein paar verzweifelte Mitgefangene heimlich mit Engelsstaub versorgt hatte. Daraufhin war sein Posten als Heiler der damals zwölfjährigen Kiva zugefallen. Und damit auch die Aufgabe, den Neulingen das Zalindov-Symbol in die Haut zu ritzen – eine Pflicht, die ihr bis heute aus tiefstem Herzen verhasst war. Aber Kiva wusste: Wenn sie sich weigerte, würde sie damit niemandem einen Gefallen tun, weder sich selbst noch den neuen Gefangenen. Diese Lektion hatte sie früh lernen müssen und die Narben auf ihrem Rücken erinnerten sie täglich daran. Vermutlich wäre sie damals einfach zu Tode gepeitscht worden, wenn es jemanden gegeben hätte, der sie als Heilerin hätte ersetzen können. Heute jedoch gab es andere, die ihre Aufgabe erfüllen konnten.
Sie war entbehrlich, so wie jeder hier.
Das verbliebene Haar des Jungen stand struppig zu Berge, als Kiva schließlich die Schere beiseitelegte und nach dem Rasiermesser griff. Bei manchen Neulingen reichte es, wenn sie lediglich ein paar verfilzte Strähnen herausschnitt. Andere wiederum waren derart verlaust, dass ihr gar nichts anderes übrig blieb, als alles kahl zu scheren, um zu verhindern, dass die kleinen Biester sich im gesamten Gefängnis ausbreiteten.
»Keine Sorge, die wachsen ganz schnell nach«, raunte Kiva dem Jungen zu und musste daran denken, wie ihr selbst an ihrem ersten Tag in Zalindov das nachtschwarze Haar abrasiert worden war. Heute fiel es ihr wieder lang über den Rücken.
Trotz ihrer aufmunternden Worte hörte der Junge nicht auf zu zittern, sodass sie noch gründlicher achtgeben musste, ihn nicht aus Versehen mit dem Rasiermesser zu verletzen.
Am liebsten hätte Kiva ihm erzählt, was ihn erwartete, sobald er die Krankenstation verlassen würde. Aber selbst ohne die streng dreinschauende Wärterin an der Tür hätte sie gewusst, dass ihr das nicht zustand. Neue Insassen bekamen für die ersten Tage einen Partner zugeteilt, der sie mit dem Leben in Zalindov vertraut machte. Dieser warnte sie vor Gefahren und unterwies sie ganz allgemein darin, wie man an einem Ort wie diesem überlebte – sofern sie Letzteres denn wünschten. Es gab nämlich immer wieder Neulinge, die sich bereits nach dem Tod sehnten, ehe sie auch nur einen Fuß durch das eiserne Eingangstor in die seelenlosen Kalksteinmauern gesetzt hatten.
Kiva konnte nur hoffen, dass diesem Jungen noch ein wenig Kampfgeist geblieben war. Denn den würde er in der nächsten Zeit dringend brauchen.
»Na bitte.« Sie ließ das Rasiermesser sinken und trat wieder nach vorn, um ihrem Schützling ins Gesicht zu sehen. Ohne sein Haar wirkte er mit seinen riesigen Augen, hohlen Wangen und abstehenden Ohren jünger als zuvor. »War doch halb so wild, oder?«
Er starrte sie an, als hätte sie ihm gedroht, ihm die Kehle aufzuschlitzen. Diesen Blick kannte sie schon, besonders von Neulingen, die nicht wussten, dass Kiva eine von ihnen war. Dass sie genauso der Willkür Zalindovs ausgeliefert war wie sie. Wenn der Junge lange genug durchhielt, würde sein Weg ihn sicher bald wieder zu ihr führen. Und dann würde er die Wahrheit herausfinden: dass sie auf seiner Seite stand und hier war, um ihm zu helfen. So wie all den anderen.
»Fertig?«, rief die Aufseherin von der Tür her.
Unwillkürlich schloss Kiva die Hand fester um das Messer, bevor sie sich zwang, ihren Griff wieder zu lockern. Sie durfte nicht riskieren, dass die Wärterin aufrührerische Tendenzen in ihr witterte.
Passivität und Unterwürfigkeit, das waren die Pfeiler ihrer Überlebensstrategie.
Viele der anderen Gefangenen belächelten sie deswegen, besonders wenn sie noch nie ihre Dienste benötigt hatten. »Zalindovs Hure« nannten sie einige. »Da kommt die eiskalte Schlitzerin«, zischten andere, wenn sie an ihnen vorbeiging. Am schlimmsten aber war der Name »Todesprinzessin«. Allerdings konnte Kiva es den anderen kaum zum Vorwurf machen, dass sie ein derart schlechtes Bild von ihr hatten. Vermutlich hasste sie die Bezeichnung genau deshalb so sehr. Denn die Wahrheit war: Viele der Gefangenen, die auf der Krankenstation landeten, verließen sie nicht wieder lebendig – was ganz allein ihre Schuld war.
»Heilerin!«, rief die Wärterin in deutlich ungeduldigerem Ton. »Bist du fertig?«
Kiva nickte knapp, woraufhin die Frau ihren Posten an der Tür verließ und auf sie zukam.
Weibliche Aufseherinnen waren in Zalindov eher die Ausnahme. Auf zwanzig Männer kam nur ungefähr eine Frau und meistens blieben sie nicht lange. Diese Wärterin schien neu zu sein; Kiva hatte sie vor ein paar Tagen zum ersten Mal gesehen. Ihr Gesicht wirkte jung und ihre kühlen, wachsamen Augen hatten die Farbe von Bernstein. Ihre Haut war vielleicht zwei Nuancen heller als das tiefste Schwarz. Dies ließ darauf schließen, dass sie aus Jiirva oder Hadris stammte, beides Königreiche, die für ihre fähigen Krieger bekannt waren. Das Haar der Wärterin war raspelkurz geschoren und von einem ihrer Ohrläppchen baumelte ein Jadeohrring in Form eines Reißzahns. Ziemlich gewagt; jemand hätte ihr das Schmuckstück mit Leichtigkeit herausreißen können. Andererseits strahlte die Aufseherin eine unerschütterliche Selbstsicherheit aus – nicht zuletzt dank der drahtigen Muskeln, die sich unter ihrer Uniform aus knielanger Jacke, schmal geschnittener Hose, Handschuhen und Stiefeln abzeichneten. Daher würden es wohl nicht viele Insassen riskieren, die Wärterin gegen sich aufzubringen. Und jeder, der es dennoch versuchte, befände sich vermutlich kurz darauf auf dem Weg in die Leichenhalle.
Kiva schluckte. Als die Wärterin näher kam, wich Kiva einen Schritt zurück und drückte dem Jungen ermutigend die Schulter. Dieser fuhr jedoch so heftig unter der Berührung zusammen, dass sie die Geste sofort bereute.
»Ich muss bloß noch das hier zum Sortieren in den Aufnahmetrakt bringen.« Kiva zeigte auf den Stapel Kleider, die der Junge getragen hatte, bevor ihm die graue Häftlingskluft ausgehändigt worden war.
Jetzt nickte die Aufseherin, ehe sie ihren Bernsteinblick wieder auf den Jungen richtete. »Komm mit«, befahl sie ihm.
Der Geruch seiner Angst erfüllte die Luft, während er sich mit wackligen Knien erhob und der Frau nach draußen folgte, seine verletzte Hand gegen die Brust gedrückt.
Er drehte sich kein einziges Mal mehr um.
Das taten sie nie.
Kiva wartete, bis sie sich sicher war, allein zu sein, und machte sich dann mit raschen, geübten Bewegungen ans Werk. Trotzdem spähte sie immer wieder nervös Richtung Tür. Denn sollte sie erwischt werden, würde das ihren Tod bedeuten, dessen war sie sich nur zu bewusst. Schließlich war sie nicht der einzige Spitzel des Vorstehers. Dieser mochte Kiva bislang zwar Wohlwollen entgegengebracht haben, aber das würde sie nicht vor Strafe schützen – oder gar einer Hinrichtung.
Als sie die Kleider des Jungen durchsuchte, rümpfte sie die Nase über deren Geruch, der von langen Reisen und mangelnder Hygiene zeugte. Stellenweise fühlte sich der Stoff klamm an und Kiva versuchte, sich nicht auszumalen, was an Schimmel und sonstigem Schmutz darin lauerte. Sie suchte nach etwas. Suchte, suchte, suchte.
Sie ließ die Hosenbeine durch ihre Finger gleiten, fand nichts und wandte sich als Nächstes dem Hemd des Jungen zu. Das Leinen war fadenscheinig, an einigen Stellen gerissen, an anderen geflickt. Kiva untersuchte jede Naht, doch noch immer war nichts zu entdecken. Langsam verlor sie die Hoffnung. Dann aber griff sie nach seinen ausgetretenen Stiefeln und – da! In einem Riss im Innenfutter des linken Stiefels steckte ein kleines zusammengefaltetes Stück Papier.
Mit zitternden Fingern klappte Kiva es auseinander und las die codierten Zeilen.
Kiva stieß den Atem aus und ihre Schultern sackten vor Erleichterung nach unten, als sie die Nachricht im Stillen übersetzte: Es geht uns gut. Bleib am Leben. Wir werden kommen.
Fast drei Monate waren vergangen, seit Kiva das letzte Mal von ihrer Familie gehört hatte. Drei Monate, in denen sie die Kleider jedes ahnungslosen Neulings durchsucht hatte, in der Hoffnung auf Informationen aus der Außenwelt. Wenn Raz, der Stallmeister, nicht wäre, hätte sie nicht einmal diese bescheidene Möglichkeit gehabt, mit den Menschen, die sie liebte, in Kontakt zu bleiben. Raz setzte sein Leben aufs Spiel, indem er die geheimen Botschaften ins Innere der Zalindov-Mauern schmuggelte. Obwohl sie nur selten kamen und stets kurz waren, bedeuteten sie Kiva mehr als alles andere auf der Welt.
Es geht uns gut. Bleib am Leben. Wir werden kommen.
Zehn Worte, die ihr innerhalb der letzten zehn Jahre immer wieder zugespielt worden waren, meistens dann, wenn sie sie am dringendsten gebraucht hatte.
Es geht uns gut. Bleib am Leben. Wir werden kommen.
Der Mittelteil war leichter gesagt als getan, doch Kiva bemühte sich nach Kräften. Sie war sich sicher, dass ihre Familie eines Tages ihr Versprechen wahrmachen und sie befreien würde. Ganz gleich, wie oft sie es schon gelesen hatte, ganz gleich, wie lange sie schon wartete, sie klammerte sich mit aller Kraft an diese Worte. Wir werden kommen. Wir werden kommen. Wir werden kommen, wiederholte sie unaufhörlich im Geiste.
Irgendwann würde sie wieder bei ihrer Familie sein. Irgendwann würde sie Zalindov entfliehen, würde frei sein.
Seit zehn Jahren wartete sie auf diesen Tag.
Doch mit jeder Woche, die verging, schwand ihre Hoffnung ein wenig mehr.
KAPITEL ZWEI
Er kam nach Zalindov wie so viele andere: blutverschmiert und totenbleich.
Seit der letzten Neuaufnahme war ein Monat vergangen. Ein Monat, seit Kiva zum letzten Mal jemandem ein »Z« ins Fleisch hatte ritzen müssen. In dieser Zeit hatte sie die üblichen Verletzungen versorgt und sich um ein paar Fälle von Tunnelfieber gekümmert, die allesamt unter Quarantäne gestellt worden waren. Viele ihrer Patienten sehnten den Tod herbei – und einigen wurde ihr Wunsch erfüllt. Aber Kiva wusste, dass die meisten bald wieder auf den Beinen sein würden, sobald das Fieber sank. Abgesehen davon hatte sie nicht allzu viel zu tun gehabt.
Heute jedoch …
Drei Neulinge.
Alle männlich.
Und alle, so hieß es zumindest, aus Vallenia – der Hauptstadt von Evalon, dem größten Königreich von ganz Wenderall.
Es kam nicht oft vor, dass in den Wintermonaten ein Gefangenentransport heranrollte, erst recht nicht aus so südlich gelegenen Ländern wie Evalon. Für gewöhnlich wurden die Häftlinge dort bis zum Frühjahr in örtlichen Verliesen und Kerkern festgehalten, damit nicht allzu viele von ihnen auf der wochenlangen Reise starben. Manchmal überlebten nicht einmal die Wachen den Weg durch die Belharewüste oder über die Tanestraberge. Vor allem dann nicht, wenn unerwartet das Wetter umschlug und heftige Schneestürme die Gebirgspässe heimsuchten. Noch dazu mussten diejenigen, die von Vallenia aus aufbrachen, die Wildauen und den Grimmsumpf durchqueren, bevor ihr Weg sie durch die Tiefen des Klagewalds führte – was schon unter besten Voraussetzungen und ohne die Grausamkeiten der Geleitwachen ein beschwerliches Unterfangen war.
Winter, Sommer, Frühling oder Herbst; es spielte keine Rolle, wann oder woher die Gefangenen kamen: Die Reise war stets gefährlich. Zalindov lag weit nördlich von Evalon, kurz vor der Grenze zu Mirraven und Caramor. Es war von keinem der acht Königreiche Wenderalls aus leicht zu erreichen. Dennoch wurden unliebsame Bürger aus jeder Ecke des Kontinents hierhergekarrt. Niemand scherte sich darum, ob sie die Reise überlebten.
Auch zwei der Männer, die man heute durchs Haupttor und auf direktem Weg zu Kiva in die Krankenstation gebracht hatte, waren bereits ins Schattenreich übergetreten. Kalt und steif lagen sie vor ihr. Zwar nahm Kiva keinen Verwesungsgeruch wahr, weshalb ihr Ableben noch nicht lange her sein konnte, aber das änderte nichts an den Tatsachen. Sie waren tot – und nichts würde sie wieder zurückbringen.
Der dritte dagegen … Sein Herzschlag, so schwach er auch sein mochte, war eine willkommene Überraschung.
Doch angesichts seiner Verfassung fürchtete Kiva, dass auch er die nächste Stunde nicht überleben würde.
Bemüht, sich nicht allzu sehr von den beiden Leichen auf ihren Metallbahren aus dem Konzept bringen zu lassen, beugte sie sich über den dritten Mann und überlegte, wie sie vorgehen sollte. Zunächst einmal musste er gewaschen werden. Nicht nur, weil er schmutzig war, sondern auch, weil sie unmöglich einschätzen konnte, wie viel von dem Blut, mit dem er verschmiert war, von ihm selbst stammte. Möglicherweise hatte er Wunden, die versorgt werden mussten.
Kiva lockerte ihre verspannten Schultern und schob sich die Ärmel bis zu den Ellenbogen hoch. Als der raue Stoff über ihren noch nicht ganz verheilten rechten Unterarm kratzte, verzog sie das Gesicht. Schnell verdrängte sie die Erinnerung an das, was die Wachen ihr drei Nächte zuvor angetan hatten. An das, was geschehen wäre, wenn nicht zufällig die neue Aufseherin – die mit den Bernsteinaugen – aufgetaucht wäre.
Warum genau die Frau eingeschritten war und ihre Kollegen gewarnt hatte, nicht den Unmut des Vorstehers auf sich zu ziehen, war Kiva noch immer ein Rätsel. Schließlich waren die Männer nicht dumm. Sie wussten selbst, dass der Vorsteher, der Zalindov mit eiserner Faust regierte, es nicht guthieß, wenn seine Untergebenen ihre Macht missbrauchten. Allerdings hielt sie dieses Wissen selten davon ab, es trotzdem zu tun. Sie achteten lediglich darauf, nicht erwischt zu werden.
Die neue Wärterin dagegen hatte sich offenbar jenen letzten Funken Anstand – Menschlichkeit – bewahrt, der bei den meisten bereits nach den ersten Wochen verlosch und einer feindseligen Verbitterung wich. Anders konnte sich Kiva ihr Eingreifen nicht erklären. Obwohl sie der Frau dafür dankbar war, hatte sie nun das Gefühl, in ihrer Schuld zu stehen. Und das war in Zalindov niemals ratsam.
All diese Gedanken versuchte Kiva niederzukämpfen, während sie einen Holzeimer mit frischem Wasser füllte. Behutsam und systematisch begann sie, den Neuling zu waschen und nach und nach aus seinen zerrissenen Kleidern zu schälen.
Denk immer dran, Mäuschen: Kein Mensch gleicht dem anderen und wir alle sind auf unsere Weise schön. Der menschliche Körper ist ein Meisterwerk, das unseren bedingungslosen Respekt verdient. Jederzeit.
Kiva sog scharf die Luft ein, als in ihrem Kopf die Stimme ihres Vaters ertönte. Es war lange her, dass sie von Erinnerungen an ihre Kindheit eingeholt worden war. Es war lange her, dass sie den Kosenamen »Mäuschen« gehört hatte – einen Namen, den sie bekommen hatte, weil sie als kleines Mädchen oft ein Quieken ausgestoßen hatte, wenn sie erschrak. Und ebenso lange war es her, dass ihr Tränen in die Augen gestiegen waren.
Halt, befahl sie sich im Stillen. Nicht weiter darüber nachdenken.
Sie holte tief Luft und genehmigte sich drei Sekunden, um sich zu sammeln, bevor sie sich wieder entschlossen an die Arbeit machte. Dennoch zog sich ihr Herz zusammen, als ihr unwillkürlich die Tage in den Sinn kamen, an denen sie ihrem Vater in seiner bescheidenen Praxis mit den Dorfbewohnern geholfen hatte. Die Menschen waren mit all ihren gesundheitlichen Beschwerden zu ihm gekommen. Von klein auf war Kiva ihrem Vater kaum von der Seite gewichen, hatte Wasser geholt, Leinen in Verbandsstreifen gerissen und, sobald sie alt genug gewesen war, um sich nicht daran zu verletzen, sogar seine Skalpelle sterilisiert. Sie war die Einzige unter ihren Geschwistern, die seine Leidenschaft für die Heilkunst teilte, die Einzige, für die es nichts Schöneres gab, als Schmerz und Qual zu lindern.
Und jetzt war sie hier, kurz davor, einem weiteren Mann eine sinnlose Verletzung zuzufügen.
Ihr Oberschenkel juckte. Sie ignorierte es.
Mit zusammengebissenen Zähnen verdrängte Kiva die Erinnerungen und zog dem Mann die letzten Kleidungsstücke aus, bis er nur noch in Unterwäsche vor ihr lag. Seine Nacktheit störte Kiva nicht. Sie war es gewohnt, den menschlichen Körper mit dem nüchternen Blick einer Heilerin zu betrachten. Ohne Umschweife widmete sie sich seinen Verletzungen. Irgendein winziger Teil ihres Bewusstseins mochte die ausgeprägte Muskulatur des Manns und den warmen Honigton seiner Haut registrieren, der unter all dem Blut, das sie abwusch, zum Vorschein kam. Doch anstatt sich zu fragen, was für ein Leben er wohl geführt hatte, um so gesund auszusehen – und trotzdem in Zalindov zu landen –, machte sie sich Sorgen darüber, was all das für seine Zukunft hier bedeuten würde. Jemand, der einen derart kräftigen Eindruck machte, lief stets Gefahr, die härteste Arbeit zugeteilt zu bekommen.
Vielleicht wäre es besser, wenn er gar nicht erst wieder aufwachte.
Kiva rief sich im Stillen zur Ordnung und machte sich mit verstärktem Eifer daran, den Mann vor ihr zu säubern. Wie immer vergaß sie dabei nicht eine Sekunde lang den Aufseher an der Tür. Im Moment war es der Metzger, der jede ihrer Bewegungen verfolgte, nachdem er kurz zuvor beim Schichtwechsel den Knochenbrecher abgelöst hatte. Natürlich waren das nicht die echten Namen der beiden, aber Kivas Mitgefangene hatten sie nicht ohne Grund so getauft. Der Metzger war selten außerhalb des Purgatoriums anzutreffen, des Straftrakts ganz im Nordosten des Gefängnisgeländes. Bereits der Name verriet, was all jene erwartete, die dorthin geschickt wurden. Nur wenige von ihnen kehrten lebendig wieder zurück. Der Knochenbrecher dagegen patrouillierte häufig mit seiner Armbrust auf der Mauer oder überwachte von einem der Türme aus das Areal. Er mochte zunächst keinen ganz so Furcht einflößenden Eindruck erwecken wie der Metzger, war jedoch für seine Neigung bekannt, den Insassen nach Lust und Laune die Knochen zu brechen, weswegen Kiva ihm möglichst aus dem Weg ging.
Dass diese brutalen Wärter für den Dienst in der Krankenstation eingeteilt wurden, kam recht selten vor. Derzeit verhielten sich die Gefangenen allerdings unruhiger als sonst. Die letzten Frostnächte hatten einen Teil der Ernte zerstört, sodass die Essensrationen für alle verkleinert worden waren. Und wenn die Feldarbeiter ihr tägliches Soll nicht erfüllten – was sie schon seit Wochen nicht mehr taten –, bekamen alle Häftlinge die Folgen zu spüren. Sowohl in Form von Hunger als auch durch die zunehmende Gewaltbereitschaft der Wärter.
Jede Jahreszeit hier war grausam, aber der Winter ganz besonders. Das hatten zehn Jahre in Zalindov sie gelehrt. Kiva ahnte bereits, dass die beiden Toten hinter ihr nicht die einzigen bleiben würden, die diese Woche in der Leichenhalle landeten. Und sicher würden ihnen bis zum Ende des Winters noch etliche weitere folgen.
Nachdem Kiva ihrem Patienten die letzten Blutspuren von der Brust gewischt hatte, widmete sie sich der beeindruckenden Ansammlung von Blutergüssen an seinem Bauch. Die Haut dort schimmerte in den verschiedensten Blau- und Grüntönen, was darauf schließen ließ, dass er mehr als nur einmal auf seiner Reise Prügel erhalten hatte. Vorsichtig tastete sie seinen Rumpf ab und kam zu dem Schluss, dass er zumindest keine inneren Verletzungen davongetragen hatte. Ein paar der tieferen Wunden würde sie versorgen müssen. Diese konnten aber kaum für all das Blut verantwortlich sein, das an seinem Körper klebte. Erleichtert stellte sie fest, dass das meiste davon offenbar von seinen verstorbenen Kameraden stammte. Vielleicht hatte er ja – vergeblich – versucht, deren Blutfluss zu stillen, um sie zu retten.
Oder … er hatte sie selbst getötet.
Nicht jeder, der nach Zalindov geschickt wurde, war unschuldig.
Bei Weitem nicht.
Bemüht, das leichte Zittern ihrer Finger zu unterdrücken, richtete Kiva ihre Aufmerksamkeit nun auf das Gesicht des Manns. Nachdem sie seine lebenswichtigen Organe überprüft hatte, musste sie als Nächstes die dicke Schicht aus Blut und Schmutz abwaschen, die noch immer seine Züge verbarg.
Früher hatte sie mit ihrer Untersuchung stets am Kopf begonnen, doch inzwischen wusste sie aus Erfahrung, dass sie bei Gehirnschäden ohnehin nicht viel ausrichten konnte. Also war sie dazu übergegangen, zunächst alles andere zusammenzuflicken, in der Hoffnung, dass der Patient bei klarem Verstand wäre, wenn er denn aufwachte.
Kivas Blick schweifte vom schmutzigen Gesicht des Manns zum ebenso schmutzigen Waschwasser im Eimer. Sie biss sich auf die Lippe. Nichts widerstrebte ihr mehr, als den Metzger um Hilfe zu bitten, aber sie brauchte frisches Wasser. Nicht nur, um dem Mann Gesicht und Haare zu waschen, sondern auch, weil seine Wunden vor dem Nähen gesäubert werden mussten.
Das Wohl der Patienten steht an erster Stelle, Mäuschen. Ihre Bedürfnisse haben immer Vorrang vor deinen eigenen.
Kiva atmete leise aus, als sie erneut die Stimme ihres Vaters hörte. Diesmal war der Schmerz in ihrem Herzen jedoch beinahe tröstlich, als stünde ihr Vater neben ihr und flüsterte ihr seine Worte direkt ins Ohr.
Es war eindeutig, was ihr Vater an ihrer Stelle getan hätte. Daher griff sie nach dem Eimer und wandte sich zur Tür. Die blassen Augen des Metzgers bohrten sich in ihre und auf seinem geröteten Gesicht breitete sich eine grimmige Vorfreude aus.
»Ich muss –« Sie wurde unterbrochen, ehe sie den Satz beenden konnte.
»Sie werden im Purgatorium gebraucht«, sagte die Wärterin mit den Bernsteinaugen, die plötzlich hinter dem Metzger aufgetaucht war. »Ich übernehme so lange hier.«
Ohne ein Wort, aber dafür mit einem bedauernden Blick, der Kiva einen Schauer über den Rücken jagte, stapfte der Metzger davon. Seine Stiefel knirschten draußen über den Kies.
Kiva wünschte, das Wasser in ihrem Eimer wäre sauber genug, um damit das Gefühl abwaschen zu können, das sein Gesichtsausdruck in ihr hinterlassen hatte. Sie strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr, um ihr Unbehagen zu überspielen, und sah die Wärterin an.
»Ich muss frisches Wasser holen«, vervollständigte sie ihren Satz von eben, weniger ängstlich als dem Metzger gegenüber, dennoch weiterhin leise und unterwürfig.
»Wo ist der Junge?«, fragte die Frau. Als Kiva sie verständnislos anschaute, präzisierte sie: »Der stotternde Rotschopf, der dir sonst immer bei alldem«, sie machte mit ihrer behandschuhten Hand eine Geste, die den ganzen Raum einschloss, »hilft.«
»Tipp?«, entgegnete Kiva. »Den haben sie über den Winter in die Küche versetzt. Da gibt es für ihn mehr zu tun.«
In Wahrheit hätte Kiva sich nach dem Tunnelfieberausbruch sehr wohl über Tipps Hilfe gefreut. Zumal sich die zwei Häftlinge, die ihr an seiner statt zugeteilt worden waren, aus Furcht vor Ansteckung kaum in die Nähe der Patienten wagten. Deshalb musste Kiva die unzähligen Bewohner Zalindovs mehr oder weniger allein versorgen. Selbst im Winter, wenn nur wenige Neulinge eintrafen, war das eine Herausforderung. Sobald der Frühling kam, würde sie obendrein einem Häftling nach dem anderen das »Z« in die Hand ritzen müssen. Aber wenigstens würde bis dahin Tipp auf die Krankenstation zurückgekehrt sein, auch wenn er ihr lediglich mit Kleinigkeiten aushelfen konnte, etwa beim Bettenbeziehen und dabei, alles so sauber zu halten, wie es in dieser schmutzstarrenden Umgebung eben möglich war.
Die Wärterin schien kurz über Kivas Anliegen nachzudenken, während ihr Blick vom blutverschmierten Gesicht des übel zugerichteten Überlebenden über die beiden Toten und schließlich zu dem trüben Wasser im Eimer wanderte.
»Warte hier«, sagte sie schließlich.
Und dann war sie weg.
KAPITEL DREI
Kiva wagte es nicht, sich vom Fleck zu rühren, bis die Wärterin nach ein paar Minuten zurückkam und einen Jungen vor sich her in die Krankenstation scheuchte. Als er Kiva anschaute, erhellte ein breites Zahnlückenlächeln sein sommersprossiges Gesicht.
Mit seinem leuchtend roten Haar und den großen blauen Augen erinnerte Tipp an eine brennende Kerze. Und die Ähnlichkeit war nicht nur rein äußerlich – er loderte geradezu vor Energie und Zuversicht. Obwohl er erst elf Jahre alt war, schien er sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Trotz all des Spotts und Frusts, den er täglich erfuhr, verbreitete Tipp sein Licht, wohin er auch ging. Er hatte für jeden Patienten ein freundliches Wort und eine tröstende Berührung übrig. Selbst den Wärtern gegenüber war er liebenswürdig, egal wie grob und ungeduldig sie mit ihm umsprangen.
Jemandem wie ihm war Kiva noch nie begegnet, schon gar nicht an einem Ort wie Zalindov.
»K-K-Kiva!«, begrüßte Tipp sie und machte Anstalten, sie zu umarmen, als hätten sie sich jahrelang nicht gesehen, nicht bloß wenige Tage. Beim Anblick ihrer Miene zügelte er sich aber. »Dir g-geht’s gut! Als Naari mich g-geholt hat, hab ich mir schon furchtb-b-b–« Er verzog das Gesicht und entschied sich für ein anderes Wort. »Hab ich mir schreckliche S-Sorgen gemacht.«
Kiva sah die Wärterin an. Dabei hätte es sie kaum wundern sollen, dass Tipp ihren Namen kannte, so offen und freundlich, wie er nun einmal war. Naari. Wenigstens musste Kiva sie in Gedanken jetzt nicht mehr als »die Frau mit den Bernsteinaugen« bezeichnen.
»Die Heilerin braucht Hilfe«, erklärte Naari gelangweilt. »Geh und hol sauberes Wasser.«
»Wird gemacht!«, erwiderte Tipp fröhlich und bückte sich gewohnt tollpatschig nach dem Eimer. Kiva rechnete fast damit, dass das blutige Schmutzwasser sich jede Sekunde über den Boden der Krankenstation ergießen würde. Doch bevor sie Tipp zur Vorsicht ermahnen konnte, war der Junge schon aus der Tür.
Angespanntes Schweigen breitete sich aus, bis Kiva sich schließlich räusperte. »Danke. Dafür, dass Sie Tipp geholt haben«, murmelte sie.
Die Wärterin – Naari – nickte kurz.
»Und … auch für neulich Nacht«, fügte Kiva leise hinzu. Sie weigerte sich, auf die Brandwunden an ihrem Arm hinunterzusehen, weigerte sich, die Erinnerung daran aufzufrischen, wie ein paar Wärter sich einen Spaß daraus gemacht hatten, sie zu quälen.
Es war nicht das erste Mal gewesen.
Und auch nicht das schlimmste.
Trotzdem war sie Naari dankbar für ihr Eingreifen.
Naari nickte erneut, so knapp, dass Kiva das Thema wohlweislich fallen ließ. Eines jedoch war seltsam. Seit Kiva den Namen der Wärterin kannte, fühlte sie sich weniger nervös, weniger … eingeschüchtert.
Vorsicht, Mäuschen.
Aber dass sie aufpassen musste, wusste Kiva auch ohne die Warnung ihres Vaters. Naari hatte die Macht, über Leben und Tod zu entscheiden – Kivas Leben und Tod. Sie war eine Aufseherin Zalindovs, eine Mensch gewordene Waffe, das personifizierte Verderben.
Im Geiste versetzte Kiva sich einen Tritt, eilte zu dem Mann auf dem Behandlungstisch und fühlte seinen Puls. Noch immer schwach, doch wenigstens ein bisschen stärker als zuvor.
Tipp kehrte in Rekordgeschwindigkeit vom Brunnen zurück und reichte ihr den Eimer, der bis zum Rand mit frischem, sauberem Wasser gefüllt war.
»W-was ist denn mit denen p-passiert?« Er deutete auf die beiden Toten, während Kiva sich daranmachte, dem Überlebenden behutsam das Gesicht zu waschen.
»Keine Ahnung«, antwortete sie mit einem unauffälligen Blick in Naaris Richtung. Hatte sie etwas dagegen, wenn sie und Tipp sich unterhielten? Aber die Aufseherin wirkte unverändert gleichgültig, also fuhr Kiva fort: »Dieser hier war allerdings von oben bis unten mit ihrem Blut bedeckt.«
Tipp beäugte den Mann nachdenklich. »G-glaubst du, er h-hat sie …?«
Kiva tauchte den Lappen ins Wasser und wrang ihn aus. »Was spielt das für eine Rolle? Irgendwer scheint jedenfalls überzeugt zu sein, dass er etwas verbrochen hat, sonst wäre er nicht hier.«
»Ist bestimmt trotzdem eine spannende G-Geschichte«, sagte Tipp und hüpfte zu Kivas Arbeitstisch, um die Utensilien zu holen, die sie als Nächstes brauchen würde. Kiva war gerührt von seiner Hilfsbereitschaft, achtete aber sorgsam darauf, sich nichts anmerken zu lassen, als sich Tipp wieder zu ihr umdrehte.
Freundschaften waren immer ein Risiko in Zalindov. Zuneigung brachte einem nichts als Leid ein.
»Und selbst wenn nicht, würdest du eine daraus machen«, entgegnete sie, ehe sie sich dem Haar des Manns zuwandte.
»Mama hat immer g-gesagt, aus mir würde mal ein großer B-Barde werden«, verkündete Tipp grinsend.
Kivas Finger krampften sich um den Lappen und ihr Herz wurde schwer, als sie zum ersten Mal seit drei Jahren an Tipps Mutter dachte. Ineke war unter dem Vorwurf, einer Edeldame Schmuck gestohlen zu haben, nach Zalindov geschickt worden. Der damals achtjährige Tipp hatte sich so fest an ihre Hand geklammert, dass die Soldaten ihn kurzerhand mit in den Wagen geworfen hatten. Sechs Monate später hatte Ineke sich im Schlachthaus an einem Messer geschnitten und als die Aufseher ihr endlich die Erlaubnis erteilt hatten, sich mit der Wunde auf die Krankenstation zu begeben, war es längst zu spät gewesen. Die Entzündung hatte sich bis zum Herzen ausgebreitet und Ineke war innerhalb weniger Tage gestorben.
Kiva hatte Tipp in jener Nacht im Arm gehalten, während seine stummen Tränen ihr Hemd tränkten.
Am nächsten Morgen hatte der kleine Junge das verquollene Gesicht gehoben, sie aus rot geweinten Augen angesehen und nur einen einzigen Satz gesagt: Sie würde wollen, d-dass ich weiterlebe.
Und das tat er. Er lebte, mit jeder Faser seines Körpers.
Kiva wünschte sich nichts mehr, als dass er das irgendwann einmal außerhalb von Zalindov tun würde.
Aber Träume waren etwas für Dummköpfe. Und Kiva war der größte Dummkopf von allen.
Wieder konzentrierte sie sich auf den Mann vor ihr und begann, vorsichtig sein schmutziges Haar zu entwirren. Es war nicht lang – was hilfreich war –, allerdings auch nicht kurz. Kiva überlegte, ob sie die Strähnen abrasieren musste, doch sie entdeckte keinerlei Anzeichen für Parasitenbefall. Nachdem sie Blut und Dreck herausgewaschen hatte und das Haar zu trocknen begann, kam ein üppig glänzender Goldton zum Vorschein, irgendwo zwischen Blond und Hellbraun.
Gesundes Haar, gesunder Körper. Beides eine Seltenheit in Zalindov.
Kiva fragte sich, was für ein Leben dieser Mann geführt haben mochte und warum es eine solch dramatische Wendung genommen hatte.
»Du f-fällst jetzt hoffentlich nicht in Ohnmacht, oder?«, erkundigte sich Tipp, der mit einer Knochennadel und einer Spule Katzendarm in der Hand neben ihr aufgetaucht war.
»Was?«
Tipp zeigte auf den Mann. »Ob d-du in Ohnmacht fällst. Weil der so g-gut aussieht.«
Kiva runzelte die Stirn. »Weil der so …« Sie musterte den Mann und erst da fiel es auch ihr auf. »Oh.« Dann zog sie die Brauen zusammen. »So ein Unsinn.«
Tipps Mundwinkel zuckten. »K-kannst du aber ruhig. Ich f-fang dich auf.«
Kiva bedachte ihn mit einem finsteren Blick und öffnete den Mund, um ihn zurechtzuweisen. Doch bevor sie die Gelegenheit dazu bekam, erschien auf ihrer anderen Seite Naari, die sich ihnen vollkommen lautlos genähert hatte.
Kiva entfuhr ein erschrockenes Quieken. Die Wärterin starrte allerdings bloß unverwandt auf den Mann vor ihnen auf dem Tisch.
Nein, nicht den Mann. Jetzt, da seine Gesichtszüge erkennbar waren, registrierte Kiva, dass er noch nicht vollends erwachsen war. Er war aber auch kein Junge mehr, vielleicht achtzehn oder neunzehn – ein, zwei Jahre älter als sie selbst.
Da Naari ihn weiterhin anstarrte, betrachtete Kiva ihn genauer. Gewölbte Augenbrauen, gerade Nase, lange Wimpern … alles so ebenmäßig, dass jeder Maler darüber ins Schwärmen geraten wäre. Über dem linken Auge verzeichnete Kiva eine Wunde, die genäht werden musste. Sie war klein, trotzdem vermutlich tief genug, um eine Narbe in der honigfarbenen Haut zu hinterlassen. Davon abgesehen war das Gesicht des jungen Manns unversehrt. Ganz im Gegensatz zu seinem Körper, wie Kiva bereits beim Waschen festgestellt hatte. Zusätzlich zu den frischen Wunden, die er offenbar von seiner Reise nach Zalindov davongetragen hatte, war sein Rücken mit einem Zickzackmuster aus Narben überzogen. Es erinnerte Kiva an ihre eigenen und die vieler anderer Häftlinge, die Bekanntschaft mit der Peitsche gemacht hatten. Die Narben des Manns waren jedoch nicht die charakteristischen Spuren einer neunschwänzigen Katze. Kiva hatte keine Ahnung, welche Art von Peitsche derartige Wülste hinterließ.
»Fällst du etwa in O-Ohnmacht, Naari?«
Tipps Stimme riss Kiva aus ihren Gedanken. Erschrocken sog sie die Luft ein.
Kein Häftling durfte von sich aus das Wort an die Wärter richten.
Ganz zu schweigen davon, sich solche Frechheiten erlauben.
Nach dem Tod seiner Mutter hatte Kiva das Beste getan, um auf Tipp achtzugeben, aber auch ihr Einfluss hatte seine Grenzen. Und jetzt …
Naaris Blick löste sich von dem jungen Mann und ihre Augen wurden schmal, während sie zuerst Tipps schelmisches Grinsen und gleich darauf die blanke Furcht in Kivas Gesicht zur Kenntnis nahm. Doch alles, was sie sagte, war: »Jemand muss ihn festhalten. Für den Fall, dass er aufwacht.«
Kiva stieß den angehaltenen Atem aus und ihr wurde beinahe schwindelig vor Erleichterung, als Naari mit dem Kinn auf das Instrument in Tipps anderer Hand deutete. Es war das Skalpell mit der weiß glühenden Spitze.
Natürlich. Schließlich musste Kiva nicht nur die Verletzungen des jungen Manns versorgen, sondern ihm auch die Markierung ins Fleisch ritzen. Und die Wärterin hatte schon entschieden, was in welcher Reihenfolge zu erledigen war. Daher griff Kiva als Nächstes nach dem Skalpell statt nach Nadel und Faden. Die Wunden würden warten müssen, bis die Frau sich – hoffentlich – zurück auf ihren Posten an der Tür begeben hatte.
»Ich halte ihn f-fest«, bot Tipp an und ging um Kiva herum auf die andere Seite des Tischs. Anscheinend war ihm überhaupt nicht bewusst, welcher Gefahr er gerade wie durch ein Wunder entronnen war. Kivas warnender Blick perlte wirkungslos an ihm ab.
»Nimm du seine Beine«, befahl Naari. »Der Kerl sieht ziemlich kräftig aus.«
Kräftig. Allein bei dem Wort zog sich Kiva der Magen zusammen. Dieser Junge würde niemals in der Küche oder einer der Werkstätten landen. Jemandem wie ihm stand körperliche Schwerstarbeit bevor.
Damit blieben ihm sechs Monate. Ein Jahr, wenn er Glück hatte. Dann wäre er tot.
Aber Kiva konnte es sich nicht leisten, Mitleid mit ihm zu empfinden. In den letzten zehn Jahren hatte sie so viel Elend gesehen. Da fiel das Schicksal eines Einzelnen kaum mehr ins Gewicht. Dieser Häftling war nichts als eine Nummer – D24L103, dem Metallreif zufolge, den die Geleitwachen bereits an seinem Handgelenk befestigt hatten.
Als Kiva das Skalpell auf seinen linken Handrücken aufsetzte, spürte sie erneut dieses Jucken an ihrem Oberschenkel. Entschlossen rief sie sich in Erinnerung, warum sie etwas tat, was gegen sämtliche Prinzipien der Heilkunst verstieß.
Uns geht es gut. Bleib am Leben. Wir werden kommen.
Seit der letzten Nachricht hatte sie nichts mehr von ihrer Familie gehört und sie rechnete auch nicht vor dem Frühling damit, wenn wieder ein stetiger Strom an Neulingen das Gefängnis erreichen würde. Umso fester klammerte sie sich an den Wortlaut der jüngsten Botschaft, an den Zuspruch, die Forderung, das Versprechen darin.
Kiva tat, was man von ihr verlangte – sie heilte Menschen, doch sie fügte ihnen auch unnötiges Leid zu. Alles, um am Leben zu bleiben. Alles, um bis zu dem Tag durchzuhalten, an dem ihre Familie sie retten würde. Dem Tag, an dem sie endlich fliehen könnte.
Diesen jungen Mann zu markieren, war vergleichsweise erträglich. Da er bereits ohnmächtig war, musste sie zumindest nicht mit ansehen, wie sich sein Gesicht vor Schmerz verzerrte, sobald die heiße Klinge in sein Fleisch fuhr. Musste ihn nicht unter ihrer Berührung zittern fühlen, ihm nicht von den Augen ablesen, dass er sie für ein Ungeheuer hielt.
Tipp wusste, wie sie empfand. Er hatte Kiva mehr Häftlinge markieren sehen, als er zählen konnte, und ihr dennoch nie etwas anderes als tiefes Verständnis dafür entgegengebracht.
Die Wärter dagegen scherten sich nicht um solcherlei Gewissenskonflikte. Sie interessierten sich lediglich dafür, dass Kiva ihre Pflicht erfüllte. Selbst Naari, so neu sie auch sein mochte, stellte keine Ausnahme dar, obwohl sie immerhin als Einzige einen Anflug von Abscheu zeigte. Ihr Unterkiefer war sichtlich angespannt, als sie die Schultern des jungen Manns auf den Behandlungstisch drückte und Kiva die Klinge in sein Fleisch grub.
Sie arbeitete zügig, während Tipp mit einem Tiegel Ballicoharz und einem frischen Leinenverband bereitstand. Naari, die offenbar darauf vertraute, dass der Patient sich nicht plötzlich bewegen und sein frisches »Z« ruinieren würde, zog sich wortlos auf ihren Posten an der Tür zurück.
»Zu schade, dass er jetzt diesen K-K-Kratzer im Gesicht hat«, bemerkte Tipp. Kiva hatte dem Mann unterdessen die Hand verbunden und machte sich nun daran, die übrigen Wunden an seinem Körper zu nähen und sie mit dem antibakteriellen Harz zu bestreichen.
»Wieso?«, murmelte sie halb in Gedanken.
»Weil er doch so h-hübsch ist.«
Kiva hielt im Nähen inne. »Hübsch oder nicht, er ist immer noch ein Mann, Tipp.«
»Na und?«
»Die meisten Männer sind Mistkerle.«
Das darauffolgende Schweigen wurde nur unterbrochen von einem – beinahe belustigten – Schnauben seitens Naaris, bevor Tipp anmerkte: »Ich bin auch ein Mann. Und ich bin kein Mistkerl.«
»Du bist noch jung«, entgegnete Kiva. »Wart’s ab.«
Tipp, der das offenbar für einen Witz hielt, kicherte. Kiva klärte das Missverständnis nicht auf. Natürlich hoffte sie von ganzem Herzen, dass Tipp immer so liebenswürdig und rücksichtsvoll bleiben würde, wie er heute war. Doch ihrer Erfahrung nach standen die Chancen dafür schlecht. Ihr Vater war der einzige Mann, für den Kiva jemals Respekt empfunden hatte. Aber der … war auch einfach unvergleichlich gewesen.
Um zu verhindern, dass die Wehmut sie schon wieder überwältigte, vernähte Kiva rasch und effizient die restlichen Wunden am Rumpf des jungen Manns und vergewisserte sich, dass seine Beine unversehrt waren, ehe sie sich seinem Gesicht zuwandte.
In dem Moment, als sie sich mit der Knochennadel über ihn beugte, öffnete er die Augen.
KAPITEL VIER
Kiva stolperte einen Schritt nach hinten, als der Mann sich ruckartig aufsetzte. Sie war sich nicht ganz sicher, wer von ihnen sich am meisten erschreckt hatte – sie, der Mann, Tipp oder die Aufseherin.
»Was zum –«, stammelte der Mann und schaute hektisch hin und her. »Wer – Wo –«
»Ganz ruhig.« Kiva hob beschwichtigend die Hände. Da bemerkte er die Knochennadel, dann das Blut an ihren Armen – sein Blut. Und in der nächsten Sekunde sprang er vom Tisch und wich zurück wie ein verängstigtes Tier.
Sie spürte, wie Naari sich hinter ihr in Bewegung setzte. Abermals versuchte Kiva, den Mann zu beruhigen, damit die Situation nicht eskalierte. »Wir sind hier in Zalindov. Du warst verletzt, als du angekommen bist. Ich habe«, sie hob ihre blutverschmierten Hände, »dich wieder zusammengeflickt.«
Da entdeckte der Mann die Wärterin. Seine Augen waren blau, wie Kiva jetzt auffiel, mit einem goldenen Kranz um die Pupillen. Es waren außergewöhnliche Augen, anders als alles, was Kiva je gesehen hatte.
Außergewöhnliche Augen in einem außergewöhnlich schönen Gesicht. Spätestens jetzt, da er wach war, bestand daran kein Zweifel mehr. Trotzdem blieb Kiva bei dem, was sie Tipp gesagt hatte: Sie hatte nicht vor, deswegen in Ohnmacht zu fallen.
Beim Anblick der bewaffneten Wärterin, die auf ihn zukam, schien der Gefangene ein wenig in sich zusammenzusacken, als hätte er endlich begriffen, wohin man ihn gebracht hatte. Vielleicht erinnerte er sich sogar, warum er hier war. Er blieb stehen – nicht dass er noch viel Platz zum Ausweichen gehabt hätte, da er bereits gegen den Arbeitstisch stieß – und wandte den Kopf von Naari zu Tipp. Letzterer beobachtete das Geschehen aus weit aufgerissenen Augen und mit offenem Mund. Schließlich sah der Neuling an sich selbst hinab, registrierte seine verbundenen Wunden, auch die an der Hand, und merkte, dass er so gut wie nackt war. Anscheinend kam er zu einem Entschluss, denn er wandte sich Kiva zu.
»Entschuldige«, sagte er mit ruhiger, voller Stimme. »Ich wollte niemanden erschrecken.«
Kiva blinzelte. Einmal. Zweimal.
»Ähm … schon gut«, stammelte sie verwirrt. Immerhin war das Erste, was er beim Aufwachen gesehen hatte, die blutige Nadel in ihrer Hand gewesen. Wenn überhaupt, hatte wohl eher sie ihn erschreckt. »Setz dich besser wieder. Dann kann ich mit der Wunde an deiner Stirn weitermachen.«
Er berührte seine Augenbraue und zuckte zusammen, als er die Schwellung ertastete. Nachdenklich betrachtete er das Blut an seinen Fingern. Kiva biss sich auf die Lippe, um sich eine Rüge zu verkneifen. Jetzt würde sie die Wunde vor dem Nähen noch einmal säubern müssen.
Mit einem Mal wich jegliche Farbe aus dem Gesicht des jungen Manns, als hätten ihn der Schock und die Erschöpfung schließlich doch eingeholt. Kiva stürzte in derselben Sekunde auf ihn zu wie Tipp und gemeinsam fingen sie den Mann auf, während seine Knie unter ihm nachgaben.
»K-k-keine Angst«, sagte Tipp, der ihrem Patienten kaum bis zur Brust reichte, aber trotzdem einen beachtlichen Teil seines Gewichts trug. »Wir halten dich.«
Kiva hatte derweil ihre liebe Mühe, den Mann zu stützen, ohne ihn aus Versehen mit ihrer Nadel zu stechen. Sie wollte ihm nicht noch mehr Schaden zufügen.
»Tut mir leid.« Seine Stimme klang jetzt dünner als zuvor. »Mir – mir geht es nicht so gut.« Ihm entwich ein leises Stöhnen.
»Tipp!« Kiva bellte seinen Namen wie einen Befehl.
Der Junge wusste genau wie sie, was dieses Stöhnen bedeutete, und eilte los, sodass Kiva den Patienten plötzlich allein aufrecht halten musste. Es gelang ihr, ihn das letzte Stück zurück zum Tisch zu schieben und ihn an die Kante zu lehnen, kurz bevor Tipp mit einem Eimer zur Stelle war. Hastig schob Kiva dem Mann das Behältnis zu und prompt erbrach er sich unter weiteren gequälten Lauten.
»Das war k-knapp«, meinte Tipp grinsend.
Kiva antwortete nicht, sondern hielt bloß den Eimer fester, während der Mann sich darüber krümmte.
Überrascht war sie nicht – Kopfverletzungen gingen häufig mit Übelkeit einher. Allerdings konnte sie ihm, solange er sich erbrach, noch keinen Mohnsaft einflößen. Und die Wunde ohne Betäubung zu nähen, würde unerträgliche Schmerzen verursachen. Wäre der Mann doch nur ein paar Minuten später aufgewacht, dann wären ihm die letzten Schritte ihrer Behandlung erspart geblieben.
Als er nur noch trocken würgte, half Kiva ihm zurück auf den Tisch und reichte den Eimer an Tipp weiter, der wortlos damit nach draußen eilte.
»Tut mir leid.« Der junge Mann klang jetzt noch kläglicher als zuvor und war besorgniserregend blass.
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen«, erwiderte Kiva, ehe sie sich davon abhalten konnte. Sollte er doch, wenn er unbedingt wollte. Was hatte es sie zu kümmern, was er sagte oder tat?
Erst jetzt fiel ihr auf, dass Naari auf halbem Weg zwischen ihrem Posten und ihnen stehen geblieben war, als könnte sie sich nicht entscheiden, ob von dem Mann Gefahr ausging oder nicht. Da er im Moment jedoch nicht einmal aufrecht sitzen konnte, machte Kiva sich keine Sorgen und warf der Aufseherin einen entsprechenden Blick zu. Naari blieb zwar, wo sie war, aber ihre Schultern entspannten sich ein wenig.
»Ich versorge jetzt deine Wunde und gebe dir etwas gegen die Schmerzen«, wandte Kiva sich an ihren Patienten. »Danach kannst du gehen.«
Sie machte sich erneut daran, die Wunde zu säubern – dankbar, dass der junge Mann dabei die Lider geschlossen hielt –, und überlegte kurz, wie sie den Schnitt am besten vernähen sollte. Als Tipp mit dem ausgewaschenen Eimer zurückkehrte, wies sie ihn leise an, frische Kleider holen zu gehen, und er verschwand wieder.
Kiva wusste, dass die Prozedur schmerzhaft sein würde, egal wie vorsichtig sie dabei war. »Versuch stillzuhalten. Das wird jetzt ein bisschen wehtun.«
Die Augen des jungen Manns öffneten sich und sein blau-goldener Blick traf auf Kivas grünen. Lautlos schnappte sie nach Luft. Sekunden … Minuten … Kiva hätte nicht sagen können, wie viel Zeit verging, bis es ihr gelang, sich loszureißen und ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Der Mann sah ihr unverwandt ins Gesicht, während sie den ersten Stich setzte.
Ein winziges Zucken war seine einzige Reaktion.
Kivas Herz aber schien plötzlich doppelt so schnell zu schlagen.
Rein, raus, zurück, Knoten.
Rein, raus, zurück, Knoten.
Rein, raus, zurück, Knoten.
Der vertraute Rhythmus ließ sie ein wenig zur Ruhe kommen, auch wenn der Mann sie weiterhin nicht aus den Augen ließ. Doch damit konnte sie leben, solange ihn das davon abhielt, sich vor Schmerzen zu winden.
»Fast fertig«, beruhigte sie ihn, so wie sie es bei jedem Patienten getan hätte.
»Keine Sorge, ich spüre kaum was«, entgegnete er. Dann fügte er hinzu: »Du machst das wirklich gut.«
»Sie hat ja auch eine M-Menge Übung«, verkündete Tipp, der unbemerkt wieder aufgetaucht war. Kiva, deren Nadel glücklicherweise gerade in der Luft verharrte, fuhr zusammen.
»Tipp, wie oft muss ich dir noch sagen –«
»Tut mir leid! Tut mir leid! Ich v-vergesse einfach immer, wie schreckhaft du bist.«
Schreckhaft. Vielleicht mochte Kiva ein bisschen angespannt sein, allerdings war das wohl kaum ein Wunder, wenn man im grausamsten Gefängnis der Welt saß.
»Fertig«, sagte sie schließlich und schnitt den Faden ab, bevor sie behutsam etwas Ballicoharz auf die Wunde strich. »Bitte hilf ihm, sich aufzusetzen, Tipp.«
Letzteres fügte sie ganz beiläufig hinzu und sie hoffte inständig, dass der Junge nicht fragte, warum sie dem Mann nicht selbst hochhalf. Denn normalerweise hätte sie das getan. Doch ihr Puls hatte sich noch immer nicht wieder beruhigt und das bloß, weil sich ihr Blick mit dem des Neulings gekreuzt hatte. Daher wollte sie lieber möglichst viel Distanz zu ihm wahren und erst recht vermeiden, seine nackte Haut zu berühren.
»Ich hole nur schnell den Mohnsaft, dann kannst du –«
»Keinen Mohnsaft.«
Er stieß die zwei Worte so scharf hervor, dass Kiva sich überrascht zu ihm umdrehte. »Du sollst ja nicht viel davon nehmen, aber es würde gegen die Schmerzen helfen. Deinen Geist beruhigen und –« Sie machte eine vage Geste, die seinen ganzen geschundenen Körper einschloss. »Und alles andere auch.«
»Keinen Mohnsaft«, wiederholte er unnachgiebig.
»Wie du meinst«, entgegnete sie. »Was ist mit Engelsstaub? Ich könnte –«
»Auf keinen Fall«, lehnte er ab und war mit einem Mal wieder leichenblass. »Ich – ich will gar nichts. Es wird schon gehen. Danke.«
Kiva musterte ihn, seine steife Körperhaltung, seine angespannten Muskeln. Als würde er sich zur Flucht bereit machen. Sie fragte sich, ob ihm unter dem Einfluss eines der beiden Mittel schon einmal etwas zugestoßen war oder er womöglich zu viel davon verabreicht bekommen hatte. Was auch immer der Grund sein mochte, sie konnte ihn kaum dazu zwingen, etwas zu nehmen, also musste sie seine Entscheidung akzeptieren. Auch wenn sie wusste, dass er sich damit keinen Gefallen tat.
»Na gut«, sagte sie. »Aber wenigstens ein bisschen Pfefferwurzelpulver solltest du nehmen. Das wird die Schmerzen ein kleines bisschen lindern.« Sie überlegte kurz. »Ich könnte auch noch etwas Weidenrinde gegen die Übelkeit daruntermischen. Und Gelbnuss. Die verleiht dir Kraft für … das, was kommt.«
Der junge Mann zog eine goldbraune Augenbraue in die Höhe, doch er bat sie weder, ihre letzte Bemerkung näher zu erläutern, noch erhob er erneut Protest gegen ihre Behandlungsvorschläge. Er nickte bloß und langsam kehrte etwas Farbe in seine Wangen zurück.
Ein Blick von Kiva und Tipp begann sofort, die nötigen Zutaten zusammenzusuchen. Pfefferwurzelpulver eignete sich eigentlich eher für die lokale Anwendung, zur Behandlung einzelner Wunden. Als Paste und oral eingenommen betäubte es dagegen die Schmerzrezeptoren im ganzen Körper, zumindest leicht. Allerdings hatte Kiva es noch nie zuvor mit Weidenrinde und Gelbnuss gemischt. Sie rümpfte die Nase über den Geruch. Dann wandte sie sich an den jungen Mann, in der Erwartung, dass er sich doch noch für den nussigen Mohnsaft oder die leichte Karamellnote von Engelsstaub entscheiden würde, da beides um einiges angenehmer schmeckte.
Stattdessen griff er wortlos nach dem Steinkrug und stürzte das Gebräu, ohne zu zögern, hinunter.
Kiva bemerkte Tipps angewidertes Gesicht und musste sich beherrschen, um nicht ebenfalls eine Grimasse zu ziehen. Ihr Patient hingegen zeigte, abgesehen von einem leichten Erschaudern, abermals keine Reaktion.
»Die, äh, Wirkung sollte in ein paar Minuten einsetzen«, erklärte sie verblüfft. Sie deutete auf die grauen Kleider, die Tipp über die Kante des Behandlungstischs gehängt hatte. »Die sind für dich.«
Während der junge Mann sich mit Tipps Hilfe umzog, wandte Kiva sich ab und ging mit dem leeren Krug zu ihrem Arbeitstisch. Als sie alles zurück an seinen Platz geräumt hatte und nicht länger so tun konnte, als hätte sie Wichtigeres zu tun, drehte sie sich wieder um. Der Mann stand fertig angezogen da und alle, Naari mit eingeschlossen, schauten Kiva erwartungsvoll an.
»Sind ab jetzt nicht Sie zuständig?«, wandte Kiva sich an die Wärterin.
Wieder fragte sie sich, wie es kam, dass dieser junge Mann sie dermaßen aus dem Konzept brachte. Ihr sonst so zuverlässiger Selbsterhaltungstrieb schien völlig außer Kraft gesetzt. Normalerweise hätte sie es niemals gewagt, eine Aufseherin an ihre Pflichten zu erinnern. Immerhin hatte Kiva nicht zehn Jahre an diesem Ort überlebt, weil sie leichtsinnig war.
Naaris dunkle Augenbrauen hoben sich kaum merklich, als ahnte sie, was in Kivas Kopf vor sich ging – dann nickte sie. Und noch während Kiva in Gedanken begann, sich eine Entschuldigung zurechtzulegen, um nicht doch noch bestraft zu werden, sagte die Frau: »Du wirst ihn einweisen.«
Überrascht sah Kiva auf. Es war lange her, dass sie mit der Einweisung eines neuen Häftlings betraut worden war. Früher, als sie noch in der Wäscherei gearbeitet hatte, war sie ein- oder zweimal dazu verpflichtet worden, seit sie ihre Position als Gefängnisheilerin angetreten hatte, allerdings nicht mehr.
»Aber … wie soll ich …«, stammelte sie, ehe sie erneut ansetzte. »Ich muss mich doch um meine Patienten kümmern.«
Naari ließ den Blick durch die leere Krankenstation schweifen. »Ich würde meinen, deine Patienten«, sie nickte in Richtung der beiden Toten, »können dich eine Weile entbehren.«
Natürlich hatte Kiva von den Patienten im Quarantänebereich gesprochen, doch Widerspruch schien zwecklos. Also ließ sie es dabei bewenden. Die Einweisung würde ohnehin nicht lange dauern. Sie würde den jungen Mann einmal im Gefängnis herumführen, in Erfahrung bringen, wo er untergebracht war, und ihn danach bis zum nächsten Tag seinen neuen Zellengenossen überlassen. Morgen würde er seine Arbeit zugeteilt bekommen und damit wäre ihre Aufgabe erledigt.
»Gut«, sagte sie und wischte sich die Hände – an denen noch immer das inzwischen getrocknete Blut des Manns klebte – notdürftig an einem feuchten Lappen ab. Dann trat sie zur Tür. »Komm mit.«
Als Tipp Anstalten machte, ihnen zu folgen, hielt Kiva ihn zurück. »Würdest du bitte zu Mot gehen und ihm sagen, dass er jemanden zur Abholung schicken soll?« Sie deutete mit dem Kinn auf die toten Männer.
Verlegen trat der Junge von einem Fuß auf den anderen und wich ihrem Blick aus. »M-Mot ist gerade nicht so g-gut auf mich zu sprechen.«
Kiva blieb stehen. »Warum denn das?«
Tipp ließ beschämt den Kopf hängen, ehe er flüchtig zu Naari hinüberspähte. Kiva begriff, dass es schlimm sein musste, wenn er sich scheute, ihr in Gegenwart der Wärterin davon zu erzählen.
Schließlich seufzte sie. »Schon gut, ich gehe selbst. Könntest du stattdessen für mich nach den Quarantänepatienten sehen? Aber vergiss nicht, eine Maske aufzusetzen und ihnen nicht zu nahe zu kommen.«
»Ich d-dachte, die hätten nur T-Tunnelfieber.«
»Man kann nie vorsichtig genug sein«, ermahnte Kiva ihn, bevor sie die Krankenstation verließ. Der junge Mann folgte ihr.
Und … Naari ebenfalls.
Kiva blinzelte verwirrt. Normalerweise blieben die Aufseher auf ihren Posten in den Werkstätten. Selbst die Krankenstation betraten sie nur selten, zumindest bis vor den Unruhen der letzten Wochen. Noch nie hatte Kiva erlebt, dass einer von ihnen einen Häftling über den Gefängnishof eskortierte. Weil es schlichtweg nicht nötig war. Zalindov wurde von unzähligen Wärtern gesichert, die auf den Wachtürmen standen oder über das Gelände patrouillierten. Außerdem gab es Hunde, die dazu abgerichtet worden waren, einem Menschen auf einen einzigen Pfiff hin das Fleisch von den Knochen zu reißen.
Naaris Gegenwart machte Kiva nervös und unweigerlich fragte sie sich, ob der junge Mann womöglich doch gefährlicher war, als er wirkte. Noch ein Grund, seine Einweisung so schnell wie möglich hinter sich zu bringen.
Nach kurzem Überlegen wandte Kiva sich nach links und marschierte auf das Nachbargebäude zu. Der Kies unter ihren Füßen knirschte in der frühabendlichen Stille. Die anderen Gefangenen würden sich bald zurück in ihre Zellen begeben, wenn sie nicht schon dort waren. Im Moment jedoch war alles ruhig. Beinahe friedlich.
»Wie heißt du?«
Kiva hob ruckartig den Kopf und begegnete dem fragenden Blick des jungen Manns neben ihr. Sie konnte nur staunen, wie gelassen er wirkte – trotz seines grün und blau geschlagenen, mit Wunden übersäten Körpers, trotz dieser neuen, alles andere als einladenden Umgebung.
Sie dachte an ihren eigenen ersten Tag in Zalindov zurück, an den Moment, in dem sie die Krankenstation verlassen hatte, die frisch bandagierte Hand an die Brust gepresst, in dem Bewusstsein, dass sie auf einen Schlag ihre Familie, ihre Freiheit und ihre Zukunft verloren hatte. Damals hatte sie niemanden nach seinem Namen gefragt. Das war das Letzte, was ihr eingefallen wäre.
»Du kannst mich Heilerin nennen«, antwortete sie.
»Das ist kein Name.« Er wartete kurz, ehe er hinzufügte: »Ich bin Jaren.«
»Nein, bist du nicht«, entgegnete sie und schaute wieder geradeaus. »Du bist D24L103.«
Sollte er sehen, was er mit dieser Information anfing. Damit, dass – und vor allem warum – sie anscheinend Gelegenheit gehabt hatte, sich die Nummer auf seinem Erkennungsarmreif einzuprägen. Er musste schließlich spüren, musste ahnen, warum seine Hand verbunden war und so schmerzhaft pochte. Schon lange, bevor sie selbst hier gelandet war, hatte Kiva bereits davon gehört, dass die Gefangenen von Zalindov markiert wurden. Damals war sie gerade erst sieben Jahre alt gewesen. Dass diesem jungen Mann – diesem Jaren – vor seiner Verhaftung noch nie etwas über das berüchtigte »Z« zu Ohren gekommen war, war mehr als unwahrscheinlich.
Sie wartete darauf, dass er wütend wurde, seinem Abscheu über sie freien Lauf ließ, so wie die meisten es bereits während des Eingriffs taten. Der Mann war dabei jedoch bewusstlos gewesen, also wäre das hier eigentlich seine Gelegenheit, das nachzuholen. Kiva hätte es nicht gekümmert. Es gab nichts, was er ihr an den Kopf hätte werfen können, das sie nicht schon einmal gehört hatte.
»D24L103«, wiederholte er schließlich und betrachtete die Abfolge aus Buchstaben und Ziffern auf seinem Metallreif. Dann musterte er den Verband daneben, als könnte er durch den Stoff hindurch die drei tiefen Schnitte in seinem Fleisch erahnen. »Das ist aber ein ganz schöner Zungenbrecher. Bleib doch lieber bei Jaren.«
Kiva fuhr so abrupt zu ihm herum, dass sie aus dem Tritt geriet. Seine blau-goldenen Augen funkelten belustigt.
Belustigt.
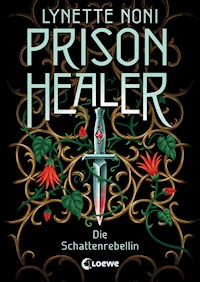

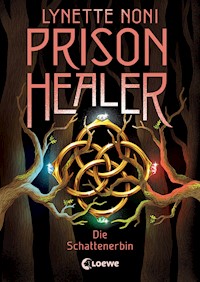













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












