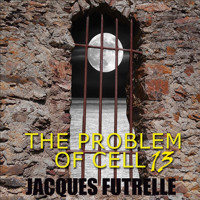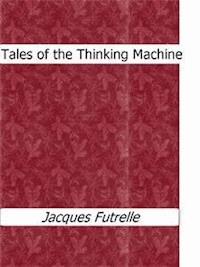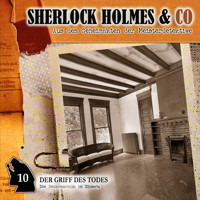PROFESSOR VAN DUSEN: DAS RÄTSEL VON ZELLE 13 UND WEITERE FÄLLE DER DENKMASCHINE E-Book
Jacques Futrelle
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Angenommen, Sie wären um das Jahr 1900 in eines der sichersten Gefängnisse Amerikas gesperrt; Sie säßen in Einzelhaft mit regelmäßigen Kontrollen durch den Aufseher, der weiß (denn Sie haben es ihm erzählt), dass Sie innerhalb einer Woche auszubrechen gedenken. Auf welchem logischen, ja, genialen Weg würden Sie den Ausbruch wagen? Dies ist die Situation, mit der Professor Augustus S. F. X. Van Dusen, genannt die Denkmaschine, in DAS RÄTSEL VON ZELLE 13 konfrontiert wird. Aber wie stets ist er in Hochform und dem Problem gewachsen. Der brillante, aber reizbare Wissenschaftler – mit seiner Vorliebe für unerbittliche Logik – tritt weiteren mysteriösen Situationen und Kriminalfällen mit Köpfchen entgegen und benutzt seine scharfsinnige Logik, um diese auf elegante Weise zu lösen... Professor Augustus van Dusen, der amerikanische Sherlock Holmes, wurde von zu Beginn des 20. Jahrhunderts von dem US-Schriftsteller Jacques Futrelle erdacht, der im Jahr 1912 beim Untergang der TITANIC ums Leben kam. Heutzutage sind die Abenteuer van Dusens in erster Linie dem Hörspiel-Publikum bekannt und erfreuen sich größter Beliebtheit. Der Apex-Verlag veröffentlicht DAS RÄTSEL VON ZELLE 13 UND WEITERE FÄLLE DER DENKMASCHINE als durchgesehene Neuausgabe und macht die Original-Erzählungen dem deutschen Lesepublikum erstmals seit über vierzig Jahren wieder zugänglich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JACQUES FUTRELLE
Professor Van Dusen:
Das Rätsel von Zelle 13
und weitere Fälle der Denkmaschine
Erzählungen
Impressum
Die in dieser Zusammenstellung enthaltenen Texte sind gemeinfrei.
Copyright dieser Ausgabe © by Apex-Verlag.
Übersetzung: Pociav und Roberto de Hollanda (Original-Zusammenstellung).
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg.
Cover: Christian Dörge/123rf.
Satz: Apex-Verlag.
Verlag: Apex-Verlag, Winthirstraße 11, 80639 München.
Verlags-Homepage: www.apex-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
DAS RÄTSEL VON ZELLE 13
DIE KRISTALLKUGEL
DAS RÄTSEL DES GESTOHLENEN RUBENS
DAS VERSCHWUNDENE COLLIER
DAS UNSICHTBARE AUTOMOBIL
EIN PERFEKTES ALIBI
DIE VERHÄNGNISVOLLE CHIFFRE
Das Buch
Angenommen, Sie wären um das Jahr 1900 in eines der sichersten Gefängnisse Amerikas gesperrt; Sie säßen in Einzelhaft mit regelmäßigen Kontrollen durch den Aufseher, der weiß (denn Sie haben es ihm erzählt), dass Sie innerhalb einer Woche auszubrechen gedenken. Auf welchem logischen, ja, genialen Weg würden Sie den Ausbruch wagen?
Dies ist die Situation, mit der Professor Augustus S. F. X. Van Dusen, genannt die Denkmaschine, in Das Rätsel von Zelle 13 konfrontiert wird. Aber wie stets ist er in Hochform und dem Problem gewachsen. Der brillante, aber reizbare Wissenschaftler – mit seiner Vorliebe für unerbittliche Logik – tritt weiteren mysteriösen Situationen und Kriminalfällen mit Köpfchen entgegen und benutzt seine scharfsinnige Logik, um diese auf elegante Weise zu lösen...
Professor Augustus van Dusen, der amerikanische Sherlock Holmes, wurde von zu Beginn des 20. Jahrhunderts von dem US-Schriftsteller Jacques Futrelle erdacht, der im Jahr 1912 beim Untergang der Titanic ums Leben kam.
Heutzutage sind die Abenteuer van Dusens in erster Linie dem Hörspiel-Publikum bekannt und erfreuen sich größter Beliebtheit.
Der Apex-Verlag veröffentlicht Das Rätsel von Zelle 13 und weitere Fälle der Denkmaschine als durchgesehene Neuausgabe und macht die Original-Erzählungen dem deutschen Lesepublikum erstmals seit über vierzig Jahren wieder zugänglich.
DAS RÄTSEL VON ZELLE 13
I
Nachdem Augustus S. F. X. van Dusen seinen ungewöhnlichen Namen erhalten hatte, erwarb er später im Verlauf einer blendenden, wissenschaftlichen Karriere praktisch alle im Alphabet übriggebliebenen Buchstaben und setzte sie, da es sich um ehrenwerte Titel handelte, ans andere Ende seines Namens. So wirkte dieser mit all dem schmückenden Beiwerk, das dazugehörte, außerordentlich imponierend. Van Dusen war Ph. D., LL. D., ein Fellow of the Royal Society (F. R. S.), M. D. und M. D. S. Darüber hinaus besaß er auch noch weitere Titel, die ihm verschiedene philosophische und wissenschaftliche Institutionen im Ausland in Anerkennung seiner Verdienste verliehen hatten - doch es waren so viele, dass er sie gar nicht alle behalten konnte.
Sein Äußeres stand seiner Nomenklatur in nichts nach. Er war schlank und ging mit den gebeugten, schmächtigen Schultern eines Gelehrten. An seinem glatt rasierten, blassen Gesicht war deutlich abzulesen, dass er den größten Teil seines Lebens mit einer zurückgezogenen, sitzenden Tätigkeit verbracht hatte. Seine Augen schienen auf erschreckende Weise zu blinzeln; es war das ewige Blinzeln eines Mannes, der kleine Dinge studiert. Wenn man sie hinter den dicken Gläsern überhaupt erkannte, waren die Augen bloße Schlitze von wässrigem Blau. Doch direkt über ihnen befand sich sein eigentümlichster Zug: eine riesige, hohe Stirn, fast anormal in ihrer Größe, die von einem buschigen, blonden Haarschopf gekrönt wurde. All dies wirkte zusammen und verlieh ihm ein wunderliches, fast schon groteskes Gehabe.
Professor van Dusens Vorfahren schienen deutscher Abstammung gewesen zu sein. Schon seit Generationen hatte seine Familie sich in den Wissenschaften hervorgetan und er war die logische Folge, das Meisterhirn. Zuerst und vor allem anderen war er Logiker. Mindestens fünfunddreißig Jahre des halben Jahrhunderts, das er bisher auf der Welt war, hatte er ausschließlich damit verbracht, zu beweisen, dass zwei und zwei vier macht, außer unter ganz besonderen Umständen, wo es auch schon mal drei oder fünf ergeben kann, je nach Lage der Dinge. Er ließ sich nicht von dem allgemein anerkannten Prinzip abbringen, dass aller Anfang irgendwo hinführen muss und war imstande, die geballte geistige Energie seiner Vorfahren auszuschöpfen, wenn es um die Lösung eines Problems ging. Beiläufig könnte man auch noch darauf hinweisen, dass Professor van Dusen Hutgröße Nummer acht trug.
Die Welt kannte Professor van Dusen als die Denkmaschine. Eine Zeitung hatte ihn eines Tages so genannt, nachdem er anlässlich eines Schachturniers eindrucksvoll demonstriert hatte, dass selbst ein blutiger Anfänger, allein durch die Kraft zwingender Logik, einen Meister schlagen kann, der sich sein ganzes Leben lang mit diesem Spiel der Spiele beschäftigt hat. Die Denkmaschine! Vielleicht charakterisierte ihn diese Bezeichnung treffender als alle seine Ehrentitel, denn er verbrachte Woche um Woche, Monat um Monat in der Abgeschiedenheit seines kleinen Labors, aus dem Gedanken entsprangen, die seine wissenschaftlichen Kollegen verblüfften und die Welt an sich zutiefst aufrührten.
Es kam nur selten vor, dass die Denkmaschine Gäste empfing. Wenn, dann handelte es sich zumeist um Männer, die selber hohe wissenschaftliche Positionen innehatten und ihn aufsuchten, um über einen bestimmten Punkt zu diskutieren oder auch sich eines Besseren belehren zu lassen. Zwei dieser wenigen, Dr. Charles Ransome und Alfred Fielding, wurden eines Abends vorstellig, um eine Theorie zu erörtern, die hier nicht von Bedeutung ist.
»Etwas Derartiges ist völlig unmöglich«, behauptete Dr. Ransome im Verlauf der Unterhaltung nachdrücklich.
»Nichts ist unmöglich«, erwiderte die Denkmaschine mit gleichem Nachdruck. Wie immer machte er einen etwas mürrischen Eindruck. »Der Verstand ist der Meister aller Dinge. Wenn die Wissenschaft diese Tatsache in vollem Umfange anerkennen würde, hätten wir schon einen großen Schritt nach vorn gemacht.«
»Wie steht es mit einem Luftschiff?«, fragte Dr. Ransome nach.
»Ein Luftschiff ist ganz und gar nicht unmöglich«, versicherte die Denkmaschine. »Eines Tages wird man es erfinden. Ich würde es ja selber in die Hand nehmen, aber ich habe keine Zeit.«
Dr. Ransome lächelte nachsichtig. »Ähnliches haben Sie auch schon früher gesagt«, meinte er. »Aber das will nichts heißen. Mag sein, dass der Verstand der Meister der Materie ist, aber bislang hat er es noch nicht vermocht, dies zu beweisen. Es gibt Dinge, die sich nicht einfach aus der Existenz heraus denken lassen - oder besser gesagt, die sich durch Denken allein nicht beeinflussen lassen.«
»Was denn zum Beispiel?«, fragte die Denkmaschine.
Dr. Ransome dachte einen Augenblick lang nach, während er einen Zug von seiner Zigarre nahm.
»Nun, Gefängnismauern zum Beispiel«, entgegnete er dann. »Kein Mensch kann sich aus einer Zelle hinausdenken. Wenn das möglich wäre, gäbe es auf der ganzen Welt keine Häftlinge mehr.«
»Er kann aber seinen Verstand und seinen Scharfsinn so gebrauchen, dass er die Zelle verlassen kann, was aufs selbe hinausläuft«, gab die Denkmaschine zurück.
Dr. Ransome lächelte belustigt.
»Gesetzt den Fall, wir haben eine Zelle, in der nur Menschen einsitzen, die zum Tode verurteilt sind - Menschen, die verzweifelt sind und irrsinnig vor Angst. Sie würden jede Gelegenheit wahrnehmen, um die Flucht zu ergreifen. Nehmen wir weiter an, Sie selbst wären in einer solchen Zelle eingesperrt. Würde Ihnen die Flucht gelingen?«
»Selbstverständlich«, erklärte die Denkmaschine.
»Sie könnten natürlich die Zelle mit Sprengstoff in die Luft jagen«, sagte Mr. Fielding, der damit zum ersten Mal in die Diskussion eingriff. »Aber unter normalen Umständen hätten Sie natürlich als Häftling keinen Sprengstoff zur Verfügung.«
»Ach was, nichts von alledem«, antwortete die Denkmaschine. »Sie könnten mich genauso behandeln wie jeden anderen Häftling auch und ich würde die Zelle trotzdem verlassen.«
»Aber nur, wenn Sie sie mit präpariertem Werkzeug betreten haben«, meinte Dr. Ransome.
Die Denkmaschine wurde zusehends ärgerlicher. Die blauen Augen sprühten Funken. »Sperren Sie mich in eine x-beliebige Zelle in einem x-beliebigen Gefängnis, egal wo und zu welcher Zeit und nur mit dem nötigsten bekleidet - innerhalb einer Woche bin ich ein freier Mann«, erklärte er scharf.
Dr. Ransome richtete sich interessiert auf. Mr. Fielding zündete sich eine neue Zigarre an.
»Sie meinen, Sie könnten sich regelrecht herausdenken?«, fragte Dr. Ransome.
»Ich würde herauskommen«, lautete die Antwort.
»Meinen Sie das ernst?«
»Selbstverständlich.«
Dr. Ransome und Mr. Fielding schwiegen eine lange Zeit.
»Würden Sie es auf einen Versuch ankommen lassen?«, fragte schließlich Mr. Fielding.
»Jederzeit«, antwortete Professor van Dusen. Das Fünkchen Ironie in seiner Stimme war unverkennbar. »Ich habe schon blödere Sachen auf mich genommen, um Menschen von weit unbedeutenderen Wahrheiten zu überzeugen.«
Die Stimmung war gereizt und der Unterton verriet den aufgestauten Ärger auf beiden Seiten. Natürlich war es völlig absurd, aber Professor van Dusen unterstrich noch einmal seine Bereitschaft, die Flucht aus dem Gefängnis zu versuchen und so kam man überein.
»Und wir fangen jetzt gleich an«, sagte Dr. Ransome.
»Ich würde es vorziehen, wenn wir morgen anfingen«, wandte die Denkmaschine ein. »Ich...«
»Nein, wenn, dann sofort«, unterbrach Mr. Fielding ihn bestimmt. »Sie werden festgenommen, rein bildlich, natürlich, und ohne jegliche Vorwarnung in eine Zelle gesperrt, sodass Sie auch keinesfalls die Möglichkeit haben, mit irgendwelchen Freunden in Verbindung zu treten. Im Gefängnis werden Ihnen dann dieselbe Behandlung und die gleiche Aufmerksamkeit zuteilwerden wie jedem anderen zum Tode verurteilten Häftling. Sind Sie einverstanden?«
»Na schön, dann eben gleich«, entgegnete die Denkmaschine und erhob sich.
»Sagen wir, die Todeszelle im Chisholmer Gefängnis?«
»Die Todeszelle im Chisholmer Gefängnis.«
»Und was werden Sie tragen?«
»So wenig wie möglich«, sagte die Denkmaschine. »Schuhe, Socken, ein Paar Hosen und ein Hemd.«
»Sie werden natürlich gestatten, dass man Sie durchsucht?«
»Ich will genauso behandelt werden, wie jeder andere auch«, erwiderte die Denkmaschine. »Weder besser noch schlechter.«
Es gab einige Vorbereitungen zu treffen, um das Experiment ausführen zu können; da es sich aber bei allen dreien um einflussreiche Männer handelte, wurden sie zur vollsten Zufriedenheit geregelt. Allerdings löste die Angelegenheit, die man telefonisch als rein wissenschaftliches Experiment erklärte, bei den Gefängnisvorstehern Verwundern aus. Professor van Dusen würde der prominenteste Häftling sein, den man hier je beherbergt hatte.
Nachdem van Dusen sich angekleidet hatte, rief er nach der kleinen alten Frau, die ihm als Haushälterin, Köchin und Hausmädchen in einer Person diente.
»Martha«, sagte er, »es ist jetzt siebenundzwanzig Minuten nach neun. Ich verlasse das Haus. Heute in einer Woche, pünktlich um neun Uhr dreißig, werden diese beiden Herren und vielleicht noch ein oder zwei andere bei mir zu Abend speisen. Vergessen Sie bitte nicht, dass Dr. Ransome Artischocken besonders gerne ißt.«
Anschließend ließen sich die drei Männer zum Chisholmer Gefängnis fahren, wo sie der Gefängnisdirektor, der telefonisch unterrichtet worden war, bereits erwartete. Man hatte ihm lediglich mitgeteilt, dass der berühmte Professor van Dusen für eine Woche sein Gefangener sein würde - vorausgesetzt, er brächte es fertig, ihn solange festzuhalten. Er habe sich keines Verbrechens schuldig gemacht, sollte aber dennoch wie ein ganz gewöhnlicher Häftling behandelt werden.
»Durchsuchen Sie ihn«, forderte Dr. Ransome den Gefängnisdirektor auf.
So geschah es. Doch die Denkmaschine hatte nichts bei sich. Die Hosentaschen waren leer; das weiße, gestärkte Hemd besaß keine Brusttaschen. Er musste Schuhe und Socken ausziehen und bekam sie erst wieder, nachdem sie gründlich untersucht worden waren. Als Dr. Ransome die peinliche Prozedur beobachtete und die mitleiderregende, fast kindlich anmutende Schwäche des Mannes, sein bleiches Gesicht und die dünnen weißen Hände bemerkte, hätte er seine Verstrickung in diesen Fall beinahe bereut.
»Sind Sie auch wirklich sicher, dass Sie es machen wollen?«, fragte er noch einmal.
»Wären Sie überzeugt, wenn ich es nicht täte?«, fragte die Denkmaschine zurück.
»Nein.«
»Nun, dann fangen wir an.« Sein Ton zerstreute jegliche Sympathie, die Dr. Ransome empfunden haben mochte. Er reizte ihn; ja er würde dieses Experiment durchführen, es wäre ein ewiger Stachel im Fleische dieses arroganten Kerls.
»Es wird ihm doch nicht gelingen, mit irgendjemandem in der Außenwelt in Verbindung zu treten?«, fragte er.
»Vollkommen ausgeschlossen«, versicherte der Direktor. »Schreibutensilien, ganz gleich, welcher Art, sind hier nicht gestattet.«
»Und Ihre Aufseher, würden die eine Nachricht von ihm weiterleiten?«
»Nicht ein Wort, weder direkt noch indirekt«, beteuerte der Direktor. »Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Sie werden mir über alles, was er sagt oder tut, Bericht erstatten.«
»Das entspricht ganz meinen Wünschen«, sagte Mr. Fielding, der ernsthaft an dem Problem interessiert war.
»Sie wissen natürlich, dass, wenn er aufgibt und seine Freiheit zurückverlangt, Sie ihn freilassen müssen?«, fragte Dr. Ransome.
»Ja, das ist mir klar«, antwortete der Direktor.
Die Denkmaschine stand daneben und hörte zu, gab jedoch kein Wort von sich, bis alles geregelt war. Dann sagte er plötzlich: »Ich hätte noch drei kleine Bitten. Sie mögen Sie mir gewähren oder nicht, ganz wie Sie wollen.«
»Keine Sonderwünsche«, warnte Mr. Fielding.
»Ich habe keine Sonderwünsche«, kam es steif zurück. »Ich hätte nur gern etwas Zahnpulver_- Sie können es selber kaufen, um sicher zu gehen -, eine Fünf-Dollar- und zwei Zehn-Dollar-Noten.«
Dr. Ransome, Mr. Fielding und der Gefängnisdirektor tauschten erstaunte Blicke. Die Bitte um Zahnpulver überraschte sie nicht, aber das Geld...?
»Gibt es hier vielleicht jemanden, den unser Freund mit fünfundzwanzig Dollar bestechen könnte?«, fragte Dr. Ransome den Direktor.
»Nicht mit fünfundzwanzigtausend Dollar!« Die Antwort war eindeutig.
»Nun, dann geben Sie sie ihm«, sagte Mr. Fielding. »Ich glaube, es kann nicht schaden.«
»Und die dritte Bitte?«, fragte Dr. Ransome.
»Ich würde mir gern noch mal die Schuhe polieren lassen.«
Wieder schauten sich die drei erstaunt an. Diese letzte Bitte war der Gipfel der Absurdität, aber es gab keinen Grund, sie ihm zu verweigern. Nachdem alles zur Zufriedenheit der Denkmaschine besorgt worden war, wurde er in die Zelle geführt, aus der er entkommen wollte.
»Das ist Zelle 13«, sagte der Direktor und blieb vor der dritten Tür des stählernen Korridors stehen. »Hier sitzen die zum Tode verurteilten Mörder ein. Ohne meine persönliche Erlaubnis darf keiner von ihnen die Zelle verlassen, und keiner kann mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen. Dafür verbürge ich mich. Die Zelle liegt nur wenige Meter von meinem eigenen Büro entfernt und ich habe gute Ohren: ein ungewöhnliches Geräusch würde mir mit Sicherheit nicht entgehen.«
»Sind Sie mit der Zelle zufrieden, meine Herren?«, fragte die Denkmaschine. Seine Stimme strahlte einen Hauch von Ironie aus.
»Vortrefflich«, lautete die Antwort.
Die schwere Stahltür wurde aufgeschlossen. Man hörte das hastige Trippeln winziger Füße und dann betrat die Denkmaschine die Dunkelheit der Zelle. Anschließend wurde die Tür wieder versperrt und vom Direktor persönlich zweimal verschlossen.
»Was ist denn das für ein Geräusch da drin?«, fragte Dr. Ransome und spähte durch die schweren Gitterstäbe.
»Ratten, Dutzende von Ratten«, antwortete die Denkmaschine knapp.
Die drei Männer wünschten eine gute Nacht und wandten sich gerade zum Gehen, als van Dusen rief:
»Wieviel Uhr ist es jetzt, Herr Direktor?«
»Elf Uhr siebzehn«, antwortete der Direktor.
»Danke vielmals. In genau einer Woche, um acht Uhr dreißig, werde ich Sie alle in Ihrem Büro wiedersehen, meine Herren.«
»Und wenn nicht?«
»Ein wenn nicht ist hier völlig ausgeschlossen.«
II
Das Chisholmer Gefängnis war ein riesiges, weitläufiges Granitgebäude mit vier Stockwerken, das mitten im offenen Feld lag. Eine sechs Meter hohe Mauer aus hartem Quadergestein umgab es, die auf beiden Seiten so glatt war, dass nicht einmal ein geübter Bergsteiger sie hätte erklimmen können. Als zusätzliche Maßnahme hatte die Gefängnisleitung oben auf der Mauer noch eine Befestigung aus anderthalb Meter hohen, spitz zulaufenden Eisenstangen angebracht. Diese Befestigung markierte die absolute Trennungslinie zwischen Freiheit und Gefangenschaft, denn selbst, wenn es jemand gelingen sollte, aus seiner Zelle zu flüchten, die Mauer zu überwinden, wäre ihm unmöglich.
Der Hof, der auf allen Seiten acht Meter breit war, was der Entfernung vom Gebäude zur Mauer entsprach, diente tagsüber als eine Art Sportplatz für die Häftlinge, denen man ab und zu die Gnade eines Ausgangs gewährte. Dies galt jedoch nie für die Insassen der Zelle 13. Der Hof wurde zu jeder Tageszeit von vier Wärtern bewacht - auf jeder Seite des Gebäudes einer.
Bei Nacht war er fast genauso hell erleuchtet wie bei Tag. Auf allen Seiten gab es Scheinwerfer, die sich über die Gefängnismauern erhoben und den Wärtern klare Sicht boten. Sie erhellten auch den oberen Teil der mit Eisenpfeilern befestigten Mauer. Die zu den Scheinwerfern gehörigen Stromkabel führten auf Isolatoren an der Wand des Gefängnisgebäudes empor und von dort zu den Pfosten, auf denen die Scheinwerfer angebracht waren.
All diese Details wurden von der Denkmaschine wahrgenommen und verarbeitet. Van Dusen musste auf das Bett steigen, um aus dem vergitterten Zellenfenster sehen zu können. Es war der Morgen nach seiner Einlieferung. Irgendwo da drüben, hinter der Gefängnismauer musste der Fluss verlaufen, denn er konnte das leise Tuckern eines Motorbootes ausmachen und sah einen Wasservogel am Himmel kreisen. Aus der gleichen Richtung drangen das Geschrei von spielenden Kindern und das gelegentliche Geräusch eines Baseballschlägers. Daher wusste er, dass zwischen der Anstalt und dem Fluss offenes Gelände lag, möglicherweise ein Spielplatz.
Das Chisholmer Gefängnis galt als absolut sicher. Keinem Menschen war es jemals gelungen, von hier auszubrechen. Von seinem Ausguck auf dem Bett konnte die Denkmaschine einiges sehen und verstand nun plötzlich, warum dieses Gefängnis einen solchen Ruf hatte. Die Wände seiner Zelle, die seiner Einschätzung nach vor etwa zwanzig Jahren errichtet worden sein mussten, waren vollkommen stabil. Die neuen Eisengitter vor dem Fenster wiesen nicht eine Spur von Rost auf. Aber auch ohne die Gitter würde das Fenster selbst keine Fluchtmöglichkeit bieten, denn es war viel zu klein.
Obgleich der Professor all dies bemerkte, war er keineswegs entmutigt. Im Gegenteil, er studierte nachdenklich und mit zusammengekniffenen Augen den Scheinwerfer - die Sonne strahlte hell vom Himmel - und folgte mit den Augen dem Stromkabel, das von dort aus zum Gebäude führte. Dieses elektrische Kabel, so überlegte er, musste am Gebäude nicht weit von seiner Zelle entlang verlaufen. Gut zu wissen.
Zelle 13 befand sich auf dem gleichen Stockwerk wie die Büros des Gefängnisses, das heißt, weder im Erdgeschoss noch ganz oben. Lediglich vier Treppenstufen führten zum Stockwerk des Büros, das bedeutete, dass der Fußboden seiner Zelle nicht viel mehr als ein oder zwei Meter über dem Erdboden liegen konnte. Er konnte ihn zwar direkt unter seinem Fenster nicht erkennen, sah ihn aber etwas weiter zur Mauer hin. Es wäre ein Leichtes, aus dem Fenster zu springen. Schön und gut.
Dann versuchte van Dusen sich zu erinnern, wie er zu seiner Zelle gelangt war. Zuerst war da das Häuschen des Wachtpostens draußen gewesen, das einen Teil der Mauer bildete. Dort befanden sich auch zwei schwere, vergitterte Stahltore. Hier stand zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Wachtposten. Nach einigem Schlüsselklirren und Türenschlagen ließ er einen ins Gefängnis hinein und auch wieder hinaus, wenn er den Befehl dazu bekam. Das Büro des Direktors lag im Gefängnisgebäude selbst. Wenn man vom Hof kam und zu ihm wollte, musste man ein Tor aus solidem Stahl passieren, das nur einen schmalen Sehschlitz besaß. Zwischen dem Büro und Zelle 13 gab es eine schwere Holztür und zwei Stahltore, die die Gefängnisgänge versperrten. Und dann war da auch noch die doppelt verschlossene Zellentür...
Alles in allem machte das also sieben Türen, die es zu überwinden galt, ehe man als freier Mann die Außenwelt betreten konnte. Andererseits war es geradezu auffällig, wie wenig er hier gestört wurde. Gegen sechs Uhr morgens erschien einer der Wärter an seiner Zellentür und brachte ihm das kärgliche Gefängnisfrühstück. Dann kam er erst mittags und zum letzten Mal gegen sechs Uhr abends mit dem Abendessen wieder. Gegen neun erfolgte die tägliche Zelleninspektion. Das war alles.
»Vortreffliches Bewachungssystem«, dachte die Denkmaschine anerkennend und zollte damit der Gefängnisleitung seine geistige Hochachtung. »Muss es mal genauer unter die Lupe nehmen, wenn ich hier erst wieder raus bin. Wusste gar nicht, dass man sich in den Gefängnissen so viel Mühe gibt.«
In seiner Zelle gab es nichts, absolut nichts, bis auf eine Eisenpritsche, die so fest zusammengefügt war, dass kein Mensch sie ohne fremde Hilfe auseinandernehmen konnte - es sei denn, er verfügte über einen Vorschlaghammer oder eine Feile. Aber er besaß weder das eine noch das andere. Es gab nicht einmal einen Stuhl, einen kleinen Tisch, Ton- oder Blechgeschirr. Nichts! Der Gefängniswärter blieb neben ihm stehen, solange er aß und nahm anschließend Holzschale und Holzlöffel, die er benutzt hatte, wieder an sich.
All diese Details prägte sich die Denkmaschine eins nach dem anderen ein. Als auch die letzte Möglichkeit in Betracht gezogen war, begann er mit einer gründlichen Inspektion seiner Zelle. Er fing bei der Decke an und tastete die Wände bis zum Boden ab, jeden Stein, jede Ritze mit Mörtel dazwischen. Immer wieder stampfte er sorgfältig über den Boden, aber der bestand aus Zement und war äußerst solide. Nachdem er seine Untersuchung abgeschlossen hatte, setzte er sich auf die Kante der Eisenpritsche und verlor sich in Gedanken. Jetzt hatte Professor S. F. X. van Dusen, die Denkmaschine, tatsächlich etwas, über das er nachdenken konnte.
Doch da wurde er plötzlich von einer Ratte gestört, die ihm über den Fuß lief und sich dann, offensichtlich von ihrer eigenen Courage überwältigt, in eine dunkle Ecke der Zelle verkroch. Nach einer Weile, in der die Denkmaschine beharrlich mit zusammengekniffenen Augen in die Dunkelheit gestarrt hatte, wo die Ratte verschwunden war, machte er mehrere, kleine, glasige Augenpaare aus, die ihn zu beobachten schienen. Er zählte sechs Paare, aber höchstwahrscheinlich gab es noch mehr - seine Augen waren nicht mehr die besten.
Zufällig streifte er in diesem Moment die Unterkante seiner Zellentür. Er bemerkte einen fünf Zentimeter breiten Schlitz zwischen Stahlkante und Erdboden. Und während die Denkmaschine noch wie gebannt diesen Schlitz im Auge behielt, machte er plötzlich einen Satz in die finstere Ecke, in der er die Rattenaugen beobachtet hatte. Er hörte ein hastiges Hin und Her von kleinen Füßen, mehrere Quieker der erschreckten Nager und dann war es still.
Nicht eine der Ratten war unter der Tür verschwunden und trotzdem war die Zelle leer. Es musste also einen anderen Weg aus der Zelle geben, egal wie klein er auch sein mochte. Auf Händen und Knien machte sich die Denkmaschine daran, diesen Ausgang zu suchen, indem er mit langen, schmalen Fingern in der Dunkelheit herumtastete.
Schließlich wurde seine Sorgfalt belohnt. Er stieß auf eine winzige Öffnung zwischen Erdboden und Wand, ein kreisrundes Loch, nicht viel größer als ein Silberdollar. Diesen Weg hatten die Ratten also genommen. Er fuhr mit den Fingern tief in die Öffnung hinein; es schien ein unbenutztes Abflussrohr oder so etwas Ähnliches zu sein und war trocken und verstaubt.
Nachdem er der Sache auf den Grund gegangen war, setzte er sich wieder auf sein Bett und grübelte eine volle Stunde nach. Dann stellte er sich an das kleine Zellenfenster und untersuchte seine Umgebung von neuem. Einer der Wachtposten draußen im Hof war genau gegenüber von Zelle 13 postiert und sah zufälligerweise gerade hoch, als der Kopf der Denkmaschine am Zellenfenster erschien. Doch der Wissenschaftler bemerkte ihn nicht.
Es wurde Mittag und der Wärter brachte ihm die widerlich dürftige Gefängniskost. Zu Hause aß die Denkmaschine nur das Notwendigste; hier akzeptierte er ohne mit der Wimper zu zucken alles, was man ihm vorsetzte. Hin und wieder tauschte er ein paar Worte mit dem Wärter aus, der draußen vor der Tür stehengeblieben war und ihm beim Essen zuschaute.
»Hat es hier eigentlich in letzter Zeit irgendwelche Erneuerungen gegeben?«, erkundigte er sich.
»Nichts Besonderes«, antwortete der Wärter. »Vor vier Jahren haben sie eine neue Mauer gebaut.«
»Ist irgendetwas am Gebäude getan worden?«
»Das Holzwerk draußen ist gestrichen worden und neue Rohrleitungen wurden verlegt, das muss jetzt sieben Jahre her sein, ja.«
»Ah!«, sagte der Gefangene. »Wie weit ist es eigentlich bis zum Fluss?«
»Hundert Meter ungefähr. Die Jungs haben da einen Sportplatz zwischen Gefängnismauer und Fluss, wo sie Baseball spielen.«
Im Moment hatte die Denkmaschine nichts weiter zu sagen, doch als der Wärter im Gehen begriffen war, bat er ihn um etwas Wasser.
»Ich habe hier immer einen solchen Durst«, erklärte er. »Ob Sie mir wohl eine Schale mit Wasser dalassen könnten?«
»Da muss ich erst den Direktor fragen«, antwortete der Wärter und verschwand.
Nach einer halben Stunde erschien er tatsächlich mit einer Schale Wasser.
»Der Direktor sagt, Sie können die Schale behalten«, beschieß er den Gefangenen. »Aber Sie müssen sie mir jederzeit zeigen, wenn ich danach frage. Wenn sie kaputt geht, war es die letzte.«
»Danke vielmals. Ich werde sie nicht kaputt machen«, versicherte die Denkmaschine.
Der Wärter ging seinen Pflichten nach. Für den Bruchteil einer Sekunde schien es so, als wollte die Denkmaschine noch eine Frage stellen, tat es dann aber doch nicht.
Zwei Stunden später, als der gleiche Wärter an Zelle 13 vorbeikam, hörte er ein ungewohntes Geräusch und blieb stehen. Die Denkmaschine kauerte auf allen vieren in einer Ecke der Zelle. Ängstliche Quieker ertönten aus dieser Richtung. Der Wärter beobachtete das alles mit großem Interesse.
»Ahhh, hab ich dich«, hörte er den Gefangenen frohlocken.
»Haben Sie was?«, fragte er scharf.
»Eine von diesen Ratten«, antwortete van Dusen. »Sehen Sie?« Er hob den Arm und der Wärter sah eine kleine graue Ratte zwischen den langen Fingern des Wissenschaftlers zappeln. Er brachte sie nah ans Licht und schaute sie sich genauer an. »Es ist eine Wasserratte«, bemerkte er.
»Haben Sie nichts Besseres zu tun, als Ratten zu jagen?«, fragte der Wärter.
»Schlimm genug, dass sie überhaupt hier sind«, sagte der Gefangene gereizt. »Nehmen Sie die hier mit und töten Sie sie. Es gibt hier noch jede Menge mehr davon.«
Der Wärter packte das zu Tode erschreckte, zappelnde Tier und schleuderte es heftig zu Boden. Es quiekte noch einmal auf und verstummte dann. Später meldete er den Vorfall dem Direktor, doch der lächelte nur.
Am selben Nachmittag schaute der bewaffnete Wachtposten, der gegenüber von Zelle 13 im Hof postiert war, wieder zum Fenster empor und sah, wie der Gefangene hinausstarrte. Plötzlich schob sich seine Hand durch die Gitterstäbe und dann flatterte etwas Weißes zu Boden, genau unter seinem Zellenfenster. Es war ein kleiner Leinenfetzen, offenbar ein Stück von einem weißen Oberhemd, das zusammengerollt und mit einer Fünfdollarnote umwickelt worden war. Als der Wärter wieder zum Fenster emporschaute, war das Gesicht verschwunden.
Mit einem grimmigen Lächeln hob er das Päckchen auf und brachte es zum Büro des Direktors. Dort entzifferten sie gemeinsam eine mit merkwürdiger Tinte geschriebene und leicht verwischte Nachricht. Außen stand:
»Finder! Bitte bringen Sie dies zu Dr. Ransome.«
»Aha!«, rief der Direktor und kicherte in sich hinein. »Fluchtplan Nummer eins ist fehlgeschlagen.« Doch dann fiel ihm ein, dass van Dusen den Fetzen an Dr. Ransome adressiert hatte. Wozu das?
»Und woher hat er Feder und Tinte zum Schreiben?«, fragte der Wärter.
Der Direktor schaute den Wärter an und der Wärter den Direktor. Für dieses Geheimnis gab es absolut keine plausible Erklärung. Schließlich studierte der Direktor das Päckchen sorgfältig und schüttelte dann den Kopf.
»Nun, dann wollen wir mal sehen, was er Dr. Ransome mitzuteilen hat«, sagte er, noch immer verdutzt, und rollte den Leinenfetzen auseinander.
»Na, wenn das... was... was sagen Sie dazu?«, fragte er verwirrt.
Der Wärter nahm das Tuch und las:
»neh hcsiw 'tne t’hcin hei e d’rewtrae seidf. U.A.«
III
Der Direktor zerbrach sich eine geschlagene Stunde lang den Kopf darüber, um welchen Geheimcode es sich wohl handeln könnte und versuchte eine weitere halbe Stunde, herauszufinden, warum sein Gefangener versuchte ausgerechnet mit Dr. Ransome, der doch der Grund für seine Anwesenheit hier im Gefängnis war, Verbindung aufzunehmen. Anschließend widmete er sich der komplizierten Frage, woher der Häftling die Schreibutensilien bekommen hatte und um was genau es sich dabei gehandelt haben mochte. Mit dem festen Vorsatz, Licht in die Sache zu bringen, nahm er erneut das Leinenstück unter die Lupe. Es handelte sich um den Fetzen eines weißen Oberhemdes mit ausgefransten Rändern.
Die Herkunft des Tuches war einleuchtend, doch das, womit der Gefangene geschrieben hatte, war eine andere Sache. Der Direktor wusste, dass er weder Füller noch Bleistift bei sich haben konnte und abgesehen davon war weder das eine noch das andere für dieses Schreiben benutzt worden. Was denn dann? Der Direktor beschloss, selber nach dem Rechten zu sehen. Die Denkmaschine war sein Häftling; er hatte den Befehl, seine Häftlinge in sicherem Gewahrsam zu halten, und wenn dieser hier meinte, ausbrechen zu können, indem er irgendwelchen Menschen verschlüsselte Nachrichten zukommen ließ, dann würde er dies unterbinden, so wie er es bei jedem anderen Gefangenen auch getan hätte.
Der Direktor machte sich auf den Weg zu Zelle 13, wo er die Denkmaschine auf allen vieren auf dem Boden herumkriechend antraf. Er tat allerdings nichts Schlimmeres als Ratten zu jagen. Als der Gefangene die Schritte des Direktors hörte, drehte er sich schnell zu ihm um.
»Es ist schrecklich«, fuhr er ihn an. »Diese Ratten! Hier wimmelt es nur so von Ratten!«
»Andere sind auch mit ihnen fertig geworden. Hier haben Sie ein frisches Hemd - geben Sie mir bitte das, welches sie gerade tragen.«
»Wieso?«, fragte die Denkmaschine schnell. Die Stimme klang alles andere als natürlich; seine ganze Art ließ auf eine momentane Verwirrung schließen.
»Sie haben versucht, mit Dr. Ransome Verbindung aufzunehmen«, sagte der Direktor streng. »Da Sie mein Gefangener sind, ist es meine Pflicht, dies zu unterbinden.«
Die Denkmaschine schwieg einen Augenblick lang. »Na schön«, sagte er schließlich. »Dann tun Sie Ihre’ Pflicht.«
Der Direktor lächelte verdrossen. Der Gefangene erhob sich vom Boden, zog sein weißes Hemd aus und tauschte es gegen das gestreifte Häftlingshemd ein, das der Direktor mitgebracht hatte. Dieser griff eifrig nach dem weißen Hemd und verglich auf der Stelle die Tuchfetzen, auf die die verschlüsselte Nachricht geschrieben worden war, mit bestimmten, ausgerissenen Stellen im Hemd des Gefangenen. Die Denkmaschine beobachtete das Ganze neugierig.
»Der Wachtposten hat es also Ihnen gebracht?«, fragte er.
»Und ob er es mir gebracht hat«, antwortete der Direktor triumphierend. »Damit dürfte Ihr erster Fluchtversuch gescheitert sein.«
Die Denkmaschine beobachtete, wie der Direktor Tuchfetzen und ausgerissene Stellen im Hemd verglich und zu seiner Befriedigung feststellte, dass nur zwei Fetzen herausgerissen waren.
»Womit haben Sie das geschrieben?«, wollte der Direktor wissen.
»Das herauszufinden ist wohl Ihre Aufgabe, würde ich meinen«, antwortete die Denkmaschine gereizt.
Der Direktor ließ sich zu einigen unschönen Bemerkungen hinreißen, nahm sich aber schnell wieder zusammen und rächte sich mit einer peinlich genauen Durchsuchung der Zelle und des Häftlings. Seine Bemühungen waren jedoch umsonst; er fand nichts, nicht einmal ein Streichholz oder einen Zahnstocher, die als Bleistift hätten dienen können. Großes Rätselraten auch, was die Flüssigkeit anging, mit der die geheimnisvolle Nachricht geschrieben worden war. So verließ der Direktor die Zelle sichtlich verärgert, nahm aber das weiße Hemd wie eine Trophäe mit.
»Naja, eine verschlüsselte Botschaft auf einem Fetzen Tuch wird ihn kaum aus dem Gefängnis herausbringen, das steht jedenfalls fest«, tröstete er sich. Dann warf er die beiden Tuchfetzen und den Fünfdollarschein in seine Schublade, um die weitere Entwicklung abzuwarten. »Wenn dieser Kerl es schafft, hier auszubrechen... dann... Himmelkruzitürken... dann nehme ich meinen Hut!«