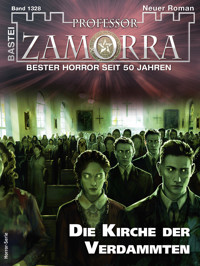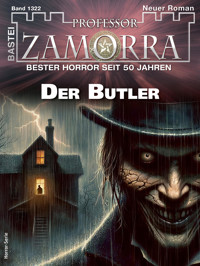1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Durch die Rauchschwaden hindurch starrte Nicole auf die Gestalt, die sich ihrer vergitterten Zelle näherte. Hoffnung keimte wie ein wärmendes Feuer in ihr auf. "Chéri!", hauchte sie. "Hol mich hier raus. Ich bin ... ich bin in einen Albtraum geraten!" Tränen liefen der schönen Französin über das Gesicht. Zamorra musterte sie durch die Gitterstäbe hindurch. Aber etwas war anders als sonst in seinem Blick. "Hat sie gestanden, mit dem Teufel gebuhlt zu haben?", fragte er den bulligen Folterknecht an seiner Seite. "Leider nein, obwohl ich ihr die Instrumente gezeigt habe, die ihr drohen." "Die Daumenschrauben", befahl Zamorra mit kalter Stimme. "Beginnen wir mit den Daumenschrauben ..."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Lukrezia
Leserseite
Vorschau
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Lukrezia
von Veronique Wille
Durch die beißenden Rauchschwaden hindurch starrte Nicole auf die Gestalt, die sich ihrer vergitterten Zelle näherte. Hoffnung keimte wie ein wärmendes Feuer in ihr auf.
»Chéri!«, hauchte sie. »Hol mich hier raus! Ich bin ... ich bin in einen Albtraum geraten!« Tränen liefen der schönen Französin über das Gesicht.
Zamorra musterte sie durch die Gitterstäbe hindurch. Aber etwas war anders als sonst in seinem Blick.
»Die Daumenschrauben«, befahl Zamorra mit kalter Stimme, die keinen Widerspruch duldete. »Beginnen wir mit den Daumenschrauben ...«
Saint Cyriac, Vergangenheit
Lukrezia war gerade mal sechzehn Jahre geworden und noch Jungfrau, als zum ersten Mal der Teufel mit ihr sprach. Niemand hörte es, niemand bemerkte es, denn der Teufel war in ihr, unsichtbar für alle anderen.
Kurz zuvor hatte sie die Kuh gemolken, aber die gab nur saure Milch. Lukrezia erschrak zutiefst. Erst vor ein paar Wochen hatte ein Inquisitor drei Dörfer weiter alle drei Kühe der Laduries bezichtigt, vom Teufel besessen zu sein, weil aus ihren Eutern nur saure Milch geflossen sein sollte. Und Agnes, die Bäuerin, hatte man gleich mit verhaftet, sodass ihr Ehemann nun nicht nur allein den Hof bewirtschaften musste, sondern auch noch für Kost und Logis im Kerker seiner Frau aufkommen. Nicht zu reden von den Gefälligkeiten, die er den Anklägern zukommen ließ, damit sie seine arme Agnes doch bitte freisprechen sollten!
Der Inquisitor und sein Gefolge waren weitergezogen, und alle im Dorf hatten aufgeatmet, denn wie schnell konnte eine Hexe mit Schadzauber eine andere bislang noch unbescholtene Frau zur Hexe machen oder einen gottesfürchtigen Mann bezirzen?
Das alles ging Lukrezia durch den Kopf. Nein, sie wollte nicht, dass ihren Eltern die einzige Kuh weggenommen wurde. Auch wollte sie nicht selbst dafür zur Verantwortung gezogen werden.
Rasch blickte sie sich um. Sie war allein im Stall. Selbst Antoine, der Hofknecht, der ihr nachstellte, wo es nur ging, war nicht zu sehen.
Lukrezia wollte sich gerade vom Melkschemel erheben, den Eimer nehmen und die Milch draußen heimlich ausschütten, als sie Schritte hinter sich hörte. Erschrocken fuhr sie zusammen.
Hinter ihr stand Antoine.
Sein Grinsen gefiel ihr nicht. Natürlich konnte er nichts von der sauren Milch wissen, aber wahrscheinlich hatte er darauf gelauert, sie allein im Stall zu erwischen.
Antoine hatte die vierzig längst überschritten. Er war ein Bär von Mann, mit dicker Wampe, verlausten Haaren, und er stank. Er torkelte leicht, als er auf sie zukam. Wahrscheinlich hatte er wieder getrunken.
Lukrezias Eltern hätten ihn wahrscheinlich längst vom Hof gejagt, aber seine Arbeit verrichtete er gut. Außerdem hatten sie kein Geld, um jemanden zu bezahlen. Kost und Logis mussten genügen. Und dafür war es schwierig, einen geeigneten Knecht zu finden. Woher er allerdings das Geld hatte, um sich ständig mit Schnaps abzufüllen, war Lukrezia ein Rätsel.
»Ah, hier hat sich die kleine Lukrezia also versteckt«, lallte er.
»Nicht versteckt! Ich habe die Kuh gemolken, das siehst du doch!«
Er torkelte noch einen Schritt näher heran.
»Ob du auch so schöne Euter hast? Hast dich ja prächtig entwickelt in den letzten Monaten.«
»Verschwinde! Ich werde es meinem Vater erzählen.«
Sein Gesicht verfinsterte sich. »Was willst du erzählen? Dass ich dir ein Kompliment gemacht habe? Meinst du, ich bin blind? Du wackelst doch mit deinem Hinter immer vor mir her, damit ich's dir besorge.«
Wäre sie ein Mann, wäre sie ihm jetzt am liebsten an die Kehle gefahren. Aber sie war nur eine Frau und zierlich gebaut. Mit einer einzigen Handbewegung würde er sie beiseite fegen.
Ein weiterer Schritt.
Bisher hatte Lukrezia ihm entweder aus dem Weg gehen oder ihn in die Schranken weisen können, indem sie drohte, es ihrem Vater zu erzählen. Das hatte sie auch schon mehrmals getan, doch der hatte stets beschwichtigt.
Lass es zu!, flüsterte plötzlich eine Stimme in ihr. Eine Stimme, lüstern und schmeichelnd.
»Nein!« Unwillkürlich hatte sie es ob der unerhörten Aufforderung laut ausgestoßen.
Einen Moment lang sah Antoine sie glubschäugig an. Dann grinste er wieder breit, sodass seine braunen Zahnstummeln zu sehen waren.
Wie sehr sie ihn verabscheute!
Abscheu ist es etwas Wunderbares, flüsterte erneut die Stimme in ihr. Nur wenn du sie überwindest, vermagst du die Schwelle zu übertreten.
Welche Schwelle denn?, fuhr es ihr verzweifelt durch den Kopf.
Dummchen, die Schwelle zum Himmelreich natürlich.
Sprach da der Allmächtige mit ihr? Nur so hatte sie sich seine Stimme nie vorgestellt. So – verdorben.
Sie hatte kaum mehr auf Antoine geachtet, zu verwirrt war sie. Da war er schon heran und stürzte sich auf sie. Beide fielen sie zu Boden. Der Eimer mit der Milch kippte ebenfalls um. Lukrezia lag mitten in der Pfütze. Antoine lag schwer auf ihr.
Lukrezia schrie, aber er presste ihr seine klobige Hand auf den Mund. Sie hielt die Luft an, um seinen alkoholgeschwängerten Atem nicht zu riechen.
Doch plötzlich stutzte er.
Er schnüffelte umher wie ein Rüde. Seine linke Pranke lag zudem in der Milchpfütze. Nun hob er sie an die Nase und roch daran.
Noch immer lag Lukrezia unter ihm auf dem Boden. Ja, auch sie roch die saure Milch, der zudem ein urinartiger Geruch anhaftete.
Erneut verzogen sich seine wulstigen Lippen zu einem schmierigen Grinsen.
»Das also bist du: eine kleine Hexe!«
Sie bäumte sich unter ihm auf, aber er lachte nur.
»Was glaubst du, was mit dir passiert, wenn ich dich dem Inquisitor melde? Dann ergeht es dir wie neulich dem Faustin seiner Hexe! Ich habe gehört, dass ihre Schreie aus dem Kerker bis nach draußen dringen.«
»Ich ... ich bin keine Hexe«, stammelte Lukrezia.
Doch, du bist es!, meldete sich die Stimme in ihr. Beweise es ihm!
»Die Kuh ...«
Antoine lachte rau. »Und die Kuh wird deinen Eltern gleich mit weggenommen. Was glaubst du, wie sie sich grämen werden, wenn man ihnen Töchterchen und die einzige Kuh entreißt?«
Er schob ihr den Kittel hoch, während er seinen massigen Leib zwischen ihre Beine drängte.
Beweise es ihm!
Während er sie weiter unter sich zwang, knöpfte er mit einer Hand seine Hose auf.
Aber wie ... wie soll ich ...?
Die Antwort kam in Form eines Bildes, das vor ihren Augen entstand. Sie sah ...
... und setzte es in die Tat um. Ihre Finger tasteten nach dem Melkschemel, der in Greifweite war. Sie war nun nicht mehr verzweifelt. Sondern eiskalt.
Antoine schnaufte über ihr vor Erregung, während er ihre Brüste knetete. Aber auch das war ihr egal.
Im nächsten Moment schrie er auf. Lukrezia hatte ihm den Schemel über den Schädel gehauen. In seinem Suff war es weniger der Schmerz als vielmehr die Wut, die ihn hatte aufschreien lassen. Obwohl ihm das Blut über die Stirn ins Gesicht lief, schien ihm der Schlag wenig ausgemacht zu haben.
»Dafür nehme ich dich besonders ran, du Hexe!«, brüllte er und schlug ihr ins Gesicht.
Lukrezia spürte, wie ihre Lippen aufplatzten, aber ich sie spürte den Schmerz nicht.
Das war erst der Anfang!, vernahm sie erneut die Stimme. Aber du bist zu mehr imstande. Zu viel mehr!
Als er erneut zum Schlag ausholte, stieß sie ihm beide Daumen in die Augen. Tief drangen sie ein. Mit Genugtuung fühlte sie, wie die Augäpfel platzten.
Diesmal brüllte der Knecht nicht mehr vor Wut, sondern vor unbändigem Schmerz. Seine Pranken fuhren zu seinen Augen hoch, während seine Schreie nicht mehr aufhören wollten.
Lukrezia nutzte den Moment und wand sich endlich unter ihm hinweg.
Töte ihn, sonst wird er dich töten!
Lukrezias Blicke huschten gehetzt umher. Da sah sie, was sie suchte. Sie sprang dorthin, bückte sich und hob die Mistgabel auf. Antoine hatte sich mittlerweile auf die Knie gehievt. Sein Oberkörper schwankte.
»Hilf mir!«, brüllte er verzweifelt.
Ja, hilf ihm!, feixte die Stimme.
Lukrezia wusste, was der Herrgott von ihr verlangte.
Schmerz um Schmerz, Blut um Blut!
Sie nahm nicht Maß. Sie stieß einfach zu, es war ihr egal, wohin. Beim ersten Stoß bohrten sich die spitzen Zinken in seinen Bauch. Aufbrüllend fiel er zurück auf den Rücken. Lukrezia musste alle Kraft aufwenden, um die Heugabel aus seinem Fleisch zu ziehen. Dann stieß sie erneut zu.
Ihr Blick irrlichterte umher und fiel auf die Axt, mit der ihr Vater das Holz hackte. Warum das Werkzeug hier im Stall lag, wusste sie nicht.
Sie sah es als Wink Gottes an, ließ die Heugabel fallen, nahm die Axt in die Hand und schritt erneut zur Tat.
Gegenwart
Im Zum Teufel, der besten, weil einzigen Kneipe in Saint-Cyriac, ging es an diesem Freitagabend hoch her. Lautstarke Gespräche, Gelächter, das Klirren der Gläser und ab und zu Moustaches lautes Organ, doch bitte der neuen Kellnerin den Weg freizumachen, wenn sie sich mit einem Tablett voller Getränke vergeblich durchzukämpfen bemühte.
Draußen hinter den Bleiglasfenstern tobten Sturm und Regen, und jeder, der es trockenen Fußes über die berüchtigte moustache'sche Seenplatte vor der Eingangstür geschafft hatte, konnte sich glücklich schätzen.
Auch der Montagne-Stammtisch war an diesem Abend wieder voll besetzt.
Nach all den aufzehrenden Ereignissen der letzten Zeit hatten sich Zamorra und Nicole entschlossen, hinunter ins Dorf zu fahren, um auf andere Gedanken zu kommen. Zu sehr ging ihnen alles im Kopf herum: Teris jetziger Zustand und die vage Andeutung des Engels Taphoas, sie zu heilen.
Doch eben das war der Knackpunkt, den Nicole und Zamorra seitdem immer und immer wieder diskutierten. Taphoas hatte behauptet, die Seele eines Erzdämons zu benötigen, um Teri zumindest eine geringe Heilungschance zu ermöglichen.
Beide, Zamorra wie Nicole, hatten mit der Forderung gerungen. Während Nicole sicherlich alles für die Freundin getan hätte, war Zamorra der Besonnenere gewesen. Er wollte nicht Gott spielen. Und überhaupt: Wie sollte er an die Seele eines Erzdämons gelangen? Schließlich konnte er nicht einfach in die Hölle einmarschieren und sich einen schnappen.
»Wirklich vorzüglich, dieser Sancerre!«, lobte Pater Ralph und ließ den guten Tropfen genüsslich in der Mundhöhle wandern. »Nur der Name und das Etikett sind für meinen Geschmack etwas gewöhnungsbedürftig.
»Du meinst unheilig?«, neckte ihn Nicole.
Eigentlich war es unüblich, dass die Gäste ihre Getränke in den Teufel mitbrachten. Aber da Pater Ralph vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt hatte und sie ihn seitdem nicht mehr gesehen hatten, hatten Zamorra und Nicole es sich nicht nehmen lassen, ihn mit einer Flasche ihres neuesten Weines zu überraschen.
»Na ja«, antwortete Pater Ralph. »Ein geradezu himmlischer Tropfen ist es in der Tat, aber warum nennt ihr ihn dann ausgerechnet œuvre diabolique – Teufelswerk?«
»Weil er wie Pfui Teufel schmeckt!«, mischte sich Dorfschmied und Werkstattbesitzer Charles Goudon ein. Auch er hatte kosten dürfen, aber sogleich das Gesicht verzogen. Allen war bekannt, dass er eher Bier und Calvados bevorzugte.
»Du weißt eben nicht, was Qualität ist!«, widersprach Jean-Paul Cotilliard. Er führte den kleinen Weinladen in Saint-Cyriac. Vornehmlich bot er Zamorras Weine an, aber auch die von Winzern aus den umliegenden Weinbergen. In diesem Fall fühlte er sich geradezu herausgefordert, Nicole und Zamorra zu verteidigen. »Diese Flasche Sancerre AOP œuvre diabolique biete ich in meinem Geschäft für mindestens fünfunddreißig Euro an!«
»So, Freunde, wollt ihr euch jetzt noch stundenlang über eine Flasche Wein unterhalten oder die Premiere meines neuesten Witzprogramms hören, mit der ich nächste Woche in Lyon an der Landesmeisterschaft teilnehme?«, fragte Malteser-Joe. Vielmehr forderte er es geradezu.
Ein Aufstöhnen ging durch die angeheiterte Runde.
»Bitte nicht heute Abend!«, seufzte Nicole. »Dafür habe ich echt keinen Kopf.«
»Außerdem werden deine Witze nicht besser«, sagte Goudon.
Malteser-Joe funkelte ihn wütend an.
Bevor alles wieder in einen Streit ausartete, wurde abgestimmt. Schließlich einigte man sich darauf, dass Malteser-Joe wenigstens einen Witz erzählen durfte.
»Aber wirklich nur einen!«, ermahnte ihn Nicole.
»Spaßverderber, allesamt!«, zische Malteser-Joe. »Also, hört zu ...«
Wer nicht bei der Sache war, war Zamorra. Während Malteser-Joe einen langatmigen Witz erzählte, stupste Nicole ihren Partner sanft an.
»Geht dir Teri wieder durch den Kopf?«, fragte sie leise.
»Das auch. Aber ich frage mich, wer dieser Werner Kurt wirklich ist.«
Nicole folgte Zamorras Blick.
Der geheimnisvolle Deutsche, der sich seit einigen Monaten in Saint-Cyriac aufhielt, saß an einem Tisch in der hintersten Ecke des Lokals. Eine Traube von jüngeren Leuten umgab ihn, die allesamt an seinen Lippen hingen.
»Auf jeden Fall scheint er mit seinen Geschichten die Menschen zu verzaubern. Daran ist nichts Schlimmes, oder?«
»Nein, aber ich wüsste gern, was er ihnen erzählt ...«
»Dann setz dich doch einfach dazu«, schlug Nicole vor, aber Zamorra schüttelte den Kopf. »Ich würde darüber hinaus gern mehr über ihn erfahren. Vielleicht sollten wir ihn mal aufs Château bitten.«
»Eine sehr gute Idee, chéri.«
In dem Moment erwiderte Kurt Zamorras Blick. Er nickte ihm grüßend zu und erhob sich. Gemessenen Schrittes kam er auf ihn zu. Seine Zuhörer sahen ihm hinterher.
»Setzen Sie sich doch zu uns?«, lud Nicole ihn höflich ein.
Vor ein paar Monaten hatte er sich schon mal selbst eingeladen, aber während der ganzen Zeit nicht ein Wort gesagt. Als wolle er die Gespräche der anderen nur in sich einsaugen, um sie später für seine Geschichten zu verwenden.
Nun schüttelte er den Kopf.
»Die Zeiten ändern sich. Weil nichts bleibt, wie es ist. Sturm wird aufziehen. Passen Sie beide gut aufeinander auf.«
Mit diesen Worten schritt er weiter zur Tür und verschwand nach draußen in den strömenden Regen.
Für einen Moment fegte ein gewaltiger Windstoß durchs Lokal, sodass sämtliche Gespräche verstummten.
Auch die anderen am Stammtisch hatten Kurts düstere Prophezeiung vernommen.
»Was will er uns nur damit sagen?«, fragte Nicole stirnrunzelnd ihren Partner. »Sturm zieht auf ... Als ob wir nicht schon genug Probleme haben!«
Zamorra zuckte mit den Schultern, aber die »Prophezeiung«, wie Nicole sie nannte, stimmte auch ihn nachdenklich.
»Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus ...«, murmelte Pater Ralph nachdenklich.
Während an den anderen Tischen die Gespräche wieder einsetzten, wollte am Montagne-Stammtisch keine rechte Stimmung mehr aufkommen.
Doch niemand ahnte, dass es vorerst der letzte heitere Abend gewesen war ...
Vergangenheit
Schweratmend tauchte Lukrezia aus dem blutigen Rausch auf, der sie erfasst hatte. Ihre Brust hob und senkte sich, als würde das wild pochende Herz sie im nächsten Moment sprengen wollen.
Noch immer hielt sie mit beiden Händen die Axt umfasst. Erst ganz langsam kam sie wieder zur Besinnung. Der Boden war übersät mit Körperteilen, Eingeweiden und Blut. Überall Blut. Seltsamerweise blieb sie völlig gelassen, während sie den Blick über das Schlachtfeld gleiten ließ. Ja, sie fühlte sich wie eine Kriegerin. Gottes Kriegerin, die der Stimme ihres Herrn gehorcht hatte, um den Sünder zu bestrafen.
Du hast recht gehandelt, vernahm sie nun erneut die Stimme. Ich bin dein Herr und werde dich fürderhin leiten. Auf dass du von nun wandelst auf dem finsteren Pfad.
Ergriffen schloss Lukrezia für einen kurzen Moment die Augen. Der Herr sprach mit ihr, mir ihr, einem einfachen Bauernmädchen, und er würde auch weiterhin seine schützende Hand über die halten.
Als sie die Augen wieder öffnete, stieß sie einen überraschten Schrei aus. Nicht, weil die blutigen Überreste verschwunden waren und auch der Lehmboden so aussah, als hätte hier nie so etwas wie ein Massaker stattgefunden, sondern weil direkt vor ihr ein Fremder stand.