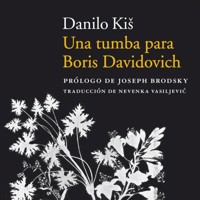15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zum 30. Todestag am 15. Oktober 2019 erstmals übersetzt: Der zweite, wegweisende Roman von Danilo Kiš. Der erstmals ins Deutsche übersetzte Roman von Danilo Kiš aus dem Jahr 1962 erzählt von der Jüdin Maria, die 1944 mit ihrem sieben Wochen alten, im Lager geborenen Sohn aus Birkenau flieht. „Nie wieder hat Kiš das Thema der Judenverfolgung mit solcher Direktheit angegangen, gleichsam auf körperliche Art und in Nahaufnahme“, schreibt Ilma Rakusa in ihrem Nachwort. Die Geschichte der Flucht verwebt er kunstvoll mit Rückblenden aus der Kindheit Marias, wie die antisemitischen Übergriffe in der Schule und das Massaker von Novi Sad. „Psalm 44“ ist sowohl thematisch als auch sprachlich ein wichtiger Baustein des zum 30. Todestag am 15. Oktober nun vollständig übersetzten Werks.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Zum 30. Todestag am 15. Oktober 2019 erstmals übersetzt: Der zweite, wegweisende Roman von Danilo Kiš.Der erstmals ins Deutsche übersetzte Roman von Danilo Kiš aus dem Jahr 1962 erzählt von der Jüdin Maria, die 1944 mit ihrem sieben Wochen alten, im Lager geborenen Sohn aus Birkenau flieht. »Nie wieder hat Kiš das Thema der Judenverfolgung mit solcher Direktheit angegangen, gleichsam auf körperliche Art und in Nahaufnahme«, schreibt Ilma Rakusa in ihrem Nachwort. Die Geschichte der Flucht verwebt er kunstvoll mit Rückblenden aus der Kindheit Marias, wie die antisemitischen Übergriffe in der Schule und das Massaker von Novi Sad. »Psalm 44« ist sowohl thematisch als auch sprachlich ein wichtiger Baustein des zum 30. Todestag am 15. Oktober nun vollständig übersetzten Werks.
Danilo Kiš
Psalm 44
Roman
Aus dem Serbokroatischen von Katharina Wolf-Grießhaber
Mit einem Nachwort von Ilma Rakusa
Carl Hanser Verlag
»Weiter sprach der Engel des HERRN zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen; denn der HERR hat dein Elend erhört.«
Erstes Buch Mose
»Du machst uns zum Sprichwort unter den Heiden …«
Psalm 44 des David
1
Schon seit einigen Tagen wurde geflüstert, dass sie vor der Evakuierung des Lagers die Flucht versuchen würden. Besonders seit man (das war vor fünf, sechs Nächten) zum ersten Mal Kanonendonner in der Ferne gehört hatte. Doch das Gemunkel hatte sich ein wenig gelegt — zumindest kam es ihr so vor —, seitdem drei Frauen, unter ihnen auch Erzsike Kohn aus ihrer Kammer, vor dem Stacheldraht erschossen worden waren.
Deshalb blieb ihr jetzt nur, auf die Kanonen zu horchen und abzuwarten, dass etwas geschehen würde. Sie fühlte sich unfähig, etwas zu unternehmen (was wahrscheinlich möglich gewesen wäre, wenn sie nur gewusst hätte, was — wie gestern Abend zum Beispiel, als sie die Glühbirnen mit einer Stange heruntergeschüttelt hatten, als wären es die Birnen unter der Laube in ihrem Garten, was sie nur dank Jeanne und unter ihrer Anleitung fertiggebracht hatte, denn ihr selbst wäre es niemals in den Sinn gekommen, die Glühbirnen zu zerschlagen und dies für etwas anderes zu halten als für ein unnötiges Risiko und Selbstmord), genauso unfähig zu etwas, wie sich Polja fühlen konnte, die jetzt im Fieberwahn neben ihr im Stroh lag. Sie konnte nur darauf warten, dass Jeanne jetzt zu ihr sagte (wie sie bisher »noch nicht« oder nicht einmal das, sondern nur »wir werden sehen« oder »wir werden schon etwas einfädeln« gesagt hatte), und sie ihr Kind in die Arme nähme wie ein Gepäckstück mit Kostbarkeiten, die es unbemerkt durch die Hintertür hinauszutragen galt, direkt vor der Nase der Agenten, die wussten, dass diese gestohlenen Kostbarkeiten hinausgebracht würden, und das wahrscheinlich gerade durch diese Tür. Und sie nähme in dem Moment, wo Jeanne ihr sagen würde, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei, ein getarntes und bewusst unauffälliges Gepäckstück und ginge damit durch den Kordon von Agenten und Polizisten, verzweifelt entschlossen, unbemerkt durchzukommen und sich haargenau so zu verhalten, wie man es ihr gesagt und angeordnet hatte, im Bewusstsein, dass sie an diesen Befehl gebunden war, weil in dem Moment (falls etwas Unvorhergesehenes geschähe), wo jemand (zum Beispiel) von hinten auf sie zukäme und ihr auf die Schulter klopfte, um sie aufzufordern, ihr Bündel vorzuzeigen, sie das wertvolle Päckchen mit dem Kind nur mit ihrem Körper abschirmen könnte — als einzigem Schutz, der ihr in diesem Augenblick einfiele. Vielleicht könnte sie insgeheim und sinnlos noch darauf hoffen, dass sich die Erde vor ihr auftun würde und sie sich unten in einem finsteren Schloss wiederfände, wo sich ihr der Deus ex Machina, das heißt Max, höchstpersönlich vorstellen würde. Denn dass Max, unsichtbar und allgegenwärtig, auftauchen und sich in alles einmischen würde und dass er sich bereits in die Flucht eingemischt hatte — war ihr vom ersten Augenblick klar gewesen. Eigentlich von dem Moment an (das war vor drei Abenden gewesen), als Jeanne mit einer verborgenen Hoffnung in den Augen zurückgekehrt war und geflüstert hatte, es sei »nicht alles verloren«. Und so war es gewesen. Polja lag schon den dritten Tag im Malariafieber, und man wartete jeden Moment darauf, dass man sie abholen würde; es war unbegreiflich, dass man sie nicht schon am ersten Abend abgeholt hatte, als sie matt und krank zurückgekommen war. Vielleicht nahm man Rücksicht auf sie (Polja), weil sie schon lange im Lagerorchester unmittelbar vor dem Eingang in die Gaskammer Cello spielte, oder es lag daran — was wahrscheinlicher war —, dass das Lagerkommando wegen des schnellen Vorrückens der Alliierten und des immer näher kommenden Kanonendonners die Exekution aufschieben musste.
Jeanne war an diesem Abend etwas später zurückgekommen. Es war eine nasse, eisige Novembernacht, und der dunkle Wind trug die müden und verstimmten Klänge der Gefangenenkapelle herüber, die Beethovens Eroica und das Lagerlied »Das Mädchen, das ich anbete« spielte. Polja phantasierte noch. Unverständlich. Auf Russisch. Im Sterben. Man durfte kein Licht einschalten, und so tastete sie sich zu ihrem Schlafplatz (wobei sie sich an Poljas Röcheln orientierte). Sie hatte Angst, Polja könne sie trotzdem hören. Dann befreite sie das Kind aus dem Stroh und von den Lumpen, in denen es schlief: eine kleine Wachspuppe. Maria wagte nicht, sich Polja zu nähern. Hatte Angst um das Kind. Und um sich. Die Mutter.
Sie hörte Jeannes Schritte: Das befreite sie davon, an Polja zu denken. Und da wurde ihr plötzlich mit einer erstaunlichen Sicherheit bewusst, dass etwas geschehen war. Das, was Jeanne so lange aufgehalten hatte. Eine Botschaft von Jakob. Oder von Max. (Dieser Max leitete sicher schon etwas in die Wege. Gegenwärtig, aber unsichtbar.) Doch Jeanne sagte nichts. Maria hörte nur ihren leichten, verschwörerischen Gang. (Das kam ihr plötzlich sehr seltsam vor: Jeanne hatte die schweren Schuhe noch nicht ausgezogen.) Dann das Rascheln des Strohs, der dumpfe Aufprall der abgeworfenen Schuhe, der rostige Klang einer Blechdose mit Wasser und wieder das Rascheln des Strohs, jetzt aus Poljas Nähe, und dann: das leise Klappern von Poljas Zähnen gegen die Blechdose. Gerade wollte sie sich äußern, etwas über Polja sagen, nicht nur um Zweifel auszudrücken, dass sie mit ihnen würde mitkommen können, sondern um endlich auszusprechen, was beide schon seit dem ersten Tag wussten, seit Polja krank zurückgekommen war, und was unausgesprochen, aber offenkundig zwischen ihnen schwebte: Polja wird sterben. Doch Jeanne befreite sie davon, und sie hörte ihr Flüstern, als spräche die Stimme eines anderen ihren eben erst hervorgebrachten Gedanken aus:
»Elle va mourir à l’aube! Sie wird im Morgengrauen sterben«, sagte Jeanne.
Statt zu antworten, seufzte sie nur. Sie spürte, wie sich ihr Hals zuschnürte. Als wäre ihr erst jetzt, wo Jeanne es gesagt hatte, bewusst geworden, was sie selbst schon seit dem ersten Tag wusste, seit Polja krank zurückgekommen war; sie würde sterben.
Dann hörte sie Poljas babylonisches Phantasieren wieder stärker als das ferne Lied der Kanonen. Deshalb wollte sie ein Gespräch mit Jeanne anfangen, damit diese ihr von den Kanonen, von Jakob, von der Flucht, letztlich von irgendetwas erzählte, nur um sie von dem Alptraum und von Poljas Röcheln zu befreien, damit sie nicht daran dachte, dass ja doch nichts geschehen würde, nicht jetzt, nicht später, nicht in zwei, nicht in zweihundertzweiundzwanzig Tagen, so wie bisher nichts geschehen war; weder die Flucht noch Jakob, noch Max, nicht einmal die Kanonen, nichts würde geschehen; nur was jetzt mit Polja geschah: Sie würde langsam erlöschen, knisternd, wie eine Kerze niederbrennt.
Der Strahl des Scheinwerferlichts, der rhythmisch durch eine Ritze hereindrang, schnitt wie ein Fingernagel wieder in das Dunkel der Baracke, und sie bekam Jeanne zu Gesicht, als sie zwischen dem hellen Strahl und der Wand stand und hineintrat wie in einen Strahlenkranz, dann verlor sie sich im Dunkel. Von dort, aus diesem für einen Augenblick beleuchteten Dunkel, hörte sie ihre Stimme, ihr Flüstern, das wie ein schmales Lichtband das Schweigen zerschnitt:
»Jan, wie geht es Jan?«
»Er ist eingeschlafen«, sagte sie. »Er schläft.« Aber das war nicht das, was sie gedacht hatte, dass sie hören würde, sie hatte etwas anderes erwartet, etwas ganz anderes als die Frage Jan, wie geht es Jan?, und sie war sogar sicher, dass Jeanne noch etwas zu sagen hatte, und sogar als Jeanne ihr zugeflüstert hatte und sogar noch davor, als sie nur gedacht hatte, etwas zu sagen (ihr schien, sie hatte genau gewusst, wann Jeanne zu reden beginnen und das Schweigen zerschneiden würde), hatte ihr geschienen, dass sie etwas anderes sagen würde, weil sie etwas ganz anderes zu sagen hatte, etwas, was (dennoch) nicht ohne Bezug zu dieser Frage war; ihr schien plötzlich sogar (das spürte sie eher an ihrem Pulsschlag, als dass sie sich dessen bewusst gewesen wäre), dass sich die Frage Jan, wie geht es Jan? gar nicht wesentlich von dem unterschied, was Jeanne zu sagen hatte. Deshalb sagte sie, ohne selbst zu wissen, wie sie ihrem Flüstern wenigstens eine feine Bedeutungsnuance verleihen konnte, als wollte sie mitteilen, dass sie verstanden habe, dass Jeanne noch etwas anderes zu sagen hatte, und dass ihre Antwort ebenfalls nur eine Einleitung, eine Andeutung sei:
»Ich habe seine Windeln gewaschen. Jetzt trockne ich sie. Ich habe sie mir um den Unterleib gewickelt, und er liegt auf mir, hier«, als hätte Jeanne ihre leichte Bewegung, mit der sie sagen wollte: oben, auf der Brust, sehen können. »Deswegen konnte ich mich nicht um Polja kümmern«, doch sogleich bereute sie es, nicht weil es nicht wahr gewesen wäre, sondern weil ihr schien, dass sie damit den Faden abgeschnitten und den Strom von Jeannes Gedanken unterbrochen hatte; oder wenigstens, dass sie damit um ein paar Augenblicke aufgeschoben hatte, dass Jeanne sagte, was sie zu sagen hatte.
»Arme Polja«, sagte Jeanne; aber das hätte genauso (zumindest kam ihr es so vor) auch »Arme Maria« und »Armer Jan« heißen können; und sie war ganz in Anspruch genommen von diesem Gedanken: Ob es einerlei wäre, wenn Jeanne Armer Jan oder Arme Maria gesagt hätte, denn wenn es einerlei wäre, würde das bedeuten, dass nichts geschehen war und nichts geschah; Polja geht also nicht mit uns, dachte sie, als dächte sie es zum ersten Mal und als begriffe sie zum ersten Mal die Schwere all dessen, aber sie sagte nur:
»Sie ist den ganzen Tag nicht zu Bewusstsein gekommen«; dann sagte Jeanne:
»Besser für sie … Verstehst du?«, und sprach damit im schwarzen Kristall dreier Worte wieder einen Gedanken von ihr aus; und gleich danach: »Ich wollte, es geschähe möglichst bald. Verstehst du? Möglichst bald.«
Endlich wurde auf diese Weise etwas ausgesprochen, was den durchtrennten Faden zu einem Knoten verband, und sie spürte, dass dies wieder etwas bedeutete, etwas anderes und etwas mehr als die bittere und einfache Wahrheit Polja wird sterben oder Polja wird nicht mit uns mitkommen können, es bedeutete auch wir werden gehen oder wenigstens wir werden es versuchen. Und plötzlich lehnte sie sich in ihrem Inneren gegen diese langsame Entstehung einer schon offensichtlichen Wahrheit auf, und es kam ihr sogar ein wenig heuchlerisch vor, dass keine von ihnen sich selbst eingestehen wollte, dass sie sich mit dieser Wahrheit abgefunden hatten — dass sie die Flucht ohne Polja versuchen würden — und dass das bereits entschieden und beschlossen war, nicht durch ihren Willen oder ihr Einverständnis, sondern einfach, schrecklich einfach entschieden und dass ihnen jetzt nichts anderes übrigblieb, als sich mit dieser Tatsache abzufinden (oder sich nicht damit abzufinden, ganz egal).
»Sie wird nicht mit uns mitkommen können«, sagte sie und versuchte — ohne dass es ihr bewusst war —, ihren ganzen Alptraum in diesem Satz zusammenzufassen, den sie in einem Atemzug aussprach, wie man mit einem Schluck eine bittere Medizin oder Gift trinkt. Aber das sagte sie auch, um Jeanne zu helfen, endlich zu sagen, was sie zu sagen hatte, oder zu tun, was sie beabsichtigt hatte oder erst zu tun plante, doch Jeanne starrte beharrlich durch die Ritze im Brett, bis sie wie ein leicht verändertes Echo ihrer eigenen Worte sagte:
»Deshalb möchte ich, dass es möglichst bald geschieht. Verstehst du: Es wird leichter sein«; aber Maria wollte ihr Gewissen ganz von den Anschuldigungen entlasten, die sie sich selbst, und nun auch Jeanne, mehr und mehr aufgeladen hatte, und dachte: Vielleicht plant Jeanne erst etwas, und vielleicht ist gar nichts geschehen, sondern all das kam ihr nur so vor, weil sie wollte, dass es so sei und dass etwas geschehe, weil sie wusste, dass sie nicht mehr warten konnte — die Kanonen zerstörten allmählich den Betonschutzwall des passiven Wartens und der Versöhnung mit dem Schicksal. Und dann — nur um Jeannes Stimme zu hören und um sich zu beruhigen, weil sie wusste, dass sie heute Nacht nicht würde einschlafen können, zumindest noch nicht jetzt, solange Jeanne nicht gesagt hatte, was sie plante:
»Ich versuche zu schlafen«, sagte sie; und dann, als beschleunigte sie damit schließlich die Antwort und die Entscheidung, über die Jeanne jetzt nachdachte, und obwohl ihr (Maria) schien, dass man in diesem Augenblick nichts planen und nichts anderes machen konnte als das, was die drei Frauen gemacht hatten, unter denen auch die kleine Erzsike Kohn gewesen war, die vor ein paar Nächten in den Stacheldraht gerannt und durchlöchert worden waren, um alles zu vergessen, weil das der Tod ist, dachte sie, Alles vergessen, fragte sie: »Wie viel Uhr kann es denn sein?«, als wäre dadurch die Hand oder wenigstens der kleine Bruder des Todes herbeigerufen worden, der ihr jetzt, müde, wie sie war, die Augen zudrückte, und mit dieser Frage regte sich der Widerstand in ihrem Geist als Folge eines dunklen Gefühls der Verbundenheit von Vergessen-Tod-Schlaf-Zeit und ihrem Bewusstsein, das in dieser Ursächlichkeit und in dieser Hierarchie an erster Stelle stehen musste, Hand in Hand mit der Zeit.
»Ich weiß nicht«, sagte Jeanne, doch dann, als erwachte auch in ihr der Widerstand, sagte sie noch, als griffe sie nach einer vergessenen Waffe: »Ich denke, es ist elf vorbei. Ich glaub’ nicht, dass es später ist.« Da schnellte wie ein Schwimmkörper an die Oberfläche, was bisher das Dunkel ausgefüllt hatte, und kristallisierte und komprimierte sich auf dem Raum von vier, fünf geflüsterten Worten: »Heute Nacht versuchen wir es.«
Und noch bevor es ihr gelang, irgendetwas zu denken, zu erschrecken oder sich zu freuen, aufzuschreien oder aufzustöhnen oder alles zusammen in der Hölle von geistiger Verwirrung und organischem Chaos, im intensiven Kreislauf des Blutes, das durch ihren Körper strömte wie eine heiße innere Welle, die am Ufer des Körpers die zerbrochenen und chaotischen Gedankenreste zurücklässt (nur das Aufblitzen zahlloser Assoziationen, die sich gegenseitig durchdringen und zerstören) sowie die Sekrete aller Drüsen und der Eierstöcke, noch bevor es ihr gelang zu begreifen, dass sie im intensiven Ansturm von alldem an der Grenze zur Ohnmacht zitterte, fügte Jeanne hinzu, was sie nicht mehr hätte sagen müssen: »Ich wollte es dir nicht gleich sagen. Ich dachte, du solltest ein wenig schlafen. Du musst ausgeruht sein.«
So erlaubte sie ihr gar nicht, an Polja zu denken und sie zu bedauern oder ihretwegen Gewissensbisse zu empfinden: Jeanne hatte Polja mit ihren Worten einfach ausgelöscht, indem sie sie nicht erwähnt hatte, nicht einmal »arme Polja« hatte sie über sie gesagt, was wiederum etwas bedeutet hätte, nur wir versuchen es, in das nichts und niemand hineinpasste außer ihnen drei, das heißt Jeanne, Jan und sie, also nur die Lebenden, während Polja mit einem Leichentuch zugedeckt war, wie Tote zugedeckt werden. Aber Maria nahm Polja noch immer wahr, nicht wegen des leisen Röchelns, das keine irdische Sprache mehr sprach, sondern nur mit der Stimme des Todes selbst flüsterte, vielmehr weil sie Poljas Leiche ständig aus ihrem Gedankenstrom auf die Seite und unter das Eis schieben musste (sie hatten Polja bereits beerdigt), wie man die Leichen der Frauen, damals, am Anfang, unter das Eis der Donau geschoben hatte —, um Platz für die Lebenden zu schaffen oder wenigstens für die, von denen sie hoffte, dass sie lebten: für Jakob eigentlich; für wen sonst. Und jetzt erblickte sie plötzlich Jakob — zum ersten Mal nach der letzten Begegnung — nicht mehr in der Perspektive, die sich, wenn sie sich umdrehte, öd und finster hinter ihr erstreckte, sondern in einer fast imaginären Zukunft; so stand Jakob groß und bleich da, mit einem roten Bart, ausgezehrt und müde von der Rückkehr, aber mit strahlendem Blick und ausgebreiteten Armen, die Straße hinunter, wo sie mit Jan in den Armen stand und ihm das Kind wie Brot und Salz, wie das heilige Wunder von Betlehem hinhielt. Doch diese momentan wahrgenommene Zukunftsperspektive begann auf einmal zusammenzustürzen wie in der Wüste errichtete Leinenkulissen — es blieb nur Jakob in dieser realen Wüstenlandschaft, aus welcher der Wind die Szenerie weggetragen hatte; nur grauer aufgewirbelter Staub.
Sie erinnerte sich an diese letzte Begegnung mit Jakob, vor gar nicht so langer Zeit, eigentlich vor fünf Wochen; Jan war da erst zwei Wochen alt gewesen, nicht mehr. Daran erinnerte sie sich genau, dass Jan zwei Wochen alt gewesen war: Sie hatte am selben Tag entbunden, als sie Jakob zum ersten Mal nach der Trennung wiedergesehen hatte. Aber das war davor gewesen. Das zweite Mal hatte sie Jakob (wer sonst hätte es sein können) auf dem Bahnhof gesehen; und so war es gewesen: Sie hatte über Max die Botschaft erhalten (die Botschaft hatte sie in ihrer Stube unter dem Stroh am Kopfende gefunden), dass Jakob hier mit dem Transport vorbeikommen würde, am Abend gegen sieben. Daraufhin überlegte sie den ganzen Tag, wie sie es bewerkstelligen sollte, ihren Arbeitsplatz zu verlassen und zum Bahnhof zu laufen, um Jakob zu sehen und ihm zu sagen, dass er Vater geworden war und dass sie sich, als sie ihm zugerufen hatte JAKOB, ICH BIN SCHWANGER, nichts eingebildet hatte und dass sie wusste, dass er ihren Schrei gehört haben und ihre Stimme wiedererkannt haben musste, denn wer hätte ihm das sonst zugerufen und zwar aus der Kolonne, die sich schon dem Lagereingang genähert hatte; sie musste Jakob sehen, wenn nicht aus einem anderen Grund, dann wenigstens, um sich zu vergewissern, dass er lebte, und um ihn zu fragen, was er über alles dachte, und ob er, als er jene Kiste vor dem Lagereingang zugenagelt hatte, nicht wenigstens die ausholende Hand mit dem Hammer hätte anhalten können, damit sie wenigstens gesehen hätte, dass er sie gehört hatte, als sie ihm zugerufen hatte, sie sei schwanger. Und dann ergab sich so etwas Unerwartetes, gerade als sie in ihrer Verzweiflung dachte, das Einzige, was sie tun könne, sei, jäh die Schaufel wegzuwerfen und loszurennen, was reiner Selbstmord gewesen wäre, und sie stellte sich schon vor, wie sie durchlöchert von den Kugeln aus einem Maschinengewehr hinfiele und im Todeskrampf ihre letzten Atemzüge täte und versuchte, trotz des Bluts, das in ihren Mund strömte, »Jakob, Jakob« auszusprechen, als könnte er sie hören und verstehen, dass sie versucht hatte, alles zu tun, was sie tun konnte, nur um ihn zu sehen. Doch da befahl ein jüdischer weiblicher Kapo ihr und Erzsike Kohn, zum Bahnhof zu gehen und etwas zu holen, was man ihnen dort geben würde. Sie wusste nicht, ob dieser Befehl echt war oder ob es nur ein Trick von Max war, um ihr ein Treffen mit Jakob zu ermöglichen, aber sie machte sich mit Erzsike Kohn zum Bahnhof auf, begleitet von einem Soldaten, der im Gleichschritt hinter ihnen ging; da wusste sie noch immer nicht (selbst jetzt wusste sie es nicht), ob es nur eine List von Max war, um sie mit Jakob zusammenkommen zu lassen, oder ob es ein Zufall war, dass gerade sie aus der Gruppe aufgefordert worden war, zum Bahnhof zu gehen.
Unterwegs dachte sie darüber nach, ob der Transport, in dem Jakob sein sollte, am Bahnhof stehen bleiben oder dort nur durchfahren würde, aber sie war ganz machtlos, irgendetwas zu tun, obwohl sie wusste, dass alles Weitere von ihr abhing, doch sie hatte keine Ahnung, wie viel Uhr es war, noch konnte sie jemanden danach fragen, obwohl ihr schien, dass die Zeit ihr in die Hände spielte (sie gingen auf der neuen Straße, die die Lagerinsassen gebaut hatten, und ihr kam es ein paarmal in den Sinn, den Soldaten zu fragen, wie viel Uhr es sei, doch dann befürchtete sie, dadurch alles zu riskieren und die Gelegenheit zu verpassen, die sich ihr bot, um Jakob zu sehen), sie schloss, dass Max in all das verwickelt war, doch sie wusste nicht, ob sie ihren Gang beschleunigen oder verlangsamen sollte, obwohl der Soldat den Schritt diktierte.