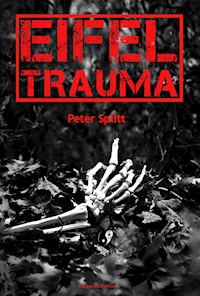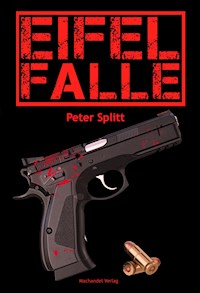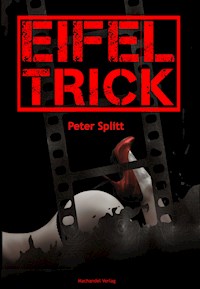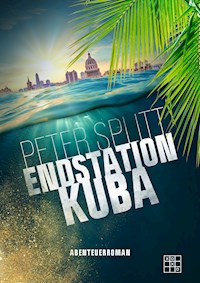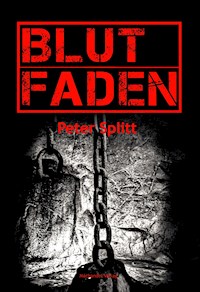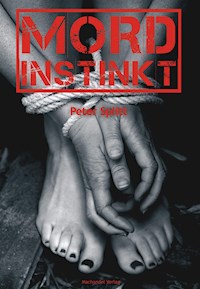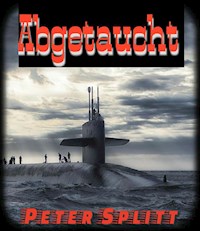1,99 €
Mehr erfahren.
Katharina Böhm wächst mit ihrer Zwillingsschwester Anni und ihren Eltern Edelgard und Pavel, in der ehemaligen DDR auf. Als ihr Vater die Familie verlässt, hält sich ihre Mutter mit Männerbekanntschaften über Wasser und steckt Katharina in ein staatliches Erziehungsheim. Geschlagen, misshandelt, vergewaltigt und weggesperrt, erlebt sie ein acht Jahre andauerndes Martyrium, das erst mit dem Erreichen ihrer Volljährigkeit und der Entlassung aus dem Jugendwerkhof ein Ende findet. Ihr erster Schritt in Freiheit führt sie zu den Russen, wo sie völlig naiv und weltfremd, den direkten Kontakt zum KGB sucht. Ihr Ansprechpartner, Oberst Kurganow, erkennt sofort welches Potential in ihr steckt und will sie als Agentin auszubilden. Doch ihr Vertrag beinhaltet auch klein gedrucktes: Marie soll Hemmungen und Scham über Bord werfen und auch ihren eigenen Körper in den Dienst der Sache stellen. Was das bedeutet, zeigt ihr Anika, eine alternde Agentin, die jahrelang für den KGB als Sex-Spionin gearbeitet hat und nun den Nachwuchs ausbildet. Die nicht gerade prüde Marie ist einigermaßen geschockt und hofft gewisse sexuelle Praktiken niemals in der Praxis anwenden zu müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Ähnliche
Peter Splitt
Pussycat
Ein erotischer Krimi aus der Zeit des kalten Krieges
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
August 1968
Oktober 2002
Oktober 1973
September 1976
Oktober 2002
Oktober 1976
Kapitel 2
Oktober 2002
Juli 1977
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Oktober 2002
März 1979
Oktober 2002
März 1979
Kapitel 6
März 1980
April 1980
Mai 1980
Juli 1980
Dezember 1980
Kapitel 7
April 1981
August 1981
September 1981
Oktober 2002
Kapitel 8
Oktober 1982
Kapitel 9
Kapitel 10
Oktober 2002
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
Kapitel 1
Impressum neobooks
Prolog
Oktober 2002
Das gleichmäßige Brummen der Triebwerke versetzte mich in eine Art Dämmerzustand. Ich lehnte den Kopf gegen das heruntergezogene Plastikrollo des ovalen Jet-Fensters und versuchte, mich zu entspannen. Ich wollte nach New York, wo ein Flieger nach Deutschland auf mich wartete. Nach vielen Jahren würde ich zum ersten Mal mein Heimatland wiedersehen. Was für ein komisches Gefühl, jetzt zurückzukehren. Wie würde es dort aussehen? Was hatte sich verändert?
Es war auch viele Jahre her, seit ich Paul zum letzten Mal begegnet war. Ich vermisste ihn noch immer. Selbst nach all den Jahren. Wo mochte er sein? Lebte er noch? Ging es ihm gut?
Ich erinnerte mich daran, wie wir uns das erste Mal geliebt hatten. Es war ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Wann immer ich daran dachte, spürte ich dieses innere Kribbeln, spürte seinen Mund auf meinen Brüsten, fühlte, wie sich seine Hände auf meinen Körper legten und sich seine Männlichkeit an mich schmiegte. Dabei blickte er direkt in mein Gesicht. Ich wusste, ich konnte, wenn ich wollte, einen richtigen Schlafzimmerblick aufsetzen, nämlich dann, wenn ich meine Augenlider bis über die obere Hälfte der Iris fallen ließ. Auch deswegen durfte ich seit meinem zwölften Lebensjahr keinem Mann mehr in die Augen sehen. Tat ich es doch, so maß er mit Sicherheit meinen noch so belanglosen Worten irgendeine sexuelle Bedeutung bei. Meine Gedanken waren immer noch bei Paul. Er knöpfte mir die Bluse auf, bevor er mich auf das große Doppelbett zog. Seltsamerweise spürte ich keine Spur von Verlegenheit, keine Scham, nur ein unbändiges Verlangen. Meine Brüste bebten, als sie freikamen. Pauls Hände berührten sie sanft. Daraufhin richteten sich meine Brustwarzen steil auf. Sein Körper reagierte umgehend. Ich sah die Erregung in seinen Augen, während er mich beobachtete. Eilig wollte er sich seiner Jeans entledigen, doch ich kam ihm zuvor, kniete mich neben ihn, schob seine Hände beiseite und begann, den Reißverschluss seiner Hose zu öffnen. Meine Finger berührten jede neue freigelegte Stelle seines Körpers. Ich spürte sein Schaudern, hörte, wie er etwas Unzusammenhängendes vor sich hin murmelte. In diesem Augenblick begehrte ich ihn wie noch niemals einen Mann zuvor. Stolz wie eine Venus baute ich mich vor ihm auf. Im Lichtschein der großen Stehlampe wirkte meine Haut makellos fein, ließ an Marmor denken. Ich spürte, wie sich Pauls Herz überschlug. Sein Atem passte sich der heftigen Bewegung meines Brustkorbes an. Unser Verlangen nacheinander wuchs mit jeder Berührung. Die Küsse wurden fordernder, die Zärtlichkeiten dringlicher. Unsere zunehmende Erregung parfümierte die Atmosphäre. Suchend, verführend, ließ ich die Lippen über seinen Körper gleiten, bis ich fühlte, wie seine Haut glühte. Danach rollte ich mich mit einer nie für möglich gehaltenen Kraft auf ihn. Bei diesem ersten Mal brauchte sich niemand von uns beiden großartig anzustrengen. Unsere Körper verstanden sich blind. Ich empfand es als äußerst angenehm, dass ich mich nicht um seine Lust kümmern musste. Sein Gesichtsausdruck gab mir zu verstehen, wie sehr seine Erregung von meinem Verlangen dirigiert wurde. Ich hörte meinen Namen, der sich von seinen Lippen losriss. Die dann folgende Vereinigung befreite mich von der Welt um mich herum, während ich meinen Körper fester und fester auf seinem bewegte. Doch dabei blieb es nicht. Nach unserem ersten Höhepunkt liebten wir uns ein zweites Mal. Diesmal kam Paul über mich, meine Lustschreie hallten in dem Gästeschlafzimmer wider. Was die anderen Mitbewohner in diesem Augenblick von uns dachten, war mir vollkommen egal. Es zählte nur dieses großartige Gefühl. Irgendwann ließen wir voneinander ab. Wir waren völlig erschöpft. Paul hob den Kopf und sah, wie mir die Müdigkeit die Augen verschleierte.
„Du wirst jetzt schlafen, Katharina!“ Es war eine Anordnung, die er mit einem Kuss bestätigte.
Oktober 2002
Dies war heute auf den Tag genau vor zwanzig Jahren geschehen, und trotzdem kam es mir so vor, als wäre es erst gestern gewesen. Mit meinen vierundvierzig Jahren war ich noch nicht alt, aber auch nicht mehr so jung und knackig wie damals. Der Zahn der Zeit und ein reichlich turbulentes Leben hatten ihre Spuren hinterlassen. Mein Haar trug ich jetzt kürzer, meine Figur war runder und irgendwie üppiger geworden. Auch Fältchen und Krähenfüße hatten sich eingestellt, obwohl ich sie mit Make-up zu überdecken versuchte. Ich wusste, meine Augen hatten den Glanz der Jugend verloren, aber trotzdem fühlte ich mich noch immer als eine attraktive Frau.
„Bitte anschnallen, wir fliegen jetzt hinaus auf den Atlantischen Ozean, und es könnte zu Turbulenzen kommen“, ertönte eine verzerrte männliche Stimme durch die Bordlautsprecher. Das Geräusch ließ mich zunächst zusammenzucken, allerdings fing ich mich schnell wieder und versuchte, mich zu beruhigen. Hier oben über den Wolken war ich allein mit meinen Erinnerungen, nahm diesen Moment der trügerischen Geborgenheit in mich auf und wollte ihn so lang wie möglich festhalten.
Doch dann, so plötzlich, wie er gekommen war, ging der Moment vorbei und ich spürte, wie eine nicht für möglich gehaltene Nervosität von mir Besitz ergriff, mich nicht mehr loslassen wollte. Allein bei den neuen Gedanken, die sich mir aufdrängten, spürte ich eine tiefe innere Unruhe aufkommen. Trotzdem schaffte ich es, der jungen Stewardess in dem dunkelblau-roten Outfit zuzulächeln, als sich diese nach meinem Getränkewunsch erkundigte. Meine Stimme zitterte in keinster Weise. Ich hatte gelernt, damit umzugehen, auch wenn es mir noch so schwerfiel. Es war so manches, was ich jetzt tun musste, von dem ich vorher geglaubt hatte, niemals dazu fähig zu sein. Diese ständigen Veränderungen, die mein bewegtes Leben mir abverlangte, sowie die vielen Schicksalsschläge, die ich wie selbstverständlich hinnahm, hatten mich letztendlich am Leben gehalten.
Die silberne Boeing 737 flog über Rhode Island hinweg und nahm Kurs auf New York. Ich traute mich zum ersten Mal, das Plastikrollo nach oben zu schieben. Die riesige Stadt versank unter mir im bleichen Dunst der Ferne, als die Maschine eine Schleife zog und langsam ihre Flughöhe verringerte. In etwas weniger als zwanzig Minuten würde sie auf dem internationalen Flughafen John F. Kennedy landen, und danach würde ich mit etwas Glück an Bord einer Lufthansa-Maschine die USA verlassen können. Das heißt, für den Fall, dass man mich nicht an der Ausreise hinderte. Bis dahin verblieben noch ein paar lange Stunden, in denen ich mich weiter lächelnd und unschuldig locker geben musste. Ich blickte hinunter auf das Land, in das ich voller Hoffnung auf eine sichere Zukunft gekommen war. Das war vor siebzehn Jahren gewesen – nachdem ich alle verraten hatte.
Wie immer war die Ankunftshalle brechend voll. Besonders lästig war die erneute Einreiseprozedur, bei der ich mein Gepäck identifizieren und wieder aufgeben musste. Ich folgte den Schildern bis zur Gepäckentnahme. An dem Rollband schnappte ich mir meinen Koffer, passierte die Einreisekontrolle und steuerte auf den Flugschalter zu. Dabei sah ich nervös auf meine Armbanduhr. Bis zum abermaligen Einchecken blieben mir noch drei Stunden. Eine verdammt lange Zeit, wenn man warten musste und der Kloß im Hals immer größer wurde. Einige Polizisten in Uniform standen herum, nahmen aber keine Notiz von mir. Aber ich wusste, dass sie da waren. Die Leute vom Geheimdienst. Irgendwo warteten sie. Ich spürte, wie ich immer nervöser wurde. Einer stand in der Nähe des Flugschalters. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Ausgerechnet dort, wo man meine Bordkarte für den Weiterflug hinterlegt hatte – und wo ich unbedingt hin musste. Der Mann wirkte teilnahmslos, seine Augen jedoch waren starr auf die Menschenmenge gerichtet. Sie überflogen jeden, der sich dem Flugschalter näherte.
Ich setzte mir die Sonnenbrille auf, obwohl das völlig verrückt war. Ich hatte mich betont lässig gekleidet. Alles hatte den Anschein, als würde ich nur eine kurze Reise unternehmen. Ich spürte einen Schubser. Jemand drückte mich von hinten vorwärts. Jetzt war ich an der Reihe, stand direkt vor dem Flugschalter. Eine freundliche Dame lächelte mich an. Ich lächelte zurück. Alles lief glatt. Problemlos bekam ich meine Bordkarte ausgehändigt. Sie stellte meinen Koffer auf die Waage.
„Möchten Sie Ihr Gepäck direkt bis Hannover durch buchen?“, fragte sie mit überlauter Stimme.
Verdammt! Musste sie so schreien, ausgerechnet jetzt?
Aber es war zu spät. Der unauffällig wirkende Beamte blickte zu mir hinüber und bewegte sich auf den Ausgang mit dem Schild Embarkation zu. „Madam, Ihre Bordkarte bitte“, sagte er höflich, aber bestimmt.
Ich hoffte, er würde nicht das Zittern bemerken, das durch meinen Körper ging. Gehorsam reichte ich ihm die Karte und machte auf lockere Konversation mit einem Nebenmann.
„Sie kommen aus Philadelphia und fliegen weiter nach Frankfurt?“, fragte der Beamte weiter.
Jetzt kam es.
„So können Sie aber nicht abfliegen“, sagte er, genau wie ich es befürchtet hatte. Der Mann mit dem kurzen Haarschnitt und dem dunklen Schnauzbart sah mich zunächst ernst an, dann aber huschte doch ein Lächeln über sein Gesicht.
„Sehen Sie, Madam. Sie haben die Ausreisesteuer noch nicht bezahlt. Dies ist ein internationaler Flug, und da werden fünfzig Dollar fällig. Die müssen sie noch begleichen. Ohne die Steuermarke auf der Bordkarte kann ich Sie leider nicht ausreisen lassen.“
Mir fiel ein Stein vom Herzen. Hatte ich richtig gehört? Diese verfluchte Ausreisesteuer! Daran hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht.
Ich schenkte ihm ein strahlendes Lächeln und griff nach dem Pappstreifen. „Wird sofort erledigt, Mister.“
Das ‚Mister‘ schien ihm zu gefallen. Ich tauchte in die Menschenmenge ein und ging zu einem der Bankschalter, wo man ein paar Devisen tauschen – und eben auch jene lästige Steuer entrichten konnte. Als ich dem Beamten kurz darauf den Karton mit der Steuermarke in die Hand drückte und ihm zunickte, grinste er breit und riss gleichzeitig den Kontrollabschnitt meiner Bordkarte ab. Danach entließ er mich in den Abflugbereich.
Nach zwei Stunden Wartezeit wurde meine Maschine nach Deutschland aufgerufen. Gate 29, Lufthansa-Flug LH 329 nach Frankfurt am Main.
Ich ging durch die Gangway und betrat den großen Airbus. Glücklicherweise befand sich mein Platz im vorderen Drittel der Maschine. Somit würde ich in Frankfurt als einer der ersten Passagiere aussteigen können. Langsam schob ich mich vorwärts und wartete geduldig, bis mir die Mitreisenden, die noch in aller Ruhe ihre Kleinigkeiten im Gepäckfach verstauten, Platz boten.
Reihe fünf – Fensterplatz, endlich!
Beim Hinsetzen blickte ich mich verstohlen um. Der Mann, mit dem ich es bereits im Flughafengebäude zu tun hatte, stand zwischen den Sitzen und beobachtete die einsteigenden Passagiere. Diese Wachmänner waren wirklich überall. Ein Seufzer stieg in mir hoch, doch ich wusste ihn zu unterdrücken. Ich lehnte die Stirn an das Fenster und glaubte, in der Ferne das Empire State Building erkennen zu können. Ein Sonnenstrahl blitzte in das ovale Fenster, worauf ich hastig das Plastikrollo nach unten zog. Erst als die Motoren brummten und endlich die Türen geschlossen wurden, fühlte ich mich einigermaßen sicher. Die Maschine fuhr auf das Rollfeld und reihte sich in die Schlange wartender Flugzeuge ein. Auf einmal knackte der Lautsprecher. Eine angenehme männliche Stimme meldete sich.
„Guten Tag, liebe Fluggäste. Mein Name ist Rheinhard. Ich bin der Co-Pilot auf Ihrem Flug nach Frankfurt. Leider wird sich der Abflug wegen des hohen Flugaufkommens um fünfzehn Minuten verspäten. Ich bitte um Ihr Verständnis und wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Ich melde mich nach dem Start wieder, wenn wir unsere Flughöhe erreicht haben.“
Es knackte ein weiteres Mal, dann verstummte der Lautsprecher. Die kleine Verzögerung war nicht weiter schlimm. Ich hatte alle Zeit der Welt, fragte mich, was mich in Deutschland erwarten würde. Siebzehn Jahre lautete die magische Zahl. Siebzehn verdammt lange Jahre war ich nicht mehr in Deutschland gewesen. In der Zwischenzeit war die Mauer gefallen. Ich hatte davon gelesen, hatte gebannt die Berichte im Fernsehen verfolgt. Für mich war der Zusammenbruch der DDR eine Sensation gewesen. Aber ich hatte auch die Anzeichen von Resignation gespürt. Wofür hatte ich all die Jahre gekämpft, meine Energie und meinen Körper eingesetzt?
Der Zweck meiner Agententätigkeit hatte darin bestanden, die Ideale, für die ich lebte, zu verteidigen. Sollten sie heute nicht mehr bestehen, dann wäre ich gescheitert. Aber falls es sie noch gab, hätte ich gewonnen. Oder hatten die anderen bloß verloren? Vielleicht fingen die Schwierigkeiten auch gerade erst an, nachdem sie die Fesseln des ideologischen Konflikts abgestreift hatten.
Wenn ich überhaupt etwas bedauerte, dann, auf welche Art und Weise ich meine Zeit und Fähigkeiten vergeudet hatte. All die Sackgassen, die falschen Freunde, die vertane Energie. Aber der Job hatte irgendwie zu mir gepasst. Wahrscheinlich war Mutter daran schuld. Oder war es dieses Buch gewesen, worin ich als Kind immer geblättert hatte? Ich wusste es nicht. Meine Vergangenheit lag viel zu weit zurück, und doch hatte sie mich diesmal eingeholt. Durch die Nachricht von Vaters Tod. Von einem Mann, den ich niemals richtig gekannt hatte.
Ich bildete mir ein, seine Stimme zu hören. Es war eine Stimme, die mir fremd war. Oder besser gesagt, ich konnte mich nicht mehr an sie erinnern, auch wenn mir die Worte vertraut vorkamen: „Komm zu mir Mariechen, komm …“
Ich stellte ihn mir vor, wie er auf der geräumigen Holzveranda unseres Hauses in einem alten Schaukelstuhl saß und gemütlich eine Pfeife rauchte. Damals hätte meine Welt noch in Ordnung sein können, aber sie war es nicht. Immerhin hatte ich noch geglaubt, dass mir niemals etwas wirklich Schlimmes widerfahren könnte. Hatte mich Vater hochgehoben, auf seine Knie gesetzt und mir dann eine nicht enden wollende Geschichte erzählt? Ich wusste es nicht, doch die Vorstellung trieb mir Tränen in die Augen, meiner Kehle entwich ein kaum hörbares Schluchzen. Aber ich wollte mir nichts anmerken lassen, wollte nicht, dass jemand erfuhr, dass ich im Begriff war, dieses Land zu verlassen, um in meine alte Heimat zurückzukehren. Das galt besonders für den finster dreinschauenden Typen in der vordersten Reihe, der direkt an der Trennwand zur Businessklasse saß. Wachsam wie ein Fuchs waren seine Augen beim Einsteigen über die Gesichter der Mitreisenden gewandert. Dabei hatte er keine Miene verzogen und versucht, mit eiskaltem Blick jede verdächtige Regung zu registrieren. Und genau daran glaubte ich, ihn erkannt zu haben. An dem ruhelos lauernden Ausdruck in den Augen. Bestimmt war er ein Mitglied der National Security, oder was vielleicht noch schlimmer war, vom amerikanischen Geheimdienst CIA, und die hatten mich mit Sicherheit noch auf ihrer Liste.
Tief unter mir glitt der Atlantische Ozean vorüber. Mir fielen die Augen zu, aber schlafen konnte ich nicht. Wie sollte ich auch, entfernte ich mich doch immer mehr von jenem Land, in dem ich in Frieden und Freiheit gelebt hatte. Fast unmerklich lichteten sich draußen die Wolken, und ein sanfter Lichtstrahl beförderte die tosende Gicht des Meers aus einem tiefen Schatten. Kleine Inseln leuchteten wie grüne Punkte in einem endlosen Blau, aber diese Schönheit der Natur nahm ich kaum wahr. Stattdessen befand ich mich in einem Zustand der Schwerelosigkeit. Ohne ein Gewicht, das mich am Boden hielt, pendelte ich zwischen gestern und morgen hin und her, losgelöst von einem Leben, an das ich mich so sehr gewöhnt hatte. Ich wusste, ich tat es für meinen Vater, den ich kaum gekannt hatte. Ich erinnerte mich nicht einmal mehr an sein Gesicht. War es leicht von der Sonne gebräunt gewesen? Hatte er intelligente Augen, einen sanften Mund, vielleicht ein Bärtchen gehabt?
Ich hatte versucht, die Fassung zu bewahren, als der Brief von seinem Tod gekommen war. Der Brief, von einem gewissen Notar Lehmann aus Göttingen aufgesetzt, hatte mich über Umwege erreicht. So einfach kam niemand an meine Adresse heran. Danach hatte ich zum ersten Mal mit Tante Ingeborg telefoniert. Obwohl ich mich bei dem Telefonat sehr bemüht hatte, meine Emotionen unter Kontrolle zu halten, musste sie sofort gespürt haben, wie nervös ich gewesen war. Beinahe vermochte ich mir das Telefongespräch nicht mehr ins Gedächtnis zurückzurufen, denn zu sehr hatte die Nachricht von Vaters Tod meine Gefühle und Sehnsüchte im Keim erstickt. Etwas begann an meinem Inneren zu nagen. Etwas, dass mich nicht mehr loslassen wollte.
Nach gut zehn Stunden Flugzeit verlor der Airbus A 320 der Lufthansa langsam an Höhe und war im Begriff, sich dem Rhein-Main-Flughafen von Frankfurt zu nähern. Ich drückte meine Nase gegen das ovale Fenster und beobachtete die Umgebung des Flughafens in der grellen Herbstsonne. Die Umstände, die zu meiner Reise geführt hatten, kamen mir jetzt fantastisch vor, und doch freute ich mich irgendwie auf die Rückkehr in meine Heimat. Die Räder des enormen Jets berührten den Boden und verursachten eine Erschütterung in der Kabine. Einige der Passagiere applaudierten, froh, wieder festen Boden unter ihren Füßen zu wissen. Das Flugzeug blieb nach einem letzten Rütteln endlich stehen, der Lärm der Motoren verstummte. Eine allgemeine Mobilität machte sich unter den Passagieren breit, als sie auf das Verlassen der Maschine vorbereitet wurden. Ich blieb noch sitzen und beobachtete die Wolken über dem Himmel der Main-Metropole. Fast kam es mir so vor, als wollten sie sagen: „Herzlich willkommen daheim in Deutschland.“
Letztendlich erhob ich mich aber doch, verließ den Flieger durch die Vordertür und folgte der Menge auf dem schmalen Gang hinüber zur Abfertigung meines Inlandsfluges nach Hannover. Die Menschenmenge sammelte sich um mich herum, aber niemand schien etwas anderes zu sein als einfach ein Reisender ohne Eile.
August 1968
August 1968
Das große Tor öffnete sich, und ich stand einfach nur da, mit einem alten Koffer in den Händen. Umgeben von hohen Mauern und Stacheldraht, dachte ich: Dies ist ein Gefängnis für Kinder, hier komme ich so schnell nicht wieder raus.
Ich trat zögerlich einen Schritt nach vorn. Jemand kam mir entgegen, schickte mich auf den Flur. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Meine fragile Blase verlangte dringend nach einer Toilette, aber hier war keine. Endlich kam eine Erzieherin. Sie trug eine Uniform. Ich wollte sie fragen, wo sich die Toilette befand, bekam aber keine Antwort. Stattdessen schrie mich die streng dreinblickende Dame an und meinte, ich solle mich an eine Wand stellen. Eingeschüchtert, wie ich war, tat ich, was sie verlangte. Dabei kniff ich die Beine zusammen und stammelte einen undeutlichen Satz vor mich hin. „Aber ich wollte doch nur … ich meine, ich muss dringend auf die Toilette.“
Statt zu antworten, schlug die Erzieherin zu. Mit einem Bambusstock auf meinen Rücken. Ich klappte zusammen. Die Erzieherin hob abermals den Stock und schlug mich erneut. Und ein drittes Mal. Ich zitterte am ganzen Leib. Dabei spürte ich, dass ich nicht mehr einhalten konnte. Meine Notdurft lief in die Hose und auf den gebohnerten Fußboden. Dafür hagelte es weitere Schläge. Und damit war noch lange nicht Schluss. Die Erzieherin zog eine Schere aus der linken Uniformtasche, drückte mich brutal nach unten und schnitt mir die Haare ab. In Sekundenschnelle lagen meine schönen blonden Locken auf dem Boden – in meinem eigenen Urin. Und der Albtraum ging weiter. Ein männlicher Erzieher brachte mich in den Waschraum. So lief das hier. Die männlichen Erzieher kümmerten sich um die Mädchen und die weiblichen um die Jungs. Das war eine Frage der Würde. Sie sollte uns Neuankömmlingen genommen werden.
Der Waschraum war feucht und kalt. Ich fror und musste mich auch noch vor dem fremden Mann entkleiden. Ich wäre am liebsten vor Scham im Boden versunken. Der Mann schmierte mich mit einem groben Scheuermittel ein und steckte mich unter die kalte Dusche. Anschließend rieb und tastete er meinen kleinen, jungen Körper ab, ehe er mich in eine Zelle steckte. Ich fühlte mich hundeelend und trotz der Behandlung mit dem Scheuermittel schmutzig. Mein Körper brannte und schmerzte, und ich war allein. Alleingelassen von meiner Mutter, von meiner Schwester, von der ganzen Welt. Dazu befand ich mich in einer Hölle, die sich Spezialheim nannte. Was hatte ich nur verbrochen, dass man mich derart bestrafte?
Nach einer Ewigkeit öffnete sich die Tür.
Vielleicht brachte man mir endlich etwas zu essen?
Weit gefehlt.
Vor mir stand derselbe Mann, der mich vorhin gesäubert und abgetastet hatte. „Meldung machen!“, verlangte er von mir.
Ich verstand nicht sofort, was er wollte. „Wie, Meldung machen?“, fragte ich vorsichtig.
„Ich denke, du solltest bereits wissen, was das ist“, antwortete der Mann barsch.
„Ich weiß nur, dass ich wissen wollte, wo sich die Toilette befindet und dafür Schläge bekommen habe“, erwiderte ich kleinlaut.
Die Antwort darauf kam prompt und beinhart.
„Hier wird nicht gefragt! Du hast zu warten, bis du Anweisungen von den Erziehern bekommst! Du gehörst zum ‚Strandgut der Gesellschaft‘. Du bist hier, um zu lernen, Anweisungen zu befolgen, dich ein- und unterzuordnen!“
Ich sank auf die harte Matratze und fing an zu weinen.
Wo war ich? Was passierte mit mir?
Bald darauf wusste ich es. Ich war in einer Disziplinierungseinrichtung gelandet, in der man mich fertigmachen und meinen Widerstand brechen wollte. Sowohl psychisch als auch körperlich. Und das alles zum Zweck der Umerziehung zu einer ‚sozialistischen Persönlichkeit‘.
Ich betrat den Gang, fragte mich, ob es nicht besser wäre, umzukehren. Der Gang war dunkel und roch nach Feuchtigkeit. Linker Hand befand sich der sogenannte Empfang. Hier hatte ich damals Meldung machen müssen, nachdem mich der Erzieher unsanft von der Matratze gestoßen hatte. Hier waren meine Daten aufgenommen worden.
Die Tür war morsch und stand halb offen. Ich stieß mit meiner Stiefelette dagegen. Sie öffnete sich sofort. Im Inneren des Raumes lag ein umgekippter Stuhl. Sein Metallrahmen war verrostet. Das Holzregal, in dem damals die Akten standen, lag zertrümmert und in allen Einzelteilen verteilt auf dem Boden. Daneben befanden sich mehrere vergilbte Blätter. Ich bückte mich und hob eins davon auf. Es war eine Seite aus einer alten Personalakte. Auf der Vorderseite stand der Name Magdalena Zorn mit Schreibmaschine geschrieben. Ich kannte keine Magdalena Zorn. Vielleicht war das auch nur ein Deckname. Ein Pseudonym für all die vielen Leidensgenossen, die man hier eingesperrt hatte.
Was wohl mit meiner Akte geschehen sein mag?
Ich wusste es nicht.
Natürlich lief ich davon. Einmal, als der Wäschewagen kam, gelang es mir, durch das geöffnete Tor zu verschwinden. Erst danach wurde mir bewusst, dass ich keinen einzigen Ort, keine einzige Person kannte, zu der ich gehen konnte. So versteckte ich mich eine Zeit lang in einer alten Scheune. Aber Hunger und Durst ließen nicht lang auf sich warten. Ich verließ mein Versteck und versuchte, auf den Hinterhof einer Bäckerei zu gelangen. Dabei schnappten sie mich und brachten mich in ein noch stärker gesichertes Heim. Hier gab es keine Schule, sondern nur Akkordarbeit nach Norm, und nach der Arbeit militärischen Drill auf dem Hof bis zum Zusammenbrechen. Noch schlimmer waren die Demütigungen durch Erzieher und höherrangige jugendliche Insassen. Ich hielt es nicht mehr aus, versuchte erneut, zu fliehen, doch der Versuch misslang. Jemand hatte meine Fluchtpläne verraten. Dafür bekam ich die schlimmste Strafe, die es gab: tagelange Einzelhaft in dem sogenannten Fuchsbau, einer winzigen, fensterlosen Zelle ohne Behälter für die Notdurft.
Oktober 2002
Oktober 2002
Den Fuchsbau gab es noch immer. Ich wusste noch ganz genau, wo er sich befand. Im Untergeschoss ganz am Ende des Flurs. Bis dahin schaffte ich es noch, dann musste ich mich übergeben.
Verdammt, was tat ich hier eigentlich? Was wollte ich mir beweisen? Dass mir die Vergangenheit nichts mehr anhaben konnte?
Ich blieb vor der kleinen Zelle stehen, betrachtete die schwere, massive Holztür. Sie war noch intakt, nur die Schlösser fehlten. In den Putz der Wände waren einzelne Worte und ganze Sätze eingeritzt.Ich wusste, was hier geschrieben stand. Es waren die verzweifelten Worte jener Insassen, die man hier eingesperrt hatte.
Wenn ich nur wüsste, wer mich damals bei den Erziehern verpfiffen hatte? Aber war das überhaupt noch wichtig?
Für die Missstände verantwortlich war auch die Hierarchie unter den Kindern. Natürlich war das von der Obrigkeit so gewollt. Die Kinder sollten gezielt gegeneinander aufgehetzt werden. Für kleinere Vergehen gab es Essensentzug. Dann wurde gesagt: „Ihr wisst ja, wem ihr das zu verdanken habt.“
Und dann rechneten die Kinder unter sich ab. An so manchem Morgen war ich mit einer aufgeplatzten Lippe oder einem blauen Auge aufgestanden. Und der Erzieher hatte noch hämisch gefragt: „Marie, bist du gefallen?“
Man versuchte mit allen Mitteln, die Persönlichkeit der Insassen zu brechen. Viele gingen an der unmenschlichen Behandlung zugrunde, ließen ihr Leben im Fuchsbau oder funktionierten danach genauso, wie es das System von ihnen verlangte. Für uns Mädchen kam ab einem bestimmten Alter noch eine ganz andere Gefahr hinzu: Vergewaltigung. Ich wurde innerhalb von fünf Monaten zehn bis zwölfmal vergewaltigt. Nicht von den Mithäftlingen, sondern von meinen Erziehern und vom Anstaltsdirektor, der auch noch stolz verkündete, man brauche in seinem geschlossenen Jugendwerkhof durchschnittlich drei Tage, um die Jugendlichen auf seine Forderungen einzustellen.
Wie ich sie alle hasste!
Oktober 1973
Oktober 1973
Mit fünfzehn wurde ich schwanger. Dieses Problem erledigte die Obrigkeit auf ihre Art und Weise. Ein sogenannter Facharzt stocherte so lange mit einem Kleiderbügel in meiner Gebärmutter herum, bis alles Mögliche aus mir heraus lief und ich glaubte, verbluten zu müssen. Aber ich überlebte. All die genannten Grausamkeiten und Repressalien vermochten meine Willensstärke nicht zu brechen, auch wenn mich der Hass auf das politische System und auf die Stasi beinahe wahnsinnig werden ließ. Nicht dass die Heimerziehung von der Stasi als ein vorrangiges Ziel betrachtet wurde, so wichtig war sie nun auch wieder nicht, aber dennoch existierte eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Einrichtungen der Jugendhilfe und der Staatssicherheit. Informationen über die Spezialheime wurden akribisch gesammelt und ausgewertet. Bei Fehlentwicklungen und negativen Einstellungen zur DDR übernahm die Stasi die Ermittlungen. Inoffizielle Mitarbeiter kamen in der Jugendhilfe und Heimerziehung zum Einsatz.
Ich wuchs zu einem attraktiven Teenager heran, mit Rundungen genau an den Stellen, wo sie sein mussten. Mit festen Brüsten, vollen Lippen, einer schlanken Taille und Hüften, die sich mit einem provozierenden Versprechen bewegten. Mit sechzehn fing ich an, meine körperlichen Reize gezielt einzusetzen. Ich sammelte Kontakte und Informationen über Personen, die mir später einmal von Nutzen sein konnten. Mein erstes Opfer war Bertram König, ein junger Erzieher, der gerade seine Ausbildung absolviert hatte. Eines Abends klopfte er an meine Zellentür, wollte sich nach irgendetwas erkundigen. Er bekam keine Antwort. Unsicher blickte er auf seine Uhr, öffnete vorsichtig die vergitterte Tür und trat ein. Der Raum war dunkel. Mein Schatten näherte sich ihm.
„Bertram …“, flüsterte ich mit heiserer Stimme.
Er erkannte sie und drehte sich um. „Marie, ich möchte etwas mit dir besprechen.“
Weiter kam er nicht. Ich näherte mich ihm langsam und kam so nah, dass er sehen konnte, dass ich nackt war.
„Großer Gott“, Bertram verhaspelte sich. „Was ist …“
Ich nahm seine Hand und legte sie auf meine Brust. „Ich möchte, dass du mit mir schläfst.“
„Du? D… du bist doch noch nicht volljährig!“ Bertram war sichtlich überrascht. „Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe.“ Er trat einen Schritt zurück und wandte sich der Tür zu, aber ich ahnte, was er vorhatte.
„Geh nur weiter, und ich erzähle dem Direktor, dass du mich zwingen wolltest …“
„Das wagst du nicht …“
„Mach dich nur davon, und du wirst es erleben!“
Er hielt inne. Er wusste, wenn ich wirklich ernst machte, wäre seine letzte Stunde gekommen. Also versuchte er es auf die sanfte Tour. „Katharina, Kleines, sei doch vernünftig …“
„Ich mag es, wenn du mich Kleines nennst.“
„Jetzt hör schon auf, Katharina! Sei vernünftig! Der Direktor wird mich entlassen, wenn du ihm das sagst.“
„Ach was, der doch nicht.“
Er versuchte es abermals. „Ich bin doch erst seit Kurzem hier. Ich würde bei allen in Ungnade fallen.“
„Aber nein! Da waren schon ganz andere, vor dir …“
„Wie bitte?“
„Ach, nichts.“
Es war hoffnungslos.
„Was willst du nun wirklich von mir?“
„Dass du es mit mir tust.“
„Aber das geht doch nicht. Wenn der Direktor davon erfährt … er würde mich auf der Stelle hinauswerfen.“
„Ganz bestimmt nicht. Er muss ja auch gar nichts davon erfahren. Nur wenn du jetzt gehst, dann erzähle ich ihm, dass du es bei mir versucht hast und dann …“
„Marie, bitte nicht.“
Ich blickte ihn herausfordernd an. „Du hast keine andere Wahl, oder?“
Er starrte mich an, ich sah Panik in ihm aufsteigen. „Warum denn gerade ich, Katharina?“
„Weil ich dich mag. Du bist immer freundlich und nett zu mir.“ Ich nahm seine Hände und führte sie vorsichtig an meinen Schoß. „Siehst du, ich bin eine richtige Frau. Zeig mir, wie es ist. Lass mich fühlen, wie eine Frau liebt.“
Was konnte er anderes tun?
Ich führte ihn zu meinem Bett, half ihm sogar aus Hose und Shorts. Dann kniete ich mich vor ihm nieder und berührte seine Männlichkeit mit den Lippen, so, wie es mir die älteren Mädchen erzählt hatten. Er stöhnte auf. Kurz darauf nahm ich sein Ding ganz in den Mund.
Ich spürte, wie hart er war, ließ von ihm ab und legte mich auf ihn. Bertram schlang seine Hände um meinen Nacken und drang von unten tief in mich ein. Er spürte keinen Widerstand, sah mich erschrocken an, aber ich drückte mich noch enger auf ihn, während sich meine Hüften fordernd an die seinen pressten.
„Mein Gott, das ist umwerfend.“
Ich fühlte mich gut. Es kam mir so vor, als wäre ich dafür geboren. Instinktiv wusste ich genau, was ich zu tun hatte. Mein Körper übernahm allein die Initiative. Als es vorbei war, blieb ich noch ein Weilchen neben ihm liegen. „Und morgen machen wir es gleich noch einmal.“
Von diesem Zeitpunkt an war Bertram König mein Verbündeter. Durch ihn genoss ich Freiheiten, von denen meine Mitgefangenen nicht einmal zu träumen wagten.
Ich bekam gesonderte Essensrationen, Süßigkeiten und Obst, und ich durfte sogar ab und zu fernsehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, es waren nicht die Heime, in denen ich es nicht aushielt, es war das ganze Land.
In der Folgezeit lernte ich, wie der Hase lief, wurde abgebrühter und emotionslos. Ich nahm mir mehrere Liebhaber, von denen ich mir gewisse Vorteile erhoffte. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit wurde ich aus dem Heim entlassen. Bei der Entlassung musste ich mich verpflichten, über das Erlebte zu schweigen. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Ich hatte meinen Hass besiegt, ihn umgedreht, sogar Kraft aus ihm gezogen, nur, um meine ganz persönliche Rache zu nehmen. Meine ersten Schritte in Freiheit führten mich nach Wolfersdorf und danach direkt zu den Sowjets.
September 1976
September 1976
Das Gebäude der Besatzungsbehörde in Berlin Karlshorst sah ganz anders aus, als ich erwartet hatte. Ich hatte angenommen, das Hauptquartier der russischen Staatssicherheit wäre in einem historischen Prachtbau untergebracht. So etwas wie das alte Bankgebäude mit seinen kunstvoll gemeißelten Pfeilern, die den Platz zweier Ladenfronten auf dem Alexanderplatz einnahmen, doch dem war nicht so.
Die Dienststelle der sowjetischen Staatssicherheit befand sich in einem rechteckigen Gebäudekomplex, dessen Mittelbau über einen erhöhten Sockel mit Kellerfenstern verfügte. Darüber streckten sich vier Vollgeschosse in die Höhe und mündeten in ein leicht geneigtes und deutlich über die Fassade reichendes Flachdach. Der mit einer Sicherheitsschleuse versehene Eingang im erhöht liegenden Erdgeschoss war über eine Freitreppe zu erreichen. Auch wenn dieser Komplex den Charme anderer historischer Gebäude vermissen ließ, so war er dennoch ziemlich beeindruckend.
Ich stand vor dem Tor und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Ein Wachsoldat in dunkelgrüner Uniform trat aus einem der kleinen Kontrollhäuschen, sah mich und kam auf mich zu. Als er beinahe vor mir stand, bemerkte ich sein ernstes Gesicht.
„Sie wünschen, bitte?“
Ich versuchte, meine Nervosität zu unterdrücken, und setzte eine Unschuldsmiene auf. „Ich möchte jemanden vom KGB sprechen.“
Der Soldat musste offensichtlich an sich halten, um nicht gleich laut loszulachen. „Hören Sie, Kindchen. Das hier ist das Hauptquartier der sowjetischen Besatzungsmacht. Von einem KGB weiß ich nichts. Zu wem genau möchten Sie denn?“
Ich sah ihn ratlos an. Das war schon mal schiefgegangen. „Leider ist mir hier keine bestimmte Person bekannt. Ich weiß nur, dass ich mit jemanden vom Geheimdienst sprechen möchte.“
Der Uniformierte schenkte mir ein breites Grinsen. „Ich glaube, Sie gehen zu oft ins Kino. Wenn Sie nicht wissen, zu wem Sie wollen, darf ich Sie nicht hineinlassen.“
Mein Mut fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen. „Aber es ist dringend.“
„Nun kommen Sie mal runter, gnädiges Fräulein. Ich habe die Order, hier niemand Unbefugten passieren zu lassen, und Befehl ist Befehl. War mir eine Ehre.“ Der Mann hob seine Hand zum Gruß und ließ mich einfach vor dem Tor stehen.
Und jetzt? Ich glaube, ich war ein wenig blauäugig, zu denken, ich könnte einfach so in das Gebäude der sowjetischen Staatssicherheit hinein marschieren und irgendwer würde sich schon um mich kümmern.
Ich überlegte, was ich tun konnte, wandte mich zum Gehen, zögerte und blieb wieder stehen. In diesem Moment näherte sich eine schwarze ZIL Limousine dem großen Tor. Der Wachsoldat nahm Haltung an und grüßte formell. An der Limousine wurde ein Seitenfenster heruntergelassen. Jetzt trat der Soldat näher an den Wagen heran. Seine Mimik entspannte sich. Anscheinend kannte er die Insassen.
„Hallo Ivan. Na, schiebst wohl eine ruhige Kugel heute, was?“
„In der Tat. Ist nicht viel los heute, Genosse Oberst.“
„Na, ist doch besser als umgekehrt.“
„Das stimmt, Genosse Oberst. Aber gerade ist mir etwas Komisches passiert. Kommt doch die Kleine, die da hinten steht, zu mir und sagt, dass sie zum KGB will. Ich habe mir fast in die Hose gemacht vor Lachen.“
Der Oberst beugte sich aus dem Fenster. Seine Augen folgten Ivans Blickrichtung. Und dann sah er mich. Ich stand einfach nur da, rührte mich nicht und bestaunte die glänzende Limousine.
„Na, die ist vielleicht einfältig. Hat sie gesagt, was sie von uns will?“
„Nein, sie meinte nur, es sei sehr wichtig. Aber zu wem sie wollte, konnte sie mir nicht sagen, und da habe ich sie natürlich auch nicht passieren lassen. Schließlich kenne ich die Dienstvorschriften.“
„Hm … gut. Aber sieht doch ganz manierlich aus, das junge Fräulein. Ich sehe sie mir mal etwas genauer an.“ Der Mann bewegte seinen Oberkörper nach vorn, um sich weiter aus dem Fenster lehnen zu können. „Hey, Sie, kommen Sie doch mal her.“
Ich starrte noch immer auf den glänzenden Wagen, meine Gedanken waren bereits ganz woanders. Erschrocken zuckte ich zusammen, als ich merkte, dass ich angesprochen wurde. Wie in Trance bewegte ich mich auf die Limousine zu. Ein älterer Herr mit grauem Haar und einem großen Schnauzbart lächelte mich freundlich an. Er war der Typ Vater, den ich gern gehabt hätte.
„Ich höre gerade, Sie möchten jemanden von der Botschaft sprechen?“ Er bluffte.
„Äh, nein, eigentlich möchte ich zu jemandem vom Geheimdienst KGB. Leider kenne ich mich hier nicht aus, und der Wachsoldat will mich nicht so einfach in das Gebäude lassen.“
„Um was geht es denn? Kann ich etwas für Sie tun?“
„Nun ja, ich dachte …, ich wollte …“
Der Mann wurde ungeduldig. „Was denn nun, junges Fräulein, zu wem wollten Sie?“
„Äh … ich weiß nicht so recht, nur dass …“ Mein Gestammel ging mir selbst auf den Geist.
Die Miene des Mannes wurde wieder ernst. „Also gut, haben Sie irgendwelche Referenzen?“
Mit fiel etwas ein. Bluffen konnte ich auch. „Ich komme von Oberstleutnant Gregori.“
Die Miene des Mannes erhellte sich. „Ah, der Genosse Theo Gregori. Der ist mir bekannt. Also schön, was haben Sie auf dem Herzen?“
„Soll ich das hier draußen mit Ihnen besprechen, einfach so?“
„Wie bitte? Ach so. Aber nein. Kommen Sie, steigen Sie ein. Haben Sie schon einmal in einem ZIL gesessen?“
„Nein.“
Die Fahrertür öffnete sich, der Chauffeur stieg aus und bequemte sich dazu, mir die linke Seitentür zu öffnen. Ich staunte nicht schlecht, als ich den Luxus im Inneren des Fahrzeugs sah. Da war ein Telefon, eine Trennscheibe aus Glas, sogar eine kleine Bar und Chromleisten, so weit das Auge reichte. Mit einem Seufzer ließ ich mich auf die bequemen Polster fallen. Hinten auf der Rückbank saß noch ein Mann. Auf einmal richteten sich sechs neugierige Augenpaare auf mich.
„Na, dann erzählen Sie mal!“
Ich bemerkte erst jetzt, dass der Mann mit dem Schnauzbart eine Uniform trug, an der mächtig viel Lametta baumelte. Dann erzählte ich ihm meine Geschichte.
„Also, mein Name ist Katharina Böhm.Ich meine, ich besitze einen deutschen Pass, der auf diesen Namen ausgestellt ist. In Wirklichkeit stammt meine Familie aus Russland, zumindest mütterlicherseits. Meine Großmutter wurde in Bolschaja Poljana, dem früheren Paterswalde geboren. Das ist ein kleines Dorf in der Oblast Kaliningrad. Sie nannte mich immer Marischka. Meine Familie ist damals aus Paterswalde geflohen, als die Faschisten kamen. An der Grenze hat man ihnen ein Dokument gegeben, aus dem hervorging, dass sie rassisch rein seien und im Großen und Ganzen dem deutschen Wesen entsprachen. Das Dokument war ausgestellt auf den Namen Böhm. Ich wurde am 10. Juli 1958 in Wolfersdorf geboren. Das liegt in Thüringen. Meinen Vater habe ich kaum gekannt. Er verschwand, als ich fünf Jahre alt war. Ich glaube, er ist in den Westen gegangen. Danach hat meine Mutter andere Männer kennengelernt. Die beschwerten sich immer über die Last der mitgebrachten Kinder. Wir waren zu zweit, müssen Sie wissen. Ich habe noch eine Zwillingsschwester. Der neue Freund meiner Mutter hielt es nicht lange bei uns aus. Danach kam wieder einer, und so ging das immer weiter, bis ich zehn war. Da steckte mich Mutter in ein Heim.“
„Ich verstehe. Wo sind Sie zur Schule gegangen?“
„In Wolfersdorf auf die Grundschule. Allerdings nur für drei Jahre. Danach folgten weitere drei Jahre sozialistischer Unterricht in einem Spezialkinderheim, inklusive gemeinsamem Zeitungslesen und FDJ-Abenden. Aber von dort bin ich dann abgehauen.“
„Was Sie nicht sagen. Wie alt waren Sie da?“
„Warten Sie. Das war im Jahr 1971. Ich muss damals dreizehn gewesen sein. Allerdings haben sie mich sehr schnell wieder geschnappt und in den Jugendwerkhof gebracht. Dort habe ich dann keinen regelmäßigen Unterricht mehr bekommen.“
„Sie haben sich also bewusst gegen das System gestellt?“
„Ach was, nein! Eine Verräterin bin ich nie gewesen. Das kommunistische System ist schon ganz in Ordnung, nur die ausführenden Personen sind unfähig und handeln aus niedrigen Beweggründen. Die meisten Erzieher sind nur daran interessiert, ihr eigenes Selbstbewusstsein an der Machtausübung gegen Wehrlose aufzurichten. Und daran möchte ich gern etwas ändern.“
Er sah mich fragend an.
„Sie meinen, Sie handeln aus echter Überzeugung?“
„Nun, der Genosse Oberstleutnant Gregori hat mir das wenigstens geglaubt. Wir haben uns im Jugendwerkhof in Wolfersdorf kennengelernt und viel miteinander gesprochen. Er wollte mich sogar in die Parteispitze mitnehmen, aber dann hat mich die Geheimpolizei abgeholt und mich nach Torgau gebracht. Nicht einmal der Genosse Oberstleutnant hat das verhindern können.“
„Ich verstehe. Bitte erzählen Sie weiter.“
„Der dortige Jugendwerkhof war die Hölle, und natürlich habe ich versucht, von dort auszubrechen, das gebe ich zu.“
„Was, schon wieder?“
„Ja, ich wollte zurück nach Wolfersdorf, aber sie haben mich nicht gelassen. Stattdessen haben sie mich in den Fuchsbau gesteckt. Sie wissen, was das ist?“
„Aber sicher. Das Konzept stammt von unserem Pädagogen Anton Semjonowitsch Makarenko. Übrigens eine sehr erfolgreiche Umerziehungsmaßnahme. Nun gut, aber irgendwann sind Sie dann entlassen worden?“
„Ja, als ich achtzehn wurde.“
„Und warum sind Sie nach Ihrer Entlassung nicht zurück in Ihre Stadt gegangen?“
„Ich bin dort gewesen, aber niemand von meiner Familie hat mehr in Wolfersdorf gewohnt. Meine Mutter nicht, und auch nicht meine Schwester. Ich weiß nicht, wo sie abgeblieben sind. Wahrscheinlich verschollen. Es gibt keinerlei Nachricht von ihnen.“
„Und was haben Sie dann getan?“
„Ich bin zurück ins Heim gegangen, doch der Oberleutnant war nicht mehr da. Man wollte mich auf irgendeine FDJ-Fakultät schicken, aber das habe ich abgelehnt.“
„Und dann?“
„Ich habe mir stattdessen ein Bahnticket nach Berlin gekauft, und jetzt bin ich hier. Vielleicht haben Sie irgendeine Verwendung für mich?“ Ich sah ihm in die Augen, war mir bewusst, wie das auf Männer wirkte.
Er blickte mich zunächst nachdenklich an, dann erschien prompt ein Lächeln auf seinem Gesicht. Er schob seinen Sitz nach vorn und reichte mir die Hand über seine Kopfstütze.
„Schön, ich bin Oberst Kurganow.“
Ich war baff. „Der Oberst Kurganow?“
„Ja, mit Leib und Seele. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, Fräulein Böhm. Aber jetzt müssen Sie gehen. Sie werden bald von uns hören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“
Das war alles? Ich war einigermaßen überrascht, doch die freundliche Art des Obersten beruhigte mich. Ich wusste, ich würde ihn bald wiedersehen, stieg aus dem Wagen, ließ einen letzten Blick durch den Innenraum schweifen und ging.
„Vielen Dank, dann bis bald, Genosse Oberst Kurganow.“
Er beobachtete, wie ich die Tür hinter mir schloss und sagte etwas zu seinem Sekretär, das ich nicht mehr verstehen konnte.
Oktober 2002
Oktober 2002
Trotz des beklemmenden Gefühls, das die finstere Umgebung des Fuchsbaus in mir auslöste, musste ich grinsen, als ich daran dachte, wie naiv ich mich damals bei den Russen angestellt hatte. Ich hatte tatsächlich geglaubt, ich könnte einfach so zum KGB marschieren und man würde mir mit Kusshand eine interessante Agententätigkeit anbieten. Obwohl, wenn ich recht darüber nachdachte, war es beinahe so gewesen, denn der Anruf aus Oberst Kurganows Büro kam genau zehn Tage später.
Oktober 1976
Oktober 1976
Die Hauswirtin, bei der ich wohnte, beobachtete mich argwöhnisch, als ich den Hörer entgegennahm. „Keine Männerbesuche“, hatte sie ausdrücklich betont, als ich mich bei ihr vorgestellt und nach dem Zimmer gefragt hatte. Es war winzig, aber billig. Also hatte ich es genommen. Auf eine Kontaktaufnahme seitens der Russen hatte ich bereits sehnlichst gewartet, aber dass die einfach bei mir anrufen würden, hatte mich doch überrascht. Woher die wohl die Telefonnummer meiner Hauswirtin hatten? Und überhaupt, wie konnten sie wissen, dass ich jetzt hier wohnte? Na ja, Geheimdienste wussten eben alles. Das beruhigte mich sogar.
„Fräulein Böhm?“
„Ja, am Apparat.“
„Bitte seien Sie morgen um 15:00 Uhr am Schloss Hohenschönhausen.“
„Wo?“
„Na, an dem alten Gutshaus, Hauptstraße 44.“
„Ja gut. Soll ich …?“
„Nicht am Telefon! Und seien Sie bitte pünktlich!“
Klick, aufgelegt. Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn, aber ich wusch sie sogleich mit dem Handrücken trocken. Das waren Profis. Ich befand mich auf dem richtigen Weg.
Der nächste Tag kam, und ich fuhr mit dem alten verrosteten Fahrrad meiner Hauswirtin nach Hohenschönhausen. Ich schauderte, als ich an der Untersuchungshaftanstalt der hiesigen Staatssicherheit vorbeifuhr. Die hohen Mauern und Wachtürme erinnerten mich an Torgau. Damit wollte ich nie wieder etwas zu tun haben. Das Schloss lag in Alt-Hohenschönhausen. Ich lehnte das Fahrrad an eine der wuchtigen Mauern und wartete. Ein gelblicher Doppeldeckerbus fuhr an mir vorbei. Dann sah ich die mir bereits bekannte schwarze Limousine. Sie kam schnell näher und hielt vor mir an der Bordsteinkante. Der Chauffeur stieg aus und öffnete mir wieder die hintere Tür. Oberst Kurganow saß auf dem Beifahrersitz. Er grüßte freundlich. Mir fiel auf, dass er in Zivil war. Er trug einen hellen Mantel und einen schwarzen Hut.
„Ich komme direkt aus Moskau“, erklärte er mir.
„Alle Achtung, war es dort schön?“
„Und ob! Der Gorky Park, die Moskwa. Katjuscha und Kalinka … ein Gedicht.“
„Sie waren bei Ihren Töchtern?“
Der Oberst grinste über das ganze Gesicht. „Wie, Sie kennen Katjuscha und Kalinka nicht? Von wegen Töchter. Das sind russische Volkslieder. Sie müssen noch sehr viel lernen, mein Kind, wenn Sie eines Tages wirklich zu uns gehören wollen. Hier, ich habe Wodka mitgebracht. Mögen Sie einen Schluck?“
Er reichte mir die Flasche. Sie war in ein Zeitungsblatt der Neuen Zeit eingewickelt. Ich griff danach und führte sie an den Mund.
„Pajéchali, auf geht’s, Nastrovje.“
Ich ließ die klare Flüssigkeit durch meine Kehle laufen. Der Wodka brannte und kitzelte meine Magenwände. Ansonsten war er gar nicht schlecht. „Ah, das tut gut.“
„Nicht wahr? Ist einer der besten, den wir bei uns in Russland haben.“
„Moskau, da möchte ich auch gern mal hin …“
„Nun ja, vielleicht kann ich Ihnen sogar dabei behilflich sein. Möchten Sie noch einen Schluck?“
„Warum nicht?“ Ich spürte bereits die Wirkung des Alkohols.
„Mögen Sie Kaviar?“
„Ich weiß nicht. Ich habe noch nie …“
Der Oberst nahm eine kleine Blechdose und einen Silberlöffel aus dem Handschuhfach.
„Hier, probieren Sie, zur Feier des Tages. Aber Achtung, der schmeckt ein wenig salzig.“
„Zur Feier des Tages? Haben wir denn etwas zu feiern?“
„Ja, das haben wir. Ich habe mich in Moskau für Sie starkgemacht. Aber zuerst verlangt man natürlich einen Beweis Ihrer Loyalität.“
Damit wusste ich nichts anzufangen. Ich zerkleinerte den Kaviar mit den Zähnen und schluckte ihn hinunter. Er schmeckte tatsächlich salzig. An die russischen Spezialitäten musste ich mich erst noch gewöhnen.
„Loyalität?“, fragte ich. „Wie kann ich die denn unter Beweis stellen?“
„Indem Sie für unsere Sache kämpfen.“
Ich blickte den Oberst ungläubig an. „Wo soll ich denn kämpfen? Der Krieg ist doch längst vorbei.“
„Ja, sicher ist er das, aber mit jeder neuen Nation, die sich aus dem Eis hervorwagt, mit jeder Wiederentdeckung alter Identitäten und Leidenschaften, mit jeder Auflockerung des alten Status Quo bekommen unsere Agenten haufenweise Arbeit. Wenn Sie nur einmal Ihre schönen blauen Augen öffnen, werden Sie erkennen, dass der imperialistische Feind uns stetig einkreist und bedroht. Aber wenn man die Gefahr erkennt, ist sie keine mehr, und das verdanken wir nur den wachsamen Augen unserer Spione. Wir haben in bösen Ländern gute Leute, die ihr Leben für unsere Sache riskieren. Hier, trinken Sie noch einen Schluck Wodka. Auf unsere lautlosen Helden!“
„Ja, hicks, auf die Helden.“
Ich war schon leicht beschwipst. So viel Wodka hatte ich noch niemals zuvor in meinem Leben getrunken. Dafür schien der Oberst umso nüchterner zu sein.
„Katharina, ich darf Sie doch Katharina nennen?“
„A… aber sicher, Genosse Oberst.“
„Also gut, Katharina, was würden Sie sagen, wenn Moskau auch Sie …?“
„Mich?“
„Wie ich bereits anfangs erwähnte, habe ich mich mächtig für Sie ins Zeug gelegt.“
„Aber wieso denn gerade für mich? Ich habe doch keinerlei Erfahrung?“
„Nun, ich habe denen erzählt, wie Sie bei uns aufgetreten sind, und glauben Sie mir, die in Moskau verstehen sich darauf, zu beurteilen, wen sie gebrauchen können und wen nicht. Sehen Sie sich das hier einmal an.“ Er griff in die Seitentasche seines Mantels und holte ein Schriftstück hervor.
Ich nahm es an mich und las.
Hiermit verpflichte ich mich zu vollkommener Loyalität dem sowjetischen Staat gegenüber. Des Weiteren werde ich strengsten Gehorsam leisten, sämtliche Aufträge befolgen, sowie alle Hemmungen und Scham über Bord werfen. Ich bin bereit, notfalls auch meinen Körper sowie mein Leben in den Dienst der Sache zu stellen.
Ich schluckte. Das war verdammt starker Tobak.
Oberst Kurganow reichte mir seinen Kugelschreiber. „Hier, unterschreiben Sie.“
Ich dachte nicht lange nach und unterschrieb. Was sollte ich auch anderes tun? Schließlich hatte ich den Stein ins Rollen gebracht und damit mein Schicksal herausgefordert.
Oberst Kurganow saß in seinem geräumigen Dienstzimmer und dachte über seine neuste Rekrutierung nach. Sie war ein Glücksfall. Hübsch, klug, ehrlich und unverbraucht. Er würde sie nach Belieben formen können. Sie war etwas anderes als diese Stümper, die die Rekrutierungen an Hochschulen normalerweise hervorbrachten. Wenn er nur an die letzte Veranstaltung dachte, die er in Leipzig organisiert hatte. Das sogenannte ‚Konfliktforschungsseminar‘ war ein großer Flop gewesen. Niemand hatte sich wirklich für sein Anliegen interessiert. Und dann stand da so ein Prachtmädchen quasi direkt vor seiner Haustür und fragte an, ob er eine Verwendung für sie hätte. Natürlich hatte er die. Er würde …
Das Telefon klingelte, und das penetrante Geräusch unterbrach seine Gedanken, auch wenn er den Anruf erwartet hatte.
„Boris?“
„Dobryy vecher, Juri. Hat alles geklappt?“
„Ja, sie hat unterschrieben.“
„Und jetzt?“
„Na, ich werde sie perfekt ausbilden lassen. Du weißt schon: Treffs, Mikrofone, Geheimschrift, Funk, Code, Fototechnik, das volle Programm. Die Kleine ist sehr begabt. An der werden wir viel Freude haben.“
„Und ideologisch?“
„Ich habe sie auf Herz und Nieren geprüft. Das Mädchen ist klasse. Sie hat Charakter, falls du verstehst, was ich meine.“
„Du meinst, sie hat Format?“
„Ja, und gute Umgangsformen. Sie ist wirklich ganz außergewöhnlich.“
„Wie alt ist sie eigentlich?“
„Gerade achtzehn geworden.“
„Was, noch so jung? Na, in dem Alter stellt man sich unsere Tätigkeit noch als großes Abenteuer vor.“
„Na und? Ist es das etwa nicht?“