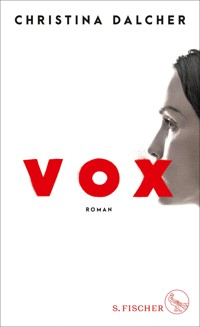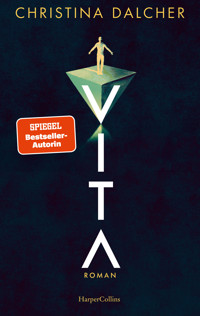12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Q: Ein fesselnder dystopischer Roman über eine Gesellschaft, in der Intelligenz und Einkommen den Wert eines Menschen bestimmen. In Christina Dalchers neuem SPIEGEL-Bestseller Q ist die Zukunft nah und verführerisch einfach: Jeder Mensch besitzt einen Q-Wert, der Intelligenz und Einkommen misst und damit den Platz in der Gesellschaft zuweist. Elena Fairchild, Lehrerin an einer Eliteschule, glaubt an dieses System und testet regelmäßig das Potential ihrer Schüler. Je höher der Q-Wert, desto größer der Zugang zu Bildung und desto goldener die Zukunft. Doch wohin jeden Morgen die Busse die Kinder mit niedrigem Q-Wert bringen, weiß niemand so genau. Nur, dass sie nicht wiederkehren. Als Elenas 9-jährige Tochter durch einen Test fällt und ihr Q-Wert auf ein erschreckend niedriges Niveau sinkt, lernt die Mutter die Kehrseite der schönen neuen Welt kennen. Was, wenn die Auslese der Besten nur der Anfang eines schrecklichen Plans ist? Was, wenn man ihr das eigene Kind nehmen will? Q ist ein packender dystopischer Thriller, der die Frage aufwirft, wie weit eine Gesellschaft gehen darf, um die vermeintlich Besten zu selektieren - und was passiert, wenn man selbst nicht dazugehört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Christina Dalcher
Q
In dieser Welt ist Perfektion alles Roman
Roman
Über dieses Buch
In der nahen Zukunft besitzt jeder Mensch einen »Q«-Wert, der Intelligenz und Einkommen misst, und damit jedem seinen Platz in der Gesellschaft zuweist. Eine verführerisch einfache Antwort auf eine zunehmend heterogene Welt. Das glaubt auch Elena Fairchild, die an einer Eliteschule lehrt und regelmäßig das Potential ihrer Schüler testet. Je höher der Q-Wert, desto größer der Zugang zu Bildung und desto goldener die Zukunft. Wohin jeden Morgen die Busse die Kinder bringen, deren Q-Wert zu niedrig ist, weiß niemand so genau. Nur, dass sie nicht wiederkehren.
Als Elenas 9-jährige Tochter durch einen Test fällt – und damit ihr Q-Wert auf ein erschreckend niedriges Niveau, lernt die Mutter die Kehrseite der schönen neuen Welt kennen. Was, wenn die Auslese der Besten nur der Anfang eines schrecklichen Plans ist? Was, wenn man ihr für immer das eigene Kind nehmen will?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Über die Autorin und die Übersetzerin
Christina Dalcher ist Autorin des internationalen Bestsellers ›Vox‹. Die Amerikanerin promovierte an der Georgetown University in Theoretischer Linguistik und forschte über Sprache und Sprachverlust. Ihre Kurzgeschichten und Flash Fiction erschienen weltweit in Magazinen und Zeitschriften, u.a. wurde sie für den Pushcart Prize nominiert. ›Q‹ ist ihr zweiter Roman.
Michaela Grabinger studierte Germanistik, Philosophie und Psychologie. Sie lebt in München. Zu den von ihr übersetzten Romanen und Sachbüchern zählen Werke von Anne Tyler, Elif Shafak, Joy Fielding, Michael Crichton, P.D. James, Tan Twan Eng, David Graeber und Alain de Botton.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel ›Master Class‹
bei Berkley, an imprint of Penguin Random House LLC, New York.
© 2020 by Christina Dalcher
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS – Visuelle Kommunikation Denker & Denker GbR
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491061-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Anmerkungen der Autorin
Danksagung
In Erinnerung an Carrie Elizabeth Buck, 1906 –1983,
und an die Kinder, die ihr und so vielen anderen verwehrt blieben.
»Sie haben mir unrecht getan. Sie haben uns allen unrecht getan.«
Carrie Buck
1
Wer weiß, wozu er bereit wäre, um aus einer beschissenen Ehe auszubrechen, damit er den eigenen Töchtern gute Chancen auf Erfolg im Leben bieten kann? Würde man Geld zahlen? Die Geborgenheit des eigenen Hauses aufgeben? Lügen, betrügen, stehlen? Wie sicherlich viele Mütter habe auch ich mich das gefragt. Nur eine Frage habe ich nie gestellt, und zwar weil mir die Antwort überhaupt nicht behagt. Dafür ist mein Überlebensinstinkt zu groß. War er schon immer.
Als sich die Mädchen gestern Abend hingelegt hatten, habe ich wieder mal mit Malc gesprochen und dabei einen möglichst leichten Ton angeschlagen, um zu verhindern, dass sich seine Teilnahmslosigkeit abrupt in Wut verwandelte.
»Es reicht mir, Malc, und Freddie hat es auch satt«, sagte ich.
Er sah einen Augenblick von seinen Unterlagen auf und warf mir einen Blick zu. »Was reicht dir?«
»Die Werte. Der ganze Druck. Einfach alles.«
»Verstehe.« Er versenkte sich wieder in seine Memos und Berichte. Als ich aufstand, um ins Bett zu gehen, glaubte ich ihn erleichtert seufzen zu hören.
Bei uns läuft es schon lange nicht mehr gut.
Ich kann mich fast nicht mehr erinnern, wie es war, als wir die Q-Werte noch nicht mit uns herumtragen mussten wie einen zusätzlichen Fingerabdruck, der für die einen ein Ehrenzeichen, für die anderen ein Schandmal darstellt, aber wahrscheinlich gewöhnt man sich im Lauf von mehr als zehn Jahren an alles. Das ist wie mit den Handys. Können Sie sich an die Zeit erinnern, als man noch nicht die ganze Welt in der Hosentasche trug? Wissen Sie noch, wie Sie auf dem Boden hockten und sich mit Ihrer besten Freundin über Gott und die Welt unterhielten, während Sie immer wieder das Spiralkabel auseinanderzogen, das sich sofort wieder einrollte? Sehen Sie das noch vor sich? Ich schon – und dann doch wieder nicht. Blockbuster-DVDs mit zweitägiger Ausleihfrist und Buchhandlungen von der Größe eines Flugzeughangars sind mittlerweile ferne Erinnerungen, verblasste Bilder eines Daseins ohne Streaming und Same-Day-Lieferung.
Genauso geht es mir mit den Q-Werten, obwohl wir schon davor fast unser ganzes Leben lang Zahlenkolonnen mit uns herumgeschleppt haben: die Sozialversicherungsnummern für die Steuererklärung, die privaten Telefonnummern, damit man im Notfall seine Mutter erreicht, die auf Dutzenden College-Bewerbungsformularen eingetragenen Durchschnittsnoten. Beim Kleiderkauf verwandelten sich Männer in L 34 oder in Kragenweite 42, Hemdlänge 83; Frauen wurden zu einer 34, 36 oder 42. In den schickeren Läden waren wir unsere Kleidergröße, in der Arztpraxis unsere Körperlänge und unser Gewicht, und während sich die eine Zahl allmählich verkleinerte, wurde die andere größer.
Wir sind seit jeher durch Nummern definiert. Durch das Geburtsdatum, den Notendurchschnitt, die Sozialversicherungsnummer, den Blutdruck (systolisch wie diastolisch), den Body-Mass-Index, die Punktzahl im Hochschulzugangstest, in den Tests für die Zulassung zum Masterprogramm, zum BWL- oder Jurastudium. Durch 89–56–89 (vielen Dank auch, Marilyn!), durch die 3 (Babe Ruth), durch PINs, Kartenprüfnummern und Ablaufdaten. Durch Jennys Telefonnummer in dem alten Song von Tommy Tutone und, im Extremfall, durch die sechzehn Ziffern umfassende Nummer der Visa-Kreditkarte. Durch unser Alter, unser Privatvermögen, unseren IQ.
Darüber denke ich nach, während ich im Supermarkt an einer Priority-Kasse anstehe. Die ungefähr hundert Tüten, Dosen und Schachteln in meinem Einkaufswagen werden meine vierköpfige Familie durch die nächsten Tage bringen. Gestern gafften im Safeway fünf Frauen, die sich drei Schlangen weiter angestellt hatten, zu mir herüber. Die eine kannte ich noch aus der Highschool. Wenn ich mich recht erinnere, war sie damals Cheerleaderin. Ziemlich dünn, ziemlich doof. Wie hieß sie noch gleich? Paulette? Paulina? Patty? Ja, Patty. Sie stand mit einem Karton Magermilch in der Hand als fünfte in der Schlange vor der einzigen geöffneten Non-Priority-Kasse. Sie hatte einen Artikel, ich hundert. Als ich sie vorlassen wollte, zuckte der Kassierer mit den Schultern und gab mir durch sein Kopfschütteln zu verstehen, dass daran gar nicht zu denken war.
»Sie wissen doch, dass die Karte der Kundin in dieser Schlange nicht funktioniert«, sagte der junge Mann.
Dann scannte er meine Karte, meine Zauberkarte mit der verschlüsselten Zauberzahl. Neun-Punkt-irgendwas. Die erste Ziffer – auf die kommt es an.
Patty sagte kein Wort. Früher hätte sie den Mund aufgemacht. Sie – oder eine von den anderen Frauen – hätte ihren Wagen herübergeschoben und sich nicht mehr vertreiben lassen. Einmal habe ich an einer Tankstelle eine Handgreiflichkeit zwischen einem kleinen Mann im Anzug und einem Angestellten aus dem Baumarkt in der Main Street miterlebt. Da war jede Konkurrenz von vornherein ausgeschlossen. Der Anzugmann musterte Mr.-Ex-Highschool-Footballer nur ein Mal kurz, stieg in seinen Lexus und fuhr davon. Als seine Karte nicht angenommen wurde, bearbeitete Mr. Ex-Footballer das Tanksäulendisplay, bis seine Fäuste bluteten und die Polizei anrückte. Seinen Q-Wert kannte ich natürlich nicht, aber er war garantiert unter neun.
Inzwischen haben wir uns alle an die Warteschlangen, an das Ranking und an die Ungleichheit gewöhnt.
Man gewöhnt sich wohl an alles, wenn es nur lange genug Bestand hat.
2
Ich habe mittlerweile neun Wecker im Haus. Der neben meinem Bett ist auf fünf Uhr gestellt. Ein zweiter piepst eine Stunde vor der Ankunft von Annes Schulbus los, drei weitere erinnern mich daran, dass ich noch dreißig, fünfzehn beziehungsweise sieben Minuten habe. Für Freddies Bus, der etwas später kommt, sind vier eigene Wecker zuständig. Neunmal Gesumm, Gedudel und Geklingel, fünfmal die Woche. Manchmal komme ich mir wie in einer Gameshow vor.
Und alles nur, damit meine Töchter bloß nicht den Bus zur Schule verpassen.
Als ich klein war, rief meine Mutter morgens von unten die Treppe hinauf. Ihre Stimme hielt immer die feine Balance zwischen sanft und bestimmt, wenn sie meinen Namen aussprach und mich aufforderte, das Bett zu verlassen und mich anzuziehen und fertig zu machen. Trotzdem kam ich hin und wieder zu spät an der Bushaltestelle an und sah die roten Rückleuchten im Morgennebel verschwinden. War aber kein Drama.
Denn damals gab es noch keinen Bonus, wenn man den Bus pünktlich erreichte.
Malcolm ist bereits aus dem Haus und macht es sich in seinem hellen Büro mit Kaffee, Vollkornbagels und fettfreiem Frischkäse gemütlich, alles von einer Assistentin serviert. Seine Töchter, beide Teilnehmerinnen an der täglichen Show mit dem Titel Wer schafft es heute nicht rechtzeitig in die Schule?, sieht er an Werktagen morgens nie, was wirklich schade ist. Die Preise sind die ganze Aufregung nicht wert, doch die Strafen für die Verlierer sorgen für ausreichend Motivation.
»Freddie!«, rufe ich aus der Küche und klinge dabei nicht wie meine Mutter, sondern wie eine verzweifelte Löwin, deren Junge von einem Rudel Hyänen umkreist sind. »Anne!«
Während ich Joghurt aus einem Tausend-Gramm-Behälter in Schüsseln löffle und gleichzeitig auf einem Bein hüpfend versuche, den Fesselriemen an meinem linken Schuh zu schließen, schrillt Annes Dreißig-Minuten-Wecker los. Anne steckt den Kopf durch die Tür und schüttelt nur kurz den Kopf.
Freddie ist noch nicht fertig. Nicht mal annähernd.
Scheiße.
Ausgerechnet am zweiten Testtag in diesem Schuljahr bin ich spät dran, meine Tochter ist noch nicht zum Frühstück erschienen, und mein einziger Gedanke gilt dem gelben Bus, der ein Stück die Straße hinauf im Leerlauf steht. Und hinter dem Steuer sitzt der Kinderfänger.
Als ich klein war, hatte ich Albträume von dem Kinderfänger aus dem alten Musical, in dem es ein fliegendes Auto gab und Dick Van Dyke sich mit seinem erbärmlich schlechten britischen Akzent herumquälte. Wenn es zu dämmern begann, lauerte er mit pomadisiertem Haar und Pinocchio-Nase vor unserem Haus und wartete.
Der Kinderfänger wirkte nicht auf Anhieb gruselig – schließlich bimmelten Glöckchen und leuchteten Lämpchen an seinem Wagen, und immerhin tänzelte er im knallbunten Mantel daher und versprach den Kindern Süßigkeiten und andere schöne Dinge. Welches Kind erschrickt schon vor Glöckchen, Farben und Süßigkeiten? Außerdem wusste man beim ersten Mal weder, dass der Wagen in Wahrheit eine vergitterte Gefängniszelle war, noch dass der Kinderfänger unter seinem Mantel Schwarz trug und seine Beute in eine dunkle Höhle verschleppte.
Doch wenn man den Film zum zweiten oder dritten Mal sah, kapierte man es. Und danach war alles klar.
Dann wusste man genau, worum es ihm ging.
Ich habe mit Anfang vierzig lernen müssen, dass es den Kinderfänger gewissermaßen noch immer gibt.
Er ist alt und sitzt in einem Bus, der an den Seiten die schwarze Aufschrift Bundesschulen trägt. Durch die Windschutzscheibe betrachtet wirkt sein Haar wie ein verschwommener weißer Fleck. Statt eines bunten Mantels trägt er eine schlichte graue Uniform, in deren Schulterklappen das Logo des Bildungsministeriums eingestickt ist, ein in drei Farben – Silber, Grün und Gelb – gehaltenes Friedenssymbol, umgeben von den Wörtern Intelligentia, Perfectum, Sapientia. Intelligenz, Vollkommenheit, Weisheit. Zwei dieser drei Wörter kann man sich auch ohne Lateinkenntnisse erklären. Der gelbe Lack des Busses – Chromgelb hieß die Farbe früher, als sie noch Blei enthielt, aber seit einiger Zeit wird sie Bundesbusglanzgelb genannt – ist rissig und blättert an den Kotflügeln und an der Falttür ab, doch das ist allen herzlich egal. Angesichts der Ziele, die von diesen Bussen angesteuert werden, und der Fracht, die sie transportieren, spielt ihr Zustand schlicht keine Rolle.
Die grünen und silberfarbenen Busse sind dagegen immer gut in Schuss, auf Hochglanz poliert und ohne Dellen oder Kratzer. Im Gegensatz zu der quietschenden Tür des gelben Busses, der an diesem Morgen durch unsere Straße rattert, öffnen sich die Türen der anderen störungsfrei und geräuschlos. Die Fahrer der grünen und silbernen Busse lächeln, wenn die Kinder einsteigen. Alle, sogar die Fünfjährigen, tragen Schuluniform in den Farben Harvard-Purpurrot und Yale-Blau.
Die gelben Busse weisen eine zusätzliche Besonderheit auf: Sie laden ihre Fracht nicht Tag für Tag im frühmorgendlichen Nebel ein und setzen sie nachmittags wieder ab, damit die Kinder nach der Schule eine Kleinigkeit essen und ein bisschen fernsehen können und nicht mehr zeitweise Mündel des Staats, sondern wieder daheim bei ihren Familien sind.
Die gelben Busse kommen nur ein Mal im Monat, immer am Montag nach dem Testtag. Und nachmittags kehren sie nicht zurück.
Sie kehren nie zurück. Zumindest nicht mit Passagieren. Und sie kommen nicht in Gegenden wie unsere.
Hätte ich Zeitungsschlagzeilen der vergangenen zehn Jahre aufgehoben, könnten sie das Ganze besser illustrieren als ich.
EINWANDERERZAHL STEIGT – DÜSTERE PROGNOSEN FÜR 2050
LEHRERMANGEL UND ÜBERFÜLLTE SCHULEN:
BEHÖRDEN FINDEN KEINE LÖSUNGEN
GENICS INSTITUTE BIETET IN ZUSAMMENARBEIT MIT BILDUNGSMINISTERIUM ERWEITERTE Q-SOFTWARE AN
KAMPAGNE FÜR WERTVOLLERE FAMILIEN VERÖFFENTLICHT RICHTLINIEN
GESETZ ZUR VERBESSERUNG DER ÖFFENTLICHEN SCHULEN WIRKT SICH NACHTEILIG AUF ALLE SCHÜLER AUS!
ERSTE ANORDNUNGEN FÜR DIE NÄCHSTEN MONATE ERWARTET
Zuerst war da die Angst, dann kamen die Gesetze.
Ich schenke mir den dritten Kaffee ein und sehe auf die Uhr. »Freddie! Bitte!« Ich bemühe mich, leise und ruhig zu sprechen wie eine liebevolle Mutter. Alles zu tun, damit sie sich nicht aufregt.
Der gelbe Bus steht im Leerlauf auf der anderen Straßenseite, zwei Häuser weiter, vor der Zufahrt der Campbells. Das ist komisch, denn Moira Campbell hat gar keine Kinder mehr – zumindest keine, die noch zu Hause wohnen. Außerdem ist heute Testtag. Aber schräg gegenüber ist immer noch besser als vor dem eigenen Haus, egal, ob der Bus pünktlich ist oder nicht. Allein bei dem Gedanken läuft es mir trotz des späten, heißen Indian Summer eiskalt über den Rücken. Seit wann stellt etwas so Banales wie ein gelber Schulbus eine solche Bedrohung dar? Als würde man einem Smiley Reißzähne aufmalen. Das darf einfach nicht wahr sein!
»Verflucht nochmal, Freddie!«
Die Wahrheit über Neunjährige: So fürchterlich die Schmerzen im Kreißsaal, so chaotisch das allnächtliche Stillen, der Pseudokrupphusten und das Trotzalter waren und so sehr man sich jetzt vor dem ersten Ich habe einen Freund, Mom! aus dem Mund eines Kindes fürchtet, das dem Gefühl nach noch gestern in Windeln herumlief, so schlimm sind Mädchen zwischen acht und zehn – vor allem, was den Aufenthalt im Bad betrifft. Aber ich darf nicht wütend werden –, gerade weil Freddie so ist, wie sie ist.
Immer daran denken: einen anderen Ton anschlagen. Zwei Oktaven tiefer und eine Million Dezibel leiser.
»Beeil dich, Schatz! Heute ist der Test!«, sage ich, diesmal mit mehr Honig in der Stimme, und überlege, ob ich es rechtzeitig zu meiner eigenen Arbeit schaffe. Dann versuche ich, die große Schwester einzuspannen; sie soll den Bad Cop spielen. »Anne, du sorgst dafür, dass deine Schwester in zwei Minuten hier auftaucht, ganz egal, ob die Haarspangen zusammenpassen oder nicht!«
Es scheint zu funktionieren. Solange Anne nicht mit der Nasenspitze an ihrem iPad klebt und sich die Q-Platzierung aller Jungs in der Stadt ansieht, die als Begleiter zum Homecoming-Ball in Frage kommen, ist sie die Vernünftige. Immer startbereit, immer pünktlich, und nach jedem Test kommt sie mit diesem unbekümmerten Lächeln nach Hause und strahlt, sobald die App auf ihrem Handy oder Tablet abends anzeigt, dass sie bestanden hat. Freddie dagegen bleibt ewig im Bad, hadert mit ihrem Pony und wäscht sich die Hände fünfmal mehr als nötig. Einmal saß sie vornübergebeugt auf dem Klo, hatte den Kopf auf die Knie gelegt, zitterte am ganzen Leib und weigerte sich herauszukommen.
»Es geht nicht anders, Schatz«, sagte ich. »Zum Test müssen alle.«
»Aber warum?«
Warum? Ich suchte nach einer beruhigenden Antwort. »Damit die Leute richtig eingeordnet werden können. Du hast es doch immer gut gemacht!«
Ich sagte nie: »Du hast es jedes Mal knapp geschafft, du wirst es wieder knapp schaffen.« Damit wäre ihr überhaupt nicht gedient.
Anne kommt in die Küche. Sie klebt noch immer an ihrem iPad, wischt, zoomt hinein und heraus und murmelt Zahlen vor sich hin. »Neun Komma eins. Quel Versager. O Mann – acht Komma acht, noch schlimmer!« Dann sagt sie: »Mom, schau dir mal den da aus dieser Schule in Arlington an, der ist auf acht Komma zwei sechs abgesackt und sieht aus, als würde er nicht mal ’nen Bluttest bestehen. Scherz.«
»Acht Komma drei war früher Note B.«
»Jetzt nicht mehr.«
Genau wie ihr Vater, denke ich, spreche es aber nicht aus. In Annes Augen dreht sich alles um Malcolm, wahrscheinlich sogar die Sonne.
»Wo ist deine Schwester?«, frage ich, während ich meinen Regenmantel zuknöpfe, und Anne antwortet, dass sie gleich hier sein müsste.
Der silberne Bus, der die restlichen Neun-Komma-irgendwas-Schüler zur höchstrangigen Schule bringt, ist um die Ecke gebogen, drosselt das Tempo und klappt die Stoppschilder aus, während er auf die Abholstelle zufährt. Hinter ihm bildet sich eine Wagenschlange – Autos, auf deren Rücksitzen Schüler mit dem Ausweis in der Hand sitzen und darauf warten, aussteigen zu dürfen. Ein stahlgrauer Lexus SUV, das erste Auto in der Schlange, fährt an den Straßenrand, und die hintere Tür wird geöffnet. Das Mädchen habe ich schon einmal an einem der Elternsprechtage gesehen, die in Annes Schule jeden Herbst stattfinden. Trotz der dichten, ungekämmten Löckchen, die das Gesicht fast verdecken, erkennt man das Weiße in seinen Augen, den Blick eines ängstlichen Hundes, als es den gelben Bus weiter vorn stehen sieht.
Anne stellt sich zu mir ans Fenster. Sie hat den Rucksack über die Schulter gehängt, hält die silberne ID-Karte fest in der Hand und zieht daran, so dass das Umhängeband in ihren Nacken schneidet. Es erinnert mich an eine Schlinge.
»Das Mädchen da wirkt ziemlich nervös«, sage ich.
»Ganz ohne Grund. Sabrinas Q ist völlig in Ordnung.« Plötzlich flüstert sie mir verschwörerisch zu: »Was man von Jules Winstons Q nicht behaupten kann. Die hat letzte Woche nur mit Müh' und Not den Mathetest bestanden.« Sie beißt in ihren Apfel und wischt wieder auf dem iPad herum.
Ich wende mich vom regennassen Fenster ab. »Die Ergebnisse sind doch angeblich geheim.« Aber ich weiß, wie Kinder sind. Schließlich war ich selbst mal auf der Highschool.
Anne zuckt mit den Achseln. »Die Ergebnisse schon, aber das Ranking nicht. Weißt du doch.«
Ja, weiß ich.
»Jedenfalls hat Jules jetzt den niedrigsten Q von allen im dritten Jahrgang«, sagt Anne. »Außerdem war sie in diesem Halbjahr drei Tage krank undhat letzten Mittwoch den Bus verpasst. Und ihre Mutter wurde entlassen, deshalb haben sie jetzt weniger Geld. Da kommt einiges zusammen.« Der nächste Biss in den Apfel. Der nächste Wisch übers iPad. »Wenn sie sich nicht bald gewaltig verbessert, sitzt sie nächste Woche im grünen Bus und im Dezember vielleicht schon in dem da.« Sie macht eine Kopfbewegung in Richtung des gelben Busses, der im Regen wartet. »Ein paar Jahre in der gelben Schule, und ihre Karriere im Fastfoodbereich ist gesichert.«
»Also bitte, Anne!«
Wieder hebt sie kurz die Schultern. Meine älteste Tochter ist derzeit Meisterin darin, alles, wirklich alles, achselzuckend abzutun. »Irgendwer muss diese Jobs schließlich machen. Zumindest bis das alles endlich automatisiert ist. Offenbar wird heute jemand abgeholt. Und das in unserer Straße. Ziemlich schräg.«
Sie klingt sachlich, wie eine Journalistin. Genau wie Malcolm, wenn er berichtet, wie viele neue Staatsschulen im nächsten Monat eröffnet werden, oder den Durchschnitts-Q im Bundesstaat, in der Stadt und im Schuldistrikt verkündet. Das macht er jeden Tag beim Abendessen, als würde uns das alle interessieren. Anne, die meist neben ihm sitzt, hängt dann immer an seinen Lippen und ist ganz hingerissen von den Zahlen.
Und Freddie? Das ist eine völlig andere Geschichte.
3
Anne hat mit ihrem iPad und der am Halsband baumelnden silbernen Karte das Haus verlassen. Hundertfünfundsechzig Zentimeter Selbstbewusstsein laufen da auf der Zufahrt zum wartenden Bus. Sie überholt die andere Schülerin – wie hieß sie noch mal? Sabrina? –, ohne sie auch nur zu grüßen, und gesellt sich zu einer Gruppe wohlgeratener Sechzehnjähriger, die, genau wie Anne, Versagen als etwas Ansteckendes empfinden.
Sabrina scheint es nicht gut zu gehen, hoher Q-Wert hin oder her. Sie wirkt adrett, ihr Haar glänzt, wie nur Teenagerhaar glänzen kann, und die Uniform ist perfekt gebügelt. Das Auto von Sabrinas Eltern lässt darauf schließen, dass es ihr an nichts fehlt. Andererseits gibt es Handicaps, die auch noch so viel Geld nicht aufwiegen kann.
Ich habe zwar keine Ahnung, woran es bei Sabrina hapert, aber am liebsten würde ich durch den Regen zu ihr unter den Schirm laufen und ihr eine Banane geben, einen Haferriegel, eine Tasse heiße Schokolade. Oder sie einfach umarmen und ihr sagen, dass ein vermasselter Test sie nicht zur Versagerin macht.
Andererseits: In diesen Zeiten macht er sie zur Versagerin.
Eines nach dem anderen gehen die Kinder zum silbernen Bus, zeigen ihre Karte vor und lassen sie scannen. Der Piepston ist so schrill und durchdringend, dass er jedes Mal, wenn eine Karte Zutritt zum Bus gewährt, durch unser Wohnzimmerfenster dringt. Die Tür gleitet auf, und das Mädchen oder der Junge steigt ein. Dann schließt sie sich und öffnet sich erst wieder, wenn der Nächste in der Schlange dran ist. Man traut Highschoolschülern diese Disziplin gar nicht zu, aber es gibt Regeln, die befolgt werden müssen, und Gesetze, in denen die Regeln stehen. Die Männer und Frauen, die die Gesetze beschließen, das sind die wahren Kinderfänger, sage ich mir.
Ich muss es wissen. Mein Mann ist einer von ihnen.
Sabrina ist die Letzte. Der Piepston, die Tür und die Zuflucht vor dem Regen, die der Bus bietet, zaubern ein mattes Lächeln auf ihre Lippen. Bevor sie einsteigt, wirft sie einen Blick zurück und lässt ihn die Straße hinaufwandern. Als er auf das Haus der Greens trifft, verschwindet ihr Lächeln. Heute hat sie die silberne Karte, aber wer weiß, was die nächste Woche bringt?
Merkwürdig, dass Annes beste Freundin nirgends zu sehen ist. Judith Green steht fast immer als Erste mit gezückter Silberkarte am Bus. Die Schule, die Hausaufgaben, die schriftlichen Referate scheinen ihr Ein und Alles zu sein.
Letzter Aufruf für die Schüler der Davenport Silver School. Der Bus der Davenport Silver School fährt in Kürze ab. Letzter Aufruf für die Schüler der Davenport Silver School.
»Aufruf« trifft es nicht ganz. Die durch die Straße dröhnende monotone, akzentlose Gynoidstimme sollte besser sagen, was Sache ist, und von »Warnung« sprechen.
Als sich die Tür schließt, ist Judith Green noch immer nicht aufgetaucht.
Nach der Abfahrt des silbernen Busses fährt der grüne Bus zur leeren Haltestelle, und dahinter steht die nächste Autoschlange im Regen. Mehrere Schüler der Middleschool latschen durch die Pfützen. Einer hopst in ein flaches Schlagloch und verdreckt mit dem aufspritzenden schlammigen Wasser die drei Kinder neben ihm, doch die lachen nur. Sind eben Kinder.
»Letzte Warnung, Freddie!«, rufe ich. Und bedauere sofort meine Wortwahl.
Endlich kommt sie ins Wohnzimmer. Der Rucksack lastet so schwer auf ihrer Schulter, dass sie sich ein wenig zur Seite neigt und eher an den buckligen Quasimodo als an ein gesundes neunjähriges Kind erinnert. Ihr Gesicht wirkt wie das einer alten Frau. Müde. Sie wischt sich nicht durch Tweets und Snaps, mümmelt auch nicht an einem Apfel oder tut sonst irgendetwas, sondern starrt nur an mir vorbei durchs Fenster auf den grünen Bus.
»Was ist?«, frage ich und ziehe sie an mich, obwohl ich genau weiß, was los ist.
»Darf ich heute krank sein?« Sie spricht mit zittriger, abgehackter Stimme. Nach jedem Wort folgt eine kurze Pause. Ehe ich antworten kann, beginnt ihr ganzer Körper in meinen Armen zu beben. Der Rucksack gleitet von ihrer Schulter und landet mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden.
»Nein, Süße, heute nicht. Vielleicht morgen.« Das ist selbstverständlich gelogen. Krankheitsfälle werden überprüft, und selbst wenn es mir gelänge, bis morgen früh um sechs Uhr, dem spätmöglichsten Zeitpunkt, ein fiktives leichtes Fieber zu melden, würde die Kontrolle durch die Schulkrankenschwester doch nur eine normale Temperatur ergeben, und Freddie würde noch mehr Q-Punkte verlieren, die sie auf keinen Fall verlieren darf: die üblicherweise für den Krankheitstag abgezogenen Punkte plus die Strafpunkte wegen des Kontrollergebnisses. Was bleibt mir übrig, als heute zu lügen und das Gesagte morgen zurückzunehmen, damit sie, koste es, was es wolle, in den Bus steigt? »Nun mach schon, Süße. Es ist höchste Zeit.«
Noch ehe ich den nächsten Atemzug getan habe, dreht sie sich um und kickt den Rucksack quer durchs Zimmer. Er landet auf Malcolms Friedenslilie, die er sogar schon vor unserer Heirat gehabt hat. Freddie kann sich innerhalb einer Sekunde vom heftig schluchzenden in ein völlig hysterisches Kind verwandeln. Malcolm wird nicht begeistert sein, wenn er nach Hause kommt.
»Ich kann nicht!«, brüllt Freddie. »Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht!«
Ach du Scheiße.
Plötzlich liegen wir beide am Boden. Freddie reißt sich die Haare aus, während ich sie daran zu hindern versuche, noch mehr Schaden anzurichten. Blonde Büschel fallen auf den Spannteppich. Wenn sie so abrupt aufhört, wie sie angefangen hat, ist es am schlimmsten. Dann beginnt sie, sich langsam vor und zurück zu wiegen wie auf einem dieser Spielplatztiere mit den großen Spiralfedern, während ihre Augen genauso ausdruckslos ins Nichts starren.
Wenn sie so drauf ist, darf ich sie nicht berühren, egal, wie sehr es mich danach drängt.
Es gibt bestimmt ein Wort für das, was Freddie ist, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wie es lauten oder klingen sollte. Für mich ist sie Freddie, sonst nichts. Frederica Fairchild, neun Jahre alt, ein unglaublich liebes Kind, das außer den normalen Problemen und Macken eines Mädchens in ihrem Alter keinerlei Probleme und Macken hat. Ihr Schmetterschlag beim Volleyball ist gefürchtet, ihr Schachspiel treibt Malcolm den Schweiß auf die Stirn, und sie isst alles, nur keinen Rosenkohl. Trotzdem liegt sie jetzt hier und fürchtet sich vor dem Testtag.
Und nicht zum ersten Mal.
»Freddie«, sage ich leise und werfe einen Blick auf die Schülerschlange vor dem grünen Bus. Nur noch zwei warten darauf, ihre Karten scannen zu lassen und einzusteigen. »Du musst jetzt gehen.«
Letzter Aufruf für die Schüler der Sanger Green School. Der Bus der Sanger Green School fährt in Kürze ab. Letzter Aufruf für die Schüler der Sanger Green School.
Ich könnte diese Scheißroboterstimme umbringen.
Während sich Freddie langsam wieder beruhigt, hebe ich den Rucksack auf, ziehe eine Handvoll Kleenex aus der Schachtel in der Küche und drücke meiner Tochter die grüne ID-Karte in die Hand. »Du schaffst das, ganz bestimmt!«
Sie nickt kaum merklich und schweigt. Wie ich den ersten Freitag im Monat hasse!
Als das vorletzte Kind in den Bus steigt, verlässt Freddie endlich das Haus. Ich versichere ihr noch einmal, dass sie sich keine Sorgen zu machen braucht, doch sie scheint mich gar nicht zu hören. Mein Kaffee ist kalt geworden, und Malcolms blöde Friedenslilie sieht aus wie nach einem Meteoriteneinschlag.
Ich drehe den Pflanztopf so, dass die am schlimmsten lädierte Stelle zur Wand zeigt, und überlege angestrengt, welche Lüge ich meinem Mann abends auftischen soll, obwohl es darauf im Grunde auch nicht mehr ankommt. In den letzten Jahren habe ich Malcolm fast ausschließlich Lügen erzählt, vom täglichen »Ich liebe dich« bis zu den geflüsterten Worten beim Sex. Der ist selten geworden und findet nur noch mit den in seinem Nachttisch gebunkerten Kondomen und einer dicken Schicht Spermizidgel statt, damit wir nur ja keine Kinder mehr bekommen.
Ich habe Freddie nicht angelogen. Ich weiß, dass sie es schaffen wird. Ihre Gene belegen es. Alles bestätigt durch das pränatale Q-Gutachten, das ich Malcolm vor neun Jahren präsentiert habe.
Allerdings war auch das eine Lüge.
Ich habe den Test nie machen lassen.
4
Ich gehe in die Küche, um den schal gewordenen Kaffee in die Mikrowelle zu stellen. Immer wenn ich an Genetik denke, fällt mir ein Gespräch ein, das ich mit meiner Großmutter geführt habe, als ich noch nicht allzu lange mit Freddie schwanger war.
Es ist keine schöne Erinnerung.
»Ich mag dieses Q nicht.« Oma schenkte sich einen Schnaps ein, prüfte die Menge und fügte noch einen Schuss hinzu. Ich öffnete den Drehverschluss der Wasserflasche, die ich aus dem Kühlschrank geholt hatte, und setzte mich zu ihr ins Wohnzimmer. Mein Bauch fühlte sich an, als würde ein kleiner Thunfisch darin schwimmen, der wuchs und wuchs. »Ich spreche nur sehr, sehr ungern von ›hassen‹, weil sich schon ein bisschen Hass irgendwann in einen Riesenhass verwandeln kann, aber dieses Q hasse ich.«
Noch einen Monat zuvor war ich beim leisesten Hauch von Alkoholgeruch zum Klo gerannt. Jetzt fand ich ihn verlockend.
»Willst du nicht wenigstens nippen?«, fragte sie mich. »Das bringt dich nicht um und das Baby auch nicht.« Sie streckte den Arm aus und klopfte dreimal kurz auf meinen Pulli, der sich bereits über meinem Bauch spannte und mich ständig daran erinnerte, dass die Zeit davonlief. »Alles wird gut – wie bei deinem Vater und bei dir.«
Ich konnte es nicht ausstehen, wenn Oma meinen Bauch tätschelte. Außerdem übertönte sie Petra Pellers Stimme aus dem Fernseher.
Wie hoch ist Ihr Q?, fragte Petra. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich direkt ansah.
Der Schnaps war wirklich verlockend. Malcolm würde es nie erfahren –, wenn ihm auffiele, dass weniger in der Flasche war, würde ich es auf Oma schieben. Aber jemand anderes würde es erfahren. Jemand in einem sterilen weißen Raum voller Urinproben aus der Praxis meines Arztes. Eine Frau mit einer Gelbschulausbildung, die man dafür bezahlte, dass sie die Ausscheidungen schwangerer Frauen sichtete und sich mit Ankreuzkästchen abquälte. Eine Frau, die ihren Job so sehr hasste, dass sie ihren Hass an jemandem auslassen musste – und zwar vorzugsweise an der Gattin des Mannes, der das Stufensystem und das Q-Ranking erfunden hatte und deren Bedeutung bei jeder sich bietenden Gelegenheit herausstrich.
Und noch viel wichtiger: Wie hoch ist das Q Ihres Babys?, hakte Petra nach.
»Was für ein Unsinn«, sagte Oma. »Ein Baby ist ein Baby. Wen kümmert sein Q?«
Malcolm interessiert es, hätte ich am liebsten erwidert. Und zwar brennend.
»Wer weiß überhaupt, was dieses Q ist?«
Ich beantwortete die Frage, so gut ich konnte, indem ich die Informationen zusammenstückelte, die ich von Malcolm und aus den Nachrichten hatte. Hatte es sich anfangs um eine Zahl gehandelt, die einem Notendurchschnitt entsprach, so waren die Algorithmen inzwischen wesentlich komplizierter geworden. »Q ist ein Quantor, Oma. Ein Quotient.«
»Und was wird da quantifiziert?«
»Na ja, zunächst mal Noten, aber auch Anwesenheit und Beteiligung. Das, was schon immer erhoben wurde.«
»Mehr nicht?« Sie klang skeptisch.
Ich zählte alle Komponenten auf, die mir einfielen. »Bildungsstand und Einkommen der Eltern. Schulische Leistungen der Geschwister. Alle anderen Q in der Kernfamilie.«
»Hast du auch so eine Q-Zahl?«
»Jeder im Schul- oder Arbeitsalter hat eine. Und sie wird monatlich neu berechnet.« Ich selbst kümmerte mich inzwischen nicht mehr darum. Dass sich meine Zahlen seit der Einführung der Q-Rankings vor ein paar Jahren im hohen Neun-Komma-irgendwas-Bereich bewegten, lag zum Teil an meinen Abschlüssen und zum Teil daran, dass ich als Lehrerin kontinuierlich sehr gute Beurteilungen erhielt. Doch die Annahme, meine Werte ließen sich ausschließlich auf mich selbst zurückführen, war dumm – aufgrund von Malcolms beruflicher Position wurden zweifellos noch ein paar Zehntelpunkte draufgeschlagen, wenn nicht noch mehr. Immerhin zählte er als stellvertretender Bildungsminister praktisch zum Umfeld des Präsidenten.
Oma fummelte an ihrem Hörgerät herum und stellte den Fernseher schließlich lauter. Petra Peller schoss ihre Phrasen wie scharfe kleine Pfeile auf die Zuhörer ab.
… vor allem für die über Fünfunddreißigjährigen …
… je früher, umso besser …
… der Vorgeburtsquotient umfasst alle Informationen, die eine Frau für diese unglaublich wichtige Entscheidung benötigt …
… ehe es zu spät ist …
Während Petra allen werdenden Müttern empfahl, sich für eine kostenlose Beratung durch einen Experten des Genics Institute anzumelden, blinkten am unteren Bildschirmrand eine rote Telefonnummer und die Web-Adresse des Instituts.
»Da hat sie allerdings recht. Niemand weiß, wie das eigene Kind sein wird.« Oma wandte sich vom Fernseher ab und sah mich an. »Aber wenn man nun einen Test macht, bei dem herauskommt, dass das Baby durchschnittlich sein wird –, was heißt das dann? Gibt es nur einen einzigen Maßstab?« Sie hielt ihr Glas leicht schief zwischen den knotigen Fingern. »Als ich vor vielen, vielen Jahren Kunstlehrerin war, da hatte ich eine Schülerin, die es nicht schaffte auszurechnen, wie viel man auf einen Dollar zurückbekam. Aber dafür hatte sie andere Talente. Weißt du, was aus diesem Mädchen geworden ist?«
Ja, ich wusste es. Fabiana Roman hing in jeder Galerie des Landes, besser gesagt: ihre Gemälde. Nach einem Blick auf die Farbspritzer, die einerseits an Jackson Pollock, andererseits an Edvard Munch erinnerten und zusätzlich einen Touch Kandinsky aufwiesen, hatte Malcolm die Bilder einmal als entartet bezeichnet.
»Vielleicht sollte ich den Test machen. Nur so, aus Neugier«, sagte ich und notierte mir Telefonnummer und URL auf einer der Elternzeitschriften auf dem Couchtisch.
Oma riss sie mir aus der Hand.
»Was soll das, Oma?«
»Das ist nicht dein Ernst, Elena! Die Amniozentese leuchtet mir ja noch ein« – sie sprach das Wort ganz vorsichtig aus, um nicht darüber zu stolpern – »aber ein Intelligenztest vor der Geburt? War das Malcolms Idee?«
»Nein.« Eine Lüge.
Natürlich hatten wir über den Test gesprochen, mehrmals sogar, und jede Diskussion hatte damit geendet, dass Malcolm erklärte, die Entscheidung liege bei mir, er werde keinen Druck machen und hinter allem stehen, was ich für richtig hielte. Ich wusste es allerdings besser. Mir war völlig klar, was Malcolm für richtig befand. Ich versuchte, die Sache mit dem Q-Wert meiner Großmutter gegenüber zu rechtfertigen.
»Du weißt doch, dass die Schule heutzutage nicht mehr so ist wie früher, Oma.«
Sie schenkte sich Schnaps nach. »Wie heißt es bei euch Amerikanern? ›Sag mir darüber?‹«
Ich korrigierte den wörtlich aus dem Deutschen übersetzten Satz. »Erzähl’s mir.«
»Dann sag es. Erzähl’s mir.«
»Ich meine, wäre es dir recht, wenn dein Kind eine drittrangige Schule besuchen müsste?«
Während Oma über Rangordnungen und Klassen schwadronierte, klinkte ich mich innerlich aus und konzentrierte mich auf Petras Fernsehinterview. In der Zwischenzeit war eine weitere Frau dazugeschaltet worden, die ich sofort als Malcolms Chefin im Bildungsministerium erkannte.
Madeleine Sinclair ist eine auffällige Figur. Groß, mit hellblondem, fast weißem, zu einem klassischen Chignon hochgesteckten Haar und stets im garantiert maßgeschneiderten figurbetonten stahlblauen Hosenanzug. Im rechten Revers steckt die immer gleiche Nadel, das gelbe Emblem der Kampagne für wertvollere Familien. Das war auch an diesem Tag nicht anders. Aber ihr Gesicht wirkte spitzer, schärfer denn je.
»Früher oder später musste es so kommen«, erklärte Petra dem Moderator. »Wir hatten den Punkt erreicht, an dem das öffentliche Schulsystem die Unterschiedlichkeit der Schüler einfach nicht mehr bewältigen konnte. Ein einheitliches Bildungsangebot war nicht mehr möglich. Ich habe die Einführung des Couponprogramms durch das Bildungsministerium als Chance begriffen, und als fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse benötigt wurden, um den Q-Algorithmus zu optimieren, war mir klar, dass das Genics Institute an vorderster Front stehen würde.«
Oma verstummte. Sie hatte gerade das Glas zum Mund geführt und erstarrte mitten in der Bewegung.
Der Moderator nickte und und wandte sich an die andere Frau. »Dr. Sinclair, Ihre Maßnahmen sind auf ziemlich heftigen Widerstand gestoßen. Können Sie uns dazu etwas sagen?«
Madeleine Sinclair richtete ihre blauen Augen auf die Kamera, so als würde sie nicht dem Interviewer, sondern dem Zuschauer am Bildschirm antworten. Vielleicht sprach sie zu mir, vielleicht zu der alten Frau neben mir. Sie sprach im ruhigen Ton einer erfahrenen Lehrerin, die einem verwirrten Kind etwas erklärt. »Widerstand wird es immer geben, das ist normal. Die Kritik kommt ja hauptsächlich von« – sie lächelte halb verständnisvoll, halb herablassend – »einem ganz bestimmten Lager. Von einem Lager, das dem verbissenen Glauben anhängt, wir seien alle gleich.«
Oma schluckte geräuschvoll.
»Was ist?«, fragte ich.
»Nichts. Ich will mir das jetzt anhören.«
»Der Punkt ist doch – und das müssen die Menschen unbedingt verstehen –, dass wir eben nicht alle gleich sind«, fuhr Madeleine fort. Dann machte sie eine Pause. Als der Moderator das Wort ergreifen wollte, hob sie abwehrend die Hand. »Ich sage es noch einmal: Wir sind nicht alle gleich.« Wieder richtete sie den Blick auf die Kamera. »Ich frage die Eltern unter den Zuschauern: Wollen Sie, dass Ihr Kind mit Schülern in einer Klasse sitzt, die massiv vom Standard abweichen? Mit Schülern, denen die geistige Fähigkeit fehlt, die Anforderungen und Probleme zu verstehen, mit denen sich Ihr fünfjähriges Kind konfrontiert sieht? Und mit Lehrern, die ihre Zeit mit so viel Unterschiedlichem verschwenden müssen, dass letztlich alle – alle! – zu kurz kommen?«
»Sie sagt nicht, was sie wirklich denkt«, murmelte Oma. »In Wirklichkeit fragt sie, ob man will, dass das eigene geniale Kind mit zwanzig normalen Kindern in eine Klasse geht. Die könnten dem kleinen Einstein ja im Wege sein und seinen Fortschritt bremsen.« Sie hackte auf der Fernbedienung herum, traf aber nicht die richtige Taste, sondern erhöhte die Lautstärke noch, während sich Petra und Madeleine zunickten und mit entsprechenden Floskeln gegenseitig bestärkten. »Die beiden sind böse, Liebchen. Ah, da ist mein Taxi. Wenigstens kann ich noch hören.«
Der Fahrer, der Oma zu meinen Eltern zurückbringen sollte, hupte ein zweites Mal. Ich begleitete sie zur Tür. Die Abschiedsumarmung fiel anders als sonst aus – ihre Hand, die früher immer fest und warm an meinem Rücken gelegen hatte, fühlte sich leicht an, und sogar bei der Umarmung selbst blieben wir auf Distanz. Ich ignorierte den Sirenengesang des Glases, das halb voll auf dem Couchtisch zurückgeblieben war, und goss den Inhalt in die Küchenspüle. Dann ging ich zum Fernseher zurück.
Jetzt sprach wieder Petra und erzählte uns allen, dass ihr Erfolg allein auf der Kampagne für wertvollere Familien beruhe. »Eine Graswurzelbewegung wurde durch den Schneeballeffekt größer und größer!«
»Wuchs lawinenartig an« hätte es besser getroffen. Irgendwo in der Mitte des Landes hatte es begonnen, auf der riesigen Fläche aus früheren Dust Bowls und Ackerland. Irgendwo unter den Salonkommunisten in Boston und San Francisco hatte es begonnen. In irgendwelchen Vorstadtwohnzimmern, in denen sich Mittelschichtsmütter treffen und sich ihre Geschichten von entzündeten Brustwarzen und schlaflosen Nächten erzählen, hatte es begonnen. Und es hatte sich verbreitet. Hatte wie ein Virus mutiert, sich verdichtet und verdoppelt. Wenige einzelne Stimmen waren zu einem Chor angeschwollen, der nach Bildungsreformen schrie. Nicht irgendwelche speziellen Programme würden in den Schulen benötigt, behaupteten sie, sondern mehr Wille zur Leistung, mehr Einsatz, die verstärkte Einsicht, dass Finanzspritzen keine Probleme lösten.
Das Motto Eins für alle sei nicht mehr zeitgemäß.
»Eine Veränderung des Systems kann aber nur gelingen, wenn sich die Menschen verändern, aus denen das System besteht«, fuhr Petra Peller fort. »Und hier kommt das Genics Institute ins Spiel.«
Sie hatte recht. Zehn Jahre nach Gründung der Kampagne für wertvollere Familien fanden in sämtlichen Bundesstaaten Babywettbewerbe statt. Zwar aus jeweils unterschiedlichen Motiven, aber immer getragen von einer widerlichen Solidarität. Der Mittlere Westen hatte die sogenannten unterprivilegierten Kinderreichen satt. Die Bostoner Hautevolee forderte Schulen, die sich vor allem auf ihre Wunderkinder konzentrierten (obwohl sogar die Salonkommunisten Bedenken wegen der Überbevölkerung äußerten – nur eben in ihren Penthouse-Salons). Die Babybrigade sorgte sich wegen Allergien, Autismus und einer stetig wachsenden Liste von Syndromen. Alle wollten etwas Neues, eine Lösung, die Möglichkeit, sich in einem Land, dessen Bevölkerungszahl schon in der nächsten Generation sprunghaft ansteigen würde, ihr kleines Stück vom menschlichen Kuchen zu sichern.
Es dauerte nicht lange, bis die Leute »zur Vernunft kamen«, wie mein Mann zu sagen pflegt. Selbstverständlich machten die tief greifenden Veränderungen im Bildungssystem Zugeständnisse seitens der Gesellschaft erforderlich. Plötzlich wussten es nicht mehr die Eltern am besten, sondern Verwaltungsbeamte. Und wenn es darum ging, die Schüler zu prüfen und ihnen die passende Schule zuzuweisen, hatte die Bundesregierung das Sagen. Solange sich die werdenden Eltern den vorgeburtlichen Vorsorgemaßnahmen unterzogen, war alles gut.
Taten sie das nicht, erwartete sie das in drei Rangstufen gegliederte Schulsystem für die Besten, die Besseren und die Mittelmäßigen.
Als hätte ich ihr eine Frage gestellt, die sie mir unbedingt persönlich beantworten wollte, kam Madeleine wieder ins Bild. »… sind die Staatsschulen wie gesagt für diejenigen jungen Leute dieses Landes da, die zusätzliche Förderung benötigen – und auch verdienen. Bitte sehen Sie das nicht so, als wollten wir Ihnen Ihre Kinder wegnehmen. Betrachten Sie es als eine Chance zur Entfaltung, die wir Ihren Kindern bieten.« Sie nickte in Richtung Publikum – eine typische Geste von ihr. »Wer im Frühling Blumen haben will, sorgt für die beste Erde, die er bekommen kann. Genau darum geht es bei den Staatsschulen.«
Ich schaltete den Fernseher aus und dachte wieder an meine Oma. An ihre Reaktion, ihren hastigen Aufbruch, die halbherzige Umarmung. Vielleicht hatte sie recht. Vielleicht waren diese Leute wirklich böse.
Doch böse oder nicht, sie waren die Gewinner. Sie brüllten und schrien nach einer strikteren Anti-Einwanderungspolitik und wählten entsprechend. No Child Left Behind, das Gesetz zur Verbesserung der öffentlichen Schulen, wurde von ihnen ebenso niedergestimmt wie der Disabilities Education Act zur Regelung der Bildung von Menschen mit Behinderung. Dabei waren sie durchaus bereit, den sozial und gesundheitlich Benachteiligten unter die Arme zu greifen. Sie wollten sie nur nicht mit ihren eigenen Kindern im selben Klassenzimmer haben.
Sie wussten nicht, was ich heute weiß: Das Übel, das man mit der Wurzel ausreißt, wächst trotzdem nach. Als den Sarah Greens dieser Welt die Entwicklung endlich klar wurde, waren das dreirangige Schulsystem und die Q-Rankings längst Gesetz.
Ich blicke aus dem Fenster. Freddies grüner Bus fährt im strömenden Regen los. Hätte ich vor zehn Jahren alles anders gemacht, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß?
5
DAMALS:
Es war im vierten oder fünften Monat meiner Schwangerschaft mit Freddie – in der Phase, als es schon kniff, wenn ich meine Jeans zuknöpfte. Die Zeit der heftigen morgendlichen Übelkeit war zum Glück vorbei. Wochenlang hatte ich nur trockenen Toast gegessen, um nicht jedes Mal sofort in die Gästetoilette rennen zu müssen. Damals kam es zu dem Gespräch zwischen Malcolm und mir, das schon seit Längerem wie eine Schüssel mit unappetitlichen Essensresten zwischen uns gestanden hatte.
»Wir haben es ja bereits besprochen, El«, sagte er, als ich ins Wohnzimmer zurückkam, nachdem ich Anne ins Bett gebracht hatte. Jetzt waren wir unter uns und konnten reden wie Eheleute und Lebenspartner. Nur dass ich mich schon seit geraumer Zeit nicht mehr wie eine Partnerin fühlte. »El?«
»Ja, ich weiß.«
»Und wann machst du es?«
Es.
Dieses kleine Wort umfasst alle möglichen Sünden vom Fummeln im Auto nach dem Highschoolball über das Einschläfern des alten, leidenden Hunds bis hin zu der Operation, bei der man einen Fötus aus dem Bauch der Mutter herausholt. Sex, Euthanasie, Abtreibung. Lässt sich praktischerweise alles mit dem Wort es bezeichnen.
Das Gespräch nahm zahlreiche Wendungen, kehrte immer wieder zum Ausgangspunkt zurück, drehte sich letztlich im Kreis. Nach einer Stunde war Malcolm keinen Millimeter von seiner Position abgewichen. Im Grunde hatte er mich immer nur daran erinnert, dass wir bereits besprochen hätten, wie äußerst egoistisch es wäre, ein Kind in die Welt zu setzen, das sich mühsam und unter großem Leid auf ein in Wahrheit nie erreichbares Level hinaufzukämpfen versuchte. Er malte mir die Zukunft aus, sprach von Q-Werten und von den Leuten, die über die Zulassung zum College entschieden. Ein Mädchen mit einem Quotienten unter dem Durchschnitt wolle wirklich niemand.
»Dann steht sie mit leeren Händen da«, prophezeite er. »Oder sie wird wie dieser Junge, der dir damals in der Schule immer hinterhergelaufen ist, dieser Jack.«
»Joe. Das war aber ein ganz Lieber.«
»Lieb zählt nicht mehr, El. Jetzt zählt Q, und das weißt du.«
Ja, ich wusste es, aber ich hätte es lieber nicht gewusst. Ich wollte nicht an Joe und an all das denken, was danach geschah. Ich wollte nicht an weitere Tests, Q-Werte und die Möglichkeit denken, so etwas noch einmal zu tun.
Malcolm stand auf und trug das restliche Geschirr in die Küche. Die Diskussion war beendet. Ich saß allein da und ging die lange Liste mit Schwangerschaftsdienstleistungen auf den Rückseiten der Broschüren über Q-Tests durch, während Malcolm, der doch angeblich in guten wie in schlechten Zeiten mein Partner war, mit dem Rücken zu mir das Geschirr vorsterilisierte.
Am nächsten Vormittag fuhr ich zur Schwangerschaftsberatung des Genics Institute. Das war lange vor Beginn des ProFemina-Programms, lange ehe Petra Peller das Ganze einen Riesenschritt weitertrieb. Vor den grün und gelb gestrichenen Wänden saßen etwa zwölf Frauen. Die satten, sonnigen Töne brachten die Plakate mit den Abbildungen perfekter Familien – perfekte Haare, perfekte gebleachte Zähne, perfekte Haut – gut zur Geltung. Nirgendwo waren Babyfotos zu sehen, nur Bilder von größeren Kindern, und mir fiel auf, dass die üblichen Faltprospekte der Milchpulver- und Windelhersteller fehlten.
Von der Raumausstattung bis zum Lesestoff zielte alles auf Frauen ab, die nie einen Fuß in einen Kreißsaal setzen würden.
Und dann die Gespräche:
»Sollte der Q-Wert auch nur einen Hundertstelpunkt unter fünf Komma fünf liegen, lasse ich es wegmachen«, erklärte eine blasse Frau hinter ihrer Maske aus perfektem Make- up. »Habe mich beim letzten Mal auch so entschieden.«
»Nur gut, dass es inzwischen wirklich fix geht«, warf die Mittzwanzigerin neben ihr ein. »Wäre toll, wenn Maniküren auch so schnell erledigt wären!« Sie lachten.
Während sie Telefonnummern und Mailadressen austauschten, weil ihre fünfjährigen Überflieger unbedingt bald mal zusammen spielen mussten, wurde die Tür hinter der Rezeption geöffnet. Eine Frau betrat den Raum, deren Schwangerschaft schon ziemlich weit fortgeschritten war. An ihren üppigen Busen presste sie einen Umschlag. Ihr Gesicht wurde von feinen grauen Löckchen umrahmt, und an den Mundwinkeln zeigten sich zarte Fältchen. Mindestens vierzig, dachte ich. Ms. Make-up und Ms. Maniküre musterten sie von Kopf bis Fuß und sahen ihr nach, als sie eilig durch die Tür zur Straße verschwand.
»Was hat die sich dabei gedacht?«, sagte Ms. Make-up. »In diesem Alter!«
»Wenn ich älter als fünfunddreißig wäre, würde ich es nicht mal versuchen«, erwiderte die andere. »Völlig ausgeschlossen.«
»Angeblich ist man inzwischen schon mit dreißig zu spät dran. Neulich habe ich einen Artikel gelesen, in dem …«
»Ja, den habe ich auch gelesen. Aber der war mir zu wissenschaftlich.«
Ich kannte den Artikel ebenfalls. Malcolm hatte mir das Magazin eines Abends aufgeschlagen aufs Kopfkissen gelegt. Ein dezenter Hinweis zum passenden Zeitpunkt, denn an jenem Abend hatten wir nach dem Essen wieder einmal über den geometrischen Rückgang des Q-Werts von Babys bei zunehmendem Alter der Mutter gesprochen.
Die beiden Frauen unterbrachen ihr Gespräch, um mich in Augenschein zu nehmen. Blicke wurden ausgetauscht, Lippen gespitzt. Ich konnte die Gedanken förmlich lesen: So ein Pech aber auch! Wird es wohl nicht behalten dürfen. Die kratzt auch schon an der Fünfunddreißig. Oder es gibt andere Schwierigkeiten. Ganz zu schweigen vom D-Wort.
Zu den wenigen Problemen, die noch stärker ins Gewicht fielen als ein niedriger Q-Wert, zählten Trisomien. Sie galten als kaum zu überbietende Katastrophe, allen voran das Downsyndrom.
Als ich von der Arzthelferin aufgerufen wurde, geschah etwas. Mein Baby, dieser kleine werdende Mensch, dem ich schon einen Namen gegeben hatte, den ich liebte und mit den alten Wiegenliedern meiner Großmutter in den Schlaf sang, bewegte sich tief im Inneren meines rundlichen Bauchs. Ich dachte: Du kannst mir gestohlen bleiben, Natur! Fürsorge zählt mehr. Und in Sachen Fürsorge hatte ich nicht wenig zu bieten.
Ich machte kehrt und ging denselben Weg hinaus, den ich gekommen war. Verschwand mit meinem achtzehn Wochen alten zukünftigen Baby, aber ohne die magische Zahl im Umschlag und ohne die Mappe, in der mir eine Entscheidung nahe gelegt worden wäre, die eher Malcolms als meiner Haltung entsprochen hätte. Danach suchte ich zwei Stunden lang nach Google-Bildern von vorgeburtlichen Q-Gutachten und fälschte den Wert, den ich meinem Mann vorlegen wollte. Ich entschied mich für eine neun Komma drei in silberfarbener Schrift. Ein guter Wert. Ein schöner Wert. Und die erste richtige nach ziemlich vielen falschen Entscheidungen.
6
Als ich auf unserer Zufahrt stehe, mit der Scheibenwischerbedienung des Acura kämpfe und den schon seit Monaten defekten Entnebler verfluche, hupt der gelbe Bus. Er klingt anders als die silbernen und grünen Busse, die eher einen leisen, wenn auch durchdringenden Ton von sich geben. Die Hupe des gelben Busses geht durch Mark und Bein. So als würde man gemütlich auf dem Highway dahinfahren, einen Top-Forty-Hit oder einen Popklassiker summen, und plötzlich lässt ein Sattelschlepper – fast immer nur aus Jux und Tollerei – seine Hupe dröhnen.
Der gelbe Bus macht es allerdings aus einem bestimmten Grund.