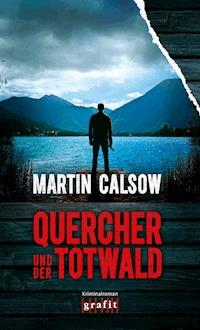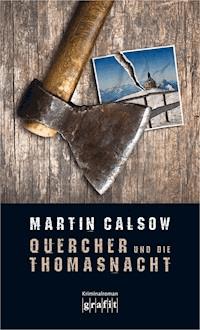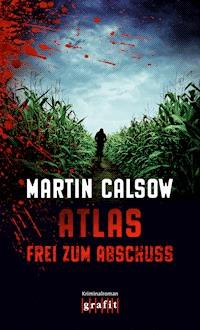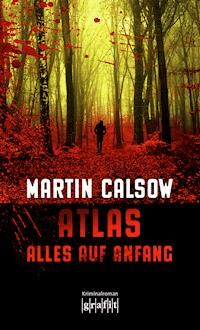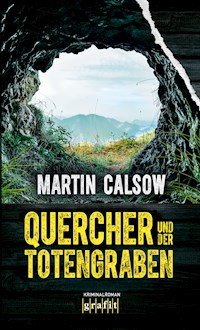9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRAFIT
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Quercher
- Sprache: Deutsch
Die dunklen Machenschaften der Pharmaindustrie – sein vierter Fall treibt Max Quercher an den Rand des Wahnsinns … Die Familie der Pharmaerbin Nina Poschner wird massiv bedroht. Die Polizei vermutet das Motiv für die Übergriffe zunächst in Ninas Engagement, am See ein Internat für Migrantenkinder zu etablieren. Doch als der LKA-Beamte Max Quercher herausfindet, dass seine ehemalige Schulfreundin vor Jahren in Afrika dubiose Testreihen für ein Mittel gegen Cholera zu verantworten hatte und dafür den Tod von Menschen billigend in Kauf nahm, beginnt er, an Ninas edlen Motiven zu zweifeln. Allerdings steht auch seine eigene Glaubwürdigkeit auf dem Prüfstand, da er zunehmend an Wahnvorstellungen und Panikattacken leidet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Martin Calsow
Quercherund das Seelenrasen
Kriminalroman
Mehr mit Max Quercher:
Quercher und die Thomasnacht
Quercher und der Volkszorn
Quercher und der Totwald
Außerdem von Martin Calsow:
Atlas – Alles auf Anfang
© 2016 by GRAFIT Verlag GmbH
Chemnitzer Str.31, 44139 Dortmund
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagfoto: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/haraldmuc (See und Steg), LUISHENGFILM (Bäume)
Der Autor
Martin Calsow wuchs am Rande des Teutoburger Waldes auf. Nach seinem Zeitungsvolontariat arbeitete er bei verschiedenen deutschen TV-Sendern. Er gehört der Jury des Grimme-Preises an und lebt heute mit seiner Frau am Tegernsee und in den USA.
Quercher und das Seelenrasen ist der vierte Band einer Serie, in der der sperrige LKA-Beamte Max Quercher im Fokus steht. Mit Atlas – Alles auf Anfang erschien zudem der erste Band einer Reihe um den schweigsamen, leicht autistischen Undercover-Ermittler Andreas Atlas. Weitere Titel beider Reihen sind in Planung.
www.martin-calsow.de
»De Woch fangt scho guat o«
Mathias Kneißl bei der Verkündung
Prolog
Oberhalb des Tegernsees, jetzt
Die Hütte lag am Hang des Ringspitzes. Eine Grünfläche, schwer zu bewirtschaften, zog sich bis in die weiter unten liegenden Feuchtwiesen des Tales hinein. Das war eine Landschaft, wie er sie liebte. Was immer da unten im Tal schon an Hass und Wahnsinn geherrscht hatte und weiter herrschen würde, hier oben blieb alles, wie es war – man sah einfach beim Wachsen und Vergehen zu. Bald würde es wieder nach Schnee riechen.
Quercher wartete auf den Nebel. Wie eine große Bettdecke würde er sich über das Tal legen, jedes Geräusch dumpfer, ferner klingen lassen. Er aber würde, auf über neunhundert Metern, über diese Decke hinwegschauen können. Richtung Osten, wo die Sonne über dem Baumgartenschneid aufstieg.
Inversionswetter war typisch für diese Jahreszeit. Der warme Föhn von Süden sorgte für wärmere Luftschichten in der Höhe, während es unten im Tal kälter blieb. Seit seiner Kindheit hatte er diese Wetterlage in den Alpen gemocht. Befand man sich oberhalb der Nebeldecke, fühlte man sich auf eine sonderbare Weise von all den Mühen und dem Ärger der Menschen getrennt.
Quercher hörte in die Stille, vernahm weit entfernt das Rufen eines Steinadlers. Er suchte den Morgenhimmel nach dem Vogel ab, nur zwei wild flatternde Krähen über den Wipfeln der Fichten.
Er würde sich den Stuhl aus der Hütte nehmen und vor die Tür stellen. Das knusprige Brot mit Butter bestreichen, Schnittlauch darüber streuen und ein Bier öffnen. Wenn er alles gegessen und getrunken hätte, würde er das Geschirr in die Küche der kleinen Behausung zurückbringen, es spülen und im Schrank verstauen, wieder hinausgehen und sich auf den Stuhl setzen.
Kapitel 1
München, im Oktober
Während Diara Poschner hinauf zur Decke des Gewölbes sah, dachte sie an ihre Zukunft. Fern jeder Arbeit mit Migranten und den immerwährenden Fragen, die man als Schwarzhäutige mit bayerischem Dialekt in diesem Land zu hören bekam. Sie war müde und erschöpft. Aber keiner sollte und vor allem wollte es wissen.
Sie atmete ein. Sie atmete aus. So wie es ihre Therapeutin ihr geraten hatte. In diesem prachtvollen Saal der Münchner Residenz mit seinen Deckenmalereien, umgeben von den Vertretern der bayerischen Elite, war sie nur eine unter vielen Frauen, die ein Dirndl trugen. Es stand ihr, fand sie. Sie hatte die Figur dazu, hatte ihre Mutter, die links von ihr saß, am Morgen im Vorbeigehen gesagt.
Einatmen. Ausatmen.
Die gesamte Familie Poschner saß in der ersten Reihe. Einmal im Jahr wurden hier Menschen geehrt, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht hatten. Das konnte im Verständnis der Staatsregierung ein Lebensretter sein, aber auch ein langjähriger Speichellecker der amtierenden Regierung. Somit stellte dieses Panoptikum aus ehrlichen Helfern und den üblichen Hofschranzen, die nach einem Dekoelement für die Brust hechelten, einen Querschnitt der bayerischen Gesellschaft dar.
Einatmen. Ausatmen.
Einige ältere Herrschaften konnten sich das Stieren nicht verkneifen. Denn Diara Poschner trug zwar die Tracht der Einheimischen, war aber pechschwarz wie die meisten Menschen aus Nigeria. Eindeutig zu dunkel für die vielen politisch Schwarzgefärbten im Antiquarium der Münchner Residenz. Diara würde heute vom Ministerpräsidenten persönlich den Bayerischen Verdienstorden entgegennehmen. Das war angesichts ihres Alters ungewöhnlich. Aber sie hatte, seit sie in Deutschland lebte, ihre Freizeit der Arbeit mit Flüchtlingen gewidmet, Migranten die deutsche Sprache gelehrt und vornehmlich Westafrikaner betreut. Das allein hätte dem Landesvater, der sie jetzt aufmunternd anschaute, nicht gereicht. Engagierte Bürger gab es viele in Bayern. Aber Diara hatte Besonderes geleistet. Sie war die Einzige gewesen, die vor einem Jahr beim Brand eines Aufnahmelagers in Miesbach Ruhe bewahrt, die Eingeschlossenen durch einen Kellerweg hinaus ins Freie und sie damit vor dem sicheren Tod bewahrt hatte. Diara war eine Heldin, wurde durch Talkshows gereicht und war selbst nach dem Abebben des Interesses immer noch der Stolz der Familie Poschner.
Auch ihre Mutter trug ein Dirndl. Ebenso waren ihr Vater und ihr Bruder in Tracht erschienen. Neben der Familie saß der Landrat, sichtlich bemüht, auch etwas vom Glanz, der auf Diara fiel, abzubekommen. Schon in der Pause würde ein Selfie von den beiden auf seiner Facebook-Seite stehen.
Der Ministerpräsident begann mit seiner Rede.
Einatmen. Ausatmen.
»Sehr geehrte Ordensträgerinnen und Ordensträger, ein Sprichwort sagt: Ehre folgt dem, der sie flieht, und flieht den, der sie jagt. Sie erhalten heute die höchste bayerische Ehrung, weil Sie erfolgreich angepackt haben. Sie handeln, weil Sie Verantwortung übernehmen.«
Für den Franken am Rednerpult waren Ordensverleihungen ein einziges Fest. Sein Leben lang hatte der einstige Rundfunkredakteur aus Nürnberg davon geträumt, ganz oben zu stehen. Er dachte in Bildern, war sich der Kraft des Visuellen bewusst. Zumindest betonte er das immer, wenn er mit seinen Speichelleckern zusammensaß. Umso mehr freute er sich, als er nach seiner Rede den Orden an Diaras Dirndl heften durfte und es schaffte, nicht zu lange in das Dekolleté zu sehen. Es wurde applaudiert, Handys wurden hochgehalten, Fotoapparate klickten, und wenig später gab der Herr Ministerpräsident wohlmeinende und gütige Interviews im Foyer.
Die Poschners standen zusammen, lachten, beantworteten Fragen von anderen Ordensträgern und genossen die Aufmerksamkeit. Sie waren so glücklich, dass sie das Zischen eines Gastes ganz in ihrer Nähe nicht hörten. Es war ein im tiefsten Bayerisch formuliertes »Nägagschwerl, elendigs! Schleicht’s eich«.
Kapitel 2
Tegernsee, zwölf Stunden später
Als sich die Jalousie geöffnet hatte, konnten sie vom Bett aus den glitzernden See und das Bergpanorama sehen. Sie schliefen bei offenem Fenster. Die Nächte waren zwar schon kalt, aber tagsüber würde die Sonne das Tal immer noch auf Temperaturen im zweistelligen Bereich erwärmen.
Sie hatten ein Ritual. Er stand auf und machte den Kaffee. Kam kurze Zeit später mit zwei Tassen, Bananen und der Zeitung zurück ins Schlafzimmer und begann zu singen. Sie stimmte nicht in das abgeschmackte Guten Morgen, Sonnenschein von Nana Mouskouri ein. Er hingegen freute sich. Es war ihm egal, ob die Kinder, die sich noch müde in ihren Betten wälzten, die Augen rollten. Oder was die Nachbarn sagten, die es durch das offene Fenster bestimmt hören konnten. Ihr Anwesen lag hoch oben auf der Ostseite des Tegernsees. Nicht weit von ihnen wohnte der Torwart eines Fußballvereins. Ihr Sohn kannte ihn.
Für Nina und Jan Poschner hatte das keine Bedeutung. Ihr Leben hatte mit dem der normalen Menschen nichts mehr gemein. Heute war ein freier Tag für sie. Sie konnten die Zeit im Bett verbringen. Die Kinder würden allein frühstücken.
Wie immer würde der Sohn nicht von allein aus seinem Zimmer kommen. Finn konnte ganze Tage im Bett verbringen. Nur wenn es um seinen geliebten Sport, das Speerwerfen, ging, war er hellwach. In der Doppelgarage des Hauses hatte er sich eine eigene Werkstatt eingerichtet. Er bastelte Wurfspeere vergangener Epochen nach, machte sich dafür bei örtlichen Kunstschmieden kundig und hatte es bereits zu einer beachtlichen Sammlung gebracht.
Er war siebzehn Jahre alt und schon jetzt einen Kopf größer als sein Vater. Mit seinen strohblonden Haaren, seinem muskulösen Körper und seinen markanten Gesichtszügen hatte er Dutzende Verehrerinnen am Gymnasium in Tegernsee gehabt. Im Juni hatte er sein Abitur gemacht, aber statt eines sofortigen Studienbeginns wollte er noch ein halbes Jahr ›chillen‹, wie er es nannte. Die Eltern waren darüber nicht besorgt. Früher hatte man sich nach dem Abitur mit Interrail auf Reisen begeben, heute gab es eben die ›Chill-Phase‹. Ende Oktober würde Finn in die USA gehen und an einer Universität in Texas ein Sportstudium beginnen. In sechzehn Tagen würde er in die USA fliegen.
Seine Adoptivschwester Diara war den Poschners in einem Waisenhaus in Nigeria aufgefallen. Sie hatten die Kinder dort ärztlich betreut. Diaras Überlebenschancen waren schlecht. Eine seltene Viruserkrankung hatte sie befallen. Die Poschners hatten alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um das Leben des kleinen schwarzen Bündels zu retten. Warum sie ausgerechnet bei diesem Mädchen so viel Engagement gezeigt hatten, konnten sie später niemandem erklären. Heute war aus dem einst Blut hustenden Kind eine hochgewachsene junge Frau geworden, die in München Kunst und Afrikanische Geschichte studierte.
Trat sie mit ihrem Bruder in der Öffentlichkeit auf, wirkten sie wie die Protagonisten eines Videos der UN zum Thema Vielfalt. Die beiden waren schön, jeder auf seine Weise, und gemeinsam hatten sie erst recht eine unglaubliche Wirkung. War Finn eher zurückhaltend, plapperte Diara wie ein Wasserfall – in tiefstem Bayerisch. Zudem hatte sie schon früh Aufgaben übernommen, für die sie eigentlich noch zu jung war. Auch das Aufpassen auf Bembo, den Labrador der Familie, fiel in ihre Zuständigkeit, zumindest dann, wenn sie wie heute nicht in ihrer Münchner WG, sondern im Haus der Eltern am Tegernsee übernachtete.
Kopfschüttelnd ging sie an diesem Morgen am Schlafzimmer ihrer Eltern vorbei, aus dem das aufgekratzte Trällern des Vaters zu hören war, und drehte mit dem Hund eine Runde auf dem nicht weit entfernten Höhenweg.
Es war noch nicht einmal acht Uhr, als Diara über den Garten zum Haus zurückkam. Es war ihr, als sei an dessen Nordseite ein Schatten vorbeigehuscht. Aber Bembo, sonst immer hellwach, schlug nicht an, als sie ihn von der Leine ließ. Stattdessen galoppierte er über den Rasen hinauf zu der großzügigen Terrasse. Diara sah, wie er sich schwanzwedelnd über etwas hermachte. Dann bemerkte sie ihren Vater im Pyjama auf dem Balkon.
»Habt ihr Bembo schon etwas in den Napf gegeben?«, rief sie.
Ihr Vater streckte die Arme von sich. »Ich darf nur deine Mutter versorgen.«
Diara rannte über den Hang hinauf zur Terrasse, wo der Hund an etwas Rotem leckte.
»Aus, Bembo! Was ist das?«
Diara schaute genauer hin. Einem Presssack gleich lag etwas Fleischiges in der Metallschüssel, aus der der Hund normalerweise sein Futter fraß.
»Papa, komm mal bitte. Da ist was Ekliges im Napf vom Bembo.«
Jan Poschner seufzte, ging ins Schlafzimmer zurück, schlüpfte in seine Pantoffeln, warf den Bademantel über und machte sich auf in Richtung Terrasse. Im Vorbeigehen klopfte er an die Tür seines Sohnes. »Soll ich für dich singen?«
»Nein, bitte nicht«, kam es schrill zurück.
Jan Poschner erreichte grinsend die Terrassentür, ließ die Jalousien elektrisch nach oben gleiten und sah, wie seine Tochter mit angewidertem Gesicht den Hund am Halsband zurückhielt.
»Ein totes Tier, Diara?«
»Glaub nicht.«
Wieder ächzte er, ehe er sich über den Napf beugte.
Es dauerte vier, vielleicht fünf Sekunden, bis er begriff. Jan Poschner bat seine Tochter leise, mit dem Hund sofort ins Haus zu gehen und die Mutter aus dem Bett zu holen. Als sie nicht sofort reagierte, schrie er sie an. Wie er noch nie geschrien hatte.
Er war Mediziner. Er hatte keine Zweifel. Die Nussschalen neben dem Napf hatte er schon einmal gesehen.
Aber das allein war es nicht. Es war die Kombination mit dem Inhalt des Napfes. Vor ihm lag kein totes Tier. Vor ihm lag ein Fleischklumpen, blau und rot gefärbt, an dessen Oberhaut noch kleine Fetzen hingen.
Woher auch immer sie stammte, es war eine Niere.
Kapitel 3
Tegernsee, neun Tage später
Blechmusik ist das Bundesland Bayern unter den Musikstilen. Laut, fast nie dezent und noch seltener virtuos. Den Beweis dafür trat gerade Max Querchers Nichte Maxima mit dem Schulorchester des Gymnasiums Tegernsee an.
Quercher saß neben seiner Freundin Regina von Valepp und litt. Geige, das wäre natürlich noch schlimmer. Aber seine von ihm heiß geliebte Nichte und ihr Saxofon würden nie Kumpel werden, fand er. Auch wenn Regina meinte, er könne das ob seines eigenen limitierten musikalischen Talents nicht wirklich beurteilen. Als er seinen Unmut leise äußerte, während der fade Direktor der Lehranstalt eine Rede hielt, zischte sie ihn an: »Für jemanden, der nur Wasserhahn heiß und kalt spielen kann, solltest du dich mit der Beurteilung von Instrumentenbeherrschung zurückhalten!«
»Klar! Nur weil Frau Blaublut am häuslichen Piano ihre Fingerfertigkeit beweisen musste …«
Sie sah ihn mit jenem Blick einer Frau an, der einem klugen Mann in der Regel zu verstehen gab, dass er zu weit gegangen war.
»Komm, Clara Schumann. Gib mir einen Kuss.«
»Nicht hier.«
»Unbedingt.«
Sie hielt ihm ihre gespitzten Lippen hin.
»Warum halten die alle ihre verdammten Handys hoch?«, fragte Quercher.
»Die sind stolz auf ihre Kinder!«
»Kann ich nicht nachvollziehen. Fotografiere ich etwa meine Leichen?«
»Dafür gibt es keinen Grund, die hast du ja auch nicht selbst gemacht!«
Regina hatte es geahnt, Quercher und Schulveranstaltungen waren keine gute Kombination. Er hasste die, wie er fand, aufgesetzte Herzlichkeit der Lehrkräfte und die hysterische Aufregung der Eltern, nur weil ein paar pickelige Pubertierende sich ungeschickt an Instrumenten versuchten, die zuweilen weitaus größer waren als sie selbst.
»Keine Sau schaut sich diese Videos später noch mal an, weil niemand mehr verwackelte Videos von den Kindern, geschweige denn von sich selbst, sehen will! Warum also können die nicht einfach nur ruhig zuhören?«
Regina verdrehte resigniert die Augen und schüttelte den Kopf.
Neben ihr saß Maximas Mutter, Querchers Schwester Anke, und filmte ebenfalls. Vor ihr schluchzte leise eine Frau in einem sündteuren Janker vom besten Trachtenladen in Rottach.
Quercher deutete auf sie. »Was hat die denn? So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht.« Er stieß den deutlich jüngeren Mann neben der weinenden Dame an. »Jetzt beruhigen Sie Ihre Frau Mutter doch mal.«
Der drehte sich entrüstet um. »Das ist meine Frau!«
Regina stöhnte und hielt sich eine Hand vor die Augen.
Die tränenüberströmte Frau erklärte sich. »Ich bin Spätgebärende. Und das da vorn, das ist der Lasse. Ich bin so stolz, verstehen Sie?«
Da soeben die Veranstaltungspause angesagt wurde, kam Quercher um eine Antwort herum. Stattdessen bahnte er sich mit Regina einen Weg durch die Menschenansammlung und versuchte, vor die Tür des Barocksaals zu gelangen.
Jemand tippte auf seine Schulter. Er erkannte die Frau sofort. Groß, dunkle lockige Haare, braun gebrannt, auffällige Oberweite.
»Hallo!«
Regina drehte sich neugierig um und zog abschätzend die Augenbrauen hoch.
»Regina, das ist, äh … Nina Poschner. Nina, das ist Regina, meine Freundin.« Noch im selben Augenblick ärgerte er sich über die alberne Formulierung.
»Ja, wir gehen jetzt miteinander«, ätzte Regina sofort. »Er hat mir einen Zettel im Religionsunterricht rübergeschoben: Willst du mit mir gehen?«
»Ach, macht er das immer noch so? Das hat er schon bei mir versucht«, erwiderte Nina.
»Ach ja? Ist bestimmt schon lange her«, lächelte Regina mit einem preisverdächtigen Krokodil-Lächeln.
Auch Frauen beherrschen das Markieren ihrer Reviere. Man ging dann besser, fand Quercher. Um ein drohendes Wortgefecht zu umgehen, zog er Regina zum Stand für Erfrischungen.
»Ein Häppchen?«, fragte er so sanft wie möglich.
»Eher einen Schierlingsbecher. Wer ist noch einmal die ›Äh, Nina‹?«
Ehe Quercher antworten konnte, sah er Pollinger und Arzu auf sie zukommen. Ein Paar mit einem Altersunterschied wie Johannes Heesters und Simone Rethel.
Morgen würde für zwei Wochen Ruhe in sein Leben einkehren. Regina hatte Anke, Arzu, die Freundin von Querchers Kollegen Picker und deren drei Kinder in die USA eingeladen. Fern der Männer wollten sie einen ›Frauenurlaub‹ in Reginas Ferienhaus machen. Quercher war das nur recht. Er war gern allein. Aber seit Pollinger und Arzu sowie Anke mit Maxima in direkter Nachbarschaft lebten und Regina quasi dauerhaft bei ihm wohnte, war er kaum noch für sich. »Terror durch Beglückung« hatte er das einmal genannt und sofort böse Blicke geerntet.
»Hast du schon gepackt, Regina?«, fragte Arzu, die angesichts der bevorstehenden Reise sichtlich aufgeregt war.
»Ich habe die meisten Sachen schon drüben, aber wir können zusammen in einem Outlet shoppen gehen und …«
Quercher knipste sich mental aus dem Gespräch aus und sah stattdessen zu Pollinger.
»Was hast du in den nächsten Tagen vor, so als Strohwitwer?«, fragte der ihn.
»Picker und ich wollen über die Blauberge zur Gufferthütte wandern und uns da die etruskischen Steinritzereien anschauen.«
»Schön, das sind aber keine etruskischen …«
»Klar, dass du ausgerechnet hier in der Schule den Streber geben musst, Ferdi!«
Querchers Blick fiel auf Nina, die sich wenige Meter von ihnen entfernt mit einem Elternpaar unterhielt. Sie trug eine enge Jeans, die den Hintern fantastisch betonte, und eine ebenso enge Lederjacke, die den Rest …
»Hörst du mir zu?«, fragte Pollinger scharf und verfolgte Querchers Blickrichtung. »Nina Poschner, reiche Pharmaerbin. Du hast einen Hang zu reichen Frauen, mein Lieber.«
Quercher seufzte. »Schauen heißt nicht begehren.«
»Sagt wer?«
»Platon!«
»Als ob du Platon zitieren könntest!«
»Weise reden, weil sie etwas zu sagen haben. Toren sagen etwas, weil sie reden müssen«, trumpfte Quercher auf.
»Woher hast du das denn?«, fragte Pollinger erstaunt.
»War der Abiturspruch unseres Jahrgangs.« Regina hatte sich umgedreht und Quercher ein Lachshäppchen in den Mund gesteckt.
»Fährst du uns morgen alle mit dem Wagen zum Flughafen?«, fragte Arzu.
Quercher nickte. »Ich will ja sehen, dass ihr auch wirklich einsteigt«, erklärte er mit vollem Mund.
Dann fiel sein Blick auf die Gruppe der heimischen Politikergarde. Der Dicke, der Kleine, der Bemühte und der wandelnde Aktenordner hatten sich an einem Stehtisch versammelt. Sie alle hatten das Glück, in einer der reichsten Regionen Deutschlands die Bürgermeisterkette tragen zu dürfen. Die Vier waren froh, ihren Amtskollegen aus Bad Wiessee nicht in ihrer Runde zu haben. Denn der gehörte nicht ihrer Partei an und war auch sonst ihrer Ansicht nach schnell überfordert. Außerdem konnten sie ohne ihn besser die üblichen Absprachen treffen. Die Jungen unter ihnen hofften immer auf eine zweite Amtszeit, weil ihnen das eine Pension sicherte. Andernfalls müssten sie in ihre vorherigen Berufe zurück, die jedoch erneut Bedeutungslosigkeit versprachen. Die Män-ner waren bereit, alles dafür zu tun, um das zu vermeiden.
Quercher nickte den Herren zu, die ihn und Pollinger freundlich an ihren Stehtisch winkten. Man grüßte und frotzelte Quercher wegen seiner neuen Liebe.
»Was wohnst denn noch auf der falschen Seite des Sees in Wiessee, da oben in Sibirien? Mit deiner Freundin gehört ihr doch nach Tegernsee oder Rottach«, stichelte der kleine Politiker aus Tegernsee, der sich heimlich Hoffnungen auf eine Karriere als Landrat machte. Im Tal munkelte man, dass er zu Hause schon heimlich das Durchschneiden von Bändern und das Anstechen von Bierfässern üben würde. Das hatte er mit dem Bemühten aus Kreuth gemein.
»Uns gefällt es in Wiessee ganz gut. Geht ja mächtig was voran«, antwortete Quercher.
»Was machen unsere Flüchtlinge? Alle brav?«, fragte Pollinger unverbindlich.
»Wird Zeit, dass die aus dem Tal verschwinden. Die gehören nicht hierher«, brummte der Dicke aus Gmund, ein altes CSU-Schlachtross mit Hang zur Überheblichkeit, der immer in Lederhosen auftauchte, optisch quasi ein Superbayer, wie Super-GAU eben.
»Soll da nicht ein Internat kommen?«, fragte Pollinger.
»Ja, die Verrückte will das unbedingt. Wir aber nicht. Mal sehen, wer sich durchsetzt«, antwortete der Bemühte aus Rottach.
Der Kleine, der die Flüchtlingsproblematik in seinem Ort in den letzten Monaten auf überraschend pragmatische Weise bewältigen konnte, während sich seine Amtskollegen vornehm herausgehalten hatten, wandte sich an Quercher. »Weißt, Max, wir haben uns das nicht ausgesucht, mal eben Flüchtlinge in dieser Größenordnung aufzunehmen. Ich lasse mich deshalb nur ungern für unsere Vorgehensweise anmachen. Meine Leute haben Tag und Nacht gearbeitet.«
»Außerdem sind Sie doch auch Staatsbeamter«, mischte sich der Dicke in der Lederhose wieder ein. »Sollten Sie da nicht auf unserer Seite des Felds spielen?«
»Wir spielen weder auf einer Spielfeldseite noch im selben Stadion, noch nicht einmal dieselbe Sportart«, kanzelte Quercher die sprechende Lederhose ab. »Nichtsdestotrotz sind es sicherlich große Probleme, die wir momentan haben«, lenkte er ein.
Alle nickten zustimmend, aber dennoch misstrauisch.
»Deshalb«, fuhr Quercher fort, »wird es Zeit, dass wir einen Bürgermeister für das ganze Tal bekommen. Damit diese Kleinstaaterei endlich aufhört.«
Keiner der Herren antwortete. Das war ein Thema, das niemand im Tal ansprechen wollte. Nur dank der existierenden Kirchturmpolitik konnten die stolzen Dorfschulzen ihre Allmacht ausspielen. Ferdi zog Quercher weg. »Dass du auch immer Streit suchen musst!«
»Wieso denn? Ich war ganz gebannt von dieser geballten Kommunalpolitikkompetenz.«
Eine Klingel ertönte und sie gingen zu ihren Plätzen zurück. Als das Orchester wieder auf der Bühne erschien, wurde erneut gefilmt, als wäre die musikalische Darbietung der kommende YouTube-Knüller.
Quercher beugte sich zu seiner Schwester hinüber. »Wie viele Kinder wurden von ihren stolzen Eltern im Sommer hier am Gymnasium angemeldet?«, fragte er Anke.
»Neunundvierzig – mit viel Ach und Krach. Das wird nicht mehr lange gut gehen«, erklärte sie.
»Das Tegernseer Tal – Gottes Warteraum eben«, ätzte er.
»Du hättest dich ja auch mal fortpflanzen können«, stichelte Regina.
»Dann lieber Rentner. Ein Quercher reicht«, warf Arzu ein, die in der Reihe hinter ihnen saß und bedeutungsvoll die Augen verdrehte.
Am nächsten Morgen küsste Quercher Regina und wurde dabei von einem jungen Typen mit Rollkoffer angerempelt. Sie waren am Flughafen. Männer in zu engen Businessanzügen eilten an ihnen vorbei, das Telefon am Ohr, auf dem Weg zu einem ihnen nicht bekannten Ziel. »Du schickst Anke und Arzu sofort wieder nach Hause, wenn sie nerven, versprichst du mir das? So viele Kinder. Das hält kein Mensch aus.«
Sie sah ihn mitleidig an. »Max, es handelt sich in diesem Fall um Pickers Sohn und um Maxima, beide schon in einem Alter, in denen sogar ich mit ihnen kommunizieren kann. Dazu der kleine Max. Mein Haus in den USA ist groß genug, um sich aus dem Weg zu gehen.«
Vier Frauen und drei Kinder in einem Haus. So muss Hölle sein, dachte Quercher und sagte: »Wird bestimmt toll.«
Sie kniff ihn.
Zwei Wochen wollten die Damen ihn mit Pollinger allein lassen. Ein Rentner ohne weibliche Gesellschaft, aber mit zu viel Tagesfreizeit konnte einem schnell die Laune verderben. Quercher wiederum, der schon viel früher mit der Pensionierung geliebäugelt hatte, musste nach wie vor im Hamsterrad des Landeskriminalamts knechten. Auch deswegen wollte er während seiner Strohwitwerschaft mit Picker an einem freien Tag wandern gehen.
»Zwei Wochen mit meiner Schwester. Du weißt, ein Anruf und die Nervensäge fliegt zurück.«
»Mach dir um uns keine Sorgen. Genieß die Zeit allein am See und denk über uns nach!«
»Regina, bitte. Ich weiß mich schon zu beschäftigen.«
»Du kaufst kein Motorrad, gehst nicht in eine Teeniedisco und suchst dir eine Jüngere?«
»Regina, ich habe keine Midlife-Crisis!«
»Nein, nur Probleme, älter zu werden.«
»Ich bin nicht alt. Ich bin fünfundvierzig. Ich will nur leben!«
Regina verdrehte die Augen. Max Quercher allein zu lassen, fiel ihr in diesem Moment sehr leicht. Der Mann brachte sie gelegentlich in Rage.
Seit anderthalb Jahren waren sie ein Paar. Aber Quercher war noch immer nicht bei ihr eingezogen, sondern in seinem verbauten, engen Elternhaus geblieben. Nicht dass sie auf einen Heiratsantrag gehofft hätte – das wäre auch ihr zu viel Nähe gewesen. Aber in Sachen konstanter Beziehungsarbeit gab es bei Max Quercher noch Luft nach oben. In jüngster Zeit regte er sich zudem über den Altersdurchschnitt im Tal auf und monierte, es handele sich nur um Menschen, die auf den Tod warteten. Dabei wirkte er selbst wie die jüngere Version von Klaus Kinski. Kurz: Sie brauchte einfach wieder einmal Distanz und musste weg, nach Long Island, wo sie ein Haus hatte. Außerdem herrschte dort noch Sommer, während hier der Herbst schon Einzug gehalten hatte.
Quercher brachte Regina zum Sicherheitscheck für First-Class-Reisende. Ein paar Reihen weiter, an der Sicherheitsschleuse für Economy-Passagiere, standen seine Schwester und Arzu. Er streckte ihnen die Zunge raus, erntete jedoch nur Gelächter.
»Hühner auf Reisen. Na, viel Spaß«, murmelte er.
Regina küsste ihn grinsend zum Abschied und ging dann durch die Kontrolle.
Es war Sonntagmittag. Er würde mit Lumpi in den Englischen Garten gehen, Stadthunde ärgern und dann an den See fahren. Heute musste er nicht ins Büro. Allerdings: Am See würde Quercher nicht allein sein. Dort wartete garantiert Pollinger mit Geschichten von früher.
Er fuhr ins Büro.
Schon auf dem Flur hörte er ihr Lachen. Seine Chefin hatte gute Laune. Es war ein Giggeln, wie es sonst nur junge Mädchen beim ersten Date von sich gaben. Er wusste von ihrer Sekretärin, dass Gerass frisch verliebt war. Bestimmt musste irgendein Referent in der Staatskanzlei privat unter der alten Gewitterhexe arbeiten. Deutlich jünger als sie sollte er sein, aber von eher schmächtiger Statur, so hörte man. Doch diese Verjüngungskur hatte Gerass nicht zu einer liebenswürdigeren Vorgesetzten gemacht. Stattdessen verteilte sie die Arbeit im Stile einer Monarchin. Es hatte auch ihn getroffen. Er musste einen Korruptionsfall im Landkreisamt Miesbach bearbeiten. Provinzielle Eitelkeit gepaart mit CSU-Gier. Und jeder hing mit drin, hielt aber dicht.
Schnell schlüpfte er in sein Büro, das er sich seit einigen Wochen mit einer neuen Kollegin aus Thüringen teilen musste, warf sich in seinen Stuhl und sah sich an seinem Rechner ein altes Video an. Es war von einem Besucher auf der Feier des sechzigsten Geburtstags eines Landrats aufgenommen worden. In der ersten Reihe saßen der Kardinal aus München, der Ministerpräsident und die üblichen CSU-Schranzen auf Kosten der Allgemeinheit gemütlich beim Bier. Als das Video entstand, war die Welt noch in Ordnung gewesen. Kurze Zeit später kam aber dank engagierter Journalisten heraus, dass der Jubilar seine Doktorarbeit gefälscht hatte. Dieser Sumpf hatte zu einer spektakulären Niederlage der CSU geführt: Der neue Landrat war ein Grüner, was vielen Altkonservativen wie eine Hure im Nonnenkonvent vorkam.
Quercher saß mit seiner Kollegin nun schon seit Wochen daran, weitere Verstrickungen aufzudecken. Er sah sich Bewirtungsbelege und allerlei anderes Material an, das die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt hatte. Eine fade und mühsame Arbeit. Seine Laune war auf dem Tiefpunkt. Überhaupt lief gerade alles gegen ihn, fand er und bemitleidete sich selbst.
»Ich brauche deine Hilfe.« Picker stand plötzlich in der Tür und riss Quercher aus seinen düsteren Gedanken.
Querchers einstiger Erzfeind Picker war wieder beim LKA tätig. Die Leitung der Kriminalinspektion in Miesbach hatte er abgegeben. Sein Gesundheitszustand ließ keine Führungsfunktion mehr zu. Die Verletzungen durch eine Explosion vor anderthalb Jahren hatten weitreichende Folgen gehabt. Picker, geistig völlig fit, hatte zuweilen schwere körperliche Aussetzer, war schnell müde und wenig belastbar. Als er seine Freundin Maria, eine Krankenschwester, heiraten wollte, war er kurz vor dem Termin zusammengebrochen, die Feier musste verschoben werden. Aus dem einst so intriganten und stolzen Superbeamten Picker war binnen kürzester Zeit ein alter Mann geworden.
Aber das hatte ihn stärker mit Quercher verbunden, als der jemals es hätte für möglich halten können. Er gab auf Picker acht wie auf einen jüngeren Bruder. Zudem mochten beide die Stille, auch deswegen freuten sie sich auf die gemeinsame Wanderung.
Man hatte Picker angesichts seiner Verdienste und auf Querchers Wirken hin eine ruhige Position im LKA eingerichtet. Picker kümmerte sich um echte und vermeintliche Bedrohungslagen von ›Privatpersonen mit sicherheitsrelevantem Hintergrund‹, kurz: von reichen, wichtigen Menschen im Freistaat Bayern.
»Wann hast du Maria und den Nachwuchs denn zum Flughafen gebracht?«
»Wir waren bei meinen Eltern in München und sind mit der S-Bahn gefahren. Und ihr? Seid ihr mit dem Heli der Chefin geflogen?«
Quercher war Spott ob des Reichtums seiner Freundin gewohnt und nahm es mittlerweile gelassen. »Komm rein. Ich habe den Tegernsee-Blues.«
Picker verstand sofort. Wer in einer Idylle lebte, konnte zuweilen genug davon haben. Mochten die Natur, der See und die Berge auch wunderschön und berauschend sein – die Bewohner des Tals konnten jemanden wie Quercher mächtig nerven. Denn am Tegernsee sahen sich die Menschen als Gottesgeschenk, quasi als notwendiges Inventar im Paradies. Jede Veränderung wurde als Angriff auf die eigene Identität gewertet. Quercher, dem diese Selbstherrlichkeit zutiefst verhasst war, würde hier immer ein Störenfried sein.
»Suchst du am heiligen Sonntag noch das Schwein zu der Niere in Poschners Hundenapf?«, fragte Quercher sarkastisch und deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch.
Picker setzte sich mit einem Stöhnen. »So wie für dich stellt auch für mich das Büro heute die bessere Alternative dar. Ich müsste eigentlich im Garten arbeiten. Deshalb bin ich lieber hier.«
Jan Poschner hatte die Polizei in Miesbach nicht sofort angerufen, um den Fund der Niere zu melden. Doch einen Tag darauf war er am frühen Morgen in seinen alten Volvo gestiegen und die kurvenreiche Straße hinunter in Richtung See gefahren. Er hatte die Musik aufgedreht, sodass ihm ein quietschendes Geräusch entgangen war, das immer lauter wurde, je mehr Geschwindigkeit das Auto aufnahm. In der vierten Kurve, oberhalb eines Hotels, passierte es: Er trat auf die Bremse, die aber nicht reagierte. Das Auto wurde schneller und fuhr geradewegs auf eine Neunzig-Grad-Kurve zu. Jan sah, dass ihm von unten ein Lkw entgegenkam, und er riss das Steuer nach rechts. Blech kratzte an einer Mauer, der Wagen wurde wieder in die Mitte der Straße geschoben. Der Lkw bremste und zog so weit wie möglich auf die linke Seite. Poschner sah das entsetzte Gesicht des Fahrers, der wild hupte. Nach einigen weiteren Lenkmanövern gelang es Jan schließlich, das Auto auf dem Parkplatz des Hotels mit einer Drehung und dem Ziehen der Handbremse tatsächlich zu stoppen. Am Ende würgte er den Wagen ab und schnaufte durch.
In diesem Moment war Jan klar gewesen, dass er mit der Polizei reden müsste.
Eine Streife hatte bei Poschners geklingelt. Die Hausherrin hatte einen Mechaniker im Tal gekannt, der das Auto kurz zuvor untersucht und einen alten Bremsschaden entdeckt hatte. Sie hatte ihren Mann, der noch immer sichtbar erregt war, beruhigt und die Geschichte vor den Polizisten heruntergespielt. Bezüglich der Niere hatte sie von einem Streich gesprochen und die Kollegen eigentlich gleich wieder hinauskomplimentieren wollen. Doch die hatten sich nicht abwimmeln lassen, dennoch einen Blick auf das Organ geworfen und trotz rudimentärer Veterinärkenntnisse festgestellt, dass es sich um eine Schweineniere handelte. Sicherheitshalber hatten sie die Niere mitgenommen, den ›Tatort‹ fotografiert, den Besitzer der Autowerkstatt befragt und dann den Hintergrund der Familie Poschner recherchiert. Die Frau eine millionenschwere Erbin und ehrenamtliche Helferin für Flüchtlinge – da konnte mehr dran sein, als Nina Poschner sie glauben machen wollte. Deshalb wurde Picker informiert und bekam die Bilder der Kollegen zugeschickt. Und auch ihm erschien die Sache seltsam.
»Du kennst doch die Poschners«, begann er.
»Ja, Jan ist ein prima Typ. Hat nur den größten Teddy aus dem höchsten Regal geheiratet.«
»Den was?«, fragte Picker verständnislos.
»Du warst doch auch in der Schule! Ich meine die Mädchen, die jeder haben wollte, aber keiner bekam. So war Nina. Sie sah gut aus, war sehr klug und vor allem: Sie hatte einen unglaublich schrägen Humor. Schon immer. Also kurz: alles, was Männer mögen.« Er sah Picker fragend an, ehe er ergänzte: »Also normale Männer mit Geschmack.«
»Sie hat dich nicht rangelassen«, stichelte Picker.
»Ich bitte dich.«
»Klar, Max, du hast dich immer bitten lassen. Die Dame war also extrem beliebt, okay. Was ist mit dem Mann?«
»Eher schüchtern, sozusagen ein stiller Terrorist.« Quercher wusste, dass sich die beiden ehrenamtlich engagierten. »Das ist eine sehr harmonische Familie. Sie finanzieren mit ihrer Kohle eine Menge, wollen sich aber nicht mit Spenden in die Bevölkerung einschleimen. Also nicht den hundertsten Eisstockplatz oder eine Hütte für die Gebirgsschützen spendieren. Stattdessen kümmern sie sich lieber um Flüchtlinge. Bei denen, deren Horizont an der A 8 endet, haben sie sicher nicht nur Freunde. Vielleicht hatte ja einer eine Niere übrig und hat sie den Poschners einfach vor die Tür gelegt. Obwohl – den Dumpfbacken hier im Tal fehlt eher das Hirn als die Niere.«
Picker stöhnte. »Kannst du mal ernst bleiben? Man legt doch nicht einfach eine Schweineniere in einen Hundenapf! Und kaputte Bremsen, so plötzlich? Die Familie ist prominent. Da liegt eine Bedrohung doch näher als ein Dummer-Jungen-Streich.«
»Waren das Drohungen?«, fragte Quercher. »So wie eine tote Katze vor der Tür oder ein in Zeitung eingewickelter Fisch von der Mafia?«
Picker zuckte mit den Schultern. »Du meinst also allen Ernstes, dass die einzigen Feinde, die diese Familie hat, irgendwelche Hinterwäldler hier aus dem Tal sind, die ihr den Reichtum neiden und denen ihr Engagement mit den Flüchtlingen missfällt.«
»Was haben die Poschners ausgesagt?«, fragte Quercher.
»Die können sich das gar nicht erklären. Mir wäre es lieb, wenn du sie heute gemeinsam mit mir noch einmal befragen könntest. Du hast zu denen einen besseren Zugang. Das sind so, so …«
»Gutmenschen, sag’s ruhig! Ja, die engagieren sich. Ist doch toll.«
»Ja, aber auch so mühsam. Man hat immer Angst, etwas Falsches zu sagen.«
»Lass mich raten, du hast der schönen Tochter blöde Komplimente gemacht?«
Picker ging nicht darauf ein. Das war seine neue Taktik im Kampf gegen Querchers ewiges Sticheln. Es schien zu wirken.
»Kannst du mich mitnehmen?«, fragte Picker.
Quercher hatte sich ein neues Auto geleistet, nachdem der Pick-up zu oft liegen geblieben war. Es war das Auto seiner Jugend, ein Mercedes Strich Achter. Für ihn verkörperte es das alte Westdeutschland, und mit Mitte vierzig durfte man wehmütig auf diese Zeit zurückblicken, fand er. Der Wagen war hervorragend in Schuss.
Lumpi saß auf der Rückbank und blickte schmollend aus dem Fenster. Die Hundedame, mittlerweile zwölf Jahre alt und mächtig grau im Gesicht, empfand es wohl als Majestätsbeleidigung, dass Picker auf ihrem Beifahrersitz Platz genommen hatte.
»Also, Familie Poschner. Was hast du so über die?«, fragte Quercher, während er seinen Wagen Richtung Autobahn lenkte.
»Der Papi deiner Schulfreundin hat eine Pillendreherklitsche, die Arzata AG. Machten am Anfang ein wenig Homöopathie, ein paar Salben. Nichts Großes. Nina Poschner steigt nach dem Studium und ein paar Jahren bei einem Pharmakonzern in der Schweiz bei Vati ein. Sie forscht an einem Mittel gegen Autoimmunkrankheiten wie Rheuma, multiple Sklerose oder Diabetes Typ-was-weiß-ich. Krankheiten, die nicht tödlich sind, aber Millionen Menschen tagein, tagaus das Leben verleiden. Dieses Mittel bringt den Durchbruch für die Bude. Ab diesem Zeitpunkt verabschiedet sich Nina Poschner aus der Forschung, bleibt aber noch im Beirat der Firma. Von nun an führt Madame mit Kindern und Ehemann ein nahezu vorbildliches Leben: spendet, engagiert sich. Kürzlich war sie mit dem neuen grünen Landrat in der Zeitung. Sie will so was wie ein Flüchtlingsinternat gründen. Und damit nicht genug: Sie ist auch noch im Gemeinderat.«
»Was, wie wir wissen, der Weg zu Neid und Missgunst im Tegernseer Tal ist«, schob Quercher ein.
»Warum?«, fragte Picker verwundert.
»Weil jeder Arsch hier einen Neidfurz herausbläst. Jeder glaubt, du gehst in den Gemeinderat und kommst mit einem Grundstück oder einem anderen Zuckerl wieder heraus.«
»Aha, vielleicht sollte ich doch wieder in die Politik gehen!« Picker spielte auf seinen kurzen Ausflug ins Berliner Innenministerium vor einigen Jahren an.
»Vergiss es, du würdest es mit denen nicht einen Tag aushalten. Dagegen ist das gallische Dorf eine Yogagruppe.«
»Legen die sich da Schweinenieren in die Hundenäpfe?«
»Eher nicht.«
Jetzt standen sie im Stau. Halb München fuhr am Sonntag in das Tal, um noch den letzten Grashalm auf den Wanderwegen niederzutrampeln und das Bräustüberl zu einem Ballermann werden zu lassen. Quercher fuhr Schleichwege, aber auch da schlängelten sich inzwischen SUVs und Porsche entlang. Als sie kurz vor Kaltenbrunn waren, war er bedient. »Ich habe Hunger«, nörgelte er.
»Dass es Regina bei dir aushält …«
»Lass uns runter nach Kaltenbrunn, um etwas zu essen, bevor wir bei der Vorzeigefamilie vorbeischauen. Die sind bestimmt Vegetarier.«
»Bis auf den Hund zweifellos.«
»Wobei … Da soll’s leckere Nierchen geben.«
»Quercher, du nervst. Ich gebe den Poschners Bescheid, dass wir später kommen.«
Während Picker telefonierte, schlenderte Quercher schon in den Biergarten, der einen gigantischen Panoramablick auf das Tal nach Süden freigab. Heute war ein Tag für frisches Sauerteigbrot mit Salzbutter und Schnittlauch. Dazu konnte man nur ein Tegernseer Helles trinken. Aber der Michi Käfer, der die teure Bude hier gepachtet hatte, schenkte Gesöff aus München aus. Es lief nicht immer gut.
Picker tauchte wieder neben ihm auf. »Also, die Familie ist jetzt wandern. Der Sohn wird uns gegen fünf empfangen, die anderen kommen später. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Wollen wir schwimmen gehen?«
»Jetzt noch?«
Wenig später tauchten sie in das nicht einmal siebzehn Grad kalte Wasser und schwammen zügig. Lumpi lag auf Querchers Jacke und schlief derweil. Als sie beide frierend aus dem See auf den Kieselstrand traten, schaute Quercher auf Pickers Wunden. Eine Schussverletzung am Bauch und etliche Narben aufgrund einer Explosion waren die sichtbaren Überbleibsel diverser Ermittlungen und ließen seinen Kollegen wie ein Kriegsteilnehmer aussehen. Doch auch Quercher konnte Narben am Körper vorweisen. Picker sah ihn fragend an. Quercher zuckte nur mit den Schultern. Das war eben ihr Leben. Sie konnten nichts anderes. Querchers Freundin Regina, mit ihrem unermesslichen Reichtum, hatte ihm immer wieder andere Berufsperspektiven angeboten. Er könne Sicherheitschef in einer ihrer Firmen werden, noch einmal studieren oder mit ihr in die USA auswandern. Aber immer hatte Quercher dankend abgelehnt. Noch vor vier Jahren hatte er alles hinwerfen und nach Salina, einer italienischen Insel, auswandern wollen. Doch das war längst passé. Dort herrschte aufgrund der Wirtschaftskrise inzwischen chronische Armut, niemand wartete auf deutsche Luxusruheständler. Also blieb er beim LKA, ließ sich von seiner Chefin Gerass herumkommandieren, nutzte die wenigen Freiräume, die sie ihm gab, und führte ein seltsam abwartendes Leben mit Regina.
Es wurde einer dieser Talnachmittage, die jenseits der Saison so einzigartig sind. Die Sonne schien, der Himmel war blau – und Letzteres galt auch bald für die beiden Männer. Sie hatten nach der sechsten Halben auf Obstler umgestellt. Die Bedienung, eine junge Frau aus Afrika, lachte, als sie sah, wie Quercher umständlich versuchte, sich von der Bank zu erheben, und dabei fast nach hinten fiel.
»He, Burli, machst mir noch a Neger. Aber flott.«
Eine Gruppe Einheimischer in voller Tracht grölte lachend in Richtung der Kellnerin, während Quercher sich mühte, sein Gleichgewicht zu halten. Einer der Männer machte eine Bewegung, die wohl so etwas wie Oralverkehr darstellen sollte. In nüchternem Zustand hätte Quercher den Typen vom Nachbartisch nur böse angeschaut. Aber jetzt fehlte ihm die intellektuelle Bremse im Kopf. Er kannte den Mann. Er hatte im Tal vor Kurzem eine Bürgerinitiative gegen Flüchtlinge gründen wollen und war allgemein als Störer bekannt. Loisl Schlitzach hieß er, daran konnte sich Quercher trotz seines betrunkenen Kopfes noch erinnern.
»Halt deine Fresse, Trachtentaliban, zauseliger«, giftete er zurück.
Die Bedienung wollte beschwichtigen. »Nicht doch, ich habe es überhört«, bat sie Quercher leise.
Er sah sie mit verschwommenem Blick an. Ihre Opferattitüde ärgerte ihn, aber er schwieg und betrachtete versonnen die schwarze Lockenpracht der Kellnerin, die sie zu Zöpfen gebunden und hochgesteckt hatte. So müssen junge Königinnen aus Afrika aussehen, dachte er.
»He, magst die mausen, Muhaggl? Was kostet die?«
Ehe Quercher reagieren konnte, hatte sich Picker erhoben und sein Janker zur Seite geschoben, sodass das Holster und die Waffe gut sichtbar waren. Die Männer murrten, hielten sich aber zurück und verschwanden kurze Zeit später. Einer von ihnen machte mit seinem Handy noch ein Foto von Picker und Quercher, der ihnen nur den Mittelfinger zeigte.
Als die Sonne unterging, hatten sie gerade noch die Kraft, Pollinger anzurufen und ihn schwer lallend zu bitten, sie abzuholen, was dieser auch tat.
Er hörte sich schweigend das sinnlose Gerede der beiden Polizisten an und brachte sie mit Mühe in Querchers Haus. Picker schlief schon, als Quercher sich über der Kloschüssel erbrach. Beide sahen nicht, wie der Alte mit seinem Handy die gerade in den USA gelandeten Damen live dazuschaltete. Wozu brauchte man Feinde, wenn man so einen Freund hatte?
Finn, den Sohn der Poschners, hatten sie in ihrem Suff vergessen.
Es begann mit einem Räuspern. Es kratzte in seinem Hals und nichts half. Finn beachtete es nicht. Er spielte mit der Playstation im Wohnzimmer und hatte keinen Sinn für das schöne Licht, das sich am Nachmittag über den See ergoss. Gedankenlos kratzte er sich an seinen Beinen, während er weiter versuchte, das virtuelle Fußballspiel zu gewinnen. Erst als er den linken Arm plötzlich nicht mehr spürte und ihm der Joystick aus der Hand auf die Fliesen des Wohnzimmers fiel, wurde er panisch. Der Junge war bestens trainiert, lief seit zwei Jahren in der Gruppe der Junioren auf Triathlonveranstaltungen und war ein exzellenter Speerwerfer. Er kannte seinen Körper. Diese Symptome waren neu. Das Herzrasen, die Kopfschmerzen, der Schwindel, der ihn ergriff, als er sich erhob. Die Luft wurde knapp. Finn konnte von einem Moment zum anderen nur noch stoßweise atmen. Er schwankte. Seine Lunge schien zu zerspringen.
Gegen neunzehn Uhr kamen die Eltern von einer gemeinsamen Bergwanderung mit Flüchtlingen zurück. Sie fanden ihren Sohn vor der offenen Terrassentür im Wohnzimmer auf dem Boden. Regungslos, ohne Atem. In seiner verkrampften Hand hielt er eine Visitenkarte. Neben ihm lagen unzählige Nussschalen. Jan Poschner begann sofort mit der Reanimation. Bis die Rettungsärztin eintraf, war Finn Poschner in ein Koma gefallen. Ein Hubschrauber brachte ihn in das Klinikum Murnau. Eine Stunde später diskutierten Ärzte im Nachbarzimmer der Intensivstation darüber, ob der junge Mann für eine Organtransplantation geeignet wäre.
Um zweiundzwanzig Uhr klingelten bei Max Quercher die Kollegen der Polizeiinspektion Bad Wiessee.
Kapitel 4
München
Gerass öffnete das Fenster. Die beiden rochen. In ihrem Gesicht lasen sie, dass sie angewidert war, was sowohl Picker als auch Quercher noch wütender machte. Gerass war lediglich Querchers Vorgesetzte, nicht jedoch seine Mutter.
Ja, sie hätten das Ganze mit einem rechtzeitigen Besuch bei den Poschners, vor allem in nüchternem Zustand, verhindern können. Auch die Schlagzeilen taten sicher nicht gut. Junge im Koma, weil Polizisten im Biergarten soffen titelte eine Münchner Boulevardzeitung.
Quercher sah die Schlagzeile und schüttelte den Kopf. »Das ist falsch oder zumindest verkürzt … Müssen wir uns das gefallen lassen?« Sein Kopf hämmerte.
Die Kollegen in Wiessee hatten sie nur befragen sollen, ob sie überhaupt im Haus der Poschners gewesen waren. Schließlich war da Pickers Visitenkarte, die der Junge in der Hand gehalten hatte.
Gerass setzte sich an den Besprechungstisch. »Sie wissen, dass der Vorwurf nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Sie hätten den Jungen gefunden, wenn Sie pünktlich um siebzehn Uhr am Anwesen der Poschners aufgeschlagen wären. Bei einem Allergieanfall dieser Güte ist jede Minute, in der ein Notarzt eingreifen kann, wichtig. Sie haben stattdessen im Biergarten gesoffen. Vielleicht hat Herr Picker ja recht, und es liegt eine Bedrohungslage vor. Eine Schweineniere im Hundenapf, kaputte Bremsen und ein im Koma liegender Junge. Reicht ja schon oder etwa nicht?«
Quercher wollte dringend eine Kopfschmerztablette. Sie hatten es versaut. Das war nicht von der Hand zu weisen. Aber musste das jetzt wirklich derart hochgespielt werden?
Gerass blieb dabei. »Der Junge hat eine Allergie gegen Nüsse, aber nicht einmal ansatzweise jemals vorher so einen Schock gehabt. Sie haben ihn stabilisiert. Er kämpft immer noch um sein Leben in Murnau. So etwas passiert einem nicht als Sohn eines Arztes und einer Pharmakologin.«
Quercher rieb sich die Augen. »Zufall. Es ist Oktober. Der Junge hat Nüsse gegessen und kurz vergessen, dass sie bei ihm eine blöde Wirkung haben können. Passiert mir auch zuweilen mit Alkohol.«
Picker schwieg und sah in eine Mappe, die ihm Gerass gegeben hatte. In diesem Büro war einst der alte Pollinger der Herrscher gewesen, hatte von hier das LKA regiert. Aber das war Vergangenheit. Der Alte lebte jetzt am See, war Querchers Nachbar und schrieb an einem Buch. Heute hatte sein altes Büro keine persönliche Note mehr. Dieser Raum konnte jederzeit von seiner momentanen Inhaberin verlassen und am nächsten Tag ohne größere Umstände von ihrem Nachfolger bezogen werden. Gerass war frei von Gestaltungswillen. Sie besaß keinerlei Vision, wie das LKA zu leiten sei. Dieser Job war lediglich eine Aufgabe, der sie sich zu stellen hatte, nüchtern und betont sachlich.
Für das Exaltierte leistete sie sich zuweilen Menschen wie Quercher. Den schützte sie, ohne dass er es bemerkte. Im Amt hatten Kollegen gegen ihn und seine Beziehung zu der Milliardärin Regina gewettet. Niemand wollte glauben, dass es eine Frau von diesem Kaliber mit einem wie Quercher aushalten würde. Gerass erfuhr davon, ließ die Initiatoren des Flurfunks zu sich kommen, erklärte ihnen kurz und deutlich, dass sie so etwas nicht dulde, und beschrieb sachlich und hart die möglichen Konsequenzen. Niemand sprach mit Quercher darüber. Doch die Wette hatte sich daraufhin erledigt.
»Wenn der Sohn der Poschners eine Nussallergie hat, woher kamen dann die Nussschalen? Irrer Suizidversuch?«, fragte Gerass erneut.
»Glauben Sie wirklich an eine Nussverschwörung? Die Eltern haben uns gegenüber angegeben, dass die Schweineniere ein Scherz und der Schock des Jungen ein Zufall gewesen sei. Wollen Sie daraus jetzt mehr stricken?«
»Wenn jemand bedroht wird, aber wenig Vertrauen in die Arbeit der Polizei hat, hält er vielleicht seinen Mund. Der Junge liegt im Krankenhaus, kann nicht befragt werden. Dann werden Sie wohl mit den Eltern noch einmal sprechen müssen. Herr Pickers Vorgesetzter bat um Unterstützung vom LKA, weil er mehr dahinter vermutet.«
»Ach? Plötzlich?«, fragte Picker, ohne von seinen Unterlagen aufzublicken. Bisher hatte sein Chef nur wenig Interesse an dem Fall gezeigt.
»Wieso? Das ist doch Unsinn, eine völlig nutzlose Aktion, weil …«
»Max, halt mal kurz die Klappe.« Picker zeigte auf die Mappe. »Das hier sind Sachen, die über die Poschners im Netz kursieren. Hier: »Diese versifften Gutmenschen sollen doch die ****Neger selber aufnehmen. Haben das dicke Geld, aber bei uns werden die abgeladen. Drecksgeschwerl, dreckiges.« Oder hier: »Die helfen denen als Arzt und ich warte stundenlang im Wartezimmer. Sauber. Hier wird ja alles gelöscht. Aber ich wüsste schon, was ich mit denen täte, wenn ich die im Dunkeln sehen würde.« Das sind Kommentare, die Menschen anonym hinterlassen haben, und die daraufhin von der Redaktion der Onlineseite gelöscht wurden. Da geht es permanent um das Engagement der Poschners für die Flüchtlinge. Und noch etwas: An der Schweineniere waren Reste von menschlichem Blut. Der oder die Täterin hat sich vielleicht beim Bearbeiten geschnitten. Also liegt das Organ jetzt in der Rechtsmedizin.«
»Ich will dir ja deine CSI-Ermittlungen nicht kleinreden. Aber am Ende wird es ein rumänischer Kopfschlachter aus einer Großschlachterei in Westfalen gewesen sein«, ätzte Quercher. »Zudem fuhr diese Familie einen steinalten Volvo, sozusagen das passende Auto zu ihrer Gesinnung. Da kommt so etwas wie defekte Bremsen schon mal vor.«