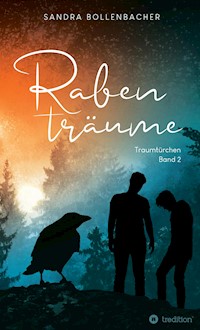
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Traumtürchen
- Sprache: Deutsch
Die magische Reise geht weiter Nach der Flucht aus der Hauptstadt ist Nyrcolas mit der mysteriösen Maga und Formwandlerin Kelda auf dem Weg in eine unbekannte Zukunft, frei von Iantos' Massen an Menschen, Monstern und Magi-Jägern, und auch Rick macht sich auf die Suche nach einem neuen Leben abseits der Großstadt. Doch manches kann man nicht so einfach hinter sich lassen, seien es alte Gewohnheiten, Ängste oder gar Feinde. Während Nyrcolas und Rick nicht nur die ungewohnte Umgebung, sondern auch ihr eigenes magisches Wesen erforschen, macht Kelda nachts kein Auge zu. Sie muss verhindern, dass der König der Nachtalbe sie findet, aber auch, dass eine Wahrheit ans Licht kommt, die so schrecklich ist, dass sie nicht nur ein Herz brechen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 720
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sandra Bollenbacher
Traumtürchen Band 2
Für Sabine, Uwe und Christina
Prolog
Dunkle, nassglänzende Felsen und tosende Wellen mit weißen Schaumkronen, die immer und immer wieder gnadenlos auf dieKüste hereinbrechen. Der Himmel ist schwarz, ohne Mond oder Sterne, und die Luft eisig kalt. Sie friert bitterlich. Ihr Kleid aus seidenen Federn hat sie abgestreift und achtlos auf einen großen, unförmigen Felsbrocken geworfen. Jetzt verschlingt ihn das Meer mit seiner gierigen Zunge und reißt das Federkleid mit sich. Ihre Zehen graben sich in den nassen Sand, als wollten sie sie festhalten, doch sie zieht ihren Fuß heraus und geht langsam, jeden Schritt aufs Neue bedenkend, auf das wütende Wasser zu. Kälter als Eis umspielt es ihre Knöchel, dann zieht sein kräftiger Sog sie mit sich. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt nach vorne. Ihre Hände leuchten geisterhaft weiß unter der sprudelnden Oberfläche. Am liebsten würde sie sich ganz hineingleiten und davontragen lassen. Doch dann sieht sie es wieder, ein blaugrünes Funkeln zwischen all dem Schwarz und Weiß, und es schenkt ihr Hoffnung. Sie richtet sich auf und geht mit sicheren, festen Schritten weiter, bis das Wasser ihren Bauchnabel kitzelt. Schon rollt die nächste Welle heran. Sie muss sich beeilen. Ihre dünnen Finger angeln nach dem farbigen Etwas, bekommen es zu fassen, verlieren es wieder. Die Welle bricht auf sie ein, hart wie eine Mauer, und drückt sie unter Wasser. Für einen kurzen Augenblick ist alles ruhig. Sie scheint zu schweben, eben noch im Ozean, jetzt im unendlichen Nichts. Ihre langen Haare fließen sanft um ihren Kopf und streicheln ihr Gesicht, doch dann wickeln sich die blonden Strähnen um ihren Hals, immer schneller, immer fester, und sie kann nicht mehr atmen. Kalte Finger streicheln ihre Wange. Hinter ihr thront der König der Nachtalbe. Er lächelt.
Keldas Augen flogen auf und sie japste nach Luft. Vereinzelt brach milchig-weißes Sternenlicht über ihrem Kopf durch das dichte Blätterdach, das sich leise raschelnd hin und her wiegte. Vorsichtig setzte sie sich auf und sah sich um.
»Was ist passiert?«, fragte sie verwirrt. Ihre Zunge war ungewohnt schwer, die Stimmbänder träge.
»Nichts, es ist alles okay. Du bist nur eingeschlafen. Hast du schlecht geträumt? Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich dich schlafen gesehen habe«, sagte Rick schmunzelnd, der auf den Ellbogen gestützt neben ihr auf dem Boden lag. »Du siehst übrigens sehr liebreizend aus, wenn du schläfst, und nicht so grimmig wie – Hey, was ist los?«
Die Maga war aufgesprungen und bereits dabei, ihre Sachen zusammenzupacken.
»Wir müssen hier weg. Sofort. Er weiß, wo ich bin.«
Kapitel 1
Somian hasste es, zu warten. Ungeduldig schritt er auf und ab, setzte sich auf seinen Thron, trommelte mit langen, schwarzen Fingernägeln auf den Armlehnen aus poliertem Mahagoni und sah immer wieder auf die kleine, silberne Taschenuhr. Noch zehn Minuten. Er würde Arcane noch zehn Menschenminuten geben, dann war seine Geduld am Ende. War es ein Fehler gewesen, dem Magus zu vertrauen? Auf seine Schuld zu bauen?
Rastlosigkeit zwang Somian wieder auf die Beine. Sein schwarzes Gewand glitt hinter ihm über die dunkle Grafittreppe seines Palastes, verwischte mit den Stufen zu dunklem Nebel.
Er war Kelda so nahe, er konnte bereits den Duft ihrer Haare riechen, ihre zarte Haut auf seinen Lippen schmecken. Sie war eine starke, alte Maga, doch Arcane, um so viele Monde älter als sie, sollte keine Probleme damit haben, sie zurückzuholen.
Warum also dauerte es so lange? Es war fast Nacht in der Menschenwelt.
Doch die Nacht war seine Domäne. Er würde dem Magus in den Wald außerhalb von Iantos folgen. In den Grenzwald, wo Kelda sich heute mit dem Träumenden treffen wollte, in dessen Traum Somian sie in der letzten Nacht gesehen hatte. Dort hatte er den Magus hingeschickt: mit einem Schlaftrunk, um Kelda zurück ins Reich der Träume zu holen, denn nur hier hatte er Macht über sie. Darum musste er auch besonders vorsichtig sein, wenn er sich gleich auf den Weg machte. Falls sie ihn sah, würde sie sofort verschwinden.
Oder hatte sie Arcane bereits durchschaut? Vielleicht war Somian auch einfach zu ungeduldig. Möglicherweise war Kelda gar nicht dort und der Magus noch auf der Suche nach ihr. Doch konnte sich Somian wirklich sicher sein, dass Arcane seinen Auftrag ausführte? Der Magus war ihm so lange entwischt, hatte sich zu oft unerlaubt Zutritt in die Traumwelt, in die Träume anderer Menschen, verschafft. Somian konnte – durfte – sich nicht darauf verlassen, dass Arcane diese Vereinbarung – Kelda für sein Leben – würdigen und einhalten würde.
Somian öffnete seine Augen in der wachen Welt, erhob sich mit wackeligen Knien aus seinem provisorischen Bett, stützte sich gegen die kalte Erdwand und kroch aus seiner kleinen Höhle oberhalb einer steilen, kreideweißen Klippe. Einhundert Meter unter ihm brachen nachtschwarze Wellen in einem langsamen, beständigen Rhythmus gegen die Felsen. Somian rief einen seiner Mahre zu sich, schwang sich auf dessen sich stetig windenden und wandelnden Rücken und ließ sich von ihm davontragen: Richtung Grenzwald, zu Arcane, zu Kelda.
Nyrcolas’ Arme schmerzten, er konnte seine Hände nicht mehr spüren und seine Augen tränten von der eiskalten Luft, die ihm unentwegt entgegenblies. Trotzdem war das Fliegen unglaublich toll. So leicht und frei hatte er sich noch nie gefühlt. Und was er alles sah! Nie hätte er es für möglich gehalten, dass es so viel gab: so viele Bäume, so viel Wasser und so viel Himmel. Über seinem Kopf hörte er das Flügelschlagen des großen Raben und des kleinen Drachen, die ihn fest in ihren Krallen hielten. Gerade gab die Maga in Vogelgestalt Rhys die Anweisung, das Dorf, das Nyrcolas am immer dunkler werdenden Horizont erkennen konnte, großräumig zu umfliegen und auf einem Feld in der Nähe des Waldrandes zu landen. Iantos, die große Stadt, in der Nyrcolas gelebt hatte und welche bis vor Kurzem alles war, was er kannte, hatten sie schon lange hinter sich gelassen, genauso wie den Fluss, dem sie zu Beginn gefolgt waren. Nun neigten sich die Köpfe seiner beiden fliegenden Freunde und in weiten Kreisen näherte sich das Trio dem dunklen Braun des Ackers unter ihnen.
Die Landung war weniger elegant. Kelda und Rhys flogen zu schnell zu tief, sodass sie Nyrco nicht sanft absetzen konnten, sondern dieser einige Schritte stolpernd über das Feld hüpfte, bis die beiden Tiere ihn schließlich losließen und er nach vorne stürzte. Doch er fiel weich: Seine Knie und Hände sanken in die kühle, frisch umgegrabene Erde. Ein paar Meter weiter landete sein Drache, nur um, ausgehungert von dem langen Flug und der schweren Last, sofort wieder aufzuspringen, einer Amsel hinterher, die gerade einen dicken Regenwurm aus dem Boden gezogen hatte.
Nachdem er einen weiten Kreis über das Feld geflogen war, kam schließlich auch der große Rabe neben Nyrcolas zur Landung. In einer fließenden Bewegung, die keine zwei Sekunden dauerte, streckte sich der schwarze Körper, die Federn zogen sich unter die Haut zurück oder wurden zu Kleidung und Haaren und die Flügel schrumpften zu Armen; nur die Augen blieben groß und schwarz. Kelda wischte sich mit dem Handrücken Schweiß von der Stirn und stapfte durch die lockere Erde zu Nyrcolas, welcher sich aufgesetzt hatte und seine tauben Arme rieb.
»Komm«, sagte die Maga gehetzt mit heiserer Stimme und reichte Nyrco ihre Hand. Dieser zuckte aus Gewohnheit zurück, doch erinnerte sich sogleich daran – wie könnte er es auch vergessen–, dass er vor Keldas Berührung keine Angst haben musste. Sie hatte nicht nur keine Monster, sie zu berühren war auch nicht verbunden mit einer Flut aus Erinnerungen – Gefühlen, Wahrnehmungen und Bildern –, wie es bisher bei fast allen anderen Menschen der Fall gewesen war. Wenn er die Maga berührte, fühlte er nur ihre Haut, mal kalt, mal warm, hier rau, dort zart.
Lächelnd nahm er Keldas Hand und ließ sich von ihr hochziehen.
»Wohin gehen wir?«
»Heute Nacht bleiben wir hier. Ich habe unweit eine Scheune gesehen, in der wir übernachten können. Morgen gehen wir zu Fuß weiter. Nach Hause.«
»Wo ist dein Zuhause?«
»In der Nähe von … Aber das wird dir nichts sagen. Mein Zuhause ist in den Bergen, einige Flugtage von hier. Doch zu Fuß … vielleicht eine Woche oder mehr. Ich weiß es nicht.«
Sie hatten den Waldrand erreicht, wo der Boden ebener und fester war. Mit der untergehenden Sonne im Rücken folgten sie ihren langen Schatten auf einem Pfad, der zwischen den Bäumen und dem Acker entlangführte.
»Und du willst, dass ich mit dir komme?«
Nyrcolas’ Frage schien Kelda genauso zu überraschen wie ihn selbst. Es lag etwas Trotziges darin, etwas Widerstrebendes.
»Möchtest du nicht?«, fragte die Maga.
Doch Nyrcolas wusste nicht, was er wollte.
Es war alles so schnell gegangen: Ben, die alte Fabrik, die Flucht auf dem unterirdischen Fluss hinaus aus Iantos in den Wald. Das Zauberritual, das Kelda und Ben durchgeführt hatten, dann der Kampf mit den Eisaugen.
Und dann: Bens Tod.
Arcane war auch tot.
Aber Ben war nicht wirklich tot, oder? Die Person, die Nyrcolas als Ben gekannt hatte, hieß eigentlich Niika. Niikas Seele hatte in Bens Körper gelebt, aber nun war Niika wieder frei und irgendwo da draußen. Kurz war Niika auch in ihm gewesen, Niikas Seele in Nyrcos Körper. Das hatte er gespürt. Es war ein schreckliches Gefühl gewesen. Aber Kelda hatte Niika vertrieben und jetzt war Niika – irgendwo.
Es war sehr verwirrend.
Nyrcolas wusste nicht, was er fühlen sollte. Einerseits trauerte er um Ben, um seinen ersten menschlichen Freund, und wollte ihn zurück, andererseits fürchtete er sich vor Niika und hoffte, dass sie sich nie wieder begegnen würden.
Und Kelda? Er kannte sie erst seit wenigen Tagen und sie war eine Maga.
Magi sind böse. Sie müssen vernichtet werden.
Aber war er nicht selbst ein Magus? Waren Ben und Arcane nicht davon überzeugt gewesen?
Kelda ist nicht dein Freund. Sie will dir wehtun. Dich töten. Dich fressen.
Nein, Kelda war nicht böse. Sie hatte ihn beschützt, vor den Kontrolleuren und vor Niika. Außerdem konnte sie sich in Vögel verwandeln und Rhys mochte sie: Wenn Rhys Kelda vertraute, dann konnte Nyrco es auch.
Aber wollte er mit ihr gehen?
Der kleine Drache und er, sie waren bisher sehr gut alleine klargekommen. Sie hatten keine anderen Menschen gebraucht, sie sogar gemieden. Meiden müssen. Trotzdem war sie schön gewesen, die kurze Zeit, die Nyrcolas mit Ben und Arcane verbracht hatte, und er hatte viel von ihnen gelernt. Aber auch Kelda wollte ihm helfen: Sie wollte ihm beibringen, mit seinen magischen Fähigkeiten umzugehen. Außerdem war da wieder diese Sache, dass Kelda anders war als die meisten Menschen. Dass er nur sich selbst spürte, wenn er sie berührte.
Und sie hatte keine Monster …
»Doch. Doch, ich möchte.«
Ihr Lächeln war wunderschön. Es erinnerte ihn an weiche Baumwolle und den Geruch von Zitronen.
Es war stockfinster im Wald, eine Wohltat für Somians Augen. Er glitt durch den substanzlosen Körper seines Mahres auf den Boden und seine nackten Zehen tauchten in etwas Nasses, Klebriges.
Blut.
Somians Blick wanderte ruhig über die am Waldboden liegenden Leichen, während er zwischen ihnen hindurchschritt. Ein dürrer Fuchs nagte an einem herausgerissenen Menschenherzen, aber ließ sich nicht durch ihn aus der Ruhe bringen, ganz anders als die Schwärme von Fliegen, die aufstoben, sobald Somians schwarzer Umhang vorbeirauschte, nur um sich sofort wieder auf den klaffenden Wunden niederzulassen oder in Mund- und Augenhöhlen zu kriechen.
Der Magus lag ziemlich am Rand der kleinen Lichtung neben der Leiche eines jungen Mannes.Erlag auf dem Rücken,die Beine unter seinem Körper eingeklappt, die Augen geschlossen, doch der Mund weit offen, ein letzter Schrei stumm auf seinen grauen Lippen.
War dies Keldas Werk?
Die meisten der anderen Toten trugen die schwarzen Anzüge der Menschenregierung. Somian bückte sich, drehte den Kopf einer jungen Frau nach vorne und schob das Lid ihres linken Auges nach oben. Es hatte schon begonnen, milchig-matt zu werden, doch das helle, eisige Blau stach noch immer auffällig hervor.
Kontrolleure. Hier hatte ein Kampf zwischen Magi und Kontrolleuren stattgefunden.
Jetzt hatten seine Bewegungen nichts mehr von königlichem Schreiten oder lautlosem Gleiten. Hastig eilte er von einer Leiche zur nächsten. Sekunden später: Erleichterung. Keldas Körper war nicht unter ihnen. Und dennoch: Sie war ihm wieder entwischt. Viel lieber hätte er sie hier gefunden, verletzt, doch am Leben – gerade so –, wehrlos, hilflos, sich dankbar in seine Arme schmiegend, wenn er sie davontrug. Nach Hause.
Nun kochte Wut in ihm auf. Der Magus hatte versagt!
In wenigen Schritten war er zurück bei Arcanes Leiche, durchsuchte seine Kleidung, fand erst nichts, dann unweit am Boden einen Schnipsel Pergament: ein Auge, ein Mundwinkel, wohlbekannt, geliebt, begehrt– die Reste einer Porträtzeichnung, die er von Kelda angefertigt hatte. Vom Schlaftrunk keine Spur.
War Kelda also hier gewesen?
Wieder sah Somian sich um, doch nirgends eine verräterische schwarze Feder, ein zierlicher Fußabdruck oder ein Fetzen ihrer Bluse, der nach ihr duftete.
Er war ihr so nahe gewesen dieses Mal. So nahe. Und jetzt?
Wo bist du jetzt?
Kapitel 2
Eine langbeinige, braune Spinne hatte ihr Netz zwischen zwei dünne Zweige gespannt, die beinahe waagerecht aus dem dicken Stamm einer knochigen Ulme wuchsen und bis fast über das mickrige Feuer reichten, das, umringt von kleinen und mittelgroßen Steinen, am Waldboden brannte. Schon die dritte Motte hatte sich, angelockt von den hellen Flammen, in den klebrigen Fäden verfangen. Je stärker sie zappelte, desto mehr verfing sie sich, desto fester hielt das Netz sie. Jetzt kam die Spinne, gerade fertig mit dem Einspinnen der letzten Motte, auf ihrem geheimen, nur ihr bekannten Pfad aus nicht klebrigen Fäden herbeigeeilt. Flinke Beinchen packten das zappelnde Insekt und im Nu hing es leblos, still, in einem weißen Kokon. Nun schnappte sich die Spinne ihre gut verpackte Beute und trug sie davon, zu einer anderen Stelle, ihrer Vorratskammer.
Rick stocherte mit einem Zweig in dem kleinen Lagerfeuer herum, das er dank eines alten Feuerzeuges, welches er am Wegrand gefunden hatte, diese Nacht hatte machen können. Er hatte sein Handy danebengelegt in der Hoffnung, die Wärme würde das Wasser verdampfen lassen und dem Gerät neues Leben einhauchen. Doch selbst wenn es nicht komplett kaputt war: Der Akku war auf jeden Fall leer.
Sein Magen knurrte, aber im Gegensatz zur glücklichen Spinne kam für ihn kein Abendessen angeflogen. Alles, was er an diesem Tag an Essbarem zu sich genommen hatte, waren ein paar bittere Löwenzahnblätter und -wurzeln gewesen. Immerhin regnete es nicht und das Feuer machte den Wald ein kleines bisschen heimeliger, auch wenn er es nicht brauchte, um nicht zu frieren. Die Nacht zuvor hatte er überhaupt nicht geschlafen, sondern hoch oben in den Ästen eines ziemlich klebrigen Nadelbaums immer ein Auge auf Bens Unterschlupf gehabt. Er wollte auf gar keinen Fall verpassen, wenn die beiden Jungs weiterzogen, in der Hoffnung, dass sie ihn irgendwann zurück in die Zivilisation führen würden. Er schätzte Ben nicht gerade als Camping-Fan ein. Außerdem fanden sie vielleicht Essen … Wenigstens waren die jungen Triebe des Nadelbaums einigermaßen genießbar gewesen.
Wieso war er bloß Ben und Iusta Ponds Kontrolleuren durch die Kanalisation gefolgt? Er hätte Varenna und Huug einfach ihren Job machen lassen und zurück zum Hotel gehen sollen. An ihrem schlussendlichen Versagen hatte er schließlich auch nichts mehr ändern können.
Lächerlich, dass er sich einmal in die Begrenztheit der Hauptstadt mit ihren Zäunen und Mauern – der Mauer – zurückwünschen würde. Doch tat er das wirklich? Weshalb war er dann noch hier, mitten im Nirgendwo, und nicht zurückgekehrt?
Weil ich nicht kann, sagte Rick sich immer wieder. Varenna und Huug sind tot. Pond hat sie auf meinen Anruf hin zur Fabrik geschickt. Sie wird mich für ihren Tod verantwortlich machen.
Unweigerlich sah er Varennas eingedellten, blutenden Kopf im geisterhaft blauschimmernden Wasser vor sich und dann: Ben. Bens leere Augen, sein blutiger Pulli.
Rick schüttelte ungeduldig den Kopf.
Es war nicht seine Schuld. Nicht wirklich. Er hatte ihn ja sogar warnen wollen!
Sein Magen knurrte laut. Er hatte schon Kopfschmerzen vor Hunger. Doch mit diesen Kopfschmerzen konnte er leben. Sie waren nichts im Vergleich zu denen, die nur mit Mageia, einer magischen Droge, gelindert werden konnten. Zum Glück hatte ihm Varenna ein bisschen mitgebracht. Zum wiederholten Mal tasteten seine Finger nach dem kleinen Plastiktütchen in seiner Tasche, das wie durch ein Wunder auf der nassen Reise aus Iantos hinaus dichtgehalten und das kostbare, bunt schimmernde Pulver geschützt hatte. Auch wenn er hier draußen, weit genug von den Menschen und ihren Wünschen und Verlangen entfernt, das Mageia nicht brauchte, flüsterte es immer wieder zu ihm, wisperte verführerisch, lockte ihn: Es könnte ihm beim Einschlafen helfen, ihn die Ereignisse und Bilder der letzten Stunden vergessen lassen. Es versprach sogar, seinen Hunger zu stillen.
Doch Rick hatte nicht vor, für immer in diesem gottverlassenen Wald zu bleiben. Vorfahren und Elfengene hin oder her. Er wollte ein normales Leben führen mit Fast Food, Toiletten, Internet und Handys ohne Wasserschaden. Mit Computerspielen, Serien-Marathons, Bier und Schokolade. Er musste zurück in die Zivilisation und dafür brauchte er den Rest Mageia, musste es aufsparen, bis er neues kaufen konnte. Geld hatte er immerhin genug.
Er hatte wirklich, wirklich großen Hunger.
Ob diese Pilze dort unter den Bäumen essbar waren?
Wenn er wenigstens jagen könnte. Oder Fallen stellen. Aber dann müsste er das Tier ja auch töten. Häuten. Aufschlitzen. Ausweiden. Schon der Gedanke daran reichte aus, um seinen Hunger in Übelkeit zu verwandeln. Vielleicht war das ja ein guter Trick? Er könnte sich so lange extrem widerliche Dinge vorstellen, bis er einschlief. Morgen, im Tageslicht, würde er sich dann auf den Weg zur nächsten Stadt machen.
Es half nichts. Selbst an Ben zu denken, tot, half nicht, seinen Hunger zu verdrängen. Es erinnerte ihn vielmehr an Pizzaessen. Schließlich löschte Rick das Feuer und stand auf. Er hatte keine Ahnung, wo die nächste Siedlung war, doch er wusste, wo die nächsten Menschen waren. Vielleicht hatten Ben und seine Freunde oder ihre Gegner irgendetwas Essbares bei sich gehabt. Das brauchten sie jetzt schließlich nicht mehr und warum sollte Rick es den tierischen Waldbewohnern überlassen, welche Futter im Überfluss hatten?
Den Weg zurück zur Lichtung fand Rick trotz Dunkelheit ohne Probleme. Schon bald war der Gestank von Blut und Fäkalien so stark, dass Rick einige Male trocken würgen musste. Er zog den Ärmel seines Sweaters über seine Hand und hielt ihn über Mund und Nase. Sein Atmen war heiß und feucht und er bekam kaum Luft, doch es war besser, als das zu riechen.
Sobald die Bäume sich lichteten, konnte Rick die Füße der ersten Leiche auf dem dunklen Waldboden erkennen – weiße Sneakers: Bens Körper lag noch immer an derselben Stelle, an der Rick ihn zurückgelassen hatte, als er Hals über Kopf in den Wald geflohen war. Irgendwie bescheuert, dachte er, dass mich das wundert. Wo soll Bens Leiche auch hin? Oder hatte er erwartet, dass wilde Tiere sie ins Unterholz gezerrt hatten?
Vielleicht sollte ich ihn begraben.
Schwachsinn. Was, wenn er dabei gesehen wurde? Wenn er Spuren hinterließ? Er konnte sich auch gleich der Polizei stellen und ein umfassendes Geständnis abliefern, dass er all diese Menschen auf der kleinen Lichtung im Grenzwald getötet hatte.
Essen. Ich muss Essen finden. Und zwar schnell, bevor jemand kommt.
Gerade hatte er sich soweit zusammengerissen, um die Lichtung zu betreten, als er etwas hörte, das ihn in seiner Bewegung erstarren ließ. Erst dachte er, es wäre nur das Rauschen des Windes, doch es fühlte sich falsch an, beinahe bedrohlich, noch bevor er realisierte, dass es so gut wie windstill war und sich die Bäume kaum bewegten. In der nächsten Sekunde stand ein dürrer Mann mit langen, schwarzen Haaren, blauschwarzer Haut und einem schwarzen, bodenlangen Umhang inmitten der Toten. Rick gelang es gerade noch, sich zurück in die Büsche zu flüchten. Er konnte weder das Gesicht des Fremden sehen noch dessen Wünsche wahrnehmen, was merkwürdig war, dennoch überkam ihn ein starkes und ebenso unerklärliches Gefühl der Abneigung. Wer war dieser Mann? Was war er? Und was wollte er? Letzteres wurde schon nach Kurzem ersichtlich: Er schien zwischen den Toten nach etwas oder jemandem zu suchen. Nach wenigen Minuten verschwand er jedoch wieder, ohne etwas mitgenommen zu haben. Abermals war dieses merkwürdige Rauschen zu hören und Rick erschauderte unwillkürlich, dann war der Mann fort. Spurlos mit der Dunkelheit verschmolzen. Oder hatte er sich einfach in Luft aufgelöst? Vielleicht war er davongeflogen. Das, was Rick für einen Umhang gehalten hatte, hätten gewiss auch Flügel sein können. Sicher konnte er sich bei den schlechten Lichtverhältnissen nicht sein.
Erst nach zehn Minuten, als Rick überzeugt davon war, dass der Fremde fort war, wagte er sich selbst auf die Lichtung. Seine Beine schmerzten vom regungslosen Kauern und er musste sie ein paar Mal kräftig schütteln, dennoch hatte er das Gefühl, wie auf Eiern zu gehen, als er schnell zwischen den Toten hindurchlief und nach Dingen Ausschau hielt, die Nahrung beinhalten konnten. Rick versuchte, dabei nicht zu Ben zu schauen, doch egal, wohin er blickte, der leblose Körper des Jungen zwang sich immer wieder über Ricks Augenwinkel in sein Sichtfeld. Schließlich trat er doch zu ihm.
Irgendwie sieht er ganz anders aus, dachte Rick, als er auf den Leichnam herabblickte. Aber wahrscheinlich traf das auf alle toten Menschen zu.
Von den anderen erkannte er niemanden wieder. Die meisten waren Kontrolleure in schwarzen Anzügen, denen er keine Beachtung schenkte. Außer Ben gab es nur eine Person in ziviler Kleidung: eine Frau mit kurzen Haaren in Jeans und rotkariertem Hemd, doch ihr Gesicht war ihm fremd. Von dem Drachenjungen und der Maga fehlte jede Spur. Sie schienen überlebt zu haben.
Nun fiel es Rick schwer, seinen Blick von Ben loszureißen.
»Tut mir leid«, murmelte er nach großer Überwindung. Er ging neben Bens Leiche in die Hocke, strich ihm mit dem Rücken seiner Finger über die eiskalte Wange und beugte sich hinunter, um Bens Stirn zu küssen, konnte sich dann aber doch nicht überwinden.
Könnte er zaubern, hätte er Ben doch gerne begraben. Die Vorstellung, dass sein Körper hier offen herumlag und bald von allerlei wilden Tieren angenagt und auseinandergerissen wurde, behagte Rick nicht. Hoffentlich würde ihn bald jemand finden. Bei der Anzahl von toten Kontrolleuren, die spätestens am nächsten Morgen vermisst wurden, würde es bestimmt nicht lange dauern, bis jemand die Leichen fand. Er sollte sich wirklich beeilen und so schnell es ging verschwinden.
Endlich riss sich Rick von Ben los und suchte mit brennenden Augen weiter nach Proviant, bis er nur wenige Meter entfernt an einen Baumstamm gelehnt Bens große, schwarze Sporttasche fand. Er hatte sie die ganze Zeit für einen Felsen gehalten, bis ihm der glänzende Reißverschluss aufgefallen war. Gierig riss er ihn auf und wühlte in der Tasche herum, bis seine Finger zwischen all der Kleidung, Drogerieartikeln und Kleinkram auf eine knisternde Plastikverpackung stießen.
Yes!
Schokokekse waren ja so schon sehr geil, aber in dieser Nacht schmeckten sie Rick besonders gut. Doch er schob sich nur zwei davon in den Mund, gleichzeitig, bevor er den Reißverschluss wieder zuzog und die Tasche schulterte.
Nichts wie weg von hier.
Rick stakste durch den Wald, bis seine Beine ihn nicht mehr weitertragen wollten und er sich einen Schlafplatz suchen musste. Obwohl ihn immer wieder Bens blasses, lebloses Gesicht einholte, sobald er die Augen schloss, fiel sein ausgelaugter Körper rasch in einen tiefen, doch viel zu kurzen Schlaf.
Kapitel 3
Erschöpft sank Kelda ins Stroh und erlaubte sich, ein paar Sekunden lang die Augen zu schließen. Auf dem Heuboden über ihr raschelte und quiekte es: Rhys war sofort auf die Jagd nach Mäusen gegangen, sobald sie die Scheune betreten hatten. Das Wohnhaus war nicht weit entfernt, weshalb sie leise sein mussten, doch solange man nur tierische Geräusche hörte, waren sie hoffentlich sicher davor, entdeckt zu werden. Sorgen machte sie sich sowieso nicht um sich selbst, sondern um Nyrcolas, der offenbar wenig Erfahrung mit Menschen hatte und sich nicht an sein Leben vor Iantos erinnern konnte. Doch auch wenn sie sich sicher war, dass der Junge große Angst vor dem Unbekannten hatte, das ihn hier draußen erwartete, bewunderte sie den Mut und die Stärke, mit welchen er die vergangenen traumatischen Ereignisse hinzunehmen schien. Wahrscheinlich hatte er in seinem Leben schon vieles erlebt, das schlimmer war. Schlimmer als der Tod seiner beiden einzigen Freunde. Kelda fühlte einen Kloß in ihrem Hals und verwandelte sich in eine Krähe, um hoch auf den Heuboden zu Nyrcolas zu fliegen, welcher Rhys hinterhergeklettert war und irgendetwas im Stroh zu suchen schien.
»Kann ich dir helfen?«, fragte Kelda, wieder in ihrer menschlichen Gestalt. »Hast du etwas verloren?«
»Nein, ich baue mir ein Bett«, sagte Nyrcolas. »Soll ich dir auch eins bauen?«
»Vielen Dank, aber das ist nicht nötig. Ich werde als Vogel schlafen und brauche dafür kein Bett.«
Nyrcolas hielt inne in seiner Arbeit, richtete sich auf und sah sie stirnrunzelnd an.
»Wieso schläfst du als Vogel? Kann man als Vogel besser schlafen als als Mensch?«
»Nicht wirklich«, sagte Kelda. »Aber es ist sicherer. Wenn ich mich in mehrere Vögel verwandle, kann ein Teil von mir schlafen, während der andere wach bleibt und aufpasst.«
»Das klingt sehr anstrengend«, seufzte Nyrcolas.
Keldas Mundwinkel zuckten.
»Ich habe mich daran gewöhnt.«
»Musst du aufpassen, dass die Eisaugen dir nicht weh tun?«
Kelda presste ihre dünnen Lippen zu einem Strich zusammen. »Haben die Eisaugen dir weh getan, Nyrcolas?«, fragte sie leise.
Irgendetwas veränderte sich bei der Frage in den Augen des Jungen. Waren sie zuvor freundlich und aufgeschlossen gewesen, neugierig und wissbegierig, so legte sich jetzt ein dunkler Schleier über das leuchtende Türkis seiner Iris. Er zuckte kurz mit den Schultern und wendete sich wieder dem Stroh zu. »Ich muss ein Bett bauen, es ist schon spät.«
Kelda nickte stumm, doch ihr Blick ruhte weiterhin auf dem Jungen: seine schmale Gestalt, das verfilzte, blonde Haar, die beinahe unsichtbaren, feinen Bartstoppel, die im goldenen Licht der Abendsonne, die durch die Dachluken der Scheune schien, hell aufblitzten. Nicht älter als siebzehn oder achtzehn würde sie ihn schätzen, wüsste sie nicht genau, wie alt er wirklich war, der menschliche Alterungsprozess nach dem Ende des Wachsens um ein Vielfaches verlangsamt durch die Magie, die durch seine Adern floss.
Schließlich musste sich Kelda abwenden. Aus den unzähligen Taschen ihres mehrlagigen, bodenlangen Rockes – manche Taschen sichtbar, manche unsichtbar, manche stinknormal und manche aus einer anderen Welt – holte die Maga ein paar schrumpelige Rüben, eine Flasche Wasser und eine Orange. Sie legte alles neben Nyrco ins Stroh, murmelte etwas von »Abendessen« und sprang vom Heuboden. Noch in der Luft zerbrach ihr fallender Körper in fünf Elstern, die elegant mit weit ausgebreiteten Flügeln nach unten glitten. Zwei segelten aus dem Scheunentor hinaus und ließen sich nach zehnminütigem Kreisen oben auf dem Dach auf den beiden Enden des Firsts nieder, um über die Schlafenden zu wachen. Ein dritter Vogel flatterte hinauf in das Gebälk des Heubodens, von wo aus er Nyrcolas im Blick behielt. Die zwei übrigen Elstern suchten sich ein dunkles, geschütztes Eck, um zu schlafen.
Der wachsame Vogel auf dem breiten Holzbalken beobachtete, wie Nyrcolas sorgsam das Stroh flach aufeinanderschichtete und es nach einer kurzen Suche mit einem alten, zerrissenen Leinensack bedeckte, welchen er in einer Kiste mit allerlei verrostetem Werkzeug gefunden hatte. Erst dann schien er das Essen zu bemerken. Er setzte sich auf sein Strohbett und trank etwas Wasser, bevor er leise nach Rhys rief. Es dauerte keine fünf Sekunden, da stob der dunkle, mal rot, mal violett schimmernde Drache aus einem Heuhaufen. Ein schlaffer Mäuseschwanz baumelte aus seinem Mundwinkel, als sich das Reptil kauend neben Nyrcos Füßen niederließ.
»Dir gefällt es hier, nicht wahr?«, fragte Nyrcolas den Drachen und begann, die Orange zu schälen.
Rhys hob den Kopf, der mittlerweile so groß war wie Nyrcos Unterarm lang, und sah den Jungen an.
»Hier draußen, meine ich. Außerhalb der Stadt, unserer Kanalisation. Du wächst ja schneller, als ich gucken kann!«
Rhys schnupperte an den Orangenschalen, die neben ihm auf den Boden fielen, und zuckte niesend zurück.
Nyrcolas seufzte. »Ich hoffe so sehr, dass deine Brüder und Schwestern auch rausgefunden haben und auf der anderen Seite der Mauer ein schöneres Leben führen als in Iantos. Vielleicht gibt es ja irgendwo mehr von den warmen Leuchtkugeln. Das wäre toll.«
Er drehte die halb geschälte Orange in der Hand, bis die ungeschälte Seite zu ihm zeigte. Sie erinnerte ihn an die leuchtenden Sonnen aus Glas, so groß wie Wassermelonen, die in dem unterirdischen Turm in Iantos’ Kanalisation rings um den Wasserfall in den Boden eingelassen waren und nicht nur ihm jahrelang Licht und Wärme gespendet hatten, sondern auch den vielen kleinen Drachen, die sich dort pudelwohl fühlten und immer mehr wurden. Als er jedoch vor ein paar Wochen in die Kanalisation zurückgekehrt war, waren die Kugeln verschwunden – und mit ihnen die Drachen. Die Erinnerung an sein zerstörtes Heim machte ihn traurig und umso mehr das, was alles danach passiert war. Die Flucht vor den Eisaugen auf dem unterirdischen Fluss, das gruselige, doch zugleich faszinierende Zauberritual, das Ben und Kelda im Wald durchgeführt hatten, der schreckliche Kampf, bei dem Arcane, der Feuermann, ums Leben gekommen war, und schließlich Ben, nein: Niika. Niikas Seele, die auf einmal in ihm war und versuchte, ihn zu erdrücken. Doch Kelda hatte ihn gerettet.
Sie hatten es ihm erklärt, Ben und Arcane in der alten Fabrik und vorhin noch einmal Kelda auf dem Weg zur Scheune, und doch war es für Nyrcolas schier unmöglich zu begreifen, dass die Person, die er als Ben kennengelernt hatte, in Wahrheit Niika war, eine körperlose Seele, die sich Bens Körper gewaltsam angeeignet hatte, wie sie es am Ende auch mit Nyrcolas’ versucht hatte. Er sollte also nicht um Ben trauern und ihn vermissen, denn Niika war böse, doch Ben war immer sehr nett zu ihm gewesen, sein erster menschlicher Freund. Seine neue Familie. Und Ben hatte ihn mitnehmen wollen. Er hatte ihm beibringen wollen, wie man zauberte. War das alles gelogen gewesen? Hatte Niika nie vorgehabt, Nyrcolas zu helfen?
Nyrco ließ die Orange sinken und wischte sich die Tränen aus den Augen, doch es flossen sofort neue nach. Leise schluchzend vergrub er das Gesicht in seinen Händen. Sofort legte Rhys seinen Kopf auf Nyrcolas’ Knie. Über ihm flatterte die Elster auf einen näheren Balken.
Vielleicht hätte er es vorher wissen müssen. Bens – Niikas – Monster war groß und stark gewesen und Nyrcolas hatte es nicht vertreiben können, auch wenn er es Ben zuliebe versucht hatte.
»Mach dir keine Sorgen, Rhys«, murmelte Nyrcolas, zog die Nase hoch und wischte sich das Gesicht an seinen Ärmeln trocken. »Mir geht es gut.Jetzt muss ich wenigstens keine Angst mehr vor den ganzen Monstern haben, solange wir im Wald sind, so weit von den Menschen entfernt. Kelda hat nämlich keins.«
Stirnrunzelnd schälte er die Orange zu Ende und schob sich zwei Stücke in den Mund. Wieder einmal fragte er sich: Wieso hatte Kelda kein Monster? Nicht jeder Mensch hatte ein Monster, doch die meisten schon. Auch wenn sie oft klein und schwach waren, war er kaum Menschen begegnet, die keins hatten, und noch nie jemandem wie Kelda, die selbst von Albträumen und den kleinen Schatten in Ruhe gelassen wurde. Noch viel verwirrender war, wieso er Kelda berühren konnte, ohne in ihrem Kopf zu landen, bombardiert von Ängsten, Erinnerungen und Schmerzen. Dass die Albträume sie in Ruhe ließen, lag vielleicht daran, dass immer nur ein Teil von ihr schlief – und das als Vogel. Nyrcolas verputzte den Rest der Orange und wischte sich die klebrigen Hände an der Hose ab. Suchend sah er sich um und fand tatsächlich zwei Albträume, die in den immer dunkler werdenden Ecken und Winkeln der Scheune zusammen mit ein paar kleinen Schatten lauerten. Er hörte sie, hörte ihr hungriges Flüstern und gieriges Fauchen, doch so sehr sie auch schnüffelten und suchten, sie fanden keinen Schlafenden und verschwanden irgendwann wieder zwischen den Holzbalken und Strohhalmen. Wahrscheinlich würden bald noch mehr kommen, wenn die Sonne untergegangen und die Nacht hereingebrochen war, aber Nyrcolas beunruhigte das nicht. Manchmal schätzte er ihre Gesellschaft sogar. Letztendlich waren sie wie Tiere, die einfach ihren Instinkten folgten, und besonders die kleinen Schatten waren eigentlich sehr niedlich.
Versuchsweise biss er von einer der beiden Rüben ab, die Kelda ihm gegeben hatte, doch verzog schnell das Gesicht und würgte sie nur mit aller Mühe hinunter. Bildete er es sich nur ein oder sah ihn der Vogel vorwurfsvoll an?
»Kelda, warum sehen die Albträume dich nicht?«
Doch die Elster blickte ihn lediglich mit starren, pechschwarzen Augen an und zupfte mit ihrem Schnabel eine Feder zurecht. Nyrcolas wusste, dass sie ihn auch als Vogel verstand, so wie Rhys, doch vielleicht fiel es ihr schwerer, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Körper aufteilen musste. Er wollte sie am nächsten Tag noch einmal fragen, wenn sie wieder ein Mensch war.
Die Sonne war lange untergegangen, als Nyrcolas endlich zur Ruhe kam und die Augen schloss. Rhys hatte sich schon vor Stunden am Fußende von Nyrcos Strohbett zusammengerollt, doch die Elster im Gebälk sowie die beiden auf dem Dach hielten bis zu den ersten Sonnenstrahlen am frühen Morgen Wache.
Keldas schlanke Finger schwebten eine Sekunde lang über Nyrcolas’ Wange, dann legte sie ihre Hand auf seine Schulter und rüttelte ihn leicht, bis er grunzte und blinzelnd die Augen öffnete.
»Wir müssen weiter. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.«
»Noch ein paar Minuten«, brummte Nyrcolas und drehte Kelda den Rücken zu.
»Gut«, sagte die Maga und setzte sich auf einen Heuballen, von wo aus sie den Scheuneneingang im Blick hatte. Sie löste die Schleife, die ihren langen, geflochtenen Zopf zusammenhielt, und zog eine breite Bürste mit Wildschweinborsten aus einer ihrer Rocktaschen. Während sie ihre aschblonden Haare gründlich durchkämmte und von Knoten, kleinen Zweigen und einigen flauschigen Pappelpollen befreite, dachte sie darüber nach, welche Route sie weiter einschlagen sollten. Sie kannte sich in der Umgebung um Iantos nicht so gut aus, da sie wie die meisten Magi die Hauptstadt mied, und was Fußwege und Straßen betraf, war sie völlig ahnungslos. Sie würde immer wieder als Vogel vorausfliegen müssen, die Gegend erkunden, den besten Weg finden, um Nyrcolas zu leiten. Zumindest so lange, bis sie Allnau erreicht hatten, der nächstgelegene Ort, der einen Eingang zum NoWer besaß. Doch auch bis dorthin würden sie sicherlich mindestens einen Tag zu Fuß unterwegs sein. Nyrcolas tragen und fliegen, dafür fehlten ihr jetzt die Kräfte, und ohne einen langen, erholsamen und vor allem vollkommenen Schlaf würde es einige Tage dauern, bis sie gestärkt genug war, um den Jungen länger als ein oder zwei Stunden am Stück tragen zu können, selbst mit Rhys’ Hilfe.
Wer wohnt hier in der Nähe? So nah an Iantos niemand … Am nächsten wahrscheinlich Tarek in Mön. Ich könnte zu ihm fliegen, ihn um Hilfe bitten und zu Nyrcolas führen.
Doch diesen Gedanken verwarf Kelda sofort wieder. Sie wollte Nyrco nicht so lange alleine lassen, denn sie waren noch immer viel zu nah an Iantos und seinen unzähligen Kontrolleuren. Zwar gab es in jeder Stadt und in jedem noch so kleinen Dorf mindestens einen, doch am gefährlichsten war es für Magi in der Hauptstadt. Außerdem hatten sie mittlerweile sicher die Toten entdeckt und ihre Kontrollen des Grenzwaldes verstärkt. Kelda konnte – durfte es einfach nicht zulassen, dass sie Nyrcolas in die Finger bekamen.
Als sie sich zu ihm umblickte, saß er regungslos auf seinem Strohbett und beobachtete sie. Kelda ließ die Bürste in den vielen Falten ihres Rocks verschwinden. Mit flinken Fingern flocht sie ihre langen Haare zu einem dicken Zopf und warf ihn über ihre Schulter nach hinten. Nyrcolas starrte sie noch immer an. Sie wollte gerade etwas sagen, als er den Blick von ihr abwandte und aufstand.
»Ich hatte gerade eine komische Erinnerung«, sagte er, doch noch bevor Kelda etwas antworten oder nachfragen konnte, war er vom Heuboden geklettert. »Ich geh Pipi machen!«, rief er und rannte aus der Scheune.
Kelda warf Rhys, der sich verschlafen im Stroh streckte, einen kurzen Blick zu und er flog dem Jungen hinterher.
Kapitel 4
Die Sonne war noch nicht einmal aufgegangen, da hatten die Vögel schon zu kreischen begonnen. Zu kreischen, nicht zu zwitschern: Rick war sich ziemlich sicher, dass das, was die Viecher da veranstalteten, niemand mit einem so sanften und fröhlichen Wort wie »zwitschern« bezeichnen konnte. Missgelaunt und mit steifem Nacken machte er sich nach einer kurzen Morgentoilette auf den Weg. Wohin? Irgendwo war doch dieser Fluss. Dem würde er folgen, dann konnte er sich wenigstens nicht verlaufen. Bestimmt würde er bis zum Abend die nächste Stadt erreichen. So weit konnte es ja gar nicht sein. Dort würde er in der erstbesten Pension einchecken, duschen, sich einen Haufen Essen aufs Zimmer bestellen, schlafen und am nächsten Tag ein Auto mieten und dann … Na ja, darüber konnte er ja dann morgen nachdenken. Er wollte schon immer mal ans Meer oder in die Berge. Eine Kleinstadt mit allen Annehmlichkeiten sowie einem gutlaufenden Mageia-Markt. Sicher würde er Iantos und das Großstadtleben vermissen, aber hey, Abwechslung war auch nicht verkehrt. Eine neue Stadt, ein neues Leben. Er freute sich sogar darauf!
Den Fluss hatte er jedoch bis zum späten Nachmittag nicht wiedergefunden. Als er nach einer weiteren Stunde endlich den Mut dazu fand, auf einen hohen Baum zu klettern, um sich einen Überblick zu verschaffen, sah er nicht nur keinen Fluss, sondern außer einem Meer von grünen Wipfeln vor allem eins: Iantos im glühenden Orange der frühen Abendsonne, viel zu nah. Offensichtlich war er mindestens einen halben Tag lang in die falsche Richtung gelaufen!
Siehst du, Oma, ich bin kein dummer, naturliebender Elf. Ich hasse den Wald! Ich kann mich nicht nur nicht daran erinnern, was hieressbar ist und was nicht, ich verlaufe mich auch erstklassig darin. Dabei ist es nicht einmal ein besonders großer Wald!
Und wenn er doch nach Iantos zurückkehrte? Vielleicht war das ja ein Zeichen. Der Wald mit all seinen toten Vorfahren kämpfte gegen Rick, den Verräter. Wahrscheinlich würde er hier draußen schneller sterben, als wenn er zu Pond ginge und ihr erzählte, dass er sie hintergangen hatte.
Er könnte Pond aber auch einfach die Wahrheit sagen. Oder eine Wahrheit. Dass er Varenna und Huug gefolgt war, um ihnen dabei zu helfen, die Maga zu fangen. Dass die Maga jedoch zu stark gewesen war, die beiden Kontrolleure getötet hatte und Rick gerade so mit dem Leben davongekommen war. Schrammen und Prellungen hatte er ja genug von seiner halsbrecherischen Reise durch Iantos’ Kanalisation, dem unterirdischen Fluss und schließlich diesem mörderischen Wald. Also was sprach dagegen, einfach zurück nach Hause zu gehen, seinen Job für Iusta Pond wiederaufzunehmen und weiterhin alle Vorzüge der Hauptstadt zu genießen?
Rick fand keine zufriedenstellende Antwort und doch hatte er sich bereits in derselben Sekunde entschieden: Er würde nicht zurückkehren. Sein altes Leben war seit Bens Tod vorbei, oder, wenn er ehrlich mit sich selbst sein wollte, schon viel früher.
Vorsichtig kletterte Rick wieder hinunter. Ein helles Blitzen ließ ihn erst zusammenzucken, dann neugierig nach der Quelle suchen. Zwischen all den grünen Wipfeln fand er etwas Braunes, Eckiges mit Fenstern und Solarzellen auf dem Dach, die das Sonnenlicht reflektierten. Ein Baumhaus? Es war nicht weit entfernt und Rick schaffte es wider seiner eigenen Erwartung, es in wenigen Minuten zu erreichen, ohne sich dabei zu verlaufen. Ein breiter, festgetretener Waldweg führte geradewegs an der Hütte vorbei und unter dem großen, dickstämmigen Baum, in dem sie thronte, reihten sich einige Gemüse- und Blumenbeete aneinander.
Er hatte mit nicht viel mehr als einem Ausguck für Jäger gerechnet, doch was er vorfand, nachdem er die hölzerne Leiter nach oben geklettert war, vorsichtig die Luke anhob und durch den Spalt lugte, glich vielmehr einer gemütlichen, wenn auch rustikalen Einzimmerwohnung. Da Rick weder jemanden sah noch hörte oder seine Wünsche fühlte, stieß er die Luke ganz auf und schlüpfte hindurch. Nachdem er die Luke wieder geschlossen hatte, ließ er Bens Tasche darauf sinken.
Das Baumhaus war wirklich nicht sehr geräumig, doch es war sauber und roch nach einer Mischung aus Tannennadeln und Äpfeln. Wer auch immer hier hauste, hatte die Hütte erst vor Kurzem verlassen. Doch wann würden sie zurückkehren?
Als Erstes nahm Rick den kleinen Kühlschrank unter die Lupe: frisches Gemüse, ein ganzer Ring Hartwurst, fünf Eier, Butter und ein halbes Laib Käse sowie einige Kartons Milch und Flaschen mit Mineralwasser. An der Salami kauend sah sich Rick um. Das Bett war ordentlich gemacht und mit einer gehäkelten Tagesdecke überzogen. Es gab eine Kochplatte und eine Spüle, darunter einen Vorratsschrank mit allerlei Konservendosen und Einmachgläsern, einen kleinen Küchentisch, auf welchem eine Schale mit Obst, eine Box mit Knäckebrot, ein Frühstücksbrettchen und ein Taschenmesser lagen, einen Stuhl mit einem plattgesessenen Sitzkissen und einen Kleiderschrank, dessen Tür beim Öffnen quietschte. Darin hingen zwei Paar Jeans und eine Handvoll Hemden, einige einfarbige T-Shirts sowie ein schwarzer Anzug. In einer Kiste darunter fand Rick Socken und Frauenunterwäsche. Das Bett stand direkt unter einem der drei Fenster und ein schmales Fensterbrett diente sowohl als Nachttisch als auch als Regal. Zwischen dem Foto eines kleinen Mädchens mit seinen Eltern und einer halb geleerten Wasserflasche entdeckte Rick einen älteren E-Reader und ein Notizbuch, auf dessen Umschlag aus schwarzem Leder auf der Vorderseite in geschwungenen Goldlettern »Hannes« gestanzt war. In einer kleinen Gummischlaufe an der Seite steckte ein Bleistift.
Rick ließ sich aufs Bett fallen und blätterte durch das Büchlein. Die Schrift war klein und krakelig und es fiel Rick schwer, den Gedanken des Verfassers zu folgen. Manchmal war er sich sicher, dass es ein einfaches Traumtagebuch war, doch dann stieß er immer wieder auf Sätze oder stichwortartige Notizen, die nach der Sammlung von Informationen über eine Person oder nach einem Überwachungsprotokoll aussahen. Wer war dieser Hannes? Und wie würde er reagieren, wenn er Rick in seinem Baumhaus fand? Rick beschloss, sich nur noch ein paar Minuten auszuruhen, bevor er alles, was er gebrauchen konnte, einpacken und weiterziehen würde.
Das kühle Licht der frühen Morgensonne kitzelte seine Nase, als Rick fast zwölf Stunden später aufwachte. Seit Wochen hatte er nicht so gut und tief geschlafen und er mümmelte sein Gesicht in das fluffig-weiche Kissen. Es dauerte ein paar Minuten, bis sich die Ereignisse der letzten Tage zurück in sein Bewusstsein gekämpft hatten.
Ben ist tot. Und ich bin auf der Flucht. Shit, bin ich etwa eingeschlafen?
Das wohlige Gefühl von Geborgenheit und Zufriedenheit verschwand wie von eiskaltem Wasser weggespült und hinterließ ein dunkles Loch aus Trauer und Ungewissheit.
»Eine Dusche wäre jetzt toll«, murmelte Rick und erschrak über den rauen Klang seiner Stimme, die Stimmbänder träge vom langen Schlafen. Irgendwo musste der Baumhausbewohner doch aufs Klo gehen und sich waschen, oder ging er dafür in den Wald? Direkt neben dem Kühlschrank fand Rick jedoch eine schmale, in die hölzerne Wand geschnittene Tür, die in eine winzige Toilette führte. Der Raum schien gleichzeitig als Dusche zu dienen, denn an der linken Wand hing eine Duschbrause und in der Mitte des gefliesten Bodens war ein Abfluss eingebaut.
Rick überlegte ernsthaft, eine Dusche zu nehmen, doch dann entschied er sich dagegen. Er hatte sich schon viel zu lange hier aufgehalten und konnte von Glück reden, dass ihn niemand überrascht hatte, als er schlief. Also benutzte er nur die Toilette, wusch sich Hände und Gesicht und beeilte sich dann, so viel Nützliches wie möglich aus der Hütte in Bens Tasche zu stopfen. Neben den meisten Lebensmitteln, einem Messer und dem E-Reader – hey, die Batterie war fast voll und so alleine im Wald konnte es schnell langweilig werden! – nahm Rick zwei Hemden und mehrere Paar Socken, drei T-Shirts und ein Deo mit. Nur weil er ein Obdachloser war, der sich durch die Wildnis kämpfte, musste er nicht wie einer aussehen und riechen! Bens Deo wollte er lieber nicht benutzen, um nicht den ganzen Tag lang Bens Geruch in der Nase zu haben. Nach kurzer Überlegung packte er auch die Häkeldecke ein. Der Waldboden konnte manchmal ganz schön hart und ungemütlich sein.
Mit einem Apfel zwischen den Zähnen schulterte Rick die Tasche und zog die Luke nach oben, als darunter zwei elektrische Motorräder leise summend zum Stehen kamen. Die plötzliche Nähe zu Menschen schickte einen stechenden Schmerz in Ricks Schläfen und Stirn, sodass ihm kurz schwarz vor Augen wurde und er das Gleichgewicht verlor. Die Luke glitt ihm aus der Hand und knallte zu.
»Da oben ist jemand«, hörte Rick eine dumpfe Stimme rufen, während er mit zitternden Fingern das Mageia-Tütchen aus der Hosentasche fummelte.
»Hannah?«, rief eine zweite Stimme, diese klarer.
Das Plastiktütchen rutschte Rick aus den Fingern und fiel auf den Boden. Etwas von dem in allen Regenbogenfarben schimmernden Pulver rieselte durch die Öffnung auf das dunkle Holz.
»Hannes. Hannes ist tot, hab ich doch gesagt«, brummte eine dritte Stimme. »Wir sollen nach Hinweisen suchen, die uns zu den Drecksmagi führen, die für das Massaker verantwortlich sind. Vielleicht hat Hannes sie schon länger beobachtet und Notizen gemacht.«
Rick war auf den Knien, leckte das verschüttete Mageia vom Boden und konzentrierte sich darauf, sich nicht vor Schmerzen zu übergeben.
Scheiß Kontrolleure und ihre unterdrückten Gefühle.
Ihr Wunsch nach Rache und der Vernichtung alles Magischen trieben ihm die Galle hoch, doch die magische Droge wirkte schnell und schon war Rick wieder auf den Beinen, den Rest Mageia sicher in der Hosentasche verstaut. Eilig schloss er den kleinen Riegel der Luke, gerade als er die Holzsprossen der Leiter quietschen hörte, kippte den Esstisch um, sodass alles darauf polternd zu Boden fiel, und zog ihn auf die Luke.
»Habt ihr das gehört? Da ist wirklich jemand drin!«, hörte Rick viel zu nah und deutlich die Stimme einer Kontrolleurin und in der nächsten Sekunde stieß etwas von unten gegen das Holz. Doch Rick hatte nicht vor, sich im Baumhaus zu verbarrikadieren und darauf zu hoffen, dass Riegel und Tisch die drei Anzugträger lange aufhalten würden. Schon hatte er das Fenster über dem Bett geöffnet und angelte nach dem Ast eines nahestehenden Baumes, doch Bens Tasche blieb im Fensterrahmen hängen, als Rick sich hinüberzog. Ein lautes Knacken verkündete das Ende des kleinen Riegels, der die Luke verschloss. Rick zog kräftig an der Tasche, sie löste sich, der Gurt glitt ihm aus den Händen und die Tasche fiel in die Tiefe, alles mit sich reißend, was auf dem Fenstersims lag.
Der Küchentisch bot so gut wie keinen Widerstand und rutschte rumpelnd gegen den Kleiderschrank, als die Kontrolleurin die Luke aufstieß.
Rick klammerte sich an den Baumstamm und versuchte, sich hinter ein paar spärlichen Ästen mit jungen Blättern zu verstecken, als auch schon das Gesicht einer brünetten Frau mit eisblauen Augen im Fenster erschien. Rick hielt den Atem an und presste sich gegen die Borke. Am liebsten wäre er in den Baumstamm hineingekrochen, mit ihm verschmolzen. Dann sah die Kontrolleurin zu ihm und Ricks Herz rutschte in seine Hose. Sie hatte ihn entdeckt, er saß in der Falle und wenn sie ihn nicht gleich erschoss, wer wusste, was sie mit ihm anstellen würde? Doch ihr Blick streifte Rick nur, bevor sie weiter die Umgebung absuchte.
»Ich sehe niemanden«, verkündete die Frau mit zusammengebissenen Zähnen. »Entweder sie können fliegen oder es waren irgendwelche Tiere.«
Ein zweiter Kopf tauchte neben ihr am Fenster auf, der eines kleinen, grauhaarigen Mannes, seine Augen ebenso eisblau wie die seiner Kollegin, seine Nase doppelt so lang. Er beugte sich hinaus, sah nach unten, nach oben, recht und links und nahm Ricks Baum genau unter die Lupe, doch auch er schien wie durch Rick hindurch zu gucken.
»Soll ich wieder runter und die Umgebung absuchen?«, fragte eine dritte Stimme hinter den beiden, doch die Brünette schüttelte den Kopf.
»War sicher nur ein wildes Tier. Seht euch doch mal um, das ganze Obst auf dem Boden und der angebissene Apfel. Lasst uns einfach unsern Job machen und dann zurückfahren. Ich bin froh, wenn ich raus aus dieser Wildnis und zurück in der Zivilisation bin.«
Die beiden Kontrolleure entfernten sich vom Fenster und Rick schnappte nach Luft.
Was zur Hölle?
Zitternd hob er eine Hand, um sich den Schweiß von der Oberlippe zu wischen, und japste erschrocken: Statt seiner Haut sah er moosbewachsene Baumrinde und statt Fingern sprossen fünf dünne Zweige mit Knospen aus seiner Hand. Seinen Zeigefinger zierten sogar zwei zarte Blätter. Doch noch während er verdattert auf seine Hand starrte, färbte sich die dunkle Borke zurück zu seinem braunen Hautton und das grüne Moos wurde zu feinen Härchen.
Keine Zeit zum Verrücktwerden. Ich sollte mich beeilen.
Rick warf einen letzten vorsichtigen Blick zum Fenster und begann zitternd damit, den Baum hinunterzuklettern. Als er endlich unten ankam, wusste er, dass ihm kaum Zeit blieb, um zu verschwinden, denn die Frustration der drei Kontrolleure darüber, dass sie nichts Nützliches fanden, waberte trotz Mageia in stinkenden Wolken zu ihm hinunter. Sie wünschten sich zunehmend dringlicher, endlich einen Hinweis zu finden oder zurück nach Iantos zu fahren. Sicher würden sie ihre Suche bald abbrechen.
Bens Tasche fand Rick nur wenige Meter entfernt in einem kleinen Gemüsebeet. Sie schien den Sturz gut überstanden zu haben. Rick schulterte sie und hob, einem Impuls folgend, auch das Notizbuch des Baumhausbewohners auf, das neben dem zerbrochenen Bilderrahmen im Dreck lag. Falls der tote Kontrolleur darin irgendetwas über Rick geschrieben hatte, sollte es lieber nicht in die Hände seiner Kollegen fallen.
»Hier ist nichts, lasst uns gehen«, drang die Stimme der braunhaarigen Frau zu Rick hinunter. »Wo ist Jocha?«
»Auf dem Klo«, kam die brummige Antwort des älteren Mannes.
Rick joggte los, doch als er an den beiden Motorrädern vorbeikam, mit welchen die drei Kontrolleure gekommen waren, kam ihm eine Idee. Die Schlüssel steckten. Wenn er das Taschenmesser schnell wiederfand … Er riss den Reißverschluss auf und durchwühlte die Tasche. Schon hörte er die Spülung von oben und das Wasser durch ein armdickes Rohr den Baumstamm hinabrauschen.
Seine Finger schlossen sich um etwas Kühles, Metallenes.
Bingo!
Die Luft entwich mit einem leisen Zischen aus Vorder- und Hinterrad des einen Bikes. Rick zog den Schlüssel und warf ihn im hohen Bogen ins Gestrüpp.
»Das war mal wieder eine so unnötige Aktion.« Schwarze Boots baumelten aus der Bodenluke und angelten nach den ersten Sprossen.
Rick schwang sich auf das zweite Motorrad, klemmte Bens Tasche vor sich, stülpte sich den am Lenkrad hängenden Helm über den Kopf und ließ den Motor an. Leise summend erwachte dieser zum Leben und das Bike schoss mit Rick davon. Er sah nicht mehr, wie die Kontrolleure eilig die Leiter hinunterkletterten, vergeblich in seine Richtung schossen oder den unbrauchbaren Zustand ihres Motorrads verfluchten. Auch wenn er früher selbst eine Maschine besessen hatte, war er schon einige Jahre kein Motorrad mehr gefahren, und nur mit viel Glück schaffte es Rick, das Bike auf dem schmalen und unebenen Waldweg unter Kontrolle zu behalten und weder sofort zu stürzen noch in einen Baum zu knallen.
Kapitel 5
Eine Kakophonie aus dem Knacken brechender Zweige, dem Knallen von zur Seite gepeitschten Blättern und dem hektischen Flügelschlagen aufgeschreckter Vögel begleitete Ricks halsbrecherische Fahrt auf einem schmalen Trampelpfad, kaum breiter als die Reifen des Motorrads, durch den Wald. Immer wieder klatschten tiefhängende Äste gegen sein Visier und das Bike holperte und hüpfte über Wurzeln und Steine. Waldmäuse huschten eilig in ihre Löcher und hungrig schreiende Vogelbabys zogen ängstlich die Köpfe ein.
Rick versuchte, nicht zu denken. Jedes Mal, wenn er sich seine Situation bewusst machte, bekam er Panik, verlor die Kontrolle und gerietins Schleudern. Schieres Glück allein verhinderte, dass ernoch nicht gestürzt oder gegen einen Baum gekracht war. Doch gerade, alser dies dachte, sprang und drehte sich das Vorderrad und riss den Lenker aus seiner rechten Hand. Das Motorrad schlenkerte zur Seite, Rick verlor das Gleichgewicht und rutschte, sich mit aller Kraft am linken Lenker festhaltend, nach links. Dichtes Gestrüpp – Büsche, junge Bäume und Farne – streifte kratzend die Maschine und Ricks Bein, während er geradewegs auf eine alte Lärche zusteuerte. In letzter Sekunde bekam er den rechten Lenker wieder zu fassen und riss die Maschine herum – oder bog sich der Baum zur Seite? – und lediglich Ricks linke Schulter streifte den borkigen Stamm.
Wenige Meter weiter hielt Rick an, zog den Helm ab und stieg vom Motorrad. Seine Knie waren so weich und zittrig, sie fühlten sich nicht einmal mehr wie Gummi an, sondern eher wie Wackelpudding, den jemand minutenlang mit großem Eifer zu einem glibberigen Brei verrührt hatte. Taumelnd ging Rick versuchsweise ein paar Schritte, doch seine Beine gaben unter ihm nach und er sank auf den Boden.
»Fuck«, hauchte er kraftlos, unfähig, sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen, während sein Herz in Rekordzeit Blut durch seinen Körper pumpte.
Es dauerte eine ganze Weile, bis das Rauschen in seinen Ohren verstummt war und die Welt um ihn herum sich nicht mehr drehte. Rick angelte nach der Tasche, die mit ihm vom Motorrad gerutscht war, und trank gierig eine halbe Flasche Wasser. Sein Blick glitt über den zerkratzten Lack des schwarzen Bikes und einen kleinen Zweig mit jungen Blättern, der in einem Spalt der Maschine steckte, und er fing lauthals an zu lachen. Kolossale Erleichterung und gleichzeitiger Unglaube darüber, dass er es wirklich geschafft hatte, nicht nur den Kontrolleuren zu entkommen, sondern auch diese Höllenfahrt zu überleben, ließen seinen Körper beben und trieben Tränen in seine Augen.
Ben würde sich nicht mehr einkriegen, würde ich ihm davon erzählen, dachte Rick und verstummte sofort.
Dann hört er sie: Stimmen und Schritte in unmittelbarer Nähe.
»Shit«, zischte er und rappelte sich auf. Wäre ja auch zu schön gewesen.
Sie hatten ihn eingeholt – natürlich. Seiner Spur zu folgen, war sicherlich alles andere als schwer gewesen. Wahrscheinlich hatte er nicht nur einen Pfad der Verwüstung hinterlassen, sondern war auch nur einem einzigen Weg gefolgt, ohne einmal abzubiegen. Selbst mit den zerstochenen Reifen, die sie bestimmt in wenigen Minuten repariert hatten, hatten sie seinen Vorsprung sicher rasch aufholen können.
Ihm blieb kaum Zeit. Schon sah er bunte Kleidung zwischen den Bäumen hervorblitzen. Schnell zog er den Helm auf und warf Bens Sporttasche aufs Motorrad, doch mit zu viel Schwung, sodass sie auf der anderen Seite wieder herunterrutschte.
»Shit!«
Er rannte um die Maschine herum und legte vorsichtig die Tasche darauf, bevor er sich selbst dahinter setzte und den Motor anließ. Keine Sekunde zu spät, denn schon traten zwei Frauen zwischen den Bäumen hervor und machten verdutzt vor ihm Halt. Rick schätzte das Alter der beiden irgendwo jenseits der Vierzig, doch noch fern der Sechzig. Sie trugen sportliche Kleidung und robuste Wanderschuhe sowie große, bunte Campingrucksäcke, an welchen je ein zusammengerollter Schlafsack baumelte. Eine der Frauen öffnete den Mund, doch bevor sie etwas sagen konnte, brauste Rick an ihnen vorbei.
Auch wenn sein Herz in seiner Brust hämmerte und das Blut in seinen Ohren rauschte, bemühte sich Rick um Kontrolle und achtete darauf, dieses Mal bedacht und nicht blindlings durch den Wald zu fahren. An jeder Weggabelung wählte er den breiteren der beiden Wanderwege und lachte erleichtert auf, als sich die Bäume gegen Mittag endlich lichteten und er auf einen breiten Feldweg hinausfuhr.
Ein paar Meter weiter hielt er kurz an, zog den Helm ab und trank etwas Wasser. Links und rechts von ihm erstreckten sich dunkelbraune Felder, die nach Kuhdung dufteten, in einiger Entfernung vor sich konnte er die Gehöfte eines Bauernhofs sehen und dahinter am Horizont die spitzen Dächer eines Dorfes. Er fischte das Plastiktütchen mit dem Mageia aus der Tasche, das bunt im hellen Sonnenlicht glitzerte. Hatte er wirklich nur noch so wenig übrig? Als ihm das Tütchen im Baumhaus auf den Boden gefallen war, musste er fast alles verschüttet haben. Doch er schätzte, dass es genug war, um bis zum nächsten Mittag im Dorf durchzuhalten.
Als er an dem Haupthaus des Bauernhofs vorbeifuhr, entdeckte er ein Schild, das Ferienwohnungen und -zimmer anpries. Er bog in die große Hofeinfahrt ein und parkte das gestohlene Motorrad gut versteckt hinter einem Geräteschuppen. Die Bäuerin, Frau Geissert, empfing ihn herzlich und glücklicherweise ohne viele Fragen. Er zahlte bar im Voraus und wurde dafür in ein kleines, doch sauber hergerichtetes Zimmer unter dem Dach geführt. Der alte Holzboden knarzte und der Wind pfiff leise durch das hohe Gebälk, doch Rick hätte sich kaum einen schöneren Ort vorstellen können. In voller Montur ließ er sich auf das breite, mit rosageblümter Bettwäsche bezogene Einzelbett fallen und schloss die Augen. Hatte er es wirklich geschafft? Hatte er wirklich ein Motorrad geklaut, war drei Kontrolleuren entkommen und hatte die Fahrt durch den Grenzwald überlebt? Das Kissen duftete nach Lavendel und die Heizung gluckerte leise. Irgendwie schaffte er es gerade noch, die Schuhe von den Füßen zu streifen und unter die Decke zu kriechen, dann war er auch schon tief und fest eingeschlafen.
16.43 Uhr zeigte Ricks Armbanduhr, als er von seiner vollen Blase geweckt wurde und mit zusammengekniffenen Augen durch den sonnenhellen Flur zum Badezimmer schwankte. Eine ausgiebige Dusche später, frisch rasiert dank des bereitliegenden Einwegrasierers und in sauberer Kleidung – Jeans, Socken und Unterwäsche von Ben, T-Shirt und Karohemd aus dem Baumhaus – fühlte sich Rick wie ein neuer Mensch und dazu bereit, den Rest des Tages und den Beginn seines neuen Lebens außerhalb von Iantos in Angriff zu nehmen.
In der geräumigen Küche des Bauernhofs ließ er sich Frühstück, Mittagessen und Abendessen in einem schmecken – eine köstliche Mischung aus hausgemachten Leckereien wie Spargelpfannkuchen und Kartoffelsuppe, die Frau Geissert mithilfe ihres 15-jährigen Sohnes für ihn zauberte. Zwar bereitete die Nähe zu den beiden und ihren Wünschen Rick Kopfschmerzen, doch vom Schlaf erholt und durch das leckere Essen gestärkt ließen sie sich viel leichter ertragen als erwartet.
Dennoch war Rick froh, wenig später wieder auf seinem Zimmer zu sein, um seine Tasche zu holen und sich auf die Suche nach Mageia zu machen. Nur ein paar Minuten wollte er sich ausruhen – das viele Essen lag ihm doch schwer im Magen –, aber als er das nächste Mal auf die Uhr blickte, war es 22.40 Uhr und stockfinster draußen. Schnell schniefte er seinen letzten Rest der magischen Droge, rannte die Treppen hinunter, schwang sich aufs Motorrad und brauste ins Dorf.
Die Siedlung bestand nur aus ein paar Dutzend Häusern, einer von Efeu und Unkraut überwucherten Kirchenruine samt Friedhof, einem Supermarkt, einer Altherrenkneipe und einem Rathaus, das sich das Gebäude mit einer Grundschule teilte. Rick brauchte nicht einmal zehn Minuten, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nach einem kurzen Stopp am einzigen Geldautomaten des Dorfes stellte er das Motorrad auf dem leeren Parkplatz des kleinen Supermarkts ab und betrat die Kneipe Zur Goldenen Sense, die schräg gegenüber lag.
Viel los ist hier ja nicht gerade, war sein erster Gedanke, doch für einen späten Abend unter der Woche in einem kleinen Dörfchen war es vielleicht Full House: An der langen Holztheke, die vom Eingang bis ganz nach hinten in den schmalen, dunklen Raum verlief, saßen tatsächlich – so ein Klischee – eine Handvoll älterer Herren, doch statt trübsinnig über ihren Gläsern zu brüten, unterhielten sie sich angeregt über Landwirtschaft und das Wetter. Offensichtlich regnete es für den einen Bauern zu wenig für diese Jahreszeit und er freute sich auf den angekündigten Regen in der kommenden Nacht, ein anderer erklärte jedoch mit überlegenem Grinsen, warum die Trockenheit für seine Felder gar kein Problem war.
Langweilig.
Bei der grauhaarigen Frau hinter der Theke bestellte Rick ein Radler, dann schlängelte er sich mit dem schäumenden Glas zwischen den Barhockern und einigen altmodisch mit Kunstblumensträußchen dekorierten Tischchen hindurch in den hinteren Teil der Kneipe. An einem massiven, runden Tisch in der Ecke saß eine Gruppe von Teenagern, die an Softdrinks nippten und sich gegenseitig offenbar extrem lustige Dinge auf ihren Handys zeigten. Rick setzte sich an einen Tisch in der Nähe und zwinkerte einem neugierig aufschauenden Mädchen zu, das grinste und dann schnell wieder wegsah. Über sein Bier hinweg beobachtete Rick unverhohlen die Jugendlichen, nicht ohne dem einen oder der anderen ein schiefes Lächeln zu schenken, bis schließlich das erste Mädchen mit einer Freundin herüberkam.
»Hey,« sagte das Mädchen.
»Hey,« sagte seine Freundin.
»Hey,« sagte Rick und lehnte sich schmunzelnd zurück. Süßes, aufgeregtes Verlangen. Wie alt mochten die beiden sein? Sechzehn? Siebzehn? Noch nicht alt genug, um Alkohol zu trinken, aber alt genug, um unter der Woche nach 22 Uhr in der Kneipe zu sein.
»Wartest du auf jemanden?«, fragte das erste Mädchen.
»Nein, ich bin alleine hier. Auf der Durchreise. Morgen geht’s zurück nach Iantos zur Uni.«
»Oh, du studierst in Iantos?«
»Japp.«
»Was studierst du denn?«
Rick musste nicht lange überlegen. »Psychologie und Astronomie. «
»Wow.«
»Cool.«

























