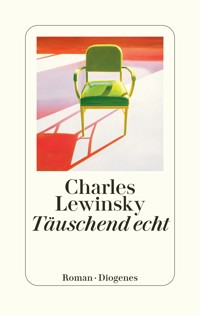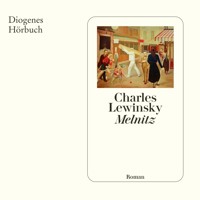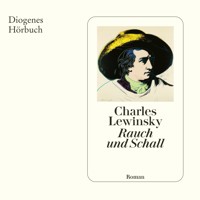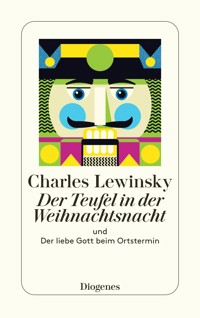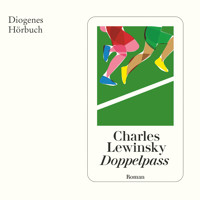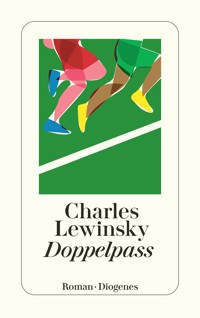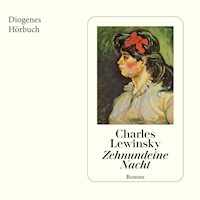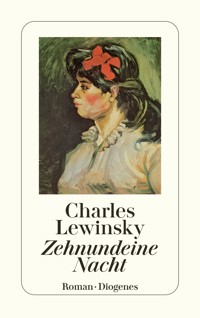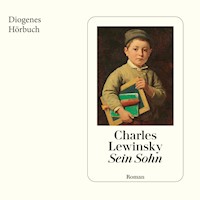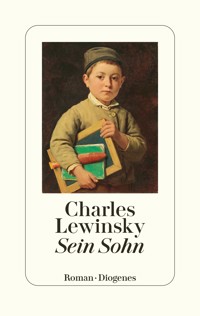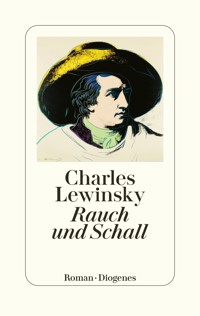
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Goethe kommt zurück aus der Schweiz und hat zu Hause in Weimar plötzlich eine Schreibblockade. Da kann sein kleiner Sohn August noch so still sein und seine Frau Christiane noch so liebevoll um sein Wohl besorgt. Ausgerechnet sein Schwager Christian August Vulpius, ebenfalls Schriftsteller und von Goethe verachteter Viel- und Lohnschreiber, kommt ihm in dieser Situation zu Hilfe. Zu einer Hilfe, die Goethe nicht will und doch dringend braucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Charles Lewinsky
Rauch und Schall
roman
Diogenes
»Niemand will ein Schuster sein, jedermann ein Dichter.«
Johann Wolfgang von Goethe
»Dichter: eine Menschengattung, die sich des Hungers nicht erwehren kann und doch von Göttermahlen, von Nektar und Ambrosia spricht.«
Christian August Vulpius
Goethe hatte Hämorrhoiden.
Auf der Rückkehr nach Weimar plagte ihn sein juckender Hintern jeden Tag mehr, die Kutschenfahrt wurde zur endlosen Odyssee, und immer öfter musste er einen Zwischenhalt befehlen, um der fraglichen Körperöffnung mit Ringelblumensalbe eine vorübergehende Erleichterung zu verschaffen. Am meisten litt er, wenn während dieser Aufenthalte die Natur ihr Recht verlangte, denn das bedeutete jedes Mal die nächste blutige Pein, als ob man, dachte er jedes Mal, wie bei manchen vom Hof bestellten Festgedichten etwas aus sich herauspressen müsse, dem die Natur das ius vivendi verweigert. Einmal hatte er, um den eigenen Körper mit scheinbarer Nichtbeachtung zu überlisten, während der schmerzhaften Prozedur ein Distichon erdacht, in dem er den unangenehmen Vorgang mit sehr viel deutscheren Worten beschrieb, als er sie in den Xenien verwendet hätte. Es war bedauerlich, dass er seine Freude über die Brillanz der skatologischen Formulierung mit niemandem würde teilen können. Er hatte die zwei Zeilen nicht einmal, wie er es sonst mit allen erhaltenswerten Einfällen tat, dem mitreisenden Secretarius Geist diktiert; dessen unbewegtes Dienergesicht ließ jeden Gedankenblitz verpuffen wie feuchtes Pulver auf der Pfanne.
Dass Goethes Laune während der Fahrt immer schlechter und seine Galle immer schwärzer wurde, lag nicht allein an den Sitzbeschwerden. Christianen hatte er erklärt, dass solche Reisen für ihn so notwendig seien wie der Ausflug einer Biene aus ihrem Stock, nicht des Vergnügens wegen unternommen, sondern um aus dem dabei gesammelten Nektar neuen Honig zu generieren, aber diesmal hatte sich, um im Bild zu bleiben, nur spärliche Ernte finden lassen, alles schon längst abgegrast und abgeerntet, die Ideen aus zweiter Hand und die Gedanken schon tausendmal von anderen gedacht. Kurz: Die anstrengende Schweizerreise hatte nicht die erhoffte Inspiration für neue Werke gebracht. Die einzige magere Ausbeute war ein vager Plan für ein dramatisches Gedicht, in dem er die Sage um den Armbrustschützen Tell im Stil von Hermann und Dorothea in Hexametern neu erzählen wollte, aber das Projekt begeisterte ihn nicht wirklich. Vielleicht war der Stoff doch eher etwas für Schiller.
Und dann – die Götter sind einfallsreich in ihren Plagen – hatte auch noch der seit Tagen immer wieder neu einsetzende Regen den Fahrweg so durchweicht, dass die Räder beim Anstieg zu einem kleinen Hügel im Schlamm stecken blieben und sich die Kutsche auch mit den vereinten Kräften ihrer Fahrgäste nicht mehr von der Stelle bewegen ließ. Es blieb keine andere Wahl, als sich zu Fuß auf den Weg zurück zu einem vor wenigen Minuten durchfahrenen Dorf zu machen, in der Hoffnung, dort einen Bauern zu finden, der ihnen mit einem Ochsengespann zu Hilfe kommen konnte. Der Kutscher wurde beim Wagen zurückgelassen, nicht nur der Pferde wegen, sondern weil nach einer langen Zeit kriegerischer Unruhen auch in so einer gottverlassenen Gegend jederzeit mit Dieben zu rechnen war. Goethe sorgte sich vor allem um die in den Schweizer Bergen gesammelten Quarzite, die seine Mineraliensammlung so vortrefflich ergänzen würden, und selbst Geists Einwand, dass sich auch die gierigste Räuberbande wohl kaum für Steine interessieren dürfte, konnte ihn nicht wirklich beruhigen.
Während sie am Rand der schlammigen Straße nach einem gangbaren Pfad suchten und dabei mehr als einmal bis über die Waden im Dreck einsanken, brach auch noch das nächste Gewitter los – an einem Tag, an dem sich die kichernden Kerkopen immer neue Streiche einfallen ließen, konnte es gar nicht anders sein –, und trotz seines Reisemantels, der ihm in den Alpen so gute Dienste geleistet hatte, war Goethe, als sie endlich das Dorf erreichten, bis auf die Haut durchnässt. Ein Gasthaus, in dem man Aufnahme hätte finden können, gab es hier nicht, nur eine enge Stube, in der sich ein alter Bauer mit selbstgebranntem Schnaps etwas zu seinem Deputat dazuverdiente. Der seltsame Wirt stellte ungefragt eine Steingutflasche und zwei Gläser vor die beiden schlotternden Männer hin, und wenn der Branntwein auch von der Art war, wie ihn Christiane mit Schmierseife vermischt als Mittel gegen Blattläuse zu verwenden pflegte, so wärmte er doch ein bisschen.
Auf die Frage nach einem Teller Suppe murmelte der alte Bauer etwas Unverständliches und humpelte hinaus, vielleicht um eine Köchin zu instruieren, aber wohl eher, um sich selber ans Werk zu machen.
Bevor er Geist auf der Suche nach einem Zuggespann wieder in den Regen hinausschickte, ließ sich Goethe von ihm noch die verdreckten Stiefel ausziehen und befahl, sie vor den Kamin zu stellen, was mehr der Gewohnheit als der Hoffnung geschuldet war, denn ein Feuer brannte hier nicht.
Er blieb nicht lang allein, denn wenig später betrat ein weiterer Gast die Stube, ein junger Mann, der trotz des schlechten Wetters bester Laune zu sein schien. Er stellte seinen ledernen Ranzen in eine Ecke, ließ Mantel und Schlapphut einfach zu Boden fallen, schüttelte sich wie ein Hund, der ein Stöckchen aus einem Weiher apportiert hat, und setzte sich dann mit einem kurzen »Es ist doch gestattet?« Goethe gegenüber an den einzigen Tisch. Die Schnapsflasche, die der ihm hinschob, wies er mit einer abwehrenden Handbewegung zurück, zog stattdessen ein flaches metallenes Gefäß aus der Tasche, schraubte es auf und nahm einen tiefen Schluck. Sein Getränk schien von besserer Qualität zu sein als der Rachenputzer, mit dem sich Goethe hatte zufriedengeben müssen, denn der neue Gast seufzte zufrieden und meinte: »Das Sprichwort hat schon recht: Im Krieg und auf Reisen kommt es auf gute Vorbereitung an.« Und fügte, während er die wieder verschlossene Flasche einsteckte, hinzu: »Die Höflichkeit würde verlangen, dass ich auch Ihnen einen Schluck anbiete, aber mein Vorrat geht zur Neige, und ich weiß nicht, wann es mir mein leerer Beutel erlauben wird, ihn wieder aufzufüllen. Nun ja«, fügte er mit dramatischer Betonung hinzu, »auch der Mangel ist ein Lehrmeister, und des Lebens Mühe lehrt uns allein des Lebens Güter schätzen.«
Goethe fand den Satz auffallend wohlformuliert und merkte erst nach einigen Augenblicken, dass er ihn ja einmal selber geschrieben hatte. Aber sosehr es ihn überraschte, in so unpassender Umgebung und aus dem Mund eines ihm völlig fremden Menschen eigene Worte zitiert zu bekommen, so wenig war er in der Stimmung, sich auf ein Gespräch einzulassen. Er beschloss deshalb, so zu tun, als gehörte seine ganze Aufmerksamkeit der Frage, ob er sich noch ein weiteres Glas von dem hausgebrannten Schnaps einschenken solle, nahm zu diesem Zweck die Steingutflasche in die Hand und wiegte den Kopf nachdenklich hin und her. Sein Gegenüber ließ sich aber durch das stumme Spiel nicht zum Schweigen bringen; der Neuankömmling schien zu der Menschensorte zu gehören, die sich selber so gern reden hört, dass sie sich durch das Ausbleiben eines Echos nicht davon abhalten lässt.
»Torquato Tasso«, sagte der junge Mann freundlich erklärend, »vielleicht kennen Sie das Schauspiel. Kein wirklich gutes Stück, wenn Sie mich fragen, zu viel Dialog und zu wenig Handlung, aber wenn man nur in gänzlich gelungenen Dramen auftreten wollte, man hätte wenig zu tun. In Neustrelitz habe ich einmal den Antonio gespielt. Eigentlich der falsche Part für mich, der Tasso hätte meinen Talenten besser entsprochen, aber ich war nie bereit, einer Rolle wegen an höherer Stelle den Buckel krumm zu machen. Immerhin sagte man mir hinterher, ich hätte die Aufgabe mit Anstand gelöst. Interessieren Sie sich für das Theater?«
Goethe hätte sich am liebsten, wie Ben Jonsons Volpone, schwerhörig gestellt, aber so, wie er sein geschwätziges Gegenüber einschätzte, hätte der Mann dann nur lauter gesprochen, und so beschloss er, wenigstens sein Incognito zu wahren und das Gespräch, wenn es sich schon ohne grobe Unhöflichkeit nicht ganz vermeiden ließ, im Unverbindlichen versanden zu lassen.
»Er ist also Schauspieler?« Wenn er gehofft hatte, der kühle Ton würde dem anderen deutlich machen, dass die Frage nur aus Höflichkeit und nicht aus wirklichem Interesse gestellt worden war, so wurde diese Hoffnung enttäuscht. Der junge Mann lachte ein Bühnenlachen, das Goethe jedem seiner Schauspieler verboten haben würde, und erklärte: »Genau diese Frage hat mir mein Vater gestellt, als ich ihm anvertraute, zu welchem Beruf ich vom Schicksal bestimmt zu sein glaubte. ›Er ist also Schauspieler?‹, fragte er mich, und als ich bejahte, gab er mir ein Jahr Zeit, um reumütig in den Schoß der Familie und des väterlichen Geschäfts zurückzukehren, was für mich bedeutet hätte, den Rest meines Lebens mit dem Brennen von Dachziegeln zu verbringen. Wir haben uns seither nie wieder gesehen. Nun ja, seine Enttäuschung lässt sich begreifen. Er hatte geglaubt, in mir seinen Nachfolger zu finden. Zürne nicht auf einen Vater, der sich in seinen Plänen betrogen findet, wie der alte Moor in den Räubern zu Franz sagt – eine Rolle, die ich übrigens auch schon zum Gefallen des Publikums gespielt habe.«
Goethe konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sein Gegenüber dieselbe Geschichte in genau diesen Worten schon des Öfteren vorgetragen haben musste und dass ihr eigentlicher Zweck darin bestand, den Erzähler als Träger von Hauptrollen wichtiger zu machen, als er es war.
»Und so«, fuhr der Schauspieler fort, »bin ich wieder einmal unterwegs zu einem neuen Engagement oder doch zu einem Ort, wo ich ein solches zu finden hoffe. Das Schicksal hat mir das Gerücht zugetragen, einer nicht ganz unbedeutenden Truppe sei der Inhaber meines Faches abhandengekommen, und ich hoffe der Erste zu sein, der seine Dienste anbietet, um die Lücke zu füllen. Der Abtrünnige hat übrigens, wie man hört, den genau umgekehrten Weg eingeschlagen als den von mir für mein Leben erwählten: Er hat Thalien verlassen, um die Tochter eines Bierbrauers zu heiraten.«
»Er ist sich dieses Engagements also nicht sicher?«
Der junge Mann hob die Schultern, breitete die Arme aus und rezitierte: »Hoffnung ist oft ein Jagdhund ohne Spur. Shakespeare. Aber solang mich meine Beine tragen, werde ich dem Ruf der Muse folgen.«
Einen Augenblick lang fühlte sich Goethe versucht, den deus ex machina zu spielen, sich als Leiter des weimarischen Hoftheaters zu erkennen zu geben und dem arbeitslosen Schauspieler hier und jetzt einen Platz in dessen Ensemble anzubieten, aber er schob den Gedanken gleich wieder beiseite. Das kurze Vergnügen, einen ihm völlig fremden Menschen gleichzeitig überrascht und glücklich gemacht zu machen, würde durch die unvermeidlich daraus folgenden Auseinandersetzungen mehr als aufgewogen. Hofkammerrat Kirms, der nicht nur die Taler, sondern auch die Groschen zählte, würde ihm in seiner pedantischen Art vorrechnen, um wie viel das unvorhergesehene Engagement das vom Hofamt vorgegebene Budget überschreiten würde, und ihm anhand des Personaltableaus nachweisen, dass ein weiterer Vertreter dieses Rollenfachs nicht benötigt würde, dass sich im Gegenteil Friktionen zwischen den Acteurs, die auf dieselben Rollen aspirierten, nicht würden vermeiden lassen – kurz, das schnelle Gefühl der Allmacht würde durch krämerische Debatten allzu teuer bezahlt werden müssen.
Außerdem hatte der Schnösel seinen Tasso kritisiert.
»Dann wünsche ich Ihm Glück bei seinem Unterfangen«, sagte Goethe also nur. »Da der Regen aufgehört hat, wird Er die letzten Stunden des Tageslichts nutzen wollen, um seinem Ziel näher zu kommen.«
Der junge Mann sprang so hektisch auf, als habe er in einem Theaterstück sein Stichwort versäumt, suchte seine Sachen zusammen und verabschiedete sich, nicht ohne unter der Tür noch einmal dramatisch auszurufen: »Ich eil, ich eil, sieh, wie ich eil, so fliegt vom Bogen des Tataren Pfeil.« Er ging hinaus, kam aber gleich wieder zurück, sagte erklärend: »Sommernachtstraum«, und war dann endlich, endlich tatsächlich verschwunden.
Als Geist zurückkam, um zu melden, dass die Ochsen gefunden und bereits auf dem Weg zur Kutsche seien, fand er seinen Arbeitgeber schlafend vor, den Kopf auf den Tisch gelegt und die Wange in einer Schnapspfütze neben der umgekippten Steingutflasche.
Christiane hockte auf dem Boden und halbierte Schnecken.
Sie benutzte dazu ein Wiegemesser, das sonst in der Küche zum Zerteilen von Zwiebeln seinen Dienst tat, und sie erledigte ihre mörderische Arbeit ganz sachlich, sine ira et studio, wie Goethe das genannt haben würde. Die Gewohnheit ihres Lebenspartners, alltäglichen Dingen durch lateinische Formulierungen den Anschein tieferer Bedeutung zu geben, mochte den meisten seiner Gesprächspartner beeindruckend oder sogar ehrfurchtsgebietend erscheinen, für Christiane war es nur eine weitere seiner liebenswerten Marotten, über die sie sich in vertrauten Momenten gern lustig machte. So hatte sie einmal, als Goethe hinter dem geschlossenen Bettvorhang einen besonders intimen Wunsch äußerte, mit dem ernstesten Gesicht, das sie zustande brachte, geantwortet: »Caritas omnia tolerat«, worauf er, nach einem Moment des Staunens über ihre unvermuteten Lateinkenntnisse, so laut gelacht hatte wie sonst nur an seinen Herrenabenden nach der dritten Kanne Blauer Portugieser. Natürlich hatte sie nie Latein gelernt, verstand auch meistens nicht, wovon die Rede war, aber ein paar von Goethes oft gebrauchten Formulierungen hatte sie sich durch Christian August übersetzen lassen. Bloß weil man eine Frau war, musste man nicht sein Leben lang dumm bleiben.
Überhaupt nutzte sie ihren Bruder gern als persönliches Vocabularium und Lexikon. Er wusste über die erstaunlichsten Dinge Bescheid, sammelte Fakten und Geschichten, wie ein Eichhörnchen Haselnüsse sammelt, um dann die Stapel vollgeschriebener Notizzettel zu Büchern zu verarbeiten. Sogar für die Gartenarbeit, die ja nun wirklich nicht Sache eines Bibliotheksregistrators war, hatte er ihr Rat gewusst. Als die Schnecken unter ihren Gurkensetzlingen gehaust hatten wie die Vandalen, hatte er gemeint, eine breite Straße aus Salz, rund um die zu schützenden Pflanzen ausgestreut, würde die schleimigen Räuber wohl fernhalten, doch sei dieses Remedium eher theoretischer Natur, wo sich doch auf dem Wochenmarkt für den Preis eines einzigen Lotes Salz ein ganzer Korb mit Gurken erwerben ließe. Mit obskuren Fakten besser vertraut als mit praktischen Dingen, hatte er nicht bedacht, dass Goethe, neben seinen vielen anderen Ämtern, auch für die Saline von Creuzburg zuständig war und dafür ein so reichhaltiges Deputat erhielt, dass das Salz, zur Gänze in der Küche verwendet, jede Suppe verdorben haben würde.
Christiane hatte den brüderlichen Ratschlag – in welchem alten Folianten hatte er den wohl aufgestöbert? – ausprobiert, und tatsächlich hatte sich der weißkörnige Sperrgürtel als wirksam erwiesen. Obwohl die Schnecken nach diesen verregneten Tagen aus dem Boden zu sprießen schienen wie Unkraut, hatte kein einziger der Angreifer das gelobte Land der Gurkensetzlinge und jungen Salate erreicht; die schleimigen Briganten waren so elendiglich zugrunde gegangen wie die preußischen Infanteristen bei der Kanonade von Valmy, deren blutige Einzelheiten ihr Goethe mehr als einmal in aller Scheußlichkeit – und, wie sie meinte, mit gehöriger Übertreibung – geschildert hatte.
Nur eben: Der Abwehrwall hatte den Biestern nicht endgültig den Garaus gemacht. Weil das Salz ihnen die Säfte aus dem Körper gezogen hatte, wanden sie sich jetzt auf höchst bemitleidenswerte Weise im Todeskampf, und wenn Christiane ihnen auch den Krieg erklärt hatte, so wollte sie ihnen doch kein unnötiges Leid zufügen, schließlich waren auch die ekelhaftesten Schädlinge Geschöpfe Gottes. In Frankreich – auch das hatte ihr Christian August erzählt – wurden Kapitalverbrecher seit dem Sturz des Königs nicht mehr gehängt oder gevierteilt, sondern man brachte sie mit einer Maschine vom Leben zum Tode. Die Beschreibung dieser Guillotine war es gewesen, die sie auf den Gedanken mit dem Wiegemesser gebracht hatte. Wer in seinem Gemüsegarten Herrin über Leben und Tod war, musste auch bereit sein, das Amt des Henkers zu übernehmen.
Wie immer, wenn sie sich auf etwas konzentrierte, hatte Christiane die Zungenspitze herausgestreckt, eine liebenswerte Gewohnheit aus Kindertagen, die Goethe sogar einmal in einer Bleistiftskizze festgehalten hatte. Wäre er nicht verreist gewesen, sondern hätte ihr, hinter dem Vorhang des Gartenzimmers verborgen, bei ihrer unappetitlichen Tätigkeit zugesehen – so wie er sie, auch nach all den gemeinsamen Jahren, gern unbemerkt beobachtete und sich dabei immer neu in sie verliebte –, so hätte er wohl in Gedanken die wenig damenhafte Körperhaltung ebenso getadelt, wie er sich gleichzeitig über Christianes jugendlichen Eifer gefreut haben würde. Nur eben: Goethe war auf Reisen, und auch wenn er in seinem letzten Brief seine baldige Rückkehr angekündigt hatte, mochte eine solche Formulierung ebenso »in den nächsten Tagen« wie »in ein paar Wochen« bedeuten, sie hatte das schon mehr als einmal erlebt. Wenn er sich, wie es seine Gewohnheit war, zum ungestörten Arbeiten nach Jena zurückzog, kam es immer wieder vor, dass aus einem versprochenen Samstag zuerst ein Dienstag und dann ein noch viel späterer Termin wurde. Goethe schob die Schuld dann jedes Mal auf die Musen, die ihn zu immer fleißigerer Arbeit angetrieben hätten, und obwohl Christiane stets Verständnis zeigte, so wäre es ihr doch lieber gewesen, wenn diese Töchter des Zeus ein bisschen mehr Rücksicht auf die organisatorischen Bedürfnisse ihres Haushalts genommen hätten.
Aber egal. Wann auch immer Goethe zurückkam, sie wollte ihm ihren Garten in voller Schönheit präsentieren. »Ihren Garten«, ja, denn die Blumen und das Gemüse gehörten zu den wenigen Aspekten des Hauses am Frauenplan, deren Attraktionen dem Fleiß der Hausherrin und nicht den Einkünften des Hausherrn geschuldet waren. Was hier in den gepflegten Beeten heranwuchs, verdankte seine Perfektion Christianes eigener Hände Arbeit, und so war sie gar nicht auf den Gedanken gekommen, die Hinrichtung der Schnecken an jemand anderen zu delegieren. Überhaupt hatte sie sich, auch nach all den Jahren, noch immer nicht wirklich daran gewöhnt, über Bedienstete zu verfügen; von Stand zu sein, schien ihr, war etwas, mit dem man aufgewachsen sein musste und das sich nicht erlernen ließ.
Und wenn sie diese Einsicht einmal vergaß – es konnte vorkommen, dass man an der Seite des Herrn Geheimrats die eigene Wichtigkeit überschätzte –, dann hatte sich im kleinen Weimar noch immer jemand gefunden, der sie daran erinnerte, welcher Platz ihr in der gesellschaftlichen Hierarchie zustand, nämlich gar keiner.
Die nächste Schnecke zerhackte Christiane mit so viel Zorn, dass sich die Klinge tief in die weiche Erde bohrte. Und dabei hatte sie sich doch vorgenommen, nicht an die Freifrau von Stein zu denken.
Da hatte sie der eine Freude machen wollen, hatte sich dafür erkenntlich zeigen wollen, dass der kleine August im Hause Stein ein gern gesehener Gast war, hatte ihr also – auch das mit eigenen Händen – zum Geburtstag einen Kuchen gebacken, eine Eierschecke, wie sie auch der Hofbäckerei nicht besser hätte gelingen können, und hatte die Magd Ernestine mit dem Präsent losgeschickt. Die war dann ganz verweint zurückgekommen, denn man hatte sie im Haus an der Ackerwand sehr unfreundlich empfangen, hatte sie noch nicht einmal das eingeübte Kompliment aufsagen lassen, und den Kuchen hatte man nicht etwa zu den anderen auf den für die Geburtstagsgesellschaft reich gedeckten Tisch gestellt, sondern ein Lakai hatte ihn hinaustragen müssen wie etwas Schmutziges.
Zum nächsten Geburtstag, nahm sich Christiane vor, würde sie der Frau von Stein einen ganz besonderen Kuchen backen, bei dem würden sich unter der Ditsche keine Apfelstücke verbergen, sondern kleingeschnittene, mit Mohn bestreute Waldschnecken. Die Vorstellung, was für ein Gesicht die eingebildete Gans beim ersten Bissen machen würde, wie sie vergeblich versuchen würde, sich den Ekel nicht anmerken zu lassen, um dann doch ihre Stickerei vollzukotzen, dieses erfreuliche Phantasiebild ließ Christianes Ärger gleich wieder verfliegen; schlechte Laune war bei ihr ohnehin nie von Dauer. Sie machte sich wieder an ihre Arbeit und war bald so eifrig bei der Sache, dass sich der kleine August unbemerkt nähern und ihr eine ganze Weile bei ihrer mörderischen Tätigkeit zusehen konnte.
»Was macht Sie da?«
»Ich töte die Schnecken.«
»Warum?«
»Sie leiden sonst zu sehr.«
August, der das Debattieren ebenso sehr liebte wie sein Vater, ließ dieses Argument nicht gelten. »Das darf man nicht«, sagte er und fügte in dem leiernden Ton, in dem er beim Hauslehrer Eisert seine Lektionen aufzusagen pflegte, hinzu: »Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen.«
»Brav, Gustel«, sagte Christiane. »Aber bei Schnecken ist das etwas anderes.«
»Wieso?«
»Weil sie unseren Salat fressen.«
»Aber wir essen den Salat doch auch, und niemand schneidet uns in Stücke.«
Christiane suchte vergeblich nach einer Erklärung, die auch ein Siebenjähriger verstehen würde. Sie hätte sich die Mühe sparen können, denn August – »Bei einer Sache zu bleiben, wird er noch lernen müssen«, hatte Goethe schon mehr als einmal gesagt – hatte das Interesse am Thema gleich wieder verloren und stellte schon die nächste Frage: »Was bedeutet ehebrechen?«
»Dafür bist du noch zu jung«, versuchte sich Christiane herauszureden. »Und außerdem ist das eine Sache, über die man unter feinen Leuten nicht spricht.«
»Sind wir feine Leute?«
»Das will ich doch hoffen.«
»Das ist gut«, sagte August mit der altklugen Miene, die er immer aufsetzte, wenn er meinte, einen Erwachsenen überlistet zu haben. »Dann muss ich keine Aufgaben machen.«
»Was hat das eine mit dem anderen zu tun?«
»Feine Leute arbeiten nicht, sagt Onkel Christian. Weil sie sich nicht die Hände schmutzig machen wollen.« Er betrachtete die von Erde und Schneckenschleim verschmierten Hände seiner Mutter und fügte triumphierend hinzu: »Sie ist keine feine Frau.«
Es war nicht einfach, einen intelligenten Sohn zu haben. Aber bei einem Vater, der allgemein als Genie bezeichnet wurde, konnte es wohl nicht anders sein. Natürlich, August spielte auch gern mal mit seinen Zinnsoldaten oder ritt auf seinem Steckenpferd durch ausgedachte Landschaften, aber am liebsten führte er Debatten und konnte sich über einen vermeintlichen Sieg seiner Argumente freuen, als habe er dem andern gerade beim Hasenrennen die Verliererkarte zugeschoben. Goethe war der Meinung, man müsse geduldig auf seine Einwände eingehen, so kindisch sie auch sein mochten; der Verstand wolle geübt sein wie die Geschicklichkeit eines Fechters, und wer als Erwachsener in solchen Duellen bestehen wolle, könne Quart und Terz gar nicht früh genug erlernen. Aber wenn Goethe die Nachfragen seines Sohnes zu viel wurden, gab es immer einen Auftrag, der dringend erledigt, oder einen Gedanken, der noch dringender festgehalten werden musste, er konnte sich jederzeit in seinem Arbeitszimmer verschanzen, das ohne besondere Einladung von niemandem außer ihr betreten werden durfte. Und wer musste dann die Disputation weiterführen? Sie natürlich.
»Nein«, sagte sie jetzt, »ich bin keine feine Frau. Ich möchte auch keine sein. Weil eine feine Frau nämlich einen kleinen Jungen, der seine Aufgaben nicht gemacht hat, nicht am Ohr fassen und in sein Zimmer schleppen kann, um ihn dort so lang einzusperren, bis seine Pflichten erfüllt sind.«
»Und warum kann eine feine Frau das nicht?« August wollte immer das letzte Wort oder doch die letzte Frage haben.
»Weil sie dafür einen eigenen Diener hat. Mehrere sogar. Einen Am-Ohr-zieh-Diener, einen Freche-kleine-Buben-einsperr-Diener und …«
»… und einen Schnecken-totschlag-Diener«, sagte August, »mit einem ganz großen Schwert, wie ein richtiger Scharfrichter.«
Die absurde Vorstellung ließ das Gespräch in gemeinsamem Gelächter enden. Den frühreifen Verstand mochte August von seinem Vater haben, die Fähigkeit zur ausgelassenen Fröhlichkeit hatte er von ihr geerbt.
»Was wolltest du eigentlich?«, fragte Christiane.
»Ach ja«, sagte August, »das habe ich ganz vergessen. Es ist ein Bote gekommen und hat ausrichten lassen: Heute Abend kommt der Herr Vater nach Hause.«
»Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man dem Ziele kommt«, diktierte Goethe. Secretarius Geist notierte den Satz mit so unbewegter Miene, als handle es sich nicht um eine kleine sprachliche Perle, sondern nur um die Erinnerung, dass ein zu lang liegengelassener Brief zu beantworten oder bei der Hofkanzlei eine Akte anzufordern sei. Nicht dass Goethe für jeden seiner Einfälle begeisterten Beifall erwartet hätte – obwohl er auch nach all den Jahren des Erfolgs immer noch nach Anerkennung gierte –, aber irgendeine Reaktion hätte Geist schon zeigen dürfen. Nun ja, es war keine große Erkenntnis gewesen, die waren auf dieser Reise leider ausgeblieben, aber es war doch immerhin ein kleiner Beitrag für den Zettelkasten hübsch geschliffener Formulierungen, die sich später einmal, wenn gar keine neuen Ideen kommen wollten, in einem noch zu findenden Zusammenhang würden verwenden lassen.
Es war seltsam, er hatte das schon oft gedacht, was alles so einen Einfall auslösen konnte; diesmal hatte ein Blick auf den Ärmel seiner Reisejoppe den Anstoß gegeben. Auf diesem Ärmel hatte nämlich, irgendwo in den Schweizer Bergen, ein Vogel ein Andenken hinterlassen, aber keines von der Sorte, mit der er Christianen oder August hätte eine Freude bereiten können. Solang man unterwegs war, brauchte einen ein solch rustikaler Fleck nicht zu kümmern, im Gegenteil: Wenn man, wie er, in einer privaten Kutsche reiste, war es durchaus angebracht, sich die Strapazen der langen Fahrt durch legere Kleidung so gut wie möglich zu erleichtern, so wie er auch zu Hause, wenn keine Dienstgeschäfte anstanden, gern den ganzen Tag in dem Déshabillé verblieb, dem er in Hermann und Dorothea einen eigenen Hexameter gewidmet hatte: Ungern vermiss ich ihn doch, den alten kattunenen Schlafrock.
Aber jetzt, wo sie bereits herzogliches Gebiet erreicht hatten und in wenig mehr als einer Stunde zu Hause ankommen würden, musste die Freiheit allmählich wieder den Repräsentationspflichten des Ministers weichen, kurz: In so staubiger Reisekleidung konnte und wollte er nicht in Weimar eintreffen. Die Titel und Ämter, die ihm der Herzog verliehen hatte, brachten nicht nur Privilegien mit sich, sondern auch Verpflichtungen; man repräsentierte den Staat nicht unrasiert.
»Anhalten«, befahl Goethe.
Das Gehöft stand etwas abseits der Landstraße und hatte nichts Bemerkenswertes an sich, war so gebaut, wie arme Leute eben bauen müssen, mehr Kate als Haus, die Streben des Fachwerks aus krumm gewachsenem Holz und die Gefache mit kaum faustgroßen Steinen gefüllt, von denen der Lehmputz schon wieder abbröckelte. Doch da war immerhin ein Brunnen, man würde sich also waschen können. Das Sitzbad aus Eichenrindensud, nach dem er sich wegen seiner Beschwerden so sehr sehnte, würde bis zur Ankunft am Frauenplan warten müssen, aber der Rauch aus dem Kamin versprach doch zumindest warmes Wasser. Wer reist, lernt sich bescheiden.
Als Herold der Gesellschaft wurde der Kutscher losgeschickt, mit dem Auftrag, ihnen Einlass und die Benutzung eines Zimmers zu verschaffen. Er musste mehrmals anklopfen und sogar den Stiel seiner Peitsche zu Hilfe nehmen, bis die Tür endlich eine Handbreit geöffnet wurde. Durch den schmalen, mit einer Kette gesicherten Spalt ließen sich, wie auf den Caravaggio-Gemälden, die Goethe in römischen Kirchen bewundert hatte, im Chiaroscuro des Flurs nur gerade ein Arm und eine Hand erkennen, während die Person selber im Schatten verborgen blieb. Aus dem Klang ihrer Stimme zu schließen, musste es sich um ein junges Mädchen handeln. Es tue ihr leid, sagte die Stimme, sie dürfe, wenn sie allein im Haus sei, niemanden einlassen, schon gar keine Unbekannten, der Vater habe es streng verboten. Aber allzu lang könne es bis zum Angelusläuten nicht mehr dauern, dann würden die Eltern vom Feld zurückkommen und den Fremden bestimmt gern zu Diensten sein. Wenn die Herrschaften also warten wollten?
Goethe, der sich in einiger Entfernung die vom langen Sitzen schmerzenden Beine vertrat, konnte nicht hören, auf welche Weise der Kutscher die Unbekannte zu überzeugen versuchte, nur einzelne Worte wie »Minister« und »lange Reise« drangen zu ihm. Schließlich hörte er den eigenen Namen, aber auch der schien hier nicht der Sesam-öffne-Dich zu sein, der magische Türöffner, als der er sich auf der Reise so oft bewährt hatte. Bis in die Bauernhäuser war sein Ruf noch nicht vorgedrungen; wer nicht liest, kennt auch keine Dichter.
Goethe wollte schon aufgeben und die Fahrt fortsetzen lassen, als Secretarius Geist den Kutscher zur Seite schob, um auch seinerseits einen Überzeugungsversuch zu unternehmen. Er hatte kaum zu reden begonnen, als die Kette auch schon ausgeklinkt und die Tür geöffnet wurde. Im Hintergrund des Flurs sah man eine weibliche Gestalt verschwinden.
»Sie macht Wasser heiß«, sagte Geist.
»Mit welchem Argument hat Er sie denn überzeugt?«
Der Secretarius konnte, auch wenn das seiner seriösen Art nicht entsprach, ein triumphierendes Lächeln nicht ganz verbergen. »Ich habe ihr im Namen Eurer Exzellenz einen halben Taler versprochen.«
Die Kammer, die ihnen schließlich angewiesen wurde, war ärmlich, aber nicht auf die gleiche, durch sorgfältige Reinlichkeit einladende Weise, die manchen Berghütten trotz der Kargheit ihrer Einrichtung eine gewisse unbeholfene Eleganz verliehen hatte. Man nahm dankbar zur Kenntnis, dass die Spinnweben an dem winzigen Fenster für eine natürliche Verdunkelung sorgten, auch wenn das mangelnde Licht das Rasieren nicht gerade erleichtern würde. Zwar hatte Goethe die Devise des Dichters Terenz humani nihil a me alienum puto auch zu seiner eigenen gemacht, aber manche Dinge wollte man trotzdem nicht allzu genau sehen. Zu seinem Bedauern ließ sich das Fenster nicht öffnen, auch wenn der unverkennbare Geruch nach Mäusekot eine gründliche Durchlüftung erstrebenswert hätte erscheinen lassen; ganz allgemein schien man hier Sauberkeit für eine überzüchtete städtische Mode zu halten.
Und doch: Wenn sich Goethe später an den kurzen Aufenthalt in dem armseligen Bauernhaus erinnerte, tat er es mit einem Lächeln. Denn da war nicht nur Armut und Schmutz, sondern auch – eine Rose, auf einem Misthaufen erblüht – die Tochter des Hauses, eine etwa sechzehnjährige thüringische Venus, die als Modell vielleicht keinen Cranach, aber mit ihrer breithüftigen Gestalt bestimmt einen Rubens hätte inspirieren können. Sie trug ein einfaches Kleid aus billigem Wollstoff, das aber durch ihr ebenmäßiges Gesicht mit einer Eleganz geadelt wurde, wie sie der teuerste Aufputz mancher Dame der Gesellschaft nicht hätte verleihen können. In ihrer bodenständig direkten Art erinnerte sie Goethe an jene Faustina, die ihm damals den Aufenthalt in Rom auf so unvergessliche Weise angenehm gemacht hatte, und selbst der doch recht grobe Dialekt konnte die Illusion nicht ganz zerstören.
Nachdem sie sich die Befolgung des elterlichen Verbots für den Judaslohn eines halben Talers hatte abkaufen lassen, zeigte sie keinerlei Scheu vor den fremden Männern, versuchte sich zum Glück auch nicht an der ungeschickten Höflichkeit, deren sich Leute, die selber nie an einem Hof gewesen waren, im Umgang mit Höhergestellten gern befleißigten. Als sie Goethe den Eimer mit dem heißen Wasser hinstellte, sagte sie: »Ich brauche ihn sonst für das Schweinefutter, aber ich habe ihn natürlich ausgewaschen.« Und kam dann gar nicht auf den Gedanken, ihn während seiner Ablutionen allein zu lassen, sondern blieb einfach stehen, wie sie wohl auf dem Jahrmarkt vor einem Tanzbären stehen geblieben wäre, und schaute ihm so aufmerksam bei seiner Reinigung zu, als habe sich in der Geschichte der Menschheit noch nie ein Mann das Gesicht gewaschen. »Es gibt auch eine Schamlosigkeit, die aus der Unschuld erwächst«, dachte Goethe, und nahm sich vor, auch diesen Satz von Geist festhalten zu lassen. In einem kleinen Experiment veränderte er seine Stellung, sodass er dem Mädchen jetzt den Rücken zukehrte, aber die Zuschauerin wollte von dem für sie offenbar so ungewöhnlichen Schauspiel nicht das Geringste versäumen und folgte mit ein paar Schritten seiner Bewegung. Schiller hatte schon recht mit dem, was er in einem seiner letzten Briefe geschrieben hatte: Die Neugier des Publikums war das Einzige, wovon etwas zu hoffen war.
Die naive Neugier der jungen Frau war Goethe so überraschend angenehm, dass er seine Waschungen über das notwendige Maß hinaus verlängerte, bis schließlich der Secretarius mit Rasierzeug und Kleidersack hereinkam. Geist verscheuchte die hübsche Zuschauerin und berichtete diensteifrig, er habe einen des Weges kommenden Bauernburschen nach Weimar vorausgeschickt, um dort Goethes baldige Ankunft zu melden. Wie ein Schauspieler, der in verschiedenen Akten einer Komödie ganz unterschiedliche Charaktere verkörpern muss, zeigte Geist jetzt wieder jene Unterwürfigkeit, die er auf der gemeinsamen Reise fast vollständig abgelegt hatte; man hätte meinen können, Secretarius und Kammerdiener seien zwei verschiedene Personen, deren Rollen sich nur den Namen teilten. Beide wurden mit »Carl« angesprochen, obwohl Geist doch eigentlich Johann Ludwig hieß. Aber Goethes allererster Sekretär hatte Carl geheißen, und warum sollte er sich der Mühe unterziehen, sich an einen neuen Namen zu gewöhnen?
Als er gewaschen, rasiert und umgekleidet war, hätte Goethe die wiederhergestellte Respektabilität gern in einem Spiegel überprüft. Er rief nach dem Mädchen, das daraufhin so überraschend schnell erschien, dass es wohl direkt vor der Tür auf die Fortsetzung seiner Privatvorstellung gewartet hatte. Goethes Verwandlung vom verschmutzten Reisenden zum elegant gekleideten Minister rief keine Reaktion hervor, so wenig wie sich Faustina beeindruckt gezeigt hatte, als er ihr einmal von seinen Ämtern am Hof erzählte. Auf den gewünschten Spiegel musste er allerdings verzichten, sie hätten keinen im Haus, sagte das Mädchen. »Mein Vater meint, dass er mich nur eitel machen würde, und außerdem … Wenn einer zerbricht, bringt das sieben Jahre Unglück.«
»Selbst der Aberglaube steht ihr gut«, dachte Goethe, »so wie er bei einer Gleichaltrigen höheren Standes nur lächerlich wirken würde.« Um den Abschied von der ländlichen Schönen um ein paar Minuten zu verlängern, schickte er Geist auf den Hof hinaus, hieß ihn, den Kleidersack zu verstauen und zu überprüfen, ob der Kutscher die Zeit auch wirklich genutzt habe, um ihr Gefährt von den schlimmsten Reisespuren zu befreien. Die Erinnerung an Faustina hatte ihn verjüngt, und als er jetzt mit dem Mädchen wieder allein war, fragte er: »Wenn ich dir statt des halben Talers einen ganzen gebe – bekomme ich dann einen Kuss?«
Sie überlegte einen Augenblick, zuckte dann die Schultern und sagte: »Warum nicht? Schlimmer als bei meinem Kuno kann es auch nicht sein.« Und fügte auf Goethes fragenden Blick hinzu: »Unser Hund. Er will mich auch immer abschlabbern.«