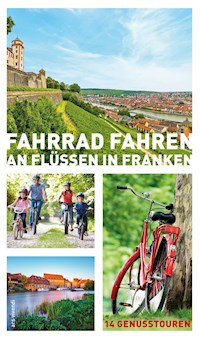Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Friede, Freude, Eierkuchen - doch dieses Jahr ist Schluss mit Liebe und Harmonie unterm Tannenbaum. Namhafte Autoren haben den Plätzchenduft satt und pusten eisigen Todeshauch in die friedliche Winterluft. Nach dem großartigen Erfolg der Weihnachtsanthologien Der Pelzmärtelmörder, Kältestarre und Christkindles-Morde halten mit RauschGiftEngel erneut höchst unterhaltsame fränkische Weihnachtskrimis Einzug ins heimelige Wohnzimmer. Nach deren Lektüre wird man geschenkte Weihnachtskekse lieber dem unliebsamen Nachbarshund geben und zweimal überprüfen, ob das auch wirklich Puderzucker auf dem Christstollen ist. Und man wird achtgeben müssen, dass vor Spannung nicht der Glühwein gefriert …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RauschGiftEngel
13 Krimis aus Franken zur Weihnachtszeit
Kriminalgeschichten
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage November 2014)
© 2014 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: Mascha Kirchner unter Verwendung einer Fotografie von © Michael Krinke/iStockphoto
Illustrationen: Annina Himpel
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-494-9
Inhalt
Helwig Arenz
Pelzmärtel
Sigrun Arenz
Füße im Feuer
Claudia Blendinger
Sonnige Weihnacht
Peter Freudenberger
Herberts Heiliger Abend
Tommie Goerz
Das Fest
Arnold Küsters
Der gefallene Engel
Killen McNeill
Die Waldweihnacht
Stefanie Mohr
Der etwas andere Weihnachtsbesuch
Theresa Mutter
Rausch Gift Engel
Horst Prosch
Süß klangen die Glocken nie
Angelika Sopp
Bitter im Abgang
Helmut Vorndran
Der Sommerbaum
Volker Wachenfeld
Gänsebraten mit Zitronengras
Die Autorinnen und Autoren
Helwig Arenz
Pelzmärtel
Wenn er in die Stadt kam, ging er immer zuerst ins Benji. Da hatte er Lokalverbot. Ein eigenes Schild hatte Kostas, der Wirt, ihm hinter die Tür geklebt: MARTIN UND DEINE BAGAGE – AUCH HIER HAST DU LOKALVERBOT! Aber das zog ihn gerade an. Er schmiss die Tür auf und warf den Rucksack unter die Eckbank.
»Kostas, hör auf zu jammern und gib mir einen Wein!«, verlangte er – und er bekam ihn auch. Er brauchte nicht lange zu warten, da kamen schon seine Freunde. Der hagere Hertle und der halb blinde Wolf aus der Ottostraße und ein paar andere, so schnell hatte es sich herumgesprochen. Sie umarmten sich und redeten alle durcheinander und machten gleich noch eine Flasche auf – Mittag war es erst! – eine Flasche, die sie nicht bei Kostas bestellten, sondern die sie verstohlen aus einer Tasche hervorholten und leerschenkten.
»Bei uns im Wohnheim steht jetzt eine Perle hinter dem Tresen, das glaubst du nicht!«, schwärmte der Hertle, und der Martin bekam gleich ein Strahlen in den Augen. Und so hat es angefangen. Kostas drohte mit der Polizei, Martin nahm sein Bündel auf und stand zwei Minuten später im Obdachlosenwohnheim am Tresen. Judith hieß sie und war wohl Ende dreißig.
»Hast du was verloren?«, hatte der Martin sie ganz am Anfang gefragt, weil sie immer auf den Boden geschaut hatte. Dann war er auf die Knie gegangen und hatte den Kopf verdreht, um ihr in die Augen sehen zu können, und da hatte sie das erste Mal gelacht. Ihr Lachen war sehr laut und wollte so gar nicht zu dem schüchternen Mädchen passen. Sie schäkerten eine Weile, das konnte der Martin.
Aber als er dann fragte: »Hat die Judith auch einen Freund?«, da wurde sie auf einmal still und sah ihn nicht mehr an und packte ihr Zeug.
»Wart noch!«, rief der Martin. »Ich will dir noch so viel erzählen!« Aber sie verschwand in der Küche hinter der Theke. Die Küche war für alle absolut tabu, daran hielt sich jeder. Nur der Martin nicht. Der schwang sich über den Tresen, dass die Glocke runterfiel, und ging der Judith nach. In der Küche muss er es wohl geschafft haben, sich zu entschuldigen, denn sie erlaubte ihm, sie ein Stück nach Hause zu begleiten.
»Aber hast du einen Wein, den wir mitnehmen können?«, fragte er, denn er hatte vor, sich irgendwo am Fluss mit ihr hinzusetzen und sie kennenzulernen.
»Nein, hier gibt es doch keinen Alkohol!«, antwortete sie. Wie er da plötzlich zusammensank, tat er ihr leid, der riesige Kerl mit dem Bart und der abgeschnittenen Pelzjacke, die aussah wie ein Designerstück.
»Wart mal!«, flüsterte sie, machte einen Schrank auf und wühlte ganz hinten darin herum, bis sie etwas zu fassen kriegte. »Hier!«, rief sie und holte eine dicke Flasche hervor. Der Martin lachte: »Das ist ja Glühwein!«
»Ja, von der Weihnachtsfeier, was anderes haben wir nicht hier.« Judith zuckte mit den Achseln. Es war den beiden egal. Sie lachten, und Martin rief: »Dann feiern wir heute eben Weihnachten!« Und das mitten im April.
Sie zogen los, der Martin redete und die Judith nickte, und der Martin nahm extra die Wege in die Wiesen, damit er nicht so viele Leute traf, die er kannte, denn die Judith, die wollte er heute für sich allein haben. Weil sie den Glühwein ja irgendwo heiß machen mussten, beschloss der Martin, zum Steg zu gehen, wo er ein Feuer machen konnte. Aber als er in den Park abbog – wo man sich als Mann und Frau auf einmal wie ein Paar vorkommen kann – hielt die Judith ihn an und fragte ihn ernst: »Wo kommt einer wie du eigentlich her?« Da sah er etwas in ihren Augen aufblitzen, das er am liebsten gleich zur Bank getragen hätte. Also beschloss er zu reden. Reden, damit sie nicht auf den Gedanken kam wegzulaufen. Er lachte sie an, vielleicht ein wenig zu laut, und dann sagte er: »Ich erzähle dir eine Geschichte.«
»Aber eine Weihnachtsgeschichte muss es sein!«, verlangte Judith und schwenkte die Glühweinflasche.
»O.k.«, sagte der Martin nur und freute sich, weil es ja wirklich eine war.
Als wollte er mit ihr eine Bühne betreten, nahm er ihre Hand, langsam und bedeutungsvoll. Und deswegen ließ sie es auch geschehen.
»Hier in der Stadt lebte mal ein Mann. Schenk hieß er«, begann der Martin. »Jetzt lebt er nicht mehr. Der Schenk hatte eine Frau aus Polen mitgebracht. Eine schöne Magda. Die hatte dunkle Haare wie du und sprach kein Wort Deutsch. Der Schenk machte ihr ein Kind und tat sie hier in seine Wohnung in einem Scheißmietshaus auf der Schwand. Weil sie keinen kannte und auch keinen kennenlernen konnte, hing sie sehr an ihm. Aber das war verkehrt, denn der Schenk war ein Arschloch. Wie sie immer runder wurde und verheult, hat er sie nicht mehr angesehen. Sie kriegten ein Mädchen, oder besser, sie kriegte es, denn da war er nicht dabei. Sie hat ihn geweckt, als sie die Wehen spürte, und er hat ihr ein Taxi hertelefoniert. Ich glaube, vier, fünf Jahre lang haben sie sich angeschrien und gegenseitig verprügelt. Dann hat er sie rausgeworfen, da war sie schon gut dabei. Alkoholmäßig, meine ich.
Das Kind behielt der Schenk, weil Magda keine Wohnung und keine Arbeit hatte. Außerdem war sie Tag und Nacht besoffen. Irgendwann lief sie dann einem anderen Mann in die Arme. Sie verfolgte ihn regelrecht, tauchte überall auf, wo er war, bis er sich schließlich mit ihr verabredete. Sie erschien ihm, als wäre sie in ein großes Geheimnis gewickelt. Magda war immer noch eine schöne Frau, aber was ihn am meisten zu ihr hinzog, war seine innere Stimme, die flüsterte, er solle die Finger von ihr lassen.
Als der Herbst kam, ging es ihr besser, denn der junge Mann war stark und lebenslustig. Wenn sie heulte, packte er sie und schüttelte jeden dummen Gedanken aus ihr heraus, bis sie nur noch lachen konnte. Und er half ihr, nicht zu trinken. In einer kalten Nacht holte er sie aus dem Wohnheim und brachte sie ins Hotel. Da machte sie große Augen: eine eigene Suite, nein, ein ganzes Hotel für sie beide. Das war das alte Parkhotel, das leer stand und in dem die beiden wohnen wollten, bis es abgerissen würde. Sie schraubten die Messingbeschläge von den Türen und verkauften sie. Davon konnte man leben.
Aber eines Tages war es mit dem Glück vorbei. Denn die Frau hatte Sehnsucht nach ihrer Tochter, die sie schon lange nicht mehr sehen durfte. Sie lauerte ihr auf dem Schulweg auf und versuchte mit ihr zu reden: ›Karin, Karin, Karin‹, rief sie, ›ich bin es, Magda, deine Mutter!‹ Aber das Kind kannte keine Magda mehr, es kannte keine Mutter mehr, die hatte der Vater aus ihr herausgezogen wie einen langen, entzündeten Zahn.
Magda lag in den Armen ihres Freundes und weinte und trank alles, was sie finden konnte. Der Freund wurde wütend. Er wollte die strahlenden Augen zurück. Den kräftigen Leib, das Reine in ihrem Lachen. Er packte seine Tasche und ging zu dem Mietshaus auf dem Hügel, um von da an dem Schenk keine unbeobachtete Minute mehr zu lassen. Als der Schenk einmal mit seiner neuen Freundin in seiner Wohnung verschwand, da ging der Freund ihm nach. Unschlüssig stand er vor der Tür. Heute nicht, dachte er. Heute nicht. Da fiel sein Blick auf die Schuhe, die die Frau vor der Tür abgestellt hatte, weil draußen bereits Schnee lag, das war am zehnten November. Stiefel waren es, rote, obszöne Stiefel. Der Mann bückte sich und nahm sie fort. Aber als er sich umdrehte, stand da ein Kind in der Tür der Nachbarwohnung und sah ihn an.«
»Das ist eine seltsame Geschichte«, sagte Judith langsam und vorsichtig, als wären ihre Worte Schlittschuhfahrer auf frischem Eis. Sie war ein bisschen außer Atem gekommen, aber am Weg konnte es nicht gelegen haben. Sie standen auf dem prall gewölbten Bogen der Brücke, unter ihnen floss die Pegnitz hindurch.
»Weißt du, wo die Pegnitz hinfließt?«, fragte sie gedankenverloren in die Stille hinein.
»Ich war schon dort, wo sie aufhört«, sagte Martin lächelnd und zog Judith mit sich: »Komm weiter, jetzt wird es spannend!«
Sie gingen eine Allee entlang, der Fluss verschwand im Gebüsch zu ihrer Linken. Radfahrer rauschten vorbei, und Hunde hechelten fröhlich.
»Mach die Augen zu, Judith«, bat Martin plötzlich.
»Die Augen? Dann fall ich in den Fluss!«, scherzte sie.
»Nein, mach sie zu, vertrau mir, ich führe dich.« Judith runzelte die Stirn. Aber dann schloss sie die Augen und reichte Martin ihre Hand. Der nahm sie, und so ging es weiter.
»Die Stiefel brachte der junge Mann seiner Freundin. Er warf sie ihr vor die Füße wie ein getötetes Tier. Magda aber freute sich nicht, sie schrie und weinte und war fast wahnsinnig vor Eifersucht auf die Frau. Sie stieß ihn von sich und sperrte sich ein und ließ ihn eine ganze Nacht nicht an sich heran. Vor der verschlossenen Tür lag er bis zur Dämmerung und hörte sie immerzu ein Lied singen, das er bis dahin nicht kannte, das er aber seitdem nicht mehr vergessen konnte.«
Weil der Martin auf einmal nichts mehr sagte, schossen Judith tausend Gedanken und Fragen durch den Kopf, und ein ganz klein wenig unbehaglich mochte ihr auch geworden sein. Deswegen fragte sie: »Ich mach die Augen wieder auf, ja?«
Aber der Martin lachte und rief: »Nein, nein! Das ist noch nicht erlaubt. Lass die Augen zu. Denn die Geschichte, die ich dir erzähle, ist dunkel. Wenn du aber die Augen aufmachst, sollst du etwas Schönes sehen.«
»Na gut«, erlaubte die Judith und ließ sich weiter vom Martin wegführen, aber ganz wohl war ihr nicht mehr. Sie gingen ein paar Schritte, das Gefühl für die Richtung hatte Judith schon längst verloren, da stolperte sie, weil es abwärts ging.
»Was machst du?«, rief sie, aber Martin fing sie auf und sagte ruhig: »Keine Sorge.« Und er bat sie, sich zu setzen. Widerstrebend ließ sie sich auf den Boden sinken. Er bückte sich zu ihr ins Gras und legte seine großen Hände auf ihre Fesseln. »Ich ziehe dir jetzt die Schuhe aus«, kündigte er an, da hatte er ihr schon die Schnürsenkel gelöst. Er zog ihr die Schuhe von den Füßen und stellte sie ins Gras. Dann zog er Judith an den Händen zu sich, vielleicht eine Spur zu lange hielt er sie so nahe bei sich, ehe er sie losließ. Sie stand barfuß da, spürte den Weg nicht länger unter ihren Füßen und wusste nicht, wo sie war. Dann hörte sie wieder Martins Stimme: »Als der junge Mann am Morgen endlich in das Zimmer gelangte, war der Boden voller Blut und Scherben, und aus Magda war kein vernünftiges Wort herauszubringen. Eine unfassbare Wut auf den Schenk packte ihn. Wieder nahm er seine Tasche und ging auf den Hügel zu dem Hochhaus. Er ging hinauf zur Tür vom Schenk und klingelte. Der Schenk machte auf und sah den Mann, den er noch nie gesehen hatte, verwundert an. Was er wolle, fragte er ihn unwirsch. Da lächelte der junge Mann und sagte: ›Bezahlen.‹ Die Hand, die er in der Tasche versteckt hielt, hatte schon den ganzen Weg die Treppen hinauf das Messingrohr umklammert. Nun fuhr sie heraus. Der Schenk drehte sich um und floh ein paar Schritte in die Wohnung, aber das Ende traf ihn, und er stürzte auf die Knie, und dann schlug der junge Mann ihm noch zweimal das Messingrohr auf den Kopf, bis der Schenk sich nicht mehr rührte. Die Wut war jetzt nicht mehr in dem jungen Mann, sondern sie zitterte in der Luft. Sie sang leise wie ein gespannter Draht. Der Mann zog den Schenk ein wenig weiter in die Wohnung hinein, damit er die Tür wieder zubekam. Dann ging er zurück in den Hausflur und erschrak. Er hatte das Rohr noch in der Hand. Das Kind sah ihn an. Es stand auch diesmal in der geöffneten Tür der Nachbarwohnung und blickte aus hellen, unsicheren Augen zu dem bärtigen Riesen im Mantel auf. Der Mann steckte das Rohr wieder in die Tasche. Er legte einen zitternden Zeigefinger auf die Lippen, um dem Kind zu bedeuten, dass es schweigen solle. Aber das Kind schwieg nicht. Es dachte über das nach, was es gesehen hatte und was es sah. ›Bist du der Pelzmärtel?‹, fragte es leise und voller erschrecktem Zauber in der Stimme. ›Ja, ich bin der Pelzmärtel‹, sagte der Mann. Was hätte er auch anderes sagen sollen? ›Gestern hast du die Schuhe geholt‹, sagte das Kind, als ob es auf einmal verstand. ›Gestern hast du die Schuhe geholt, aber du hast nichts reingefüllt. Du bist mit der Rute gekommen.‹ ›Ja‹, sagte der Mann, ›ich bin mit der Rute gekommen. Weil der Schenk böse war.‹ Und dann kniete er sich zu dem Kind hin. Er kramte in seinen Taschen und fand einen Umschlag aus Papier. Darin war eine Kleinigkeit, die er und Magda ihrer Tochter zum Martinstag hatten in die Büchertasche schmuggeln wollen. Er reichte sie dem Kind, dann nahm er den Kopf des Jungen in die Hände. ›Du darfst nichts erzählen‹, flüsterte er ihm ins Ohr. ›Sonst komme ich auch zu dir noch einmal‹. Und er zeigte auf die Tasche mit dem Rohr. Der Junge nickte stumm.« Martin machte eine kleine Pause.
»Ich mach jetzt die Augen auf!«, rief die Judith. Aber in diesem Moment spürte sie zwei große, warme Hände über ihrem Gesicht. »Gleich«, flüsterte der Martin flehend. Eigentlich hatte sie genug von ihm, von den geschlossenen Augen und der gruseligen Geschichte. Die Geräusche der Spaziergänger um sie herum waren auf einmal verschwunden, nur die Vögel hörte sie lärmen. Sie atmete tief durch und entschied sich, ihrem seltsamen Begleiter noch ein paar Minuten länger zu vertrauen.
»Was kommt jetzt?«, fragte sie dennoch, und es klang ein wenig trotzig. Martin lachte vergnügt.
»Keine Angst! Gleich feiern wir Weihnachten!« Er berührte ihre Fingerspitzen und führte sie ein Stückchen in die Wiese hinein, denn sie waren jetzt am Steg angekommen, zu dem der Martin sie hatte bringen wollen.
»Jetzt fühl mal!«, rief er. Und Judith spürte weichen Flaum zwischen den Zehen, viel weicher als Gras.
»Was ist das?«, fragte sie verwundert, aber Martin hatte noch ein paar letzte Worte zu sagen.
»Still«, bat er und legte ihr den Finger auf die Lippen. »Als der junge Mann gegangen war, wurde ihm erst bewusst, was er getan hatte. Es war der schrecklichste Moment in seinem Leben, und hätte er eine Pistole gehabt, er hätte sie benutzt. Aber die hat er zum Glück nicht gehabt. Er fing an, das Gefühl in ihm in Gedanken umzuwandeln, in Gedanken und Pläne. Fieberhaft schnell dachte er. Als er sah, dass das Blut vom Schenk rundherum auf seinen Mantelsaum gespritzt war, schnitt er seinen Mantel hastig um die Hüfte herum ab und ließ das Stück zusammen mit dem Rohr und der Tasche verschwinden. Er rannte zur Schule, von der aus Karin gleich nach Hause laufen würde. Das durfte sie nicht. Nicht nach Hause! Er fing sie ab, redete auf sie ein, drohte ihr, schließlich erzählte er Karin, ihre Mutter sei sehr krank und brauche sie unbedingt, sonst würde sie sterben. Er führte sie in das verlassene Hotel und drückte sie der stammelnden, verwirrten Magda in die Arme. Dann küsste er die beiden, küsste sie unter Tränen, packte seine Sachen und rannte davon. Er rannte aus der Stadt, aus dem Land, und er wäre auch von diesem Planeten gerannt, wenn er gekonnt hätte. Aber das … ja, das geht ja nun leider nicht. Mach die Augen auf, Judith!«
Und Judith öffnete die Augen. Was sie sah, war ein Wunder. Sie stand barfuß auf einer weiß verschneiten Wiese mitten im April. Die Sonne stand tief und malte ein goldenes Gemälde mit den Kronen der Silberpappeln. Der Wind trieb die weißen, flaumigen Samen der Bäume über das Feld und verblies sie über den Himmel. Die ganze Wiese war von ihnen bedeckt. Weiß wie Schnee. Es war still um Judith und Martin. Das Staunen hatte alles andere auch erfasst. Kinder, Jogger, Radfahrer, Hundebesitzer standen sprachlos am Rand der Wiese und blickten das Wunder an. Manche versuchten, es zu fotografieren, andere bückten sich und betasteten den warmen, weichen Schnee.
»Fröhliche Weihnachten!«, sagte Martin.
»Fröhliche Weihnachten!«, flüsterte Judith. Dann kümmerten sie sich um den Glühwein.
Als der Martin im Morgengrauen ging, tat die Judith so, als würde sie noch schlafen, weil sie Abschiede nicht mochte. Sie hielt die Augen geschlossen, hörte, wie er sich die abgeschnittene Jacke auszog, und fühlte die Wärme, als er sie behutsam damit zudeckte. Dann ging er leise summend davon. Sein Lied wollte sie nie wieder vergessen.
Sigrun Arenz
Füße im Feuer
»Mein ist die Rache, redet Gott.«
(C. F. Meyer, Die Füße im Feuer)
Der Glühwein lag in der Tasse, rot und duftend, mit einem leicht öligen Film darauf. Ruhte und duftete nach Nelken und warmem Alkohol. Eine einzelne Schneeflocke segelte auf ihn herab und funkelte einen Augenblick lang beinahe, ehe sie auf der Oberfläche des heißen Weins zerschmolz. Rot lag er in der Tasse, schwer und duftend und flüchtig. Er roch nach Nelken und Zimt und Zitrone. Er roch, wie alle roten Dinge, nach Liebe und nach Blut.
Ein seelenloser Korridor, in hartes Kunstlicht getaucht, ohne Blick hinaus. Die Tür vor ihr öffnete sich, und trotz allem, was vorausgegangen war, zögerte sie, hindurchzutreten, die Hand krampfhaft um den Riemen ihrer Tasche geschlossen. Jenseits der Tür lag ihre Befreiung, und doch war sie sich für einen langen Moment des Zweifels nicht sicher, ob sie diesen Schritt wirklich machen würde. Vielleicht war es Furcht vor dem, was danach folgen würde. Was kommt nach der Hölle?
Sie zögerte und ging dann doch weiter, hatte tief drinnen ja gewusst, dass sie es tun würde, wunderte sich immer noch, wie leicht es gewesen war. Die Tür hatte sich aufgetan, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, ihr den Weg frei zu machen. Vielleicht lag es daran, dass Weihnachten war und selbst Beamte der Justizvollzugsanstalt es an diesen Tagen nicht so genau nahmen. Sie klammerte sich an den Gedanken, dass jetzt alles anders werden würde, sie wirklich frei werden und die Vergangenheit hinter sich lassen würde. Ein Schritt hindurch, und die Tür zum Zellentrakt schloss sich hinter ihr. Sie war drinnen.
Ein Besuchsraum, dessen kahle Nüchternheit durch einen Adventskranz halbherzig aufgebrochen war. »Besuch für Sie«, das war alles, was Meier zu ihm gesagt hatte, und ein wenig gegrinst hatte er dabei, ein wenig anzüglich, ein wenig verschwörerisch, als ob das alles ein abgesprochenes Spiel zwischen ihnen sei. Vielleicht, weil Weihnachten war und selbst Beamte der JVA an so einem Tag ein wenig anders tickten.
»Besuch für Sie.«
Mit ihr hatte er nicht gerechnet. Sie trug ihr Haar anders, kurz geschnitten und glatt geföhnt, und es dauerte einen Augenblick, bis er wirklich begriff, wen er da sah. Es war Weihnachten, und sie war gekommen. »Besuch für Sie.« Die Tür mit dem vergitterten Sichtfenster darin schloss sich hinter ihr. Sie waren allein.
Die Luft war frostig, und ein paar Schneeflocken segelten träge durch die Luft, fingen im Fallen das Licht von Hunderten von Lämpchen auf, um dann sofort unter Hunderte von Füßen getreten zu werden. Und überall gerötete Hände und Ohren und aufgestellte Kragen und Schals und Wollmützen und die Kälte. Christkindlesmarkt in Nürnberg; sie waren zu sechst, außer ihm noch das unattraktive blonde Mädchen, der Kommilitone mit den Hundeaugen, dann das Pärchen aus dem Proseminar, ineinander versunken die zwei, als gäbe es die Welt um sie herum nicht. Und sie, mit ihrer bunten Umhängetasche und ihrem Lachen, das in der kalten Luft glitzerte wie die wenigen Schneeflocken, die es schafften, durch ihr Blickfeld zu treiben. Frostiger Atem dampfte vor den Gesichtern. Zugleich die Hitze: Körper, aufgeheizt von Glühwein und Feststimmung, die Menschenmassen, die Lichter, und die Gerüche nach Holz und Alkohol, feuchter Wolle, menschlichen Ausdünstungen, Zimt und Nelken, nach Fleisch, das auf den Grills der Würstchenbuden zischte und brutzelte. Der Gedanke an menschliches Fleisch, das sich unter Lagen von Jacken und Pullovern und Unterwäsche verbarg, und man konnte nicht wissen, ob es fror oder erhitzt war und aufgeregt.
Irgendwann sah er, wie sie mit einer ungeduldigen Handbewegung ihre Mütze vom Kopf zog und in die blaue Winterabendluft atmete, ihr Gesicht ein wenig gerötet, und das lange Haar rollte, rötlichbraun, befreit, über den Kragen ihrer Winterjacke.
Er wusste, warum sie ihre Haare abgeschnitten hatte.
Sie setzte sich ihm gegenüber, ohne ein Wort zu sagen, schlüpfte unter dem Riemen ihrer Umhängetasche durch, die sie über der Schulter getragen hatte – war das erlaubt? Er konnte sich nicht erinnern, es war so lange her seit dem letzten Besucher, er hatte nie darauf geachtet. Vielleicht hatten sie eine Ausnahme gemacht, weil Weihnachten war, aber jedenfalls hatte sie eine Tasche dabei und legte sie auf den Tisch vor sich, die Hände ruhten auf dem bunten Stoff, ohne loszulassen. Schöne Hände, schlank und wohlgeformt, schmal, aber nicht schwach, nicht zerbrechlich.
Er wusste auch, dass die Tasche eine Mauer war zwischen ihm und ihr. Früher wäre ihm das nicht aufgefallen. In seinem alten Leben, als er nur wahrgenommen hatte, was er sehen wollte, als die Welt sich um ihn gedreht hatte und alles, alles nur in Bezug auf ihn und seine Wünsche und Abneigungen wichtig gewesen war. Halsstarrig war sie gewesen, damals. Schön und halsstarrig. Nicht, dass er das Wort jemals benutzt hätte in seinem alten Leben – jetzt kam es ihm in den Sinn, mit den Worten aus einer Ballade, die er gelesen hatte – »ein fein, halsstarrig Weib«. Auch Balladen gehörten zu seinem neuen Leben, in dem er in den Gesichtern seiner Mithäftlinge lesen konnte und Dinge verstand, die niemand aussprach. In dem er wusste, warum sie sich die Haare abgeschnitten hatte, warum sie nicht mehr dieselbe sein wollte, weder äußerlich noch innerlich.
Was er nicht deuten konnte, auch nicht nach diesen zwei Jahren, nicht nach dem Prozess und nicht nach den vielen einsamen Stunden des Lesens und Beobachtens, war ihr Gesichtsausdruck, als sie die Tasche zwischen ihnen öffnete und einen länglichen Gegenstand heraushob.
»Ich habe dir etwas mitgebracht«, erklärte sie und schraubte den Deckel der Thermoskanne auf.
Zwischen ihnen, auf dem blanken Holztisch, stand eine Tasse mit dampfendem Glühwein.
»Ich hol uns noch was zu trinken«, hat er gesagt und ist zum Stand zurückgegangen, wo er erst einmal stehen bleibt, dankbar für den Anorak, der lang genug ist, um seine Erregung zu verbergen. Er ist überhitzt, die paar Schneeflocken, die aus der immer dunkler werdenden Luft auf sein Gesicht fallen, bewirken nichts weiter, als ihm zu zeigen, wie heiß er ist. Der Schnee scheint auf seiner Haut zu glühen, ihn zu verbrennen, ist so heiß wie die Berührung ihrer Hand vorhin, als sie ihn gestreift hat. Beim Umdrehen, im Gespräch mit der blonden Freundin, die er hasst, weil sie sich für sie umdreht, mit dem Kommilitonen, den er verachtet, weil er dieses Lächeln aufsetzt, wenn er mit ihr redet, bewundernd, ein bisschen hilflos. Der Typ ist verliebt in sie, sie, die er hasst, weil sie halsstarrig ist und schön und ihn anmacht und dann so tut, als sei nichts gewesen.
Wie sie ihr Haar befreit hat, als sie die Mütze abgestreift hat, wie es, rötlichbraun und plötzlich lose, das Licht gefangen hat von den Weihnachtssternen und Lichterketten über dem Christkindlesmarkt. Wie sie sich umgewandt hat, sodass ihr bloßer Hals direkt vor seinen Augen lag, weiß und glatt, und das Blut hat in ihren Adern gepocht. Wie ihre Hand ihn gestreift hat beim Umdrehen, tausend Grad heiß, sodass er die Stelle noch jetzt spürt wie eine Wunde, wie ein Brandzeichen – und dann hat sie sich abgewendet und mit den anderen geredet, und als er etwas zu ihr gesagt hat, hat sie ihm diesen Blick zugeworfen. Einen Blick, als ob er ein Niemand wäre, oder jemand, der da sein könnte oder auch nicht, der keinen Unterschied macht, der keine Bedeutung hat. Du Schlampe, hat er gedacht, und dann hat er ihr Haar wieder gesehen, mit den Lichtpünktchen darin, und hat die Worte gesagt. Um wegzukommen von ihr, ja, aber vor allem, um sie zu bestrafen.
»Ich hol uns noch was zu trinken.«
Der Glühwein lag in der Tasse, ein leicht öliger Film darauf, und erfüllte den kleinen Besuchsraum der JVA mit dem Duft nach Nelken und Zimt und Zitrone. Er roch, wie alle roten Dinge, nach Liebe und nach Angst.
Ihm wurde kalt, als er ihr ins Gesicht sah. Ihre Augen – ein lichtes Braun – waren unverwandt auf ihn gerichtet, unerbittlich, rätselhaft. Sie sagte nichts. Nicht »trink« und nichts sonst, starrte ihn nur an, auffordernd, erbarmungslos. Und er wusste, dass sie gekommen war, um mit ihm abzurechnen, mit ihm abzuschließen, die Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen.
Was er nicht wusste, was er nicht deuten konnte, war das Wie.
Er hatte erst dem Kommilitonen seinen Becher gereicht, dann der Blondine. Für das ineinander versunkene Pärchen hatte er keinen Glühwein mitgebracht. Seinen eigenen Becher stellte er auf dem wackligen Tisch ab, um den sie herumstanden; es war der dritte – oder der vierte? Ganz sicher war er sich nicht.